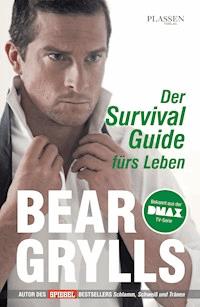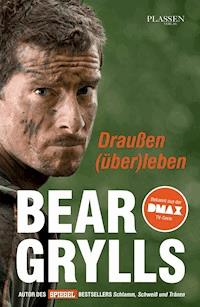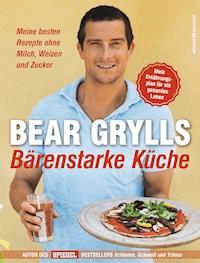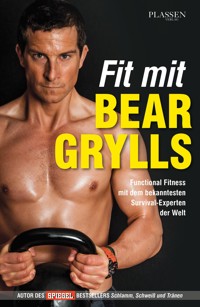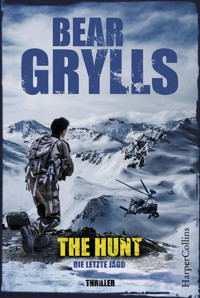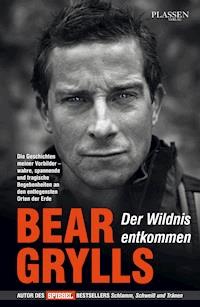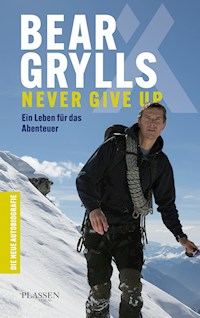
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Plassen Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
In diesem mit Spannung erwarteten Nachfolger seines Bestsellers "Schlamm, Schweiß und Tränen" erzählt Survival-Ikone Bear Grylls, was sich in seinem außergewöhnlichen Leben getan hat, seit er sein Wissen weltweit im TV weitergibt. Der Leser blickt hinter die Kulissen von "Ausgesetzt in der Wildnis", der Serie, die eine ganze Abenteuerindustrie hervorgebracht hat, und ist hautnah dabei, wenn Grylls auf seine härtesten Expeditionen geht und die größten Herausforderungen besteht. Zudem gibt er einzigartige Einblicke in seine Erfolgsserie "Stars am Limit", in der er hochkarätige Gäste wie Julia Roberts, Roger Federer und sogar US-Präsident Barack Obama begrüßen durfte. Eine inspirierende Autobiografie voller Abenteuer, Herausforderungen und der Erkenntnis: Gib niemals auf und die guten Dinge im Leben werden folgen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 462
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BEARGRYLLS
NEVER GIVE UP
Ein Leben für dasAbenteuer
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel
Never Give Up
ISBN 978-1-78763-419-0
Copyright der Originalausgabe 2021:
Copyright © BGV Global Limited 2021
All rights reserved.
Translation copyright © 2022, by Börsenmedien AG
Copyright der deutschen Ausgabe 2022:
© Börsenmedien AG, Kulmbach
Übersetzung: Börsenmedien AG, Stefanie Konrad
Gestaltung Cover: Timo Boethelt
Gestaltung und Satz: Sabrina Slopek
Herstellung: Daniela Freitag
Lektorat: Jana Siegemund
Korrektorat: Claus Rosenkranz, Elke Sabat
Druck: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-86470-827-5
eISBN 978-3-86470-828-2
Alle Rechte der Verbreitung, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe und der Verwertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen vorbehalten.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
Postfach 1449 • 95305 Kulmbach
Tel: +49 9221 9051-0 • Fax: +49 9221 9051-4444
E-Mail: [email protected]
www.plassen.de
www.facebook.com/plassenbuchverlage
www.instagram.com/plassen_buchverlage
Für meine wunderbare Shara –das freundliche, kluge und liebevolle Fundamentunserer Familie.
&
Delbert Shoopman III und Rupert Tatefür eure Freundschaft – Krieger,die auf dieser Reise an meiner Seite stehen.
INHALT
PROLOG
1.SCHLAMM, SCHWEISS UND ÄNGSTE
2.AUSGESETZT IN DER WILDNIS
3.FLÜSSIGKEITSZUFUHR IN DER WILDNIS
4.HÜTE DICH VOR HODEN
5.DIE ZÄHESTEN
6.UNSERE ZEIT ABLEISTEN
7.SLAV DER PFÄHLER
8.EIN TEAM, EINE MISSION
9.ÜBERLEBEN IN DER APOKALYPSE
10.DAS ENTSETZLICHSTE
11.KLUB DER SCHLANGENBISSÜBERLEBENDEN
12.DAS DRECKIGSTE
13.NIPPELZEIT
14.STILLE MÖRDER
15.VULKANRETTUNG
16.ENTBLÖSSUNG
17.SCHWERE ANKER
18.IMMER VORWÄRTSGEHEN
19.LOKALE HELDEN
20.KORNE UND SÄCKE
21.SHERIFF IN DER STADT
22.DAS ENDE VOM ANFANG
23.RAUCHENDE HOSE
24.SIEHT AUS, ALS HÄTTEN SIE EINEN KRIEG HINTER SICH
25.AUF SOLOPFADEN
26.UM FREIHEIT KÄMPFEN
27.BEGLEITE MICH
28.SCHLACHTLINIEN
29.BESCHEIDENE ANFÄNGE
30.WER NICHT WAGT, DER NICHT GEWINNT
31.„STARS AM LIMIT“ BEGINNT …
32.UNSEREN GROOVE FINDEN
33.INSEL-BESTREBUNGEN
34.ZU HAUSE IN DER WILDNIS
35.ZURÜCK AUF HEIMISCHEM RASEN
36.FREI RENNEN, SCHNELL RENNEN
37.IMPROVISIEREN, ANPASSEN, ÜBERWINDEN
38.PUBLIKUMSLIEBLINGE
39.SEINE HELDEN TREFFEN
40.SPIELZEIT
41.DIE GROSSE GLEICHMACHERIN
42.KNAPPES ENTKOMMEN
43.„STARS AM LIMIT“ GEWINNT
44.CHINA EROBERN
45.NIE AUFHÖREN ZU ERFORSCHEN
46.DAS EIS RUFT
47.DIE ULTIMATIVE ENTDECKUNG
48.STRENG GEHEIM
49.DER PRÄSIDENT RUFT
50.BÄRENBEUTE UND BÄRENSPRAY
51.ABRIEGELUNG DES WEISSEN HAUSES
52.KRYPTONIT
53.DIE ANDERE INSEL
54.MEISTER UNSERES EIGENEN SCHICKSALS
55.KÄMPFE FÜR DAS, WORAN DU GLAUBST
56.THE NATURAL STUDIOS
57.IM NACHHINEIN IST MAN IMMER SCHLAUER
58.SICH SEINE KICKS HOLEN
59.SICH WINTERFEST MACHEN
60.DIE WAHRHEIT SAGEN
61.ANGST IST DEIN FREUND
62.ERST DAS VERSAGEN
63.DER ANGST INS GESICHT SCHAUEN
64.DAS FEUER FINDEN
65.GLAUBE IST WICHTIG
66.WAHRER REICHTUM
67.DAS STÄNDIGE SCHLACHTFELD
68.KRIEGER AN MEINER SEITE
69.FREUNDE AUF DER GANZEN WELT
70.GLAUBE, DER BERGE VERSETZT
71.DU GEGEN DIE WILDNIS
72.WEITER INNOVATIV SEIN
73.AMAZON: DER HÄRTESTE WETTLAUF DER WELT
74.JUNG BLEIBEN
75.VORBEREITET SEIN
76.INTERNATIONALER SCOUTING CHIEF
77.GLOBALE DÖRFER
78.EINMAL EIN MARINE, IMMER EIN MARINE
79.FREUNDE GEWINNEN UND MENSCHEN BEEINFLUSSEN
80.DER WILDNIS IST EGAL, WER DU BIST
81.NARBENGEWEBE
82.DER KING’S CUP
83.STÜRME MACHEN UNS STÄRKER
84.AMEISEN ESSEN MIT DEM ZUKÜNFTIGEN KÖNIG
85.GERADE ERST IN FAHRT GEKOMMEN…
BILDQUELLEN
ÜBER DEN AUTOR
PROLOG
ICH SCHAUE NOCH EINMAL auf die Uhr. 0933. Die Leute sagen, dass die Zeit stillstehen kann. Das ist nicht wahr. Aber manchmal fühlt es sich sehr danach an.
Ich bin seit vier Uhr morgens wach. Und zwei Stunden Schlaf sind niemals genug. Es war definitiv bereits ein Akt, einfach nur hierher zu kommen. Ich bin müde. Aber ich bin auch voller Adrenalin.
Ich schaue mich um. Ich sehe, wie sich einige der Büsche bewegen. Ich weiß, wer sich dort versteckt, und lächle. Ich weiß, dass sie genauso nervös sind wie ich. Unser kleines Team von acht Leuten. Klein, aber mächtig. Sorgfältig überall bei den Bäumen positioniert. Sie werden ohne viel Aufhebens auftauchen und sich mir in dem vorher festgelegten Moment anschließen.
Aber im Moment bin ich allein. Und so fühle ich mich auch.
Ich muss mir immer wieder vor Augen führen, dass uns im Umkreis von 200 Metern eine Menge gut ausgebildeter Scharfschützen und Personenschützer begleiten, von denen ich keinen sehen kann. Ich schätze, das ist ihr Job. Ein beruhigender Gedanke ist das allerdings nicht.
Atme, Bear. Alles ist gut.
Die riesigen Berge Alaskas erheben sich über uns. Das alles scheint sie nicht sonderlich zu kümmern. Eines der vielen Dinge, die ich an Bergen liebe – sie urteilen nie, loben nie und scheinen sich nie um etwas zu sorgen. Sie sind einfach da. Und sie sind erstaunlich. Das ist ein passender Moment, um mich daran zu erinnern.
Komm schon, Bear. Du schaffst das. Atme es ein.
Die kühle Sommerluft fühlt sich gut an. Und die Stechmücken sind jetzt weg. Ich hasse Stechmücken. Sie haben weiß Gott über die Jahre mein Fleisch gepeinigt.
Ich versuche, die ersten Momente in meinem Kopf durchzuspielen. Die Interaktion. Die Fragen. Die Route. Ein weiterer riesiger Militärhubschrauber fliegt über das weite Tal, das sich an den Rand der Gletschermoräne schmiegt. Eine letzte Sicherheitsüberprüfung des Gebiets, denke ich mir.
Ich atme noch einmal tief durch. Die Worte meiner Mutter klingen mir im Ohr: „Man hat nur eine Chance, einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen.“
Vermassle es nicht.
Ich bücke mich und nehme ein paar Steine in die Hand, die ich in meinen Handflächen hin und her bewege. Gelassenheit ist ansteckend. Einer der Leitsprüche der Navy SEALs. Ich kenne ihn gut. Allerdings ist er nicht immer leicht zu praktizieren.
Na los! Wo zum Teufel bist du?
Ich schaue nach links und rechts.
Nichts.
„Du bist spät dran … woanders würde man deshalb Liegestütze befehlen“, murmle ich vor mich hin.
Keiner kann mich hören. Außer Jimmy, unser Tonmann, über mein Fernmikrofon. Er wird es von seiner Position am Flussufer aus mit einem Lächeln quittieren. Versteckt. Er ist einer der wenigen in unserer Crew, die über meine schlechten Witze lachen. Dafür liebe ich ihn.
Ja, genau. Liegestütze würden in solch einem Moment befohlen werden.
In meiner Armeezeit waren Liegestütze immer die Standardstrafe für die Truppe, wenn einer zu spät zum Marsch kam. Ich frage mich, ob diese Regel auch gilt, wenn man der Oberbefehlshaber des größten und mächtigsten Militärs ist, das die Menschheit je gesehen hat. Wahrscheinlich nicht.
Ich schaue noch einmal auf die Uhr. Erst 1053.
Knisternde Störgeräusche aus meinem Funkgerät. Das lässt mein Herz höherschlagen.
Und dann ist plötzlich alles seltsam still.
Ich kann es spüren.
Jetzt geht es los.
Das Spiel beginnt.
Dann tritt der Präsident der Vereinigten Staaten, ohne jegliche Fanfare oder viel Aufhebens, jedoch flankiert von zehn schwarz gekleideten Agenten des Secret Service, die ihre Waffen bereithalten, aus den Bäumen hervor.
Und ich bin auf seinen Wunsch hier.
Wie um alles in der Welt ist es dazu gekommen?
1
SCHLAMM, SCHWEISS UND ÄNGSTE
DIE WAHRHEIT ÜBER das Ankommen auf dem Gipfel eines Berges ist, dass der einzige Weg vorwärts nach unten führt.
Das ist einer der Gründe, warum ich so lange gebraucht habe, um eine Fortsetzung der Autobiografie „Schlamm, Schweiß und Tränen“ zu schreiben, die ich 2011 veröffentlicht habe. Ihr Erfolg hat meine ganze Familie überrascht. Und mich auch. Sie stand über zehn Wochen lang an der Spitze der Sunday Times-Bestsellerliste. Bis dahin war ich noch nie die Nummer 1 bei irgendetwas gewesen.
Als das Buch 2012 zum einflussreichsten Buch in ganz China gewählt wurde, hatte ich das Gefühl, dass wir etwas erreicht hatten. Gute Arbeit, Team. Wir werden ein paar Piña coladas (wie es in unserer Crew üblich ist) und einen Berg Pizza (wie immer) bestellen und morgen geht es dann wieder an die Arbeit. Auf zu neuen Territorien. Zu anderen Bergen.
Denken Sie daran: Wenn Sie zu lange auf dem Gipfel sitzen, sterben Sie. Eine grundlegende Everest-Lektion. Und vom Gipfel aus geht es, wie gesagt, nur nach unten.
Manche Menschen leben vielleicht für den Erfolg. Ich nicht. Ich habe damit zu kämpfen. Er fühlt sich wachsweich an. Er macht die Menschen träge. Ich sehe das oft. Und ich bin mir der Realität der vielen Faktoren, die den Erfolg ermöglichen, nur allzu bewusst.
Meine Einstellung lautet: Mit Gottes Gunst gehe ich. Und ich weiß, welch große Rolle das Glück in meiner Karriere gespielt hat. Daran habe ich keinen Zweifel. Andererseits ist Glück eine seltsame Sache. Wie einer meiner Helden, Ranulph Fiennes, einmal sagte: „Glück ist nur die Hälfte der Geschichte. Man muss vor allem die Widerstandsfähigkeit haben, lange genug durchzuhalten, bis das Glück kommt.“
Das hat mir schon immer gefallen.
So oder so – Glück oder Entschlossenheit – wurde mir als Kind immer gesagt, ich solle aufhören, wenn ich vorn liege, und Partys lieber fünf Minuten zu früh als zu spät verlassen. Diese Einstellung wurde mir von klein auf eingeimpft. Meine Eltern haben mir wirklich gesagt: Sei nicht gierig, sei stets dankbar.
Aus diesem Grund habe ich immer gezögert, eine Fortsetzung von „Schlamm, Schweiß und Tränen“ zu schreiben. Ich wollte es gut sein lassen. Nennen Sie es Angst, wenn Sie wollen. Oder besser gesagt: Ängste, die ich in den letzten Jahren auf jeden Fall angesammelt habe.
Angst ist aber ein schrecklicher Grund, etwas nicht zu tun. Und nur, weil ein Berg groß ist, heißt das nicht, dass man ihn nicht besteigen sollte. Und dann gibt es noch die Tatsache, dass sich manche Geschichten einfach danach sehnen, erzählt zu werden. Und es besteht kein Zweifel, dass die letzten zehn Jahre meines Lebens die außergewöhnlichsten waren, die sich ein Abenteurer nur vorstellen kann.
Also, was solls. Fangen wir an …
2
AUSGESETZT IN DER WILDNIS
EINES DER DINGE, nach denen ich am häufigsten gefragt werde, ist „Ausgesetzt in der Wildnis“ und die vielen Abenteuer, die wir für diese Sendung gefilmt haben. Ich habe diese Geschichten in „Schlamm, Schweiß und Tränen” nicht erzählt, weil ich das Gefühl hatte, dass es noch eine Menge anderer Dinge zu erzählen gibt: die unbekannten Geschichten, die mich geprägt haben, als ich aufwuchs und als junger Mann versuchte, in das Abenteuer des Lebens aufzubrechen. Ob es nun darum ging, die Schule zu überstehen, dem Militär beizutreten oder mir bei dem Unfall im freien Fall den Rücken zu brechen und kurz danach den Everest zu besteigen. Unsere erste transatlantische Arktis-Expedition mit einem Schlauchboot oder eine Motorschirmfahrt über den Himalaja und die vielen anderen Expeditionen, die mein Leben geprägt und bei viel zu vielen Gelegenheiten fast beendet hätten: Sie alle fühlten sich zu dieser Zeit eher wie die wahren Eckpfeiler meines Lebens an.
Aber es besteht auch kein Zweifel daran, dass „Ausgesetzt in der Wildnis“ der Türöffner für so vieles war, was seitdem passiert ist. Es war ein großes Privileg, die Chance zu bekommen, zur Hauptsendezeit für einen Sender mit dem globalen Netzwerk und der Reichweite von Discovery im US-Fernsehen zu arbeiten. Man hört oft von britischen Schauspielern, dass sie Amerika erobern wollen, aber dieser Weg ist übersät mit gescheiterten Versuchen. Ich war einer von denen, die Glück hatten.
Um ehrlich zu sein, habe ich dieses Glück und die unglaubliche Chance, die sich mir bot, damals nie richtig zu schätzen gewusst. Ich habe mich immer mehr darüber gefreut, für Channel 4 im Vereinigten Königreich zu arbeiten als für einen weit entfernten amerikanischen Sender – vor allem, weil meine Mutter es sehen würde. Ich war so naiv.
Diese einmalige Chance in den USA verdanke ich einem britischen Produzenten, Rob MacIver, und Diverse Productions. Ich werde Rob immer dankbar sein für sein Vertrauen in einen ungepflegten ehemaligen Soldaten, der sein Angebot, eine amerikanische Fernsehshow zu machen, immer wieder ablehnte. Ich schätze, es war sowohl ein Mangel an Selbstvertrauen als auch die Angst vor dem Unbekannten, aber ich dachte einfach, dass das Fernsehen nichts für mich sei. Also sagte ich Rob dreimal ab.
Rob hat an mich geglaubt, als ich keine Ahnung hatte, was ich da tat. Bis heute sagt er, dass ich ungehobelt und ahnungslos war, aber er wusste, dass es das amerikanische Publikum lieben würde, wenn wir ein paar Abenteuer filmen könnten, die so wild und lustig wären, wie wir sie uns vorstellten.
Ich hatte keine Ahnung, ob er recht hatte, aber schließlich ließ ich mich doch darauf ein. Robs Idee für das US-Fernsehen, „Abenteuer Survival“ – wie die erste Ausgabe von „Ausgesetzt in der Wildnis“ hieß –, wurde besser bezahlt als die Channel-4-Serie „Escape to the Legion“, die ich gerade gedreht hatte. Ich hatte also nicht viel zu verlieren, wie meine Frau Shara sehr weise bemerkte.
Die erste „Ausgesetzt in der Wildnis“-Staffel hat alles verändert.
Wenn ich jetzt zurückblicke, sind zwei Dinge kristallklar: Erstens, dass die Möglichkeit, Jahr für Jahr im amerikanischen Fernsehen so stark beworben zu werden, der Schlüssel zu so vielem war, was in meinem Leben folgte. Und zweitens hatten wir bei der Produktion dieser Sendung einige wirklich überwältigende Momente, die mir für immer in Erinnerung bleiben werden.
Und genau dorthin möchte ich Sie mitnehmen.
Ich könnte mit dem selbst durchgeführten Einlauf auf dem Floß beginnen, das ich auf einer pazifischen Wüsteninsel gebaut hatte; oder mit dem Baumstamm, der unter mir zerbrach, als ich eine 30 Meter tiefe Schlucht in Alaska überquerte; oder mit der Grubenotter, die mich im Dschungel von Borneo gebissen hat; oder mit dem Wels, den ich mit bloßen Händen aus den von Alligatoren verseuchten Sümpfen von Alabama zog. Oder vielleicht eine der hautnahen Begegnungen mit Salzwasserkrokodilen im australischen Northern Territory, das Verschüttetsein in einer Schneelawine oder das Gefangensein in einer Steinlawine. Vielleicht der improvisierte Neoprenanzug, den ich aus einem verrottenden Robbenkadaver gebastelt habe, oder das Urintrinken, Fäkalienmampfen, Stachelschweinjagen, Vogelspinnenkauen und Stromschnellenlaufen, Bergsteigen, freie Fälle, Momente der Wasserlandungen … und davon gab es viele.
Es gibt auch so viele Fragen. Zum Beispiel, was das Schlimmste war, was ich je gegessen habe. Oder meine Lieblingsfolge von „Ausgesetzt in der Wildnis“. Oder der härteste Ort, an dem ich je überleben musste. Oder der schlimmste.
Das sind alles Fragen, die beantwortet werden sollten.
Also, um des Genusses willen, lassen Sie es uns tun: „Ausgesetzt in der Wildnis“ aus meiner Sicht. Nur um es festzuhalten.
3
FLÜSSIGKEITSZUFUHR IN DER WILDNIS
ICH BIN SCHON ÖFTER, als man sich vorstellen kann, gefragt worden, ob ich wirklich meinen eigenen Urin trinke. Ich weiß nicht, was die Leute nur haben. In erster Linie Zweifel und ein unstillbares Verlangen, zu erfahren, wie Urin schmeckt.
Nun, die Antwort lautet: Ja, das habe ich, und ja, es ist schrecklich. Aber nein, ganz bestimmt trinke ich Urin nicht zum Spaß. Oder für die Gesundheit. Obwohl es da draußen einige Leute gibt, die darauf zu schwören scheinen. Ich gehöre nicht zu ihnen, aber ich habe ihn schon ein paar Mal getrunken, um zu überleben. Und die Antwort auf die Frage „Wie ist er?“ ist: „Er stinkt.“
Warmer, salziger Urin wurde nicht gemacht, um gut zu schmecken. Vor allem nicht, wenn er in der Haut einer Klapperschlange aufbewahrt wurde, während man eine Wüste durchquerte. Vermischt mit Blut und Schlangeninnereien hat dieser Urin einen ganz eigenen Geschmack angenommen, sodass ich das so schnell nicht wiederholen möchte. Andererseits schmeckt das Überleben selten gut und tut fast immer weh, stinkt und lässt einen ein wenig angeschlagen zurück. Das ist die Realität in der Wildnis und ganz sicher die Realität des Überlebens. Sie kann dich leiden lassen. Aber es gibt einen Teil von mir, der das liebt.
Das Leben kann heutzutage so steril sein. Wir scheuen den Kampf und lehnen das Gebrochene, das Gefallene, das Unkonventionelle und das „Untaugliche“ ab. Für den Überlebenskünstler und seit Jahrtausenden für die Menschheit bedeuten genau diese Dinge eine Chance. Gutes Überleben bedeutet, über den Tellerrand zu schauen, tief zu graben, das Unvorstellbare zu tun. Und ja, es könnte wehtun und wird wahrscheinlich stinken. Aber wenn es darum geht, am Leben zu bleiben, fährt die Belohnungen immer die Person ein, die am tiefsten gräbt und das gewisse Etwas in sich findet, das sie das Unvorstellbare tun lässt. Aus diesem Ethos wurde schließlich „Ausgesetzt in der Wildnis“.
In den wenigen Survival-Shows, die bis dahin im Fernsehen liefen, ging es immer darum, minimale Risiken einzugehen, einen Unterschlupf zu errichten, ein Feuer zu machen und auf Rettung zu warten. Für mich waren das die langweiligsten Aspekte des Überlebens. Ich mochte die ständige Bewegung und das unermüdliche Streben nach Entkommen. Was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass niemand kommt, um dich zu finden, und du dich bewegen musst, um dich selbst zu retten? Oh, und was wäre, wenn dir als Zugabe auch noch Wölfe auf den Fersen wären? Du hast keine Hilfsmittel, nur deinen Verstand und deinen Überlebenswillen, die dich antreiben …
Boom! Das ist doch mal ein Abenteuer. Und das war das Leitbild der Show: Was wäre, wenn …
Wie dem auch sei, ja, Urin schmeckt schlecht, aber er kann Ihr Leben retten, wenn Sie nicht verdursten wollen. „Verschwende keinen klaren Urin“, lautet die Devise, denn in einer Überlebenssituation steht die Flüssigkeitszufuhr ganz oben auf der Liste der Prioritäten. Ohne wertvolle Flüssigkeit geht es schnell bergab. Seien Sie also klug und sparsam – und auch, wenn es Ihnen schwerfällt: Um überleben zu können, müssen Sie den klaren Urin trinken. (Aber denken Sie daran: Wenn Ihr Urin braun ist und stinkt, ist das die Art der Natur, Ihnen zu sagen, dass Sie die Finger davon lassen sollten. Dann ist es nämlich ein reines Abfallprodukt.)
Ich erinnere mich noch gut an die Zeit, als unser ältester Sohn Jesse etwa acht Jahre alt war und ich draußen trainierte. Ich machte ein paar Burpees und Liegestütze, die Uhr tickte, die Intensität war hoch, die Wasserflasche stand neben mir und ich ging an meine Grenzen. So mag ich meine Work-outs – schnelle Körpergewichtsübungen, die Schnelligkeit, Kraft und Flexibilität fördern. Funktionelle Fitness, die mir hilft, meinen Job zu machen.
Jedenfalls kam Jesse vorbei und ich bat ihn zwischen zwei Atemzügen, mir einen Gefallen zu tun: schnell meine Wasserflasche aufzufüllen. Er hob meine leere Flasche auf, huschte ins Haus und kam mit der Flasche zurück … und einem Lächeln im Gesicht.
Ich beendete meinen Satz Wiederholungen, stemmte die Hände in die Hüften und saugte die Luft für die zehn Sekunden Pause vor der nächsten Übung ein.
„Danke, Champion“, murmelte ich, als ich die Wasserflasche nahm.
Ich schraubte den Deckel ab und trank einen großen Schluck … so gut.
So … salzig! Ich habe es kräftig ausgespuckt.
Anstelle von Wasser hatte ich einen Schluck von Jesses warmen Urin genommen.
„Was? Warum?“
„Aber du trinkst doch so gern Pipi, Papa!“
Ich schätze, dieser Urin-Gag wird mich noch eine Weile verfolgen.
Es ist kein tolles Getränk, das muss ich zugeben. Aber was ist mit dem Schlimmsten, das ich je gegessen habe?
Es wäre verlockend, diese Kameldarmflüssigkeit oder den gefrorenen Augapfel eines sibirischen Yaks voller Blut, Flüssigkeit und Knorpel zu nennen. Aber auch das neuseeländische Rieseninsekt Weta hat die Skala gesprengt. Oder vielleicht waren es lebende Skorpione, die immer schrecklich sind – voll mit einem seltsamen gelben Schleim; oder der Elefantenmist oder die aus dem Bärenkot herausgekratzten Beeren, die einen ganz besonderen Geschmack hatten. Stinktieranus und Rattenhirn waren die Tiefpunkte. Aber das alles verblasst im Vergleich zu dem rohen, geschwollenen Ziegenhoden, den ich einmal in der Sahara gegessen habe …
4
HÜTE DICH VOR HODEN
NACH VIELEN JAHREN, in denen ich lokale Delikatessen probiert habe, habe ich aus bitterer Erfahrung gelernt, besonders vorsichtig zu sein, wenn es um ebensolche geht. Sei es ein lokaler Schnaps, der aus dem fermentierten Speichel des Emberá-Stammes in einem Dschungel in Panama hergestellt wird, oder eingelegte Hühnerfüße in China. Die Erfahrung hat mich vorsichtig gemacht. Sehr vorsichtig.
Ich war nicht immer so scharfsinnig. Der Hoden dieser bestimmten Ziege in der Sahara war ein Tiefpunkt.
Wir verbrachten die Nacht in einem notdürftigen Lager inmitten der Sandwüste in einer sehr abgelegenen Ecke der Westsahara bei den einheimischen berberischen Wüstenbewohnern. Sie haben darauf bestanden, eine Ziege zu töten und gemeinsam unter dem Sternenhimmel zu speisen. Ihre wunderbare Gastfreundschaft konnte man nur schwer ablehnen.
Ach ja, und als Gast würde man mir zu Ehren einen Ziegenhoden anbieten. Das bedeutete, dass ich das Privileg haben würde, ihn warm und roh zu essen. Die wertvollen, kostbaren Geschlechtsteile sozusagen.
Die Augen der Crew leuchteten auf. Gott, war ich blass.
Der Berberhäuptling führte mich hinter die Zelte, wo die besagte Ziege angebunden war. Sie war nicht sonderlich groß. Ein gutes Zeichen, dachte ich bei mir. Während der Berber damit beschäftigt war, seine Klinge zu schärfen, könnte ich die Größe der Hoden dieser Ziege überprüfen. Mentale Vorbereitung und so.
Ich schlenderte langsam um die Rückseite herum und beugte mich hinunter, um einen Blick darauf zu werfen.
Heilige Mutter Gottes. Sie waren riesig. In der Tat überproportional, wie es schien. Dieser Kerl hatte Melonen unter sich hängen. Es war wirklich Ironie des Schicksals, dass dies die bestbestückte Ziege in der gesamten Sahara war.
Das Messer war scharf und der Berber schlitzte der armen Ziege innerhalb einer Sekunde die Kehle auf. Für diese Leute ist das ein Teil ihres Lebens, den ich nicht infrage stellen wollte. Besonders so weit draußen in der Wüste.
Sein Begleiter fing das Blut auf, das aus der Schnittwunde floss, und schon bald hing die Ziege kopfüber und war bereit für das Festmahl. Die Hoden hingen hinunter wie schlaffe, geschwollene Wasserballons.
Ein paar geschickte Schwünge mit der Klinge und der Sack war offen, wobei sich der erste abgetrennte Hoden wie ein riesiger weißer Wackelpudding in der Hand des Berbers ausdehnte. Die Größe des Hodens wurde nur noch durch das Grinsen in seinem Gesicht übertroffen. Er nickte mir zu und streckte mir seine Hand entgegen … und die Kameras liefen.
Für mich hatte das blinkende rote Licht der Kamera schon immer etwas Beruhigendes, das mir hilft, etwas Schwieriges zu tun. Es bedeutet, dass wir bereit sind, dass wir loslegen können und dass es Zeit ist, abzuliefern.
Ich habe das Motto der Pfadfinder immer geliebt: Gib dein Bestes. GDB GDB GDB. Oder mit den Worten meiner Mutter zusammengefasst: „Wenn eine Aufgabe einmal begonnen ist, hör nicht damit auf, bis sie erledigt ist; sei sie groß oder klein, mach sie gut oder gar nicht.“
Und in diesem Fall war es eine große Aufgabe.
Ich streckte die Hand aus und der Hoden glitt hinein. Er war schwer. Wow.
Ich atmete tief durch. Tu das Schwierige. Gib dein Bestes.
„Uno, dos, tres, rein gehts.“
Ich drückte den Hoden in meinen weit geöffneten Mund und kaute mit einer Grimasse. Die Kugel schien nur zu gleiten, doch dann explodierte sie plötzlich in meinem Mund – voll mit etwas, von dem ich nur vermuten konnte, dass es Ziegensperma war. Ich versuchte, es herunterzuschlucken, aber der Brechreiz und der beißende Geschmack waren so stark, dass ich sofort würgen musste und spürte, wie das Erbrochene in mir aufstieg. Ich versuchte, den Brechreiz zu überwinden und das Sperma und den Sack meine Kehle hinunterzubekommen.
Komm schon, ermahnte ich mich.
Doch das Erbrochene schoss in meinen Mund und vermischte sich mit dem Gelee.
Halt es drin, Bear.
Selbst der Berber zog eine Grimasse. Unsere Blicke trafen sich für einen Augenblick. Und manchmal kann ein Blick alle Sprachbarrieren beseitigen. Seine Augen verrieten nur eines: Das war ein wahrer Goldschatz von einem großen Hoden, was?
Schließlich habe ich ihn runtergeschluckt, mit Erbrochenem und allem. Job erledigt. Ich entschuldigte mich sogar auf sehr britische Art für die Aufregung. Er lächelte, dann lachte er laut auf.
Kamera aus. Es war für uns alle ein langer, heißer Tag gewesen. Weiter gehts, Team. Weiter gehts.
Also ja, dieser Hoden war schlimm. Aber wenn Sie mich nach dem härtesten Ort fragen würden, an dem ich überleben musste … nun, das war eine Weltreise entfernt von der Sahara, an einem der kältesten und brutalsten Orte der Erde.
Sibirien. Im Winter.
5
DIE ZÄHESTEN
WENN SIE EINEN ORT auf unserem Planeten auswählen müssten, der mit seinen rauen, kalten und trostlosen Bedingungen brutal gnadenlos ist, dann wäre Sibirien im Dezember definitiv unter Ihren Top 3. Wahrscheinlich sogar die Nummer 2.
Es ist weit, weit weg von allem, schwer zu erreichen und als Überlebenskünstler ebenso schwer wieder zu verlassen. Es hat mich an meine Grenzen gebracht.
Es ist immer etwas Besonderes und öffnet einem auch manchmal ziemlich die Augen, in die wirklich abgelegenen Teile der Welt zu reisen – umso mehr, wenn man in einem Land ist, das so lange im Banne des Kommunismus stand. Während sich weite Teile Russlands nach dem Fall des Kommunismus sehr schnell veränderten, ging es in Sibirien etwas langsamer voran. In einer Welt, in der die Durchschnittstemperatur im Winter bei milden minus 25 °C liegt, dauert alles länger.
Nach vier Flügen in immer kleineren und immer unzuverlässigeren Flugzeugen fanden wir uns in winzigen Blockhütten mitten im Taigawald im tiefsten Sibirien wieder. Jede Hütte so groß wie eineinhalb Tischtennisplatten und ausgestattet mit einem Einzelbett und einem kleinen Eisenofen zum Heizen. In den sechs Jahren, in denen wir „Ausgesetzt in der Wildnis“ drehten, waren solche Situationen keine Seltenheit. Es war einfach ein weiterer schwierig zu erreichender Ort mit Einheimischen, die in erster Linie überrascht von dem waren, was wir vorhatten.
Unser Team bestand im Allgemeinen aus weniger als zehn Personen. Eine Mischung aus Kameraleuten, Toningenieuren, ein oder zwei Bergführern (um die Sicherheit der Crew zu gewährleisten), einem Sanitäter, einem Logistikkoordinator, einem Produzenten und zusätzlich einem lokalen Mittelsmann, der Probleme regeln würde, wenn etwas schiefgeht … was nicht unüblich war.
Eine anfängliche Einweisung des gesamten Teams durch die örtlichen Such- und Rettungsteams oder die Ranger war oft eine ernüchternde Angelegenheit, die uns daran erinnerte, dass die umliegende Wildnis wirklich unbarmherzig sein kann (was zu dieser Jahreszeit besonders auf Sibirien zutrifft) – Warnungen, an die ich mich nur allzu sehr gewöhnt hatte. Kurzum, die Standorte und Bedingungen bei „Ausgesetzt in der Wildnis“ waren selten einfach.
Sicherlich gab es auch leichtere Momente und oftmals landeten wir sogar am Ende von zwölf Tagen, in denen wir durch Dschungel, Wüsten, Sümpfe und Berge gewandert waren, an einem halbwegs anständigen Ort für eine Nacht. Aber die meiste Zeit über war es hart. Ich habe es damals nur nicht so sehr gemerkt. Heute blicken die Crew und ich kopfschüttelnd und lächelnd auf das Tempo zurück, mit dem wir uns bewegten, auf die Orte, an denen wir waren, und auf die Dinge, die wir anstellten. Ich denke, wir haben unser Handwerk gelernt, unser Durchhaltevermögen getestet und unsere Zeit abgeleistet.
Jedenfalls begannen die Dreharbeiten immer vor der Morgendämmerung und wenn man unter Bedingungen arbeitet, bei denen es entweder sehr kalt oder sehr heiß ist, wird alles sehr schnell zu harter Arbeit.
Wir wurden Meister darin, uns in schwierigen Umgebungen zurechtzufinden, und das hatte nichts mit dem zu tun, was wir eigentlich drehten. Da ging es nur darum, sich selbst zu erhalten, sich zu schonen und sich anzutreiben, um den Tag zu überstehen. Oft ging es einfach nur darum, die Abenteuer des Tages zu überstehen und die nächste kurze Nacht zu erreichen, um für den nächsten knallharten Tag bereit zu sein.
Dieser Ablauf wiederholte sich immer wieder …
Am Ende von sechs Staffeln hatten wir die Dreharbeiten für „Ausgesetzt in der Wildnis“ auf fünf oder sechs Tage reduziert, aber in den ersten Tagen, als wir mehrere Sendungen hintereinander drehten, war es ein brutaler Zeitplan, bei dem es darauf ankam, die durchgetakteten Stunden und die Intensität durchzuhalten. Und ein Großteil dieser Ausdauer war eine Frage der Geisteshaltung.
Wenn ich mir überlege, was wir den ganzen Tag über gemacht haben, und das täglich, kommt es mir verrückt vor. Aber Eisen schärft Eisen und die Crew, mit der ich gefilmt habe – eine Gruppe von Legenden –, hat dafür gesorgt, dass wir den Job immer erledigt haben. Wir haben uns gegenseitig auf Trab gehalten und uns immer wieder zum Lachen gebracht, indem wir uns von morgens bis abends gegenseitig auf die Schippe genommen haben. Durch die Ängste, die Kälte, die Hitze, die langen Wanderungen, die schweren Rucksäcke und all die blutgetränkten, magenumdrehenden Momente, die die Show ausmachten, bestand die Crew aus besten Freunden. Und das sind wir immer noch.
Bis heute sind viele von ihnen in unseren Netflix-, Amazon Prime-, ITV- und National Geographic-Sendungen neben mir zu sehen – immer noch da, immer noch lachend, immer noch scherzend, immer noch die Hügel hinaufkletternd und die schweren Rucksäcke tragend. Wenn ich sie also Legenden nenne, ist das keine Floskel. Sie sind es wirklich. Für das Publikum sind sie Namenlose, aber für mich sind sie Helden. Und zwar die einzig wahren.*
*Ihr wisst, wer ihr seid: Mungo, beide Dans, James, Simon, Pete, Paul, Dave, Duncan, Danny, Jimmy, Scott, Dilwyn, Josh, Woody, Matt, Jimmy, Ben, Rob, Jeff, Ross, Meg, Stani und Liz … Ich liebe euch und bin so dankbar für alles, was ihr macht.
6
UNSERE ZEIT ABLEISTEN
WIE AUCH IMMER, zurück nach Sibirien. Ich erinnere mich an eine eiskalte sibirische Nacht, in der Kameramann Simon Reay und ich in unseren Schlafsäcken, auf dünnen Rollmatten zusammengerollt, im tiefen Schnee unter einem Baum lagen. Keiner von uns beiden schlief und etwa jede Stunde stupste er mich an, um mir zu zeigen, dass die Temperaturanzeige an seiner Kameratasche noch weiter gesunken war.
„Ich weiß, dass es kalt ist, Simon. Mir ist der Rotz an der Nase festgefroren und das Atmen tut weh.“
Er quetschte sein Gesicht durch einen kleinen Spalt im Schlafsack, sodass nur die Nasenspitze und seine grinsenden Lippen zu sehen waren.
„Minus 42. Das ist episch.“
Je verrückter die Situation war, desto mehr wussten wir als Crew, dass wir etwas Besonderes taten. Ich sehe noch immer den stolzen Gesichtsausdruck von Simon, als bei den Dreharbeiten am nächsten Tag das Wasser in Sekundenschnelle auf der Linse seines Unterwasserkameragehäuses gefror.
„Scheiße. Habt ihr das gesehen, Leute?“, rief er. „Verdammt kalt. Ist buchstäblich beim Abwischen eingefroren.“
Dave Pearce, unser Sicherheitsexperte, ehemaliger Elitesoldat und alles in allem ein guter Kerl, hält Simon an einem kurzen Seil fest und sichert ihn so flussaufwärts von mir gegen die Strömung des eiskalten Wassers, während Simon sich in den Fluss drängt.
Inzwischen bin ich bei minus 35 °C nackt und versuche barfuß durch das dünne Eis an den Rändern zu stapfen, um den Hauptstrom – den schwarzen, schnell fließenden Mittelteil – zu erreichen und letztendlich zum anderen Ufer hinüberzukommen. Ich rufe Simon zu, dass er bei mir bleiben und weitergehen soll. Kamera hin oder her, wir halten jetzt nicht an.
Schnell handeln. Nicht herumstehen. Das war die DNA unserer Zeit. Vor allem bei den extremen Temperaturen. Daher kam auch die Idee, „keine zweite Aufnahme“ für irgendetwas zu machen. Pure Notwendigkeit. Entweder es klappt oder nicht. Das machen wir nicht noch einmal. Weiter gehts.
Währenddessen ist der Rest der Crew bereits am anderen Ufer, stampft mit den Füßen und reibt sich die Hände, um sich warm zu halten, vergraben unter all den Schichten – genau wie ich bis drei Minuten zuvor, als ich wusste, dass es Zeit war, mich auszuziehen und den Job zu erledigen.
Sowohl Dave als auch Simon tragen vollständige Trockenanzüge. Beiden ist immer noch eiskalt. Das geht uns allen so. Aber nackt wird meine Überlebenszeit immer kürzer, besonders, wenn ich in diesem Fluss in Schwierigkeiten gerate. Oft habe ich gesehen, wie Menschen bei ihrem ersten Eintauchen in Eiswasser vor Schreck erstarrten und nicht einmal in der Lage waren, ihren Namen auszusprechen, geschweige denn nackt zu schwimmen, Eis zu durchbrechen, eine tiefe Schneewehe zu erklimmen und dann nur mit einem Feuerstahl und einem Stein ein Feuer zu entfachen. Aber diese Dinge waren so typisch für das, was „Ausgesetzt in der Wildnis“ verkörperte. Abenteuer Überleben.
„Ausgesetzt in der Wildnis“ wurde zu einer Studie darüber, wie man gerade genug „geplanten Ärger“ bekommt, ohne von den ungeplanten Dingen überrascht zu werden. Das hat nicht immer geklappt.
Wenn alles perfekt nach Plan verlief, war das vor uns liegende „Schwimmen-Springen-Durchtauchen“ möglich, aber was mit der Zeit immer deutlicher wurde, war, dass wir in ernsthaften Schwierigkeiten stecken würden, wenn die Dinge nicht nach Plan verliefen. Mit anderen Worten: Der Spielraum für Fehlschläge war gering. Und genau darin lag die Gefahr.
So wie damals, als mich ein Fischdampfer in Alaska von den Füßen riss, als ich auf einem kleinen Eisberg balancierte und versuchte, eine dünne Strickleiter zu ergreifen, die von der Schiffsseite herabgelassen worden war. Ich erwischte das Seil gerade noch und konnte so verhindern, dass ich zwischen dem Dampfer und dem Eisberg zerquetscht und in zwei Hälften geschnitten wurde.
Und dann war da noch die Überquerung der hohen Schlucht, als der Baumstamm nachgab und ich es gerade noch geschafft habe, mit einer Hand einen Ast zu erwischen; oder der Felsabbruch, bei dem ein Felsbrocken von der Größe eines Autos mit 100 km/h zwischen Dan Etheridge, unserem Kameramann, und mir herunterflog und uns nur knapp verfehlte.
Die Lektion lautete: Spiele nicht zu lange mit den Chancen und was du planen kannst, plane gut, mach es einmal und versaue es nicht. Oder aber … Bei dem „Oder aber“-Teil kann Mutter Natur sehr unbarmherzig sein. Und wenn etwas schiefgeht, dann geht es meist schnell schief. Wie man so schön sagt: Die Natur ist wie deine Mutter … respektiere sie und sie wird dich gut behandeln; respektiere sie nicht und sie wird dir eine Lektion erteilen, die du nie vergessen wirst.
Jedenfalls verlief die sibirische Flussdurchquerung gut. Wir sind nicht gestorben, wir haben all unsere Aufgaben erfüllt, Simon konnte die Action gut mit der Kamera einfangen, Dave hat Simon gesichert, das Mikrofon hat trotz des Wassers funktioniert und so weiter. Wie die Royal Navy sagt: Das Team funktioniert. Aber wir hatten nie viel Zeit, Bilanz zu ziehen und uns gegenseitig zu beglückwünschen. Das Tempo war immer so hoch angelegt. Zwölf Tage in einem Land, um zwei Episoden zu drehen. Immer weitermachen. Es gibt so viel zu tun.
Nach dem Verlassen des Flusses galt es, eine Schneehöhle zu graben, Fallen aufzustellen, Klippen zu erklimmen, auf einem Tierkadaver riesige Schneewände von 300 Metern hinunterzuschlittern und frisches Blut aus dem Hals eines Yaks zu trinken. Dann verfolgten wir den transsibirischen Schnellzug und sprangen mit dem Fallschirm aus einer alten russischen Mi-17-Rostlaube in einen Schneesturm. (Bei solchen Wetterbedingungen hätten wir im Vereinigten Königreich nie eine Genehmigung für einen Sprung bekommen. Niemals. Aber in Sibirien …)
Die Liste der verrückten Dinge bei „Ausgesetzt in der Wildnis“ war endlos. Jeder Tag anders. Jeder Tag eine knappe Sache. Es war ein wilder Ritt, aber das gehörte einfach zum Job. Wir haben es selten infrage gestellt. Ich betrachtete es einfach als das Ableisten unserer Zeit.
7
SLAV DER PFÄHLER
MEINE LETZTE ERINNERUNG an Sibirien ist das Übernachten in einer Höhle mit Dave in einer weiteren eiskalten Nacht. Der Rest der Mannschaft hatte eine einstündige Fahrt in einem alten russischen Lastwagen vor sich – zurück über die schmalen Bergwaldwege zu den Blockhütten und dem Generator, wo sie die Batterien ihrer Kameras aufladen, etwas warmes Essen bekommen und sich ausruhen konnten, bevor sie am nächsten Tag um 4 Uhr früh aufbrechen mussten, um wieder zu uns zu stoßen.
Der Moment, in dem die Crew mit den Kameras abreiste und die Dreharbeiten für den Tag beendet waren, war immer mein Lieblingsteil. Ich war noch nie jemand, der gern im Mittelpunkt steht. Auch heute noch sind Kameras für mich ein notwendiges Übel, das ich ertragen muss, um diese Abenteuer mit großartigen Freunden in der Natur zu erleben. Aber das ist eben der Job. Damals war es mein einziger Job – und meine einzige Einnahmequelle. Ich musste weitermachen. Nimm das Schwierige in Kauf. Denke daran, dass die Kameras am Ende des Tages aufhören werden zu filmen.
Denn vor der Kamera zu stehen war etwas, mit dem ich mir schwertat. Zu Beginn eines jeden Tages musste ich immer wieder die Motivation neu aufbringen – nicht für das Abenteuer (das war der Teil, der sich für mich natürlich anfühlte), sondern dafür, mich vor die Linse zu stellen. Ich habe wirklich damit gerungen. Ich mochte es einfach nicht, wenn Leute mich beobachteten, kritisierten und jede meiner Bewegungen diskutierten – was in den ersten Tagen unweigerlich der Fall war.
Ich stellte eine Falle auf und der Produzent und alle anderen, die dabei waren, diskutierten leise darüber, ob sie gut genug war oder ob es noch einmal gemacht werden musste. Ich habe dieses Warten gehasst. Zumal meine Art zu überleben immer ein wenig ungehobelt war – gut genug ist gut genug, wie ich zu sagen pflege. Das war keine Lektion im Löffelschnitzen, sondern eher eine Demonstration, wie man sich schnell aus einer misslichen Lage befreien kann.
Aus diesem Grund habe ich dem Team schon sehr früh gesagt, dass ich es so nicht mehr machen kann. Die Wiederholungen und die endlosen Überprüfungen haben mich und den Geist des Ganzen getötet. Und das Fernsehen offenbart so vieles, sodass man es merkt, wenn jemand die Begeisterung verliert. Als ich merkte, dass das passiert, sagte ich, dass wir die Dinge nur einmal machen sollten, wenn die ganze Sache überhaupt Bestand haben soll. Wir sollten es natürlich halten und mir erlauben, die Kamera so weit wie möglich zu ignorieren, und die Crew müsste alles tun, was sie kann, um es auf Film einzufangen. Bekommt es hin oder nicht. Aber immer weitermachen.
Der damalige Produzent entgegnete: „Das ist unmöglich, wir werden die Berichterstattung, die Nahaufnahmen und die Ausschnitte nicht hinbekommen. Die Sendung wird ein totaler Reinfall.“ Ich blieb standhaft. Und wissen Sie was? Der Zauber kehrte zurück.
Ich hatte langsam einen Weg gefunden, diese Angst zu überwinden, und zwar aus der Not heraus.
Blende sie einfach aus, Bear … Konzentriere dich auf das Abenteuer. Und mach diesen Teil gut.
Heute fühle ich mich viel wohler bei der ganzen Sache mit dem Filmen – aber nur, weil ich gelernt habe, die Kameras zu ignorieren und einfach das Abenteuer durchzuziehen, ohne an die Kontrolle durch die Linse zu denken. Das ist der Grund, warum wir jetzt bei jedem Dreh mindestens vier Kameras dabeihaben, nicht nur eine. Jeder weiß, dass man mehrere Kameras braucht, um eine Szene angemessen abzubilden – und sie müssen immer laufen. Selbst wenn das Objektiv mit Schlamm und Regen bedeckt ist, ist das in Ordnung. Man muss es kurz halten. Es funktioniert.
Jetzt können Sie wenigstens verstehen, warum ich den „Kamera aus“-Moment am Ende des Tages bei „Ausgesetzt in der Wildnis“ immer geliebt habe. Ich konnte mich zum ersten Mal seit zwölf Stunden auf einen Baumstamm setzen und einfach innehalten. Keine Kameras. Einfach nur entspannen.
An diesem eiskalten Abend reiste die Mannschaft ab, Dave und ich schürten ein Feuer und bereiteten uns auf eine kalte Nacht in der Höhle vor, die in circa 90 Meter Höhe am Fuß einer steilen Felswand lag.
Wir blickten auf die Gleisgabelung unter uns, wo Slav, unser ortskundiger Begleiter, schlafen sollte. Slav sprach kaum, wog etwa 146 Kilo und schien nur geräucherten Schweinespeck und Knorpel zu essen, die er mit seinem bewährten russischen Taschenmesser aufspießte. Und anstelle von Tee sah ich ihn immer nur sibirischen Wodka trinken. Wir fanden ihn großartig.
„Vielleicht sollten wir einfach nachsehen, ob es ihm gut geht, bevor wir für die Nacht in unseren Schlafsäcken verschwinden – was meinst du dazu?“, fragte mich Dave.
Wir wanderten hinunter zu seinem Lager und fanden ihn auf dem Rücken liegend, auf halbem Weg zwischen dem Feuer und seinem Zelt. Er schnarchte. Die leere Wodkaflasche erzählte alles.
„Der Kerl wird sterben, wenn wir ihn bei diesen Temperaturen hier lassen“, sagte ich zu Dave.
Wir versuchten ihn wachzurütteln, aber nichts. Wir versuchten ihn daraufhin in sein Zelt zu bringen. Der Kerl rührte sich nicht.
Es kostete unsere ganze Kraft, ihn schließlich die paar Meter zu seinem alten Zelt zu stemmen und hineinzuschieben. „Glaubst du, er packt das?“, fragte ich.
„Sibirische Zähe. Er wird wieder.“
In dieser Nacht war es noch kälter als in der letzten, in der Simon mit mir draußen geblieben war. Dave und ich verbrannten in diesen dunklen Stunden einen Holzstapel, der so groß war wie ein kleines Haus. Keiner von uns schlief länger als 20 Minuten am Stück, ehe wieder jemand aufstehen musste, um das Feuer mit weiteren Holzscheiten am Brennen zu halten. Ohne dieses Feuer hätte uns diese kalte Höhle umgebracht.
Als wir im Morgengrauen in die kalte Bergluft eintauchten und den Hang hinuntergingen, um nach Slav zu sehen und auf die Mannschaft zu warten, waren wir ein wenig besorgt, in welchem Zustand er sich befinden würde. Wir konnten sehen, dass sein Feuer längst erloschen war. Ich war wirklich besorgt, ob er überhaupt noch am Leben sein würde.
Als wir schließlich an seinem Zelt ankamen, fragte ich mich, warum wir uns überhaupt die Mühe gemacht hatten. Da stand Slav, grinste uns an, genauso gekleidet, wie wir ihn verlassen hatten.
Er trug einen dicken grauen Mantel, hatte Hände wie Spaten, die aus den Ärmeln schauten, und kaute auf einem auf seinem Messer aufgespießten Stück Schweinefett herum.
Dave und ich sahen uns an und lachten. Es würde mehr als eine Nacht bei minus 45 °C brauchen, um Slav, den Schweinepfähler, wie Dave ihn zu nennen begann, zu erledigen. Wow, die sind ganz schön zäh in Sibirien.
Wenn ich heute einen Moment des Selbstmitleids habe oder mich über die Bedingungen, das Terrain oder die Fahrtzeit beschwere, denke ich oft an Slav. Er ist knallhart, hat Hände wie Boote und immer ein Lächeln auf den Lippen – egal wie die Bedingungen sind.
Slav der Pfähler. Eine Legende.
8
EIN TEAM, EINE MISSION
OBWOHL ICH STÄRKE DARAUS ZIEHE, Menschen wie Slav zu kennen, ist es wichtig, dass ich aus der Zeit von „Ausgesetzt in der Wildnis“ mitgenommen habe, dass ich bei fast jeder Gelegenheit so viel Hilfe von unserem Team bekommen habe, wie ich brauchte, wenn ich sie wollte oder darum bat.
Trotz der Art und Weise, wie die Leute die Show wahrnehmen (und trotz des Disclaimers am Anfang, der besagt, dass Bear Grylls und die Crew Unterstützung erhalten, wenn sie sich in potenziell lebensbedrohlichen Situationen befinden), habe ich „Ausgesetzt in der Wildnis“ nie als „ein Mann gegen die Elemente“ gesehen. Wir waren eine eingeschworene Gruppe von Brüdern (und manchmal Schwestern) und die enorme Unterstützung, die vielen unsichtbaren Freundlichkeiten und helfenden Hände, die mir das Team jeden Tag zukommen ließ, machten diese Show erst möglich.
Es ist so einfach und wahr zu sagen, dass es ohne dieses Team „Ausgesetzt in der Wildnis“ nie gegeben hätte. Das ist der Grund, warum ich die Aufmerksamkeit und das manchmal überzogene Lob, das „Ausgesetzt in der Wildnis“ einbrachte, nie wirklich mochte. Ich könnte nie so stark und fähig sein, wie es in der Sendung oft dargestellt wurde: ein Mann, der allein kämpft und selbst gegen eine Übermacht immer gewinnt. So ist das Leben oder die Wildnis nicht. Man kann vielleicht einmal so überleben, aber nicht jede Woche, jedes Jahr. Es braucht ein Team, wenn auch ein kleines, aber vor allem ein großartiges, um so etwas sicher und beständig zu schaffen.
Ich habe immer gewollt, dass die Menschen wissen, wie sehr mir unser Team bei jedem Einsatz geholfen hat. Dass ich ohne sie viele Male gestorben wäre.
Aber immer, wenn ich an Pressetagen über diese Dinge sprach, schienen sich die Leute nicht besonders für diese weniger dramatischen Tatsachen zu interessieren. Ihre Leser oder Zuschauer wollten die Gefahr, die Kämpfe und die verrückten Dinge. Es ging immer nur um die Schlagzeile oder die zwei Minuten einer Geschichte auf einer Talkshow-Couch und das war es dann. Das war alles, was die Journalisten interessierte. Das Heldenbild passte in ihre Vorstellung. Aber ich kannte die Realität und ich schätzte – immer mehr als alles andere – die Kraft dieses Teams. Ohne diese echten Helden, die hinter oder neben mir standen, die bei jedem Schritt härter und länger arbeiteten und oft einen komplizierteren und besseren Job machten als ich, hätte ich niemals „überlebt“. Und das in mehr als einer Hinsicht.
Obwohl, wenn ich so darüber nachdenke, gab es da dieses eine Mal in der Sahara, als es wirklich fast hieß: ein Mann gegen die Wildnis. Und es bringt mich immer noch zum Lächeln.
Wir hätten es wirklich besser wissen müssen: Der Hochsommer in der Sahara ist keine gute Zeit zum Filmen. Jeden Tag Sanddünen rauf und runter, klettern, festkrallen, rollen, schleppen, bauen – und das alles bei 50 °C Hitze –, das musste unseren ohnehin schon geringen Spielraum für Fehler noch weiter verringern.
Schon bald erlitt ein Mann einen Hitzschlag und musste sich übergeben. Das bedeutete, dass unser erstes Mannschaftsfahrzeug und ein Fahrer weg waren, um ihn aus der sengenden Hitze zu evakuieren. Dann fiel der Sanitäter aus, was bedeutete, dass das zweite Fahrzeug und ein weiterer Fahrer weg waren, quer durch die Dünen zurück in Richtung Zivilisation.
Der Tag wurde heißer, aber wir machten weiter, filmten weiter. Das taten wir immer. Gegen Mittag verloren wir einen weiteren Mann und unser vorletztes Fahrzeug. Wir waren jetzt nur noch zu viert: Simon der Kameramann, Paul Ritz, unser Tontechniker, ein brillanter ehemaliger Fallschirmjäger namens Danny Cane, der die Dreharbeiten in Bezug auf Logistik und Zeitplanung immer am Laufen hielt, und ich.
Wir hatten jetzt nur noch ein Auto und einen Fahrer und hielten uns an den Plan, den Kamelen zu Fuß über die glühend heißen Dünen zu folgen, wo einem schon das Atmen im Hals wehtut.
Und schließlich ging Paul, der sonst nicht zu bremsen war, in die Knie, übergab sich und begann zu schwanken.
„Nein, mir geht es gut, ich kann weitergehen“, murmelte er, während er sich wieder aufrichtete.
Aber 20 Minuten später war klar, dass er nicht mehr weitermachen konnte. Wir halfen ihm in das letzte Auto, schütteten Wasser über ihn und stellten die Klimaanlage an. Er musste schnell zur Basis zurückkehren. Ein Hitzschlag kann wirklich gefährlich sein, das wussten wir alle. Wir hatten bereits Berichte erhalten, dass die anderen Hitzschläge der Crew ernster waren, als wir gedacht hatten. Ein Mitglied des Teams lag jetzt im Krankenhaus.
Wir mussten uns entscheiden, ob wir die Ausrüstung abbauen oder weitermachen sollten. Wir hatten nur noch eine Szene zu drehen, um die Sendung abzuschließen und zu beenden. Wir mussten es schaffen, und alle waren bereit, für einen letzten Versuch zu bleiben. Aber wie sollten wir das ohne einen Tontechniker schaffen?
Jetzt muss man die Scharade verstehen, die Paul uns über mehrere Jahre und mehrere Abenteuer hinweg vorgespielt hat: wie kompliziert es sei, Tontechniker zu sein, dass sie die einzigen wirklich unverzichtbaren Personen bei einem Dreh seien und dass wir Affen nicht einmal wüssten, wo wir anfangen sollten, seinen Job zu machen. Wir alle hatten die Geschichte schon oft gehört.
Aber es war eine verzweifelte Situation, die verzweifelte Maßnahmen erforderte. Was konnten wir tun? Der einzige Mann, der Paul ersetzen konnte, war Danny, der Ex-Fallschirmjäger. Aber Danny konnte trotz seiner vielen Fähigkeiten kaum ein Handy bedienen, geschweige denn das mobile Mischpult eines Toningenieurs mit all den Reglern, Nadeln, Windschutzpuscheln und Mikrofonstangen.
Paul lag nun zusammengesackt auf einem Haufen, musste sich zeitweise übergeben und war vor Hitze beinahe besinnungslos. Er wusste, dass seine Zeit fast abgelaufen war.
„Paul, entweder sagst du uns die Wahrheit über die Tontechnikeraufgaben oder wir scheitern mit unserer Mission“, beschwor ich ihn.
Zu diesem Zeitpunkt, als wir völlig verzweifelt waren, hörten wir zum ersten Mal die unsterblichen Worte darüber, wie man ein Tontechniker wird.
„Danny, komm her“, murmelte Paul, als würde Nelson Hardy zu seinem Abschiedskuss rufen. „Jetzt hör mal gut zu …“ Wir hielten alle den Atem an. „Im Grunde“, fuhr Paul fort, „ist es ganz einfach: Die Teleskopangel muss aus dem Schussfeld und die Nadeln in der Mitte bleiben.“
Und damit wurde er ohnmächtig.
Seitdem schauen wir uns alle an, wenn ein Tontechniker mit einem von uns im Team ins Gespräch kommt oder sich beschwert, dass er Zeit braucht, um ein akustisches Problem zu lösen, während wir in einer Dschungelschlucht unser Ding machen, und sagen übereinstimmend: „Warum? Du musst doch nur die verdammte Teleskopangel aus dem Bild und die Nadeln in der Mitte halten.“
Genial.
Wie auch immer, Sahara erledigt. Auch das haben wir überlebt. Weiter gehts.
9
ÜBERLEBEN IN DER APOKALYPSE
WENN SIE MICH BITTEN WÜRDEN, eine Episode auszuwählen, die ich am liebsten gedreht habe, dann wäre es die städtische Episode, die wir in einer alten stillgelegten Schiffswerft an der polnischen Ostseeküste gedreht haben. Wir befanden uns zu diesem Zeitpunkt in der fünften Staffel von „Ausgesetzt in der Wildnis“ und wollten die Dinge immer wieder neu mischen und das Abenteuer und das dynamische Überleben auf die nächste Ebene bringen. Und viele Leute hatten ein apokalyptisches Szenario vorgeschlagen.
Für uns als Team waren die Dreharbeiten episch. Wir hatten den Raum und die Freiheit, einige unserer eigenen Regeln und die konventionelle „Ausgesetzt in der Wildnis“-Formel zu brechen und die Apokalypse voll auszuschöpfen.
Die Basis, in der wir drehten, war eine ehemalige Nazi-Sklavenwerft, die früher zur Reparatur von U-Booten genutzt wurde und seitdem kaum verändert worden war. Ein riesiges Areal mit gigantischen alten Lagerhallen und versteckten Tunneln, Treibstoffdepots, Ölreservoirs und Glasscherben überall. Der Ort war voller Staub, Fett, Taubendreck und einer Atmosphäre voller Geschichte und Entbehrungen, der man sich nur schwer entziehen konnte.
Die Episode begann damit, dass wir von einem schnellen Schlauchboot der Special Forces in ein Frachtnetz gesprungen sind, das an einem alten Kran über dem Hafen aufgehängt war. Und von da an ging es Schlag auf Schlag. Wir kletterten an Kabeln hoch und Aufzugschächte hinunter, überquerten Stromleitungen und sprengten sogar Türen durch das Anzünden alter Sauerstoff- und Acetylenflaschen auf, um Zugang zu einer versteckten Kammer zu erhalten.
Es war eine lustige Gelegenheit, das Ganze ein bisschen mehr wie einen Film wirken zu lassen – mit einigen coolen Elementen wie Parcours und Rückwärtssaltos von Dächern oder sich durch Fenster zu schwingen und in engen Lüftungsschächten zu verkeilen. Das bedeutete, dass wir die Show etwas mehr „produzieren“ und sorgfältig planen mussten, aber was an Spontaneität verloren ging, die entstand, wenn wir Geröllhalden hinunterstürmten und Flüsse überquerten, gewannen wir durch das Zeigen eines eher szenarioartigen Überlebens wieder.
Wie auch immer, wir haben es alle geliebt, es hat den Rahmen gesprengt und wir haben etwas völlig Neues mit einem altbekannten Format gemacht. Ich war am Ende der Dreharbeiten so schmutzig, voller Fett, Öl und Dreck, dass es eine ganze Woche dauerte, bis ich wieder normal aussah. Und ich habe generell eine ziemlich hohe Messlatte, was das Schmutzigwerden angeht.
Zu Hause wurde es sogar zu einem kleinen Witz, dass Shara mir nach meiner Rückkehr von den Dreharbeiten zu „Ausgesetzt in der Wildnis“ verbot, das Haus zu betreten, bis die Taschen geleert waren und ich mich ausgezogen und abgespritzt hatte. Die Dinge, die aus meinen Taschen, Rucksäcken, meinen Hosentaschen und meinen Ohren purzelten, hätten eigentlich katalogisiert werden müssen. Von Rattenschwänzen und Klapperschlangenzähnen bis hin zu ausgebrannten Fackeln und blutgetränkten Socken und einmal sogar einem lebendigen Skorpion war alles dabei.
Ich habe sie an unserem Hochzeitstag gewarnt, dass das Leben mit mir anstelle von konventionell und reglementiert immer ein Abenteuer sein würde.
10
DAS ENTSETZLICHSTE
WENN ICH DEN DRECKIGSTEN und entsetzlichsten Ort nennen sollte, an dem wir je gedreht haben, würde ich wahrscheinlich die schwarzen Sümpfe von Sumatra nennen. Aber um ehrlich zu sein, gibt es in dieser Kategorie einige starke Anwärter.
Das australische Northern Territory ist beispielsweise ein brutales Sumpfgebiet und die Moskitos, die dort ihr Unwesen treiben, können die Besten von uns um den Verstand bringen. Ich erinnere mich, dass wir einmal im Outback gedreht haben und ich einen brutalen Tag zu Fuß durch tiefen Schlamm und dorniges Gestrüpp hinter mir hatte. Da es bald dämmern würde, war es an der Zeit, das Lager aufzuschlagen.
Nach zwölf Stunden Arbeit bei 100 Prozent Luftfeuchtigkeit und irrsinnig hohen Temperaturen waren wir alle erschöpft. Die Moskitos wurden immer mehr zum Problem, aber unser örtliches Unterstützungsteam und unsere Aborigine-Führer beschwerten sich nicht, also machten wir weiter. Bei Sonnenuntergang waren diese Leute jedoch alle weg, da sie zu einer Straße gewandert waren, um die Fahrzeuge zu holen, die den Rest der Mannschaft zu unserer Produktionsbasis in eine Stadt, die eine Stunde entfernt war, zurückbringen sollten. Damit waren Dave und ich mit einem Haufen Notfallausrüstung über Nacht ganz allein – mal wieder.
Wir schlugen unser Lager auf und zogen uns bis auf die Unterhosen aus, um uns im schmutzigen Bachwasser zu waschen, abzukühlen und sauber zu werden. Plötzlich, innerhalb weniger Minuten, war es, als hätte sich jede Mücke, die uns um den Kopf schwirrte, verhundertfacht. In einem Moment plauderten wir noch, während wir unsere Ausrüstung sortierten, im nächsten war der Lärm der summenden Moskitos so laut, dass wir schreien mussten, um uns gegenseitig hören zu können. Die Luft um uns herum war buchstäblich voll mit Wolken von ihnen. Es war ein wahnsinniger Anblick.
Wenn Sie sich jemals zu klein fühlen, um etwas in Ihrem Leben zu verändern, kommen Sie nach Australien und erleben Sie das Northern Territory in der Abenddämmerung. Man ist nie zu klein, um etwas zu bewirken. Diese Viecher können die stärksten Männer und Frauen systematisch zu stammelnden Wracks machen – und zwar schnell. Wenn es um Moskitos geht, sollte man ihre Macht, einem den Tag zu vermiesen, wirklich nicht unterschätzen.
Am Morgen sahen unsere Körper aus, als hätten wir uns über Reißzwecken gerollt. Wir waren überall angeschwollen, bluteten und kratzten uns – und das, obwohl wir ein Zelt hatten, in das wir kriechen konnten.
Es war ein weiterer Moment, in dem mir bewusst wurde, dass ich als Überlebenskünstler immer eher ein „Reisender auf der Durchreise“ war als eine Art „Eroberer“ der Wildnis. Wenn man die Technik, die Ausrüstung und die Ressourcen weglässt, sitzen wir ziemlich schnell in einem ähnlichen Boot wie unsere Vorfahren vor Tausenden von Jahren. Ja, wir könnten etwas Mist auf das Feuer legen und uns ausräuchern lassen, um einige der Mücken in Schach zu halten. Ja, wir könnten unsere Haut mit Schlamm einreiben, um zu versuchen, die Biester vom Beißen abzuhalten. Aber letztlich sind wir in der Wildnis nie die Stärksten, Zähesten oder Widerstandsfähigsten. Dieser Preis geht an die Tiere. Abgehärtet, geschliffen und verfeinert in ihrer Fähigkeit, auszuhalten, sich anzupassen und zu überleben. Tiere befinden sich in einem ständigen Kampf um ihr Überleben. Deshalb sind sie auch verdammt gut darin.
Ich andererseits? Ich bin nichts als ein Anfänger.
Diese Reise durch das moskitobesetzte Northern Territory werde ich aus mehreren Gründen nie vergessen. Nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass ich zum ersten Mal meinen eigenen Urin trinken musste. Ein entwürdigender Meilenstein in meinem Leben, aber dennoch ein unvergesslicher Moment. Über das Urintrinken haben wir bereits gesprochen, aber ein weiterer Grund, warum diese Episode hervorsticht, ist, dass ich zum ersten Mal den Kopf einer lebenden Schlange im Mund hatte.
Im Allgemeinen scheinen die Menschen Schlangen nicht besonders zu mögen. (Ich vermute, dass dies auf die Geschichte von Eva zurückgeht, die von der Schlange im Garten Eden verführt wurde, was dazu führte, dass der Mensch und die Schlange nie wirklich die besten Freunde wurden.) An vielen Orten, an denen ich mich aufhalte, sind Schlangen immer noch für viele Todesfälle verantwortlich. Unser ehemaliger Produzent von „Ausgesetzt in der Wildnis“, Steve Rankin, wurde im Dschungel von Costa Rica von einer Terciopelo-Lanzenotter gebissen und hätte dabei fast seinen Fuß und sein Leben verloren, obwohl er innerhalb einer Stunde in einem Krankenhaus war und man ein Gegengift zur Hand hatte. Manche Schlangen können wirklich tödlich sein. Ein Indischer Krait zum Beispiel oder der Australische Taipan können genug Gift injizieren, um über 50 erwachsene Männer zu töten. (Obwohl, wie Piers Morgan mir einmal vorhielt: Sie beißen also nur Männer?)
Die überwiegende Mehrheit der Schlangenbisse ist aus Sicht der Schlangen ein Akt der Selbstverteidigung und sie sind ganz sicher nicht die Bösewichte, für die sie von einem Großteil der Bevölkerung gehalten