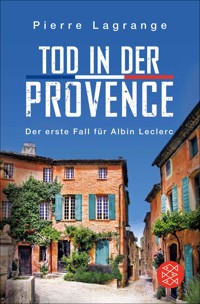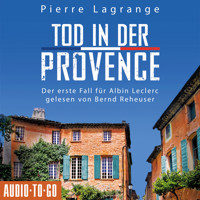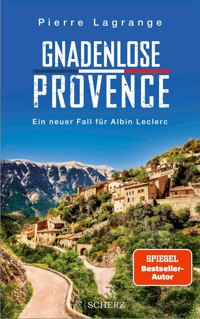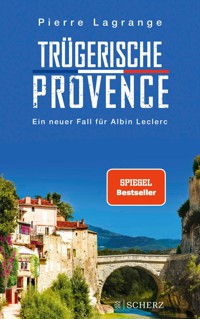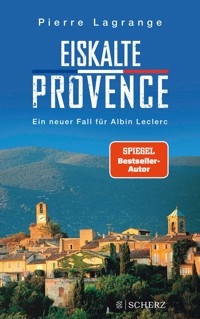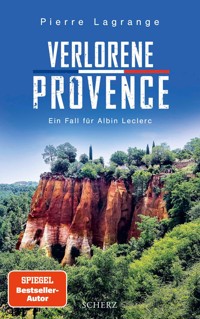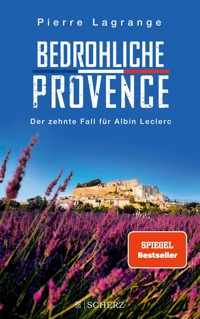
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Commissaire Leclerc
- Sprache: Deutsch
Dunkle Wolken drohen am blauen Himmel der Provence – der zehnte Band der Provence-Krimi-Reihe von Bestseller-Autor Pierre Lagrange Ex-Commissaire Albin Leclerc ist Vater geworden – sein Mops Tyson hat Nachwuchs bekommen. In all dem Alltagswahn kommt es ihm gerade recht, dass ihn sein alter Bekannter Arnault Langlois anruft und um Hilfe bittet: Seine Nichte Sandrine und ihr Lebensgefährte sind verschwunden. Albin verspricht zu helfen, doch es ist zu spät – das Pärchen wird erschossen aufgefunden. Vermutlich planten die beiden die Entführung der Ehefrau eines reichen Rotlichtbosses. Wurden sie deswegen getötet? Aber es bleibt nicht bei diesem einen Mord. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren. Und Albin trifft schließlich auf eine Person, die zu allem bereit ist ... Ex-Commissaire Albin Leclerc ermittelt in der Provence: Band 1: Tod in der Provence Band 2: Blutrote Provence Band 3: Mörderische Provence Band 4: Schatten der Provence Band 5: Düstere Provence Band 6: Eiskalte Provence Band 7: Trügerische Provence Band 8: Gnadenlose Provence Band 9: Unheilvolle Provence Band 10: Bedrohliche Povence
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Pierre Lagrange
Bedrohliche Provence
Über dieses Buch
Ex-Commissaire Albin Leclerc sieht sich Vaterfreuden entgegen – sein Mops Tyson erwartet Nachwuchs. Da bittet ihn sein alter Bekannter Arnault Langlois um Hilfe: Seine Nichte und ihr Lebensgefährte sind verschwunden. Albin verspricht zu helfen, doch kurz darauf wird das Pärchen ermordet aufgefunden und wenig später ein weiteres. Die Capitaines Caterine Castel und Alain Theroux ermitteln auf Hochtouren. Dem Anschein nach planten die verschuldeten Ermordeten die Entführung der Frau eines reichen Rotlichtbosses. Wurden sie deswegen getötet? Die Spur führt Albin zu einem Sondereinsatz der französischen Armee in Afrika, zu Blutdiamanten und zu einem Mann, der sich durch nichts aufhalten lässt – erst recht nicht von Albin Leclerc.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Pierre Lagrange ist das Pseudonym eines bekannten deutschen Autors, der bereits zahlreiche Krimis und Thriller veröffentlicht hat. In der Gegend von Avignon führte seine Mutter ein kleines Hotel auf einem alten Landgut, das berühmt für seine provenzalische Küche war. Vor dieser malerischen Kulisse lässt der Autor seinen liebenswerten Commissaire Albin Leclerc gemeinsam mit seinem Mops Tyson ermitteln.
Inhalt
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
Prolog
Jede Sekunde, dachte Guy Dumas, brachte ihn dem Tode näher. Sterben, Leben – beides verlief gleichzeitig, ohne dass man etwas daran ändern konnte. Schon beim ersten Atemzug nach der Geburt drückte das Schicksal auf die Stoppuhr. Bei einigen Menschen erfolgte der zweite Klick früher, bei manchen später. Niemand wusste, wann er an der Reihe war und wie und wo er sterben würde. Zumindest nicht in der Regel.
Die Momente, in denen einem die Parallelität des Lebens und Sterbens bewusst wurde, waren sehr rar. Aber wenn sie kamen und einem die Endlichkeit vor Augen geführt wurde, dann traf es einen meist unvorbereitet. Die Erkenntnis kroch wie Gift durch die Poren. Sie griff mit ihren Spinnenfingern um das Herz und presste es langsam zusammen. Sie schob sich wie eine schwarze Wolke vor die Sonne, legte sich wie eine dunkle, nasse Decke auf die Seele.
So wie in dieser schwülen Nacht, in der Dumas ein weiteres Mal kein Auge zutun konnte. Schwer zu sagen, wie spät es war. Vielleicht drei oder vier Uhr in der Frühe.
Er lehnte schweißnass an der Mauer aus Lehm, um die herum der Käfig gebaut worden war, starrte in den Himmel voller Sterne, die er in den fast sechzig Jahren seines Lebens oft angeschaut hatte. Die anderen drei Geiseln lagen auf den Matratzen und schliefen tief und fest. Ein sanfter Wind raschelte in den Palmen, wehte Staub über die rote Erde und brachte den Geruch von Feuer und den würzigen Kräutern Afrikas durch den eng geflochtenen Maschendraht.
Links und rechts war das Rebellenlager mit improvisierten Wällen aus Wellblech, Schrott und darüber gespanntem Stacheldraht befestigt. An den Ecken gab es jeweils einen Wachturm mit Leitern und Holzpaletten, die als Podeste fungierten. Im Inneren des Forts standen Jeeps mit aufgebockten Maschinengewehren sowie ein olivgrüner Militär-Lkw von Renault, mit dem kürzlich Kisten französischer Famas-Sturmgewehre und Raketenwerfer geliefert worden waren, wie Guy Dumas in seinem Dauerzustand zwischen Lethargie und Agonie verfolgt hatte.
An einem der Jeeps lehnte ein Soldat der sogenannten Befreiungsarmee von Côte d’Ivoire unter Führung von Moussa Kanga, der sich Lord Kanga nennen ließ und über seiner Uniform meistens so viele Goldketten trug wie ein amerikanischer Rapper. In Kangas tiefschwarze Haut waren an den Wangen Muster geritzt worden, als er ein Junge gewesen war – Stammeszeichen, die sich zu dekorativen Narben entwickelt hatten.
Der Soldat steckte sich eine Zigarette an, die orangefarben aufglomm. Er trug ein Gewehr an einem Trageriemen und hatte offensichtlich die Nachtschicht im Camp aufgebrummt bekommen.
In den vergangenen Tagen hatte Dumas rund zwanzig Soldaten gezählt. Das Lager war klein und diente vermutlich vor allem zur Aufbewahrung der Geiseln – aktuell außer Dumas ein Ingenieur sowie zwei Banker, allesamt Franzosen. In den ersten Tagen hatten sie permanent davon gesprochen, dass sicherlich bald Lösegeld gezahlt werden würde und der Spuk vorbei wäre. Wenn ihr wüsstet, hatte Dumas gedacht. Je mehr Zeit verging, ohne dass etwas geschah, desto weniger war das Lösegeld Thema gewesen, sondern die Frage, wann es Wasser geben würde, denn die Sonne glühte brutal.
Aber, das musste man sagen: Es ging ihnen nicht schlecht. Die Soldaten der Befreiungsarmee kümmerten sich um sie. Es gab ausreichend Wasser und Nahrung, zwischendurch Traubenzucker, und den Ingenieur hatten sie mit Antibiotika vollgestopft, weil sich eine Kopfwunde entzündet hatte, die bei der Entführung entstanden war. Es könnte weitaus schlechter laufen, wusste Dumas. Bedeutend schlechter.
Dumas atmete tief ein und wieder aus. Er steckte den Zeigefinger unter den Metallreifen am Fußgelenk und kratzte sich die Haut. Wie die Tiere waren sie an diese Fußfesseln und mit Ketten an in der Wand eingelassenen Eisenringen festgemacht. Als ob einer von ihnen in der Lage wäre, das stabile Gitter aufzubrechen und fortzulaufen – vor allem: Wohin denn? Sie steckten mitten im Dschungel, wahrscheinlich im Grenzgebiet zu Mali, und sie hatten allesamt nicht den geringsten Schimmer, wie man sich da draußen durchschlagen sollte. Weglaufen wäre Selbstmord. Die einzige Überlebenschance, das hatte Dumas den anderen immer wieder eingebläut, war: Ruhe bewahren und abwarten, denn früher oder später würde mit Sicherheit irgendetwas geschehen.
Und als Dumas genauer in den nächtlichen Himmel sah, die Augen zusammenkniff und ein leises Grollen hörte wie das von einem knurrenden Tiger, dachte er: Seht ihr, ich habe recht gehabt. Er kannte den Klang. Die Rotoren eines schallgedämpften Hubschraubermotors, wie sie von Spezialkräften eingesetzt wurden.
Der Soldat kannte den Klang ebenfalls. Er schnippte die Zigarette fort, stieß sich von dem Auto ab und entsicherte das Famas. Er rief etwas, starrte nach oben. Im nächsten Moment tauchten zwei weitere Soldaten auf, die ebenfalls in den Himmel sahen und gestikulierten.
Eine Sekunde später gab es eine Explosion. Sie schleuderte das Wellblechtor, mit dem das Camp verschlossen war, aus den Angeln. Gleichzeitig seilten sich in Schwarz gekleidete Schatten von Stricken ab. Wie Spinnen. Sie waren wie aus dem Nichts über dem Camp erschienen und schossen aus der Luft auf die Soldaten, die wie aufgeschreckte Ameisen am Boden herumliefen.
Weitere Kämpfer tauchten aus dem Rauch der Explosion am Tor auf, drangen in das Camp ein, bewegten sich in Richtung der Zelte, warfen etwas herein – und kurz darauf gab es weitere ohrenbetäubende Explosionen.
Die drei anderen Geiseln waren längst erwacht und starrten mit Dumas in Richtung des Feuergefechtes, hielten sich die Hände schützend über die Köpfe.
Ebenso schnell, wie das Schießen begonnen hatte, endete es wieder und ging in Rufen und Schreien unter. Menschen lagen auf dem Boden, tot, verletzt, oder sie wurden gefesselt. Ein massiger Mann in Unterhosen wurde aus einem Zelt gezerrt und außer Sichtweite geschleppt. Er schimpfte laut in einer fremden Sprache. Das war Moussa Kanga, der offenbar festgenommen wurde.
Dann erschienen drei in Schwarz gekleidete Soldaten ohne Abzeichen auf den Uniformen vor dem Gitter von Dumas. Sie trugen Nachtsichtgeräte. Einer knackte mit einer Drahtschere das Schloss auf. Das Licht einer Taschenlampe blendete Dumas. Es leuchtete abwechselnd in die Gesichter der Gefangenen. Einer der Soldaten hatte ein Tablet dabei, verglich offensichtlich die Personen und fragte in tadellosem Französisch nach ihren Namen. Der mit der Drahtschere kappte die Ketten der anderen drei Geiseln. Sie wurden von behandschuhten Händen aus dem Käfig gezerrt, wimmerten dabei dankbar. Alles ging sehr schnell.
»Guy Dumas?«, fragte eine Stimme.
»Ja.«
Dumas kniff gegen das grelle Licht die Augen zu und machte sich bereit, dass seine Kette durchtrennt und er ebenfalls aus dem Käfig geholt werden würde.
Aber nichts dergleichen geschah.
Stattdessen nahm einer der Spezialkräfte seine Pistole und richtete sie auf Dumas’ Kopf.
Dumas’ Herz sackte ihm in die Hose. Er konnte nicht denken. Er verstand nicht, er begriff nicht, er …
Er hyperventilierte.
Ein anderer Soldat legte seine Hand auf den Arm des Kameraden und schüttelte mit dem Kopf.
»Aber wir haben den Befehl …«, sagte der mit der Pistole.
»Ich weiß«, erwiderte der andere. »Aber nicht unter meinem Kommando. Wir sind keine Auftragskiller. Ein Querschläger hat Guy Dumas getroffen und tödlich verletzt. Alles klar?«
»Zu Befehl«, erwiderte der mit der Waffe, steckte die Pistole wieder ein und war im nächsten Moment verschwunden.
»Viel Glück, Guy Dumas«, sagte der andere Soldat, holte mit dem Gewehrkolben aus und rammte ihn ihm gegen die Stirn.
Es fühlte sich an, als würde sein Gehirn in gleißenden Farben explodieren. Dumas kippte zurück, schnappte nach Luft. Sein Herz schien auszusetzen. Er blinzelte, sah erneut ein gleißendes Licht, wie vom Blitz einer Kamera, mit der ein Bild von ihm geschossen wurde.
Dann sah er gar nichts mehr.
Nur Schwärze.
Er tauchte wenig später wieder aus der Dunkelheit auf, rappelte sich auf und schrie: »He!«
Aber die Einsatzkräfte waren verschwunden. Er hörte das Jammern von Verwundeten, das Schimpfen von Gefesselten, die am Boden lagen. Sein Gesicht fühlte sich warm und nass an. In seinem Schädel dröhnte es.
»He!«, rief er erneut.
Dumas zitterte am ganzen Körper. Er trat mit den Füßen gegen das Gitter.
»He! Ihr könnt mich nicht … Nehmt mich mit!«
Doch nichts geschah.
»Hilfe! Holt mich hier raus! Kommt zurück!«
Erneut trat er gegen das Gitter. Dieses Mal mit beiden Füßen.
Alles rotierte. Sein Herz hämmerte in der Brust. Das Blut pumpte aus der klaffenden Kopfwunde.
Er sprang auf, warf sich mit Wucht gegen den Zaun. Die Kette an seinem Fußgelenk straffte sich.
Er stürzte.
»Hilfe«, flüsterte er. »Lasst mich nicht hier …« Sein Atem strich über den roten Staub. »Lasst mich nicht hier!«, brüllte Dumas aus voller Lunge. Speichel stob von seinen Lippen. »Kommt zurück! Kommt zurück!«
Da tauchte einer der afrikanischen Soldaten vor ihm auf. Seine Augen glühten wie Lava. Die Haut war nass vom Schweiß. Er atmete schwer und schnell, blutete aus einer Wunde an der Augenbraue.
»Du«, keuchte der Soldat. »Du! Bastard! Mach deine Rechnung mit deinem Gott!«
Er nahm sein Schnellfeuergewehr in Anschlag.
Dumas hielt die Hände schützend vor das Gesicht. »Nein«, wimmerte er. »Bitte …«
»Fahr zur Hölle!«
»Nein! Ich kann … Ich gebe dir alles, was ich habe! Ich habe …«
Der Soldat zielte auf Dumas’ Kopf.
»Nein!«, rief Dumas.
Sein gellender Schrei verlor sich in der Nacht.
1
Die Zukunft lag wie glitzernde Diamanten vor Sandrine und Thierry. Aber wie das mit Edelsteinen immer so ist: Nicht jeder ist echt.
Sie betrachteten das kleine Haus zwischen Carpentras und Mazan von oben bis unten, strahlten mit der untergehenden Sonne um die Wette und waren zufrieden mit sich.
Das Haus hatte schon deutlich bessere Tage gesehen. Der Putz bröckelte von der Fassade und gab den groben Bruchstein darunter frei. Die Fenster waren in einem schlechten Zustand, die Türen ebenfalls, von dem kleinen Garten gar nicht erst zu reden. Über dem Eingang hing das verblichene Schild mit der Aufschrift »La Vigne«. Die Buchstaben waren nur noch zu erahnen. Überall blätterte die Farbe ab. Es wäre eine Menge Arbeit, alles wiederherzurichten, und es würde viel Geld kosten, gar keine Frage. Aber die Sterne standen günstig, und insofern war es ein gutes Zeichen, dass die ersten bereits im lavendelfarbenen Himmel über dem baufälligen Dach des früheren Restaurants aufgegangen waren.
Thierry hatte die linke Hand in die Hosentasche seiner Jeans gestopft und die rechte auf Sandrines Schulter gelegt. Die Haare fielen ihm locker ins Gesicht. Das selbstzufriedene Lächeln wirkte darin wie eingemeißelt. Sandrines Haut fühlte sich warm an. Sie trug ein geblümtes Sommerkleid, Sneakers, die blonden Haare hatte sie im Nacken zusammengebunden.
»Was meinst du«, fragte sie, »sollten wir den Namen nicht einfach beibehalten? Ich finde, er klingt gut und passt gut. Vielleicht erinnern sich noch einige Menschen daran. Das wäre nicht schlecht.«
»La Vigne«, sagte Thierry und schmeckte den Namen auf der Zunge ab wie einen Schluck edlen Rotwein. Er nickte. »Glaube schon. Das wäre gut. Also: La Vigne.« Er beugte sich zu Sandrine, um ihren Kirschmund zu küssen. Sie roch nach Sommer und war wie Thierry immer noch braungebrannt, obwohl sie schon seit zwei Wochen zurück im Land waren und längst wieder arbeiteten. Beide waren im Krankenhaus beschäftigt, dem Centre Hospitalier d’Avignon, Thierry in der Apotheke und Sandrine auf der Kinderstation als Krankenschwester.
Aber diese Jobs waren endlich. Das »La Vigne« war die Zukunft, dachte Thierry. Sie lag hier, direkt vor seinen Füßen.
Sandrine und er träumten schon lange davon, eine eigene Weinbar zu eröffnen, in der es auch kleine Snacks geben sollte. Im Vorbeifahren war ihnen eines Tages das alte Haus aufgefallen, und wie es der Zufall wollte, war es früher als Restaurant genutzt worden, stand aber seit fast zwanzig Jahren leer. Dem Vernehmen nach war der Besitzer gestorben, und die Erben hatten keinerlei Interesse daran, es weiterzuführen, nicht einmal daran, sich um eine Neuverpachtung zu kümmern. Stattdessen hatte es Streit gegeben – und deswegen stand das Haus immer noch leer. Da mittlerweile ein weiterer Erbe verstorben war, hatten sich die Verhältnisse geändert, und das Gebäude sollte verkauft werden – zwar zu einem Spottpreis, aber immer noch eine Menge Geld für Sandrine und Thierry. Außerdem müssten einige Euros in die Hand genommen werden, um alles wieder auf Vordermann zu bringen. Große finanzielle Mittel hatten Sandrine und Thierry niemals zur Verfügung gestanden, obwohl sie im Krankenhaus nicht schlecht verdienten. Sie würden einen hohen Kredit aufnehmen müssen.
Doch die Zeiten hatten sich gewandelt. Bald schon, sehr bald, würde das anders aussehen. Sie hatten mittlerweile lang genug abgewartet, alle wichtigen Kontakte geknüpft und aktiviert. Nun waren der Zahltag und ein neues Leben ohne Sorgen und mit vielen Möglichkeiten nicht mehr weit entfernt.
»La Vigne«, seufzte Sandrine versonnen und lächelte. »Das wird schön, oder?«
Thierry nickte. »Die Lage ist perfekt. Die Terrasse ebenfalls. Alles ist perfekt.«
»Wir sind perfekt.« Sandrine lächelte, stellte sich auf die Zehenspitzen und küsste Thierry, der es sich gern gefallen ließ.
In Kürze, nachdem ein paar wichtige Dinge erledigt waren, würden sie einen Termin beim Notar vereinbaren und das Haus kaufen. Dann stand ihnen die Zukunft offen. Sie würden ihre Jobs an den Nagel hängen. Alles wäre geritzt, und Thierry hatte Sandrine versprochen, dass sich auch der Rest bessern würde, ganz bestimmt. Er hatte ihr erklärt, dass seine Probleme nur auf die Unzufriedenheit mit seinem Job zurückzuführen wären – wenn er endlich eine erfüllende Aufgabe hatte und er sein Leben in der eigenen Hand hielt, dann wäre das alles vorbei. Er bräuchte keinen Kick mehr, kein Risiko, nichts dergleichen. Sandrine glaubte ihm. Natürlich tat sie das.
So oder so hatten die letzten Wochen sie beide sehr viel enger zusammengeschweißt. Sie waren eine Einheit, untrennbar miteinander verbunden. Deswegen hatten sie auch schon über das Heiraten nachgedacht – aber eines nach dem anderen. Erst mal die wichtigen Dinge regeln und die Voraussetzungen schaffen, dann das Haus kaufen, den Job quittieren, den Umbau in die Wege leiten.
Schritt für Schritt.
Thierry lächelte und küsste Sandrine zurück. »Das sind wir«, sagte er.
»Komm, fahren wir in die Stadt und essen etwas«, erwiderte sie.
Thierry hatte keine Einwände, ganz im Gegenteil. Also gingen sie zurück zu ihrem weißen Citroën, der auf der Schotterfläche vor dem Eingang zur Terrasse parkte. Die Sonne war inzwischen untergegangen, was den Himmel für einen Moment lang in Farben explodieren ließ. Thierry setzte zurück, scherte auf die Route Nationale ein und bog nach links in Richtung Mazan ab. Sie fuhren eine Weile auf der schmalen D942, bis Thierry ein einzelnes Licht im Rückspiegel auffiel, das sich rasch näherte. Es blendete auf, dann zuckten zwei Blaulichter los.
»Mist«, murmelte er. »Ein Motorradpolizist.«
»Sollst du anhalten?«, fragte Sandrine und sah sich nach hinten um.
»Scheint so. Aber ich bin nicht zu schnell gefahren. Keine Ahnung, was der will«, erwiderte Thierry, blinkte und verlangsamte das Tempo, was das Motorrad im Rückspiegel ebenfalls tat.
Schließlich fuhr Thierry rechts ran. Der Polizist schloss auf und stoppte unmittelbar neben ihm. Thierry ließ das Fenster herab.
»Was ist denn?«, fragte er.
Der Polizist deutete nach vorn. »Bitte fahren Sie rechts in den Feldweg. Hier blockieren Sie die Straße.« Durch den Helm und das herabgelassene Visier klang seine Stimme dumpf.
»Aber warum? Ich war doch nicht …«
»Allgemeine Verkehrskontrolle. Außerdem ist Ihr Rücklicht defekt. Bitte fahren Sie dort vorn in den Feldweg und halten Ihre Papiere bereit.«
»Das Rücklicht?«
»Monsieur, bitte fahren Sie in den Feldweg.«
Sandrine hatte bereits die Klappe vom Handschuhfach geöffnet und suchte nach den Fahrzeugpapieren. Thierry trat die Kupplung und setzte einige Meter voran, bog dann in einen schmalen, geschotterten Wirtschaftsweg, der links von einem Wäldchen, rechts von einem Weinfeld begrenzt wurde. Ihm war nicht bewusst, dass das Rücklicht defekt war. Ehrlich gesagt wirkte es auch gar nicht so, wenn er in den Rückspiegel sah. Vielmehr schienen die Rückleuchten gegen die Frontverkleidung des Polizeimotorrads, das ihnen folgte und hinter dem Wagen stoppte, um ihn zu blockieren, rot zu reflektieren.
»So ein Mist«, murmelte Thierry erneut. »Das fehlt mir gerade noch.« Er schnallte sich ab und hob den Hintern an, um seine Geldbörse aus der Gesäßtasche zu ziehen, in der der Führerschein steckte.
»Hoffentlich«, flüsterte Sandrine, »wird das nicht teuer. Noch haben wir das Geld nicht, und …«
»Die Papiere, bitte«, sagte der uniformierte Polizist.
Er stand nun direkt neben dem Fenster und trug nach wie vor seinen Helm.
Thierry ließ sich den Fahrzeugschein von Sandrine geben und packte seinen Führerschein obenauf. Der Polizist nahm beides entgegen, warf einen kurzen Blick drauf und schien sich ansonsten nicht sonderlich dafür zu interessieren. Er hantierte dann an seinem Einsatzgürtel. Im nächsten Moment blickte Thierry in den Lauf einer Waffe.
Ihm wurde schlagartig übel.
»Ich glaube«, sagte der Polizist, »wir haben etwas miteinander zu klären.«
2
Albin trank einen weiteren Schluck Pastis. Er blickte nach oben, sah durch das Dach der Platanen in den immer noch sattblauen Himmel an diesem frühen Abend. Der Geschmack von Anis breitete sich in seinem Mund aus. Er ließ ihn etwas nachwirken. Dann stellte er das leere Glas auf dem Metalltisch ab, klemmte sich die Gitanes in den Mundwinkel und klickte die beiden Metallkugeln aneinander. Er ging zur Boulebahn, stellte sich hinter den Strich im sandigen Boden und nahm Maß. Verdammt, nicht einfach, dachte er. Die kleine Holzkugel, das Schweinchen, war umringt von anderen Kugeln – wie eine klitzekleine Sonne von übergroßen Planeten aus Edelstahl.
Und wie es aussah, würde das Team der Freiwilligen Feuerwehr aus Mazan heute den Sieg nach Punkten davontragen. Daran konnte auch Albin nicht mehr viel ändern, höchstens das Schlimmste verhindern und dafür sorgen, dass die zusammengewürfelte Truppe aus Carpentras rund um Jérôme Lehmann nicht vollends das Gesicht verlor. Lehmann stand am Rande, hatte die Hände tief in den Hosentaschen vergraben und wirkte bockig. Unter dem T-Shirt mit dem Aufdruck seiner Hausverwaltungsfirma »Lehmann – Gérance d’Immeubles« spannten sich die Muskeln. Es war vom Schweiß dunkel verfärbt. Sein neben ihm stehender Schwager Robert Robaix, dem die Entrümpelungsfirma Robaix Brocante gehörte, sah ebenfalls nicht glücklich aus. Die übrigen Teammitglieder standen hinter Albin und ließen sich von Matteo, dem Wirt des Café du Midi, neues Wasser und Pastis bringen. Die kleine Boulebahn grenzte unmittelbar an sein Geschäft, einer Mischung aus Bistro, Bar Tabac und Café, was den Laden an frühen Abenden wie diesem zu einer echten Goldgrube machte.
Auf der anderen Seite der Spielbahn tuschelten die Burschen aus Mazan miteinander. Sie gruppierten sich um Bastian Crouchaut, dessen Glatze wie frisch poliert glänzte. Er war siegesgewiss, gab sich lässig und würdigte Albin und die anderen keines Blickes.
Albin wusste, wie sehr das Lehmann auf die Nerven ging. Die beiden Teams verband eine Art Hassliebe miteinander.
Als Albin vor einiger Zeit zum ersten Mal nach vielen Jahren wieder zu den Boulekugeln gegriffen hatte, hatte er mit einem glänzenden Schuss Mazan regelrecht vernichtet. Bei einem Gegenbesuch in Mazan anlässlich der Dorf-Fête hatten sie die Freiwillige Feuerwehr sogar auf heimischem Boden geschlagen. Albin war nicht dabei gewesen, wenngleich Lehmann mit Engelszungen auf ihn eingeredet hatte. Sie hatten es auch ohne Albin geschafft, und: Nein, Albin wollte lieber nur gelegentlich boulen, und zwar dann, wenn er Lust dazu verspürte. Außerdem widerstrebte ihm der Gedanke daran, festes Mitglied in einer Gruppe zu sein. Das brachte nur Verbindlichkeiten mit sich, und Albin war zeit seines Lebens kein Teamplayer gewesen. Am besten war er, wenn er allein agierte. Und das würde sich nicht mehr ändern. Allerdings gab es Ausnahmen von der Regel. Zum Beispiel heute, denn Lehmann hatte Albin mit einem unwiderstehlichen Angebot von Installateurs- und Malerarbeiten der beiden Teammitglieder Moulin und Duvant zum Vorzugspreis auf Lebenszeit herumgekriegt und an seine Ehre als Bürger von Carpentras appelliert.
Denn es war so: In der letzten Zeit hatte sich im Team aus Mazan etwas getan. Einerseits spielten sie inzwischen allesamt mit denselben mattschwarzen Kugeln aus einer Karbonstahllegierung, die sündhaft teuer und mit einer speziellen Dämpfung versehen waren, und trugen T-Shirts der Firma »Obut«. Das hinterließ den Eindruck, als würden sie von dem Hersteller gesponsert, obwohl dem nicht so war. Außerdem liehen sie sich regelmäßig zwei junge Spieler von der Feuerwehr aus Le Thor aus und gaben vor, dass es sich um Ersatzspieler handele, weil jemand krank geworden sei. Die beiden Burschen waren sensationell gut und das mit den Krankheiten nur Ausreden. Alles andere – die Hightechkugeln, die T-Shirts – war lediglich psychologische Kriegsführung von Crouchaut, die Lehmann stets als lächerlich bezeichnete. Dennoch wirkte das neue System: Mazan hatte Carpentras einige Male regelrecht von der Bahn gefegt.
Lehmann musste kontern. Ihm blieb nichts anderes übrig, als selbst zu Einschüchterungstaktiken und psychologischer Kriegsführung zu greifen – und zwar mit seiner Geheimwaffe Albin Leclerc. Er ließ ihn gegen Mazan als letzten Spieler antreten, um damit die Erinnerung an die Deklassierung von damals zu wecken, als Albin Mazan mit einem einzigen brillanten Wurf pulverisiert hatte. Außerdem überragte Albin die meisten anderen Spieler an Körpergröße und war mit seinem inzwischen fast weißen Haar nicht nur optisch eine einschüchternde Erscheinung. Er war halt, wie Lehmann immer wieder sagte und Albin dabei die Schultern massierte, eben Albin Leclerc, den ja jeder kenne, das dürfe man nicht vergessen: der Ex-Commissaire, der die Bürger von Carpentras beschützte und den Bösen gab, was sie verdienten – und das gelte hier und heute insbesondere für die Bösewichte mit den schwarzen Angeberkugeln. Mit Albin Leclerc lege sich besser niemand an, das wisse ja jeder, und die aus Mazan würden zu Salzsäulen erstarren, sobald Albin das Spielfeld betrete, keine Frage, sie würden nur noch mit zitternden Fingern werfen können, und ihre Kugeln würden allein aus Respekt gegenüber Albin ihr Ziel verfehlen.
Na ja, dachte Albin, das hatte alles nicht viel geholfen. Sie lagen dennoch hinten und hatten keine Chance auf den Sieg. Er kniff das linke Auge gegen den Zigarettenrauch zu und visierte mit dem rechten. Er hatte verschiedene Möglichkeiten. Er könnte versuchen, die Kugeln des eigenen Teams näher ans Ziel zu treiben. Die Alternative war, seinen Wurf optimal zu platzieren und damit eine Kugel der gegnerischen Mannschaft wegzukicken, um dadurch dem eigenen Team einen Vorteil zu verschaffen. Dazu würde man als Ziel diejenige Gegnerkugel wählen, die der Konkurrenz die meisten Punkte versprach. Allerdings war es gleichgültig, was Albin tun würde, denn wie auch immer er sich entscheiden würde: Mazan hatte gewonnen. Also, dachte Albin, würde er einfach das tun, was er in seinem allerersten Spiel gegen Mazan auch schon getan hatte und was zumindest ein kleiner Stich ins schwarze Herz der Freiwilligen Feuerwehr darstellte.
Er griff die Kugel etwas fester, holte dann mit einer eleganten Bewegung aus, ging in die Knie, bewegte den Arm mit Schwung voran und streckte sich dabei. Er spürte, wie die Kugel mit leichtem Drall die Fingerspitzen verließ und blickte ihr hinterher. Das taten auch die Spieler aus Mazan sowie die von Albins eigenem Team – und in dem Moment mussten sie ahnen, was Albins Plan war und dass es ihm nicht um einen Punktevorteil ging. Sie mussten es vollends begreifen, als die Kugel mit einem dumpfen Knirschen aufschlug und nur einen Sekundenbruchteil später gegen die von Bastian Crouchaut höchstpersönlich kickte, die wie der dunkle Todesstern von Darth Vader eher im mittleren Bereich des Schweinchens lag. Albins Kugel tauschte den Platz mit ihr, während die angeschossene mit Schwung von der Spielfläche rollte und unter einem der Bistrotische liegen blieb. Was die Punkte anging: ein dummer Wurf. Es ging einzig um die Symbolwirkung.
Niemand sagte etwas. Aber Albin war zufrieden mit seinem Wurf, lächelte und zwinkerte Crouchaut zu, der fassungslos zwischen seiner Kugel und Albin hin und her blickte. Albin zwinkerte auch Lehmann und Robaix zu, die seine Intention begriffen und wie er ein Lächeln auf den Lippen hatten. Sie hatten es kapiert: Wenn du nicht gewinnen kannst, dann gehe wenigstens mit Stolz vom Platz und versetze dem Gegner einen Tritt in den Hintern.
»Was sollte denn das?«, hörte Albin Crouchaut schimpfen. Er ging zu Matteo, der Albin anerkennend gegen den Oberarm klopfte, weil er mit seinen kurzen Armen die Schulter unmöglich erreichen konnte.
»Was soll denn das heißen?«, motzte Crouchaut weiter. »Genauso gut kannst du mir auch vor die Füße spucken, Leclerc! Willst du mir vor die Füße spucken?«
Albin paffte und nahm sich einen weiteren Pastis. Er blickte sich kurz um und sah, dass Crouchauts Gesicht hochrot angelaufen war. Er hatte einen cholerischen Anfall und erinnerte dabei an Louis de Funés in seinen besten Zeiten. Zwei seiner Teammitglieder hielten ihn fest und redeten auf ihn ein – wie um ihn davon abzuhalten, auf Albin loszugehen.
»Meine Güte. Der hatte immer schon eine kurze Lunte«, murmelte Matteo.
»Das macht es ja so reizvoll«, erwiderte Albin. Er hob das Glas und prostete in Richtung Crouchaut.
Das brachte dann das Fass zum Überlaufen. Jetzt mussten die beiden Feuerwehrmänner Crouchaut wirklich festhalten.
»He! Leclerc! Willst du dich mit mir anlegen, oder was?«
»Du«, bellte Lehmann schließlich von der anderen Seite, »lässt meine Spieler jetzt mal in Ruhe, Crouchaut! Was willst du denn? Ihr habt gewonnen! Glückwunsch! Was soll dieser Affentanz?!«
»Affentanz?!«
»Genau!«
»Du nennst mich einen Affen?!«
»Niemand tut das! Aber nun lass meine Spieler in Frieden, Mensch!«
»Er hat mich provoziert!«
»Niemand provoziert dich!«
»Und ob! He, Leclerc! Ich rede mit dir! Du willst mir vor die Füße spucken? Dann komm doch her!«
Albin wendete sich wieder zu Matteo, trank einen Schluck Pastis und zog an der Gitanes. Er grinste immer noch. »Ich weiß«, sagte er leise zu Matteo, »ich bin ein mieser Hund.«
Albins Mops Tyson, der unter einem der Bistrotische lag und das Geschehen bislang gelangweilt verfolgt hatte, stand nun auf, streckte sich und trottete zu Albin – ohne dabei das Team aus Mazan aus den Augen zu lassen. Er hockte sich neben Albin, hob die Schnauze in Richtung von Crouchaut und wirkte dabei so arrogant und herablassend, wie ein Mops nur arrogant und herablassend wirken kann.
»Redest du mit dem Chef?«, schien er zu sagen. »Du laberst den Chef an? Kann es sein, dass du den Chef meinst? Mit wem glaubst du, kannst du in diesem Ton reden? Komm doch, ich zerfetze dir die Hose!«
Matteo stellte das Tablett mit dem Wasser und der Pastisflasche auf einem Tisch ab und streckte sich etwas, was ihn nicht wesentlich größer wirken ließ. Er trug eine seiner uralten Jeans und ein verwaschenes Poloshirt sowie ein Handtuch, dass er sich wie eine Schürze in den Hosenbund gestopft hatte. Matteo war früher Boxer gewesen, sogar kein schlechter, wie einige Zeitungsausschnitte verrieten, die gerahmt an den Wänden des Cafés hingen. Über allem schwebte ein Porträt von Marine Le Pen mit Autogramm.
Matteo knurrte: »Den werfe ich gleich raus«, und schickte sich an, zu Crouchaut zu gehen, aber Albin schüttelte mit dem Kopf.
»Du kannst ihn nicht rauswerfen, weil er schon draußen ist.«
»Trotzdem.«
Albin blickte sich um und sah, dass nun die Teams aus Mazan und Carpentras dicht zusammenstanden und allesamt aufeinander einredeten, wobei die kräftigsten Spieler jeweils damit befasst waren, Crouchaut und Lehmann davon abzuhalten, sich gegenseitig an den Kragen zu gehen.
»Weißt du«, erklärte Albin, »die beiden konnten sich noch nie ausstehen. Ich habe mit dem Krach eigentlich gar nichts zu tun. Ich bin allenfalls ein Katalysator.«
Matteo brummte, warf einen Blick auf Albin. »Na ja«, murmelte er, »du hast ihm gerade öffentlich in den Hintern getreten, was ich nicht verurteile, im Gegenteil. Du hast ihm gezeigt, dass wir könnten, wenn wir wollten. Und damit kann er halt nicht umgehen.«
»Genau darum geht es«, erwiderte Albin. »Mittelfristige Taktik. Beim nächsten Turnier werden sie so verbissen spielen, dass sie eigentlich nur verlieren können. Das verschafft uns einen Vorteil.«
Als er hochblickte, fiel ihm ein älterer Mann am Rand der Spielfläche auf, der Albin mit einem Lächeln und erhobener Hand grüßte.
»Na so was«, sagte Albin und lächelte zurück. »Wenn das mal nicht Arnault Langlois ist.«
Albin nahm sein Pastisglas, überließ die Streitenden sich selbst und bat Matteo, darauf zu achten, dass Tyson niemanden zerfleischen würde. Dann ging er rüber zu Langlois und begrüßte ihn mit einem langen, kräftigen Handschlag.
»Albin Leclerc, wie er leibt und lebt«, sagte Langlois, der etwa im selben Alter war wie Albin und ebenfalls längst in Rente, aber älter wirkte und so, als laste etwas Schweres auf seinen Schultern. Er trug ein buntes Hemd über der hellen Hose und einen Pork-Pie-Strohhut – den Typ Hut, den Gene Hackman in »French Connection« aufhatte.
Langlois und Albin kannten sich seit einer halben Ewigkeit, hatten sich aber ebenfalls seit einer gefühlten Ewigkeit aus den Augen verloren. Langlois gehörte früher das Eisenwarengeschäft Langlois, in dem Albin alles Mögliche zur Renovierung seines Hauses und zum Bau des Carports gekauft hatte. Davon abgesehen hatte er Langlois einige Male aufgesucht, wenn es um Einbrüche und dabei verwendete Werkzeuge ging sowie um fachkundigen Rat und die Frage, ob dieses oder jenes bei ihm womöglich kürzlich gekauft worden war, um es bei Straftaten zu verwenden. Langlois hatte das Geschäft schließlich an eine größere Kette verkauft, die es inzwischen geschlossen hatte. Schon damals hatte er stets einen solchen Hut und bunte Hemden unter seinen grauen Kitteln getragen.
»Wie er leibt und lebt«, bestätigte Albin. »Und dir geht es ebenfalls nicht schlecht, wie ich sehe.«
Langlois machte eine wegwerfende Geste. »Könnte besser sein. Mit der Gesundheit und insgesamt.«
»Hm«, brummte Albin, trank einen Schluck Pastis und holte mit den Lippen eine Gitanes aus der knittrigen Verpackung, die er anschließend wieder in der Jeanstasche verschwinden ließ.
»Also.« Langlois hustete, hob den Hut und fuhr sich mit der Hand über den Schädel. »Ich kannte deine Telefonnummer nicht, und im Telefonbuch habe ich dich nicht gefunden …«
»Als Polizist steht man besser nicht darin.«
Langlois nickte und setzte das Hütchen wieder auf. »Da dachte ich, ich schaue mal bei Matteo vorbei und frage ihn. Na ja, und da finde ich dich hier beim Spielen, wollte aber nicht stören. Du hast ganz schön Unruhe da drüben gestiftet.«
Albin grinste. »Keine Sorge. Die kriegen sich schon wieder ein.«
»Tja, ich wollte dich fragen, ob du mir vielleicht bei einer Sache weiterhelfen kannst. Du bist der einzige Polizist, den ich kenne. Und wie man hört und liest, bist du nicht wirklich im Ruhestand oder kennst vielleicht noch ein paar Leute …«
»Ich bin polizeilicher Berater«, erklärte Albin. »Um ehrlich zu sein: Mir wird sonst langweilig, und sie haben mir diesen Titel verliehen, damit es keinen juristischen Ärger gibt, wenn ich als Privatier in offiziellen Ermittlungen mitwirke. Manchmal kann ich den Exkollegen etwas auf die Sprünge helfen. Der alte Mann gehört noch nicht zum alten Eisen.«
Langlois rang sich ein Lächeln ab. »Ich wollte mit dir sprechen. Wegen meiner Nichte«, erwiderte Langlois. »Sie ist seit einigen Tagen verschwunden. Man kann sie telefonisch nicht erreichen. Zur Arbeit kam sie auch nicht mehr. Sie ist wie vom Erdboden verschluckt.«
»Ist sie als vermisst gemeldet worden?«
Langlois nickte. »Ja, mein Bruder hat sie als vermisst gemeldet. Wir alle machen uns große Sorgen. Ihr Lebensgefährte wird ebenfalls vermisst und ist unerreichbar.«
»Möglicherweise sind die beiden im Urlaub und haben es keinem gesagt?«
»Nein. Sie waren eben erst wieder aus dem Urlaub zurückgekehrt. Sie arbeiten beide im Krankenhaus, er in der Apotheke und sie als Krankenschwester. Sie sind beide sozial engagiert und helfen manchmal bei Ärzte ohne Grenzen. Sie waren gerade ein paar Wochen lang in Afrika an der Côte d’Ivoire. Da werden sie kaum schon wieder in den Urlaub gefahren sein und erst recht nicht, ohne es jemandem zu sagen.«
Albin nippte an seinem Pastis. »Die Kollegen werden sicherlich etwas über die beiden in Erfahrung bringen. Es kommt oft zu Vermisstenmeldungen, und dann tauchen die Personen plötzlich wieder auf, und alles klärt sich. Ein Telefon war kaputt. Man war Freunde besuchen und hat niemandem Bescheid gesagt oder war krank. Es gibt viele Ursachen. Wie lange sind die beiden vermisst?«
»Seit drei Tagen.«
»Das wird sich schon klären, Arnault.«
»Wenn ich ehrlich bin, habe ich das Gefühl, dass die Polizei nicht allzu viel tut, Albin. Deswegen dachte ich, ich frage dich mal, ob du da nicht etwas machen kannst oder vielleicht mal hören, was da los ist. Mir sagen die nämlich nichts außer: abwarten.«
Albin konnte es sich gut vorstellen. Er hatte immer wieder mit Vermisstenfällen zu tun gehabt – und meist konnte man den Angehörigen tatsächlich nicht mehr sagen. Einem Erwachsenen konnte man seinen Aufenthaltsort nicht vorschreiben, und es gab keine rechtliche Verpflichtung, diesen seinen Angehörigen oder Freunden mitzuteilen. Die Polizei konnte im Grunde erst tätig werden, sobald eine Gefahr für Leib oder Leben vorlag. Und selbst wenn es eine Gefahrenlage gab und die vermisste Person aufgetrieben wurde, musste man sie erst fragen, ob man Angehörigen und Bekannten den Aufenthaltsort mitteilen durfte. Die gute Nachricht war jedoch: Innerhalb von einer Woche erledigte sich die Hälfte der Vermisstenfälle von selbst, innerhalb eines Monats sogar zu achtzig Prozent.
Aber natürlich gab es auch andere Fälle. Albin hatte es selbst erlebt. Gerade vor einigen Tagen war ein Polizist aus Marseille als vermisst gemeldet worden, wie er in der Zeitung gelesen hatte. Der Mann war später in der Vorstadt tot aufgefunden worden – ohne Uniform und Waffe, und sein Motorrad war fort. Die Ermittler gingen davon aus, dass eine kriminelle Bande dafür verantwortlich sein musste und es sich womöglich um eine perverse Mutprobe im Rahmen eines Gang-Aufnahmerituals handeln könnte. Mit anderen Worten: Nicht jeder Vermisstenfall stellte sich als harmlos heraus.
Deswegen, und weil Albin Langlois gut kannte und wusste, wie sich Ungewissheit anfühlte, sagte er: »Ich kann ja mal nachhorchen und melde mich dann bei dir, Arnault. Wie heißen die beiden?«
»Sandrine Langlois und Thierry Roubert«, erwiderte Langlois.
3
Das Plateau de Vaucluse war ein kleinerer Höhenzug als der Luberon, aber nicht minder reizvoll. Er verlief ungefähr in Ost-West-Richtung zwischen Fontaine de Vaucluse, wo die Sorgue entsprang, und dem Mont Ventoux. Zahlreiche malerische Dörfer wie Venasque oder Gordes klebten wie Schwalbennester an den grauen Felsen. In einem Tal lag die Abtei von Senanque, hier und da fand man kleine Kapellen, verfallene Ruinen und weitere Bergdörfer in einer ursprünglichen Landschaft. Die D4 führte über den Col de Murs, und dort gab es viele Wirtschaftswege und Zonen zum Picknicken, die oft von Familien aufgesucht wurden. Außerdem sah man überall Radtouristen und Wanderer.
David Morey ließ deswegen die Wochenenden gerne aus. Ihm gefiel es sehr viel besser, allein mit der Landschaft und dem Himmel zu sein, wenn er in der Natur malte, was er oft tat. Seine kleinformatigen Gemälde stellte er in der eigenen Galerie aus, aber auch in denen der umliegenden Ortschaften, wo sie von Touristen gekauft wurden, die sich ein solches Mitbringsel aus dem Urlaub leisten konnten, denn preiswert waren Moreys Bilder nicht gerade. Natürlich hätte er einfach auf Masse produzieren können, ohne das Atelier zu verlassen. Die Ansichten von Wäldern mit Himmel und einer Ruine oder einem Dorf hatte er im Kopf und hätte Hunderte davon malen können, ohne jemals einen Schritt vor die Tür zu setzen. Aber genau das gehörte ja für Kunden zu einem impressionistisch anmutenden Bild dazu: die Illusion, dass der Maler wie Vincent van Gogh durch die Gegend spaziert ist und von einer Ansicht derart überwältigt war, dass er sie wie im Rausch sofort auf die Leinwand bannen musste. Außerdem erwarben seine Kunden die Erinnerung an ihr eigenes Empfinden beim Urlaub in der wunderschönen, duftenden, von der Sonne durchfluteten Provence. Und für Morey gehörte das ebenfalls dazu. Die Arbeit im stillen Kämmerlein war nicht sein Stil.
Morey hatte den Kangoo am Col de Murs geparkt, seinen Klapphocker und den Rucksack mit den Farben, den Leinwänden und der an der Seitentasche befestigten, ausklappbaren Staffelei herausgenommen und ging um eine rostige Schranke herum, die einen Waldwirtschaftsweg absperrte. Abgeschlossen war sie nicht. Er spazierte zwischen den Pinien und Felsen hindurch, inhalierte die würzige Luft und nahm sich vor, in etwa zweihundert Metern nach links zu gehen. Dort gab es einen Einschnitt im Bewuchs mit einem Vorsprung, von dem man eine hervorragende Aussicht auf einige Dörfer hatte und sogar bis zum Luberon sehen konnte. Dort würde er seinen Stuhl aufbauen, die Staffelei platzieren und zunächst ein Salamibrot mit einem Becher Rotwein zu sich nehmen, bevor er loslegte.
Er hatte sich vorgenommen, heute Nachmittag wenigstens vier Bilder zu produzieren. Er nutzte Acrylfarben, die genauso wie Öl leuchten würden, aber für seine Zwecke erheblich praktischer waren und blitzschnell trockneten. Er würde ein Nickerchen machen, während Wind und Sonne den Prozess beschleunigten. Für jedes Bild – falls es sich verkaufte, und daran zweifelte Morey nicht – würde er rund tausend Euro kassieren. Kein schlechter Tagesverdienst.
Er ging um eine langgezogene Kurve und sah kurz vor der Schneise im Wald einen weißen Citroën, der dort offensichtlich parkte. Morey wunderte sich für einen Moment, weil der Wirtschaftsweg doch abgesperrt war, aber dann erinnerte er sich, dass sich an der Schranke kein Schloss befunden hatte. Vielleicht hatte der Fahrer des Autos auch einen Schlüssel und es handelte sich um den Privatwagen des Försters, der nur mal rasch nach dem Rechten sehen wollte. Wenngleich der Citroën nicht mitten auf dem Weg stand, sondern zur Hälfte zwischen den Büschen abgestellt war, weswegen man nur das Heck erkennen konnte.
Morey ging weiter, näherte sich dem Fahrzeug, und je näher er kam, desto mehr war er der Auffassung, dass das nicht der Wagen eines Försters oder Landschaftswächters sein konnte. Möglicherweise gehörte es doch Ausflüglern – vielleicht hatte sich hier ein Pärchen für ein Schäferstündchen zurückgezogen? Wer weiß, dachte Morey, und überlegte, ob er nicht doch einen anderen Standort wählen solle, um niemanden zu stören. Andererseits – warum sollte er sich deswegen davon abhalten lassen? Er verlangsamte sein Tempo, kam näher an das Auto heran – und erkannte durch die Heckscheibe zwei Personen, die auf dem Fahrer- und Beifahrersitz saßen.
Morey sah noch einmal genauer hin. Ja, da waren zwei Personen. Aber die waren definitiv nicht miteinander beschäftigt. Die Köpfe hingen etwas zur Seite, so dass es aussah, als würden die Insassen schlafen.
Morey bekam ein schlechtes Gefühl. Da war irgendetwas nicht in Ordnung, beim besten Willen nicht. Niemand fuhr doch sein Auto so tief in das Buschwerk auf einem entlegenen Weg des Col de Murs, wenn er nicht einen Grund dafür hatte. Und diese Bewegungslosigkeit …