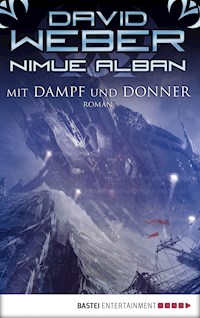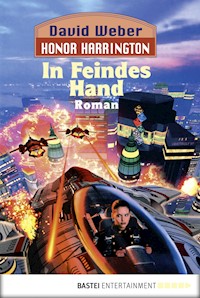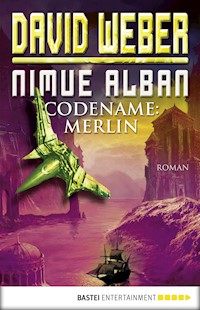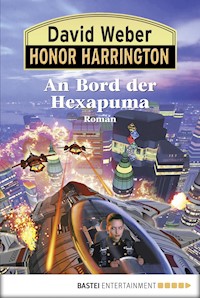4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Der Pionierplanet Sphinx wird von einem Dieb heimgesucht - und Stephanie Harrington ist fest entschlossen, ihn zu fassen. Auf ihrer Jagd nach dem Täter macht sie allerdings eine weitaus größere Entdeckung: eine sechsbeinige Baumkatze! Augenblicklich freundet sie sich mit dem Tier an. Doch Stephanies Fund und ihre erstmalige Verbindung mit einer Baumkatze bringen eine Flut von Gefahren mit sich. Eine Reihe hochrangiger Feinde möchte, dass der Planet Sphinx vollständig in menschlicher Hand bleibt - selbst wenn dies die Ausrottung einer anders denkenden Spezies bedeutet.
»Brillant! Brillant! Brillant! Unvergleichlich großartig!« ANNE MCCAFFREY
Die großartige Vorgeschichte zur Erfolgsserie Honor Harrington von Bestseller-Autor David Weber - für Fans und Neueinsteiger!
Band 1: Begegnung auf Sphinx
Band 2: Flammenzeit
Band 3: Krieg der Baumkatzen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 513
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
Überraschende Begegnungen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Wer solche Freunde hat …
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Glossar
Personenverzeichnis
Über den Autor
David Weber ist ein Phänomen: Ungeheuer produktiv (er hat zahlreiche Fantasy- und Science-Fiction-Romane geschrieben), erlangte er Popularität mit der HONOR-HARRINGTON-Reihe, die inzwischen nicht nur in den USA zu den bestverkauften SF-Serien zählt. David Weber wird gerne mit C. S. Forester verglichen, aber auch mit Autoren wie Heinlein und Asimov. Er lebt heute mit seiner Familie in South Carolina.
BegegnungaufSphinx
Roman
Aus dem Amerikanischenvon Dr. Ulf Ritgen
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2011 by Words of Weber, Inc.
Published by arrangement with BAEN BOOKS, Wake Forest, NC, U.S.A.
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »A beautiful Friendship«
Originalverlag: BAEN BOOKS, Wake Forest
This work was negotiated through Literary Agency
Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titelillustration: Arndt Drechsler, Regensburg
Textredaktion: Beke Ritgen
Lektorat: Ruggero Leò
Umschlaggestaltung: Arndt Drechsler, Regensburg
E-Book-Produktion: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-8387-5948-7
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Überraschende Begegnungen
1518 P. D.,Planet Sphinx,Doppelsternsystem von Manticore
1
»Es ist mir ernst damit, Stephanie!«, sagte Richard Harrington mit Nachdruck. »Du wirst nicht noch einmal in den Wald gehen, ohne dass deine Mutter oder ich dabei sind. Haben wir uns verstanden, junge Dame?«
»Ach, Daaaaddy …«, versuchte es Stephanie, verstummte jedoch sofort, als ihr Vater die Arme vor der Brust verschränkte. Kein gutes Zeichen. Dann begann er auch noch rhythmisch mit dem Fuß zu tappen, und ihr sank das Herz. Nein, das lief nicht gut. Die Reaktion ihres Vaters zeigte: Es war keine Sternstunde ihres … nennen wir es: Verhandlungsgeschicks. Das passte ihr nicht – ebenso wenig wie das Verbot, das sie unbedingt hatte verhindern wollen, nun aber ausgesprochen war. Sie war fast zwölf T-Jahre alt, ein helles Köpfchen, Einzelkind und eine Tochter. Das verschaffte ihr natürlich gewisse Vorteile. Kaum dass sie hatte sprechen können, hatte sie ihren Vater auch schon um den kleinen Finger zu wickeln gewusst. Ihre Mutter dagegen war schon immer ein härterer Brocken gewesen. Leider neigte der Vater dazu, völlig skrupellos jegliche Nachsichtigkeit über Bord zu werfen, wenn es die Situation seiner Meinung nach verlangte.
So wie jetzt.
»Wir brauchen gar nicht weiter darüber zu reden«, sagte er mit unheilverkündender Ruhe. »Nur weil du noch keine Hexapumas oder Gipfelbären gesehen hast, heißt das noch lange nicht, dass es da draußen keine gibt.«
»Aber ich habe den ganzen Winter lang drinnen gesessen, ohne etwas unternehmen zu können«, wandte sie ein. Geflissentlich unterdrückte sie einen Anflug von schlechtem Gewissen, als sie sich an Schneeballschlachten, Ausflüge auf Langlaufski und Schlittenfahrten, an in den Schnee gebaute Höhlen und diverse andere Ablenkungen erinnerte. »Ich will nach draußen und mich umsehen!«
»Das weiß ich ja, meine Süße«, sagte der Vater sanfter und verwuschelte ihr den braunen Lockenschopf. »Aber da draußen ist es gefährlich. Du weißt genau, dass wir nicht mehr auf Meyerdahl sind.« Stephanie schloss die Augen und bemühte sich nach Kräften auszusehen, als habe man ihr soeben das Herz gebrochen. Es reichte, um Schuldgefühle in Richard Harrington wachzurufen: Diesen letzten Satz hätte er sich besser verkniffen. »Wenn du etwas unternehmen willst, warum fährst du dann nicht heute Nachmittag mit Mom nach Twin Forks?«
»Weil Twin Forks absolut hohl ist, Daddy.« Verzweiflung und unterdrückte Wut schwangen in Stephanies Antwort mit – ein taktischer Fehler, wie sie ganz genau wusste. Selbst Eltern wie ihre, die alles in allem ganz erträglich waren, schalteten bei zu viel Widerspruch auf stur. Aber bitte jetzt mal ehrlich: Im Umkreis von Besitz Harrington verdiente Twin Forks zwar am ehesten die Bezeichnung ›Ortschaft‹, aber es war ein Kaff. Bestenfalls lebten fünfzig Familien dort – und die meisten Gleichaltrigen waren in Stephanies Augen nur eines: reine Zeitverschwendung. Von denen interessierte sich keiner für Xenobotanik oder Biosystematik. Im Gegenteil: Sie verbrachten ihre Freizeit mit dem jämmerlichen Versuch, sich ›Kuscheltiere‹ zu fangen – ganz egal, wie sehr dieser Versuch den ›Kuscheltieren‹ in spe schadete. Stephanie wusste genau, dass jeder Versuch, einen dieser Zorks für ihre Erkundungszüge zu rekrutieren, eher früher als später zu einem Wortgefecht oder sogar zu Handgreiflichkeiten bis hin zu einem blauen Auge führen würde. Meine Schuld aber, dachte sie düster, wär’s nicht! Ausgerechnet in dem Moment, wo sie in das Jugendprogramm der Forstbehörde aufgenommen worden war, mussten ihre Eltern sie ja unbedingt von Meyerdahl verschleppen. Dort wäre sie jetzt schon als Praktikantin auf ihrer ersten Exkursion, ganz sicher! Stephanie trug jedenfalls nicht die Schuld daran, dass es anders gekommen war. Wäre es da nicht moralische Pflicht ihrer Eltern, ihr die Erkundung zumindest der eigenen Ländereien in der neuen Heimat zu erlauben?!
»Twin Forks ist nicht absolut hohl«, widersprach ihr Vater energisch.
»Doch«, erwiderte sie mit vorgeschobener Unterlippe, und Richard Harrington holte tief Luft.
»Hör mal«, sagte er nach kurzem Schweigen, »ich weiß ja, dass du all deine Freunde auf Meyerdahl zurücklassen musstest. Ich weiß auch, wie sehr du dich auf das Praktikum bei der Forstbehörde gefreut hast. Aber Meyerdahl ist seit mehr als tausend Jahren besiedelt, Steph – Sphinx dagegen nicht.«
»Das weiß ich, Dad«, erwiderte sie und versuchte dabei ebenso sachlich und vernünftig zu klingen wie ihr Vater. Dieses erste ›Daddy!‹ war ein echter Fehler gewesen, das wusste sie – ein Fehler, den sie auf keinen Fall wiederholen würde. Sein Verbot, die unmittelbare Umgebung des Elternhauses zu verlassen, hatte sie allerdings völlig überrascht. »Aber ich hatte doch mein UniLink dabei! Ich hätte jederzeit um Hilfe rufen können, und ich bin auf jeden Fall schlau genug, den nächsten Baum hochzuklettern, sobald mich was fressen will! Wäre da was auf mich zugekommen, hätte ich in fünfzehn Metern Höhe auf einem Ast gesessen und darauf gewartet, dass Mom oder du mein Funkfeuer anpeilen, versprochen!«
»Klar … wenn du es rechtzeitig bemerkst«, meinte ihr Vater grimmig. »Aber Sphinx ist nicht so vernetzt wie Meyerdahl. Wir haben noch überhaupt keine Ahnung, was dort draußen alles lebt! Es werden noch Jahrzehnte vergehen, bis man auch nur eine grobe Vorstellung davon haben wird, was es da alles an Tierarten gibt! Und alle UniLinks der Welt bringen mich nicht rechtzeitig in den Flugwagen, wenn du plötzlich doch einem Hexapuma oder einem Gipfelbär gegenüberstehst!«
Stephanie setzte schon zu einer Erwiderung an, doch dann stockte sie. Unrecht hat er ja nicht, gestand sie sich widerwillig ein, allerdings ohne schon bereit zu sein, sich in das scheinbar Unvermeidliche zu fügen. Aber ein fünf Meter langer Hexapuma konnte einem schon den Tag verderben – und viel besser waren die Gipfelbären auch nicht. Nicht von der Hand zu weisen war auch, dass man bisher praktisch nichts über die Tier- und Pflanzenwelt im unberührten Urwald von Sphinx wusste. Aber genau darum ging es hier ja – deswegen wollte sie ja endlich hinein in den Urwald!
»Hör mir zu, Stephanie«, sagte ihr Vater schließlich. »Ich weiß ja, dass Twin Forks im Vergleich zu Hollister nichts Besonderes ist, aber mehr habe ich dir nicht zu bieten. Du weißt doch, dass der Ort wächst. Man spricht sogar davon, im nächsten Frühling einen eigenen Shuttlelandeplatz zu bauen.«
Stephanie gelang es – irgendwie –, nicht die Augen zu verdrehen. Twin Forks im Vergleich mit Hollister ›nichts Besonderes‹ zu nennen, war dieselbe Kategorie Untertreibung wie die Behauptung, gelegentlich schneie es auf Sphinx ein wenig. Angesichts des endlos langen, sich ewig hinziehenden Jahres auf Sphinx wäre Stephanie im nächsten Frühling schon siebzehn T-Jahre alt. Bei ihrer Ankunft war sie fast zehneinhalb gewesen; gerade rechtzeitig zum ersten Schnee waren sie hier eingetroffen. Und dann hatte es fünfzehn T-Monate lang nicht mehr zu schneien aufgehört!
»Es tut mir leid«, sagte der Vater, als hätte er ihre Gedanken gelesen. »Es tut mir leid, dass Twin Forks nicht besonders aufregend ist. Es tut mir leid, dass du Meyerdahl nicht verlassen wolltest, und es tut mir leid, dass ich dir nicht erlauben kann, auf eigene Faust durch den Wald zu streifen. Aber so ist es nun einmal, meine Süße. Und nun …«, er blickte ihr tief in die braunen Augen, »versprich mir, dass du tust, worum deine Mom und ich dich bitten.«
Mürrisch stapfte Stephanie durch den Morast hinüber zu dem Pavillon. Wie einfach alles auf Sphinx hatte auch er ein auffällig steiles Dach. Stephanie seufzte tief, während sie sich auf der kleinen Treppe niederließ und dabei an den Grund dafür dachte.
An den Schnee. Selbst hier, so dicht am Äquator von Sphinx, maß man den jährlichen Schneefall in Metern. In vielen Metern!, dachte sie düster. Häuser mussten steile Dächer haben, damit sie nicht unter dem Gewicht des gefrorenen Wassers einstürzten – zumal die Schwerkraft des Planeten um ein Drittel höher lag als auf Alterde. Nicht dass Stephanie jemals Alterde besucht hätte – oder irgendeine andere Welt, die vom Rest der Menschheit nicht als ›Hochschwerkraftplanet‹ klassifiziert war.
Erneut seufzte sie ihr Elend heraus und wünschte sich, ihre Urur-undsoweiter-großeltern hätten sich nicht freiwillig für die Erste Meyerdahl-Welle gemeldet. Kurz nach ihrem achten Geburtstag hatten ihre Eltern sie beiseite genommen und ihr genau erklärt, was das eigentlich bedeutete. Das Wort ›Dschinn‹ hatte Stephanie damals schon gekannt, obwohl sie nicht wusste, dass es streng genommen auch auf sie zutraf. Damals ging sie erst seit vier T-Jahren zur Schule, und in Geschichte waren sie noch nicht beim Letzten Krieg von Alterde angelangt. Deshalb wusste Stephanie nicht, weshalb manche Menschen schon auf die bloße Erwähnung gezielter Veränderungen des menschlichen Erbguts so heftig reagierten – und dass diese Leute deswegen den Begriff ›Dschinn‹ als eines der schlimmsten Schimpfworte ansahen, die das Standardenglisch zu bieten hatte.
Mittlerweile wusste sie es – und hielt noch immer jeden, der so dachte, für albern. Natürlich waren die Biowaffen und Supersoldaten im Letzten Krieg der blanke Horror gewesen. Aber das lag doch nun schon mehr als fünfhundert T-Jahre zurück – und mit den Leuten aus den Ersten Wellen von Meyerdahl oder Quelhollow hatte der Letzte Krieg nicht das Geringste zu tun. Stephanie war mittlerweile ganz froh, dass die ersten manticoranischen Siedler Sol schon vor jenem Letzten Krieg verlassen hatten. Ihre altmodischen Kälteschläfer waren lange genug unterwegs gewesen, um sie dieses schreckliche Ereignis verpassen zu lassen. Deshalb waren sie nicht unter den Vorurteilen zuleide gehabt, die damit zusammenhingen.
Zum Glück gab es fast nichts, was Aufmerksamkeit auf die Veränderungen lenkte, die Genetiker an den Meyerdahl-Kolonisten vorgenommen hatten. Auf die Masse bezogen waren Stephanies Muskeln um ungefähr fünfundzwanzig Prozent leistungsfähiger als die sogenannter reinblütiger Menschen, und um diese Muskeln mit Energie zu versorgen, arbeitete ihr Stoffwechsel ein gutes Fünftel schneller. Auch am Atmungssystem und Kreislauf der Meyerdahler waren geringfügige Verbesserungen vorgenommen worden (so kamen sie mit deutlich größeren Schwankungen des Luftdrucks zurecht, ohne auf Nanotechnologie zurückgreifen zu müssen wie Reinblüter). Darüber hinaus hatte man ihre Knochen verstärkt, schließlich mussten diese ja auch mit den leistungsfähigeren Muskeln zurechtkommen. All diese Veränderungen waren dominant, wurden also auch den jeweiligen Nachkommen vererbt. Die Unterart von Dschinn, der Stephanie angehörte, war mit reinblütigen Menschen voll fortpflanzungsfähig, und zumindest sie selbst hatte das Gefühl, an sich würden die Unterschiede gar nicht so viel ausmachen. Sie bewirkten lediglich, dass ihre Eltern und sie eine bestimmte Körperkraft auch mit geringerer Muskelmasse erreichten und hervorragend an Hochschwerkraftwelten angepasst waren, ohne dabei klein und stämmig zu sein oder überentwickelte Muskelpakete aufzubauen. Doch nachdem Stephanie ein wenig über den Letzten Krieg und einige Anti-Dschinn-Bewegungen gelesen hatte, musste sie ihren Eltern recht geben: Es war wirklich besser, nicht jedem Fremden gleich auf die Nase zu binden, dass sie modifizierte Gene besaß. Ansonsten dachte Stephanie selten darüber nach. Nur hin und wieder überlegte sie bitter, was wohl geschehen wäre, wenn ihre Eltern keine Dschinni gewesen wären: Hätte die hohe Schwerkraft auf den besiedelten Planeten des Doppelsterns Manticore sie vielleicht davon abgehalten, ihre Tochter hierher in diese Ödnis zu zerren, wo man das Licht noch mit dem Hammer ausmachte?
Stephanie nagte an ihrer Unterlippe, lehnte sich zurück und ließ den Blick über die umzäunte Lichtung schweifen, die nun, auf Beschluss ihrer Eltern, zu ihrem Gefängnis geworden war. Das grüne, hohe Dach des Haupthauses war ein heiterer, farbenfroher Klecks vor den noch kahlen Pfostenbäumen und Kroneneichen, die es umstanden. Stephanie allerdings war nicht in der Laune, sich aufheitern zu lassen, und kam deswegen schnell zu dem Schluss, grün sei für ein Dach eine selten dämliche Farbe. Etwas Dunkles, weniger Aufdringliches – braun vielleicht oder sogar schwarz – hätte ihr besser gefallen. Und wo sie schon beim Baumaterial war: Wieso hatte man nicht etwas Bunteres genommen als grauen Naturstein? Klar, Naturstein war kostengünstiger als alles andere, und der sphinxianische Winter verlangte zur Wärmeisolation Wände, die über einen Meter dick waren. Aber ausgerechnet grau …? Als würde man in einem Verlies leben, dachte Stephanie. Erst als sie es dachte, fiel ihr auf, wie treffend der Vergleich war: Er passte hervorragend zu ihrer aktuellen Stimmung. Sie merkte ihn sich für eine spätere Wiederverwendung.
Sie hing noch einen Augenblick ihren Gedanken nach. Dann schüttelte sie sich und betrachtete die Bäume hinter dem Wohngebäude und den Gewächshäusern gleich im Anschluss sehnsüchtig – so sehnsüchtig, dass sie fast körperlichen Schmerz empfand. Manche Kinder wollten Raumfahrer oder Wissenschaftler werden, kaum dass sie das Wort aussprechen konnten. Stephanie aber zog es nicht zu den Sternen, sondern … ins Grüne. Gut, auch sie zog es dorthin, wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen war. Aber ihr Weg sollte sie dabei nicht durch den Hyperraum, sondern auf einen warmen, belebten Planeten führen, auf dem man atmen konnte. Sie wünschte sich Wasserfälle und Berge, Bäume und Tiere, die nie von einem Zoo auch nur gehört hatten. Und sie wollte diese Tiere als Erste entdecken und studieren, verstehen und beschützen …
Vielleicht lag es an ihren Eltern: Dass sie wütend über das Verbot des Vaters war, war vergessen – vorerst. Richard Harrington hatte einen Abschluss in terranischer und in Xeno-Veterinärmedizin, beides akademische Grade, die ihn für eine Grenzwelt wie Sphinx weitaus wertvoller machten als für seinen Heimatplaneten … und doch hatte ihn auch die Forstbehörde von Meyerdahl, der Wildlife Management Service, immer wieder zurate gezogen. Dadurch war Stephanie schon früh mit dem Tierreich ihrer Geburtswelt in Berührung gekommen – und viel enger als die meisten ihrer Altersgenossen. Ihre Mutter war promovierte Pflanzengenetikerin und damit genau die Sorte Spezialist, die auf neuen Welten händeringend gesucht wurde. Dieser Beruf hatte der Tochter dazu verholfen, bereits in zartem Alter die Schönheit von Meyerdahls Flora zu begreifen.
Aber dann war den Eltern eingefallen, ihre Tochter aus all dem herauszureißen und ausgerechnet hier auf Sphinx auszusetzen!
Angeekelt verzog Stephanie das Gesicht. Es stimmte: Ihr hatte die Vorstellung, Meyerdahl zu verlassen, überhaupt nicht gefallen. Trotzdem war ein Teil von ihr auch hellauf begeistert gewesen. Karriere beim Wildlife Management Service hin oder her: Sternenschiffe und Reisen zwischen den Sternen waren nun einmal faszinierend. Also hatte sie sich ganz darauf konzentriert, sich im Rahmen einer Rettungsmission einen Planeten zur neuen Heimat zu machen, dessen Bevölkerung von einer Seuche stark dezimiert worden war (zugegebenermaßen wäre dieser Aspekt deutlich weniger reizvoll gewesen, hätten die Ärzte nicht bereits ein Heilmittel für besagte Krankheit gefunden). Die Kosten für die Reise trug, und das war das Tüpfelchen auf dem i, das Sternenkönigreich. So ermöglichten die Berufe ihrer Eltern, der Familie mit den ganzen Ersparnissen ein gewaltiges Stück Land zu kaufen – ein Stück Land, das ihnen ganz allein gehörte. Der Besitz Harrington hatte in etwa die Form eines Rechtecks und lag auf dem Steilhang der Copperwall Mountains. Von dort aus hatte man einen herrlichen Blick auf den Tannerman-Ozean. Die Kantenlänge des Grundstücks betrug etwa fünfundzwanzig Kilometer. Nicht fünfundzwanzig Meter im Geviert wie das Grundstück in Hollister, sondern fünfundzwanzig Kilometer – damit war es so groß wie eine ganze Großstadt auf Meyerdahl! Außerdem grenzte es unmittelbar an eine Region, die zum Naturschutzgebiet erklärt worden war.
In ihrer Begeisterung jedoch hatte Stephanie manches nicht bedacht – zum Beispiel den Umstand, dass der Besitz Harrington fast eintausend Kilometer von jedem Flecken entfernt war, den man auch nur ansatzweise als Stadt bezeichnen konnte. So sehr Stephanie die Wildnis mochte, sie war es nicht gewohnt, fernab von jeglicher Zivilisation zu leben. Die Entfernungen zwischen den Ansiedlungen hatten zur Folge, dass ihr Vater auf dem Weg von einem Patienten zum nächsten sehr viel Zeit in der Luft verbrachte. Stephanie war Dank des planetaren Datennetzes mit Schule beschäftigt, war trotz des Umzugs bald (wieder) Klassenbeste und stand in der planetaren Rangliste der Schach-Junioren auf Platz sechzehn. Das bedeutete auf Sphinx natürlich längst nicht so viel wie etwa auf Meyerdahl. Schließlich war die Bevölkerung hier deutlich kleiner und damit eben auch die Anzahl der Rivalen. Dennoch verhinderte diese Ablenkung das, was Stephanies Mutter als ›Hüttenkoller‹ bezeichnete. Auch die Ausflüge in die Stadt genoss Stephanie (außer sie musste Twin Forks’ Mickrigkeit ihren Eltern gegenüber als Hebel einsetzen). Doch von den wenigen Kindern in ihrem Alter, die es in Twin Forks gab, nahm keines am beschleunigten Lehrprogramm teil, also war keines von ihnen in Stephanies Klasse. Online hatte Stephanie sie längst nicht so gut kennenlernen können wie seinerzeit ihre Freunde auf Meyerdahl. Wahrscheinlich waren diese Kinder doch nicht völlig hohl, aber Stephanie kannte sie eben nicht. Außerdem musste sie sich eingestehen, dass ›Sozialkompetenz und zwischenmenschliche Interaktion innerhalb ihrer Bezugsgruppe‹ (so nannten es zumindest die Schulpsychologen) nicht gerade zu ihren Stärken gehörte. Sie wusste natürlich selbst, dass sie wenig Geduld mit Leuten hatte, die keine vernünftigen Argumente vorbrachten oder darauf beharrten, irgendwelche dämlichen Dinge zu tun – sehr wenig Geduld sogar. Sie war jähzornig, auch das wusste sie. Mom hatte es ihr erklärt: Cholerisches Naturell ging oft mit den Meyerdahl-Modifikationen einher. Stephanie bemühte sich, ihren Jähzorn im Griff zu behalten. Doch, sie bemühte sich wirklich! Aber trotzdem hatte schon so manche ›zwischenmenschliche Interaktion‹ mit Angehörigen ihrer ›Bezugsgruppe‹ eine blutige Nase oder ein blaues Auge zur Folge. Kurz gesagt: Nein, sie hatte keine Freunde unter den jüngeren Bewohnern von Twin Forks gefunden – zumindest bislang noch nicht. Dort gab es auch nichts von alledem, was Stephanie für selbstverständlich hielt. Schließlich war sie in Hollister aufgewachsen, einer Stadt mit einer Bevölkerung von fast drei Millionen.
Doch selbst damit hätte sie sich arrangieren können, gäbe es auf Sphinx nicht zwei Faktoren, die das unmöglich machten: Schnee und Hexapumas.
Mit finster gerunzelter Stirn bohrte Stephanie eine Stiefelspitze in den matschigen Boden vor der untersten Pavillonstufe. Daddy hatte sie noch gewarnt, dass sie pünktlich zum Wintereinbruch auf dem Planeten eintreffen würden. Seinerzeit hatte sie gemeint zu verstehen, was das bedeutete. Aber Winter auf Sphinx war etwas ganz anderes als auf dem milden, warmen Meyerdahl, wo Schnee aufregend war und Seltenheitswert hatte. Sechzehn T-Monate Winter, das war mehr als ein Zehntel ihres bisherigen Lebens! Mittlerweile konnte sie den Anblick von Schnee nicht mehr ertragen. Da konnte Dad noch so oft sagen, die anderen Jahreszeiten würden ja genauso lange dauern. Natürlich glaubte ihm Stephanie das. Vom Kopf her begriff sie durchaus, dass fast vier T-Jahre vergehen würden, bevor der Schnee zurückkehrte. Doch erlebt hatte sie das noch nicht, und momentan gab es nur Schlamm, wohin man schaute. Schlamm, Schlamm und noch mehr Schlamm, und dazu die ersten Knospen auf den Laubbäumen. Und jede Menge Langeweile.
Sie runzelte erneut die Stirn, als sie an ihr Versprechen ihrem Dad gegenüber dachte. Sie würde gegen diese Langeweile nichts unternehmen dürfen. Schön, dass ihre Eltern sich derart um sie sorgten. Aber es war so … so hinterhältig von ihrem Dad, ihr dieses Versprechen abzuringen. Sie war jetzt praktisch ihre eigene Gefängnisaufseherin, und das wusste er ganz genau.
Seufzend erhob sie sich, schob die Fäuste in die Jackentaschen und machte sich auf den Weg zum Büro ihrer Mutter. In den siebzehn Monaten, die sie nun schon auf Sphinx lebten, war Marjorie Harrington zu einer gefragten Person geworden. Doch im Gegensatz zu ihrem Ehemann, der zu seinen Patienten musste, brauchte sie nur selten zu ihren Klienten zu fliegen. In den wenigen Fällen, in denen sie tatsächlich echte Gewebeproben oder dergleichen benötigte, statt nur elektronisch auf Daten zuzugreifen, konnten diese ebenso gut hierher zum Besitz Harrington geschickt werden wie an jeden anderen Ort auf Sphinx. Stephanie bezweifelte, dass es ihr gelingen würde, Mom auf ihre Seite zu ziehen und Dad zu bewegen, es sich doch noch einmal zu überlegen. Aber einen Versuch war es auf jeden Fall wert. Und zumindest könnte Stephanie ihrer Mom ein bisschen Mitgefühl abringen.
Dr. Marjorie Harrington stand am Fenster und lächelte, als sie Stephanie aufs Haus zutrotten sah. Sie wusste, wohin ihre Tochter wollte – und was sie ausheckte. Im Prinzip schätzte sie Stephanies Versuche nicht, ihre Eltern gegeneinander auszuspielen, wenn ihr eine Regel oder ein Verbot nicht passte. Aber eines musste man ihrer Tochter lassen: Sosehr eine Regel ihr auch missfiel und sie sich abmühte, sie abzuschütteln – Versprechen hielt sie, eisern.
Marjories Lächeln verblasste. Stephanies Enttäuschung war sicher groß. Aber Richard hatte gar keine andere Wahl gehabt, als ihre Bewegungsfreiheit so drastisch einzuschränken. Fair allerdings war das deswegen noch lange nicht – und sicher kein Grund zur Freude.
Ich muss auch mal wieder weg von meinem Terminal, dachte sie. Natürlich kann ich unmöglich so viele Stunden im Wald verbringen, wie Steph das lieb wäre, denn so viele Stunden hat nicht einmal ein Tag auf Sphinx! Aber ich sollte doch wenigstens genug Zeit für sie finden, dass sie ab und zu einen erwachsenen Begleiter hat. Wenigstens eine Minimaldosis dessen, was ihr so wichtig ist, sollte sie schon bekommen!
Sie schmunzelte, als ihr eine weitere Idee kam. Nein, wir können Steph unmöglich allein durch den Wald streifen lassen. Aber vielleicht gibt es ja eine andere Möglichkeit, sie abzulenken. Sie knackt doch so gern Rätsel – sie druckt sich das Kreuzworträtsel aus der Yawata Crossing Times aus und benutzt dann richtig schön altmodisch einen Stift, statt das Ganze elektronisch anzugehen. So kann sie sich natürlich keinen Fehler erlauben. Nun, wenn man sie mit ein paar Andeutungen in die richtige Richtung schubst …
Über den Flur näherten sich Schritte. Marjorie ließ die Rückenlehne ihres Sessels in die aufrechte Ausgangsposition zurückwippen, zog einen Stapel Ausdrucke heran und nahm rasch die Schutzkappe von einem Stift. Mit konzentriertem Gesicht beugte sie sich über den Papierstoß. Im nächsten Moment klopfte Stephanie auch schon an den Rahmen der offenstehenden Tür.
»Mom?«
Die übertriebene Verletztheit, die Stephanie in ihrer Stimme mitschwingen ließ, brachte Marjorie dazu, sich ein mitfühlendes Lächeln zu gestatten: nur kurz und nicht für die Augen ihrer Tochter bestimmt. Ernst blickte sie auf.
»Komm herein, Stephanie«, sagte sie einladend und lehnte sich wieder zurück.
»Könnte ich dich kurz sprechen?«, bat Stephanie, und Marjorie nickte.
»Aber natürlich! Was hast du auf dem Herzen?«
2
Klettert-flink huschte den Stamm des Netzholzbaums hinauf. Gleich auf der ersten Astgabelung verharrte er und säuberte sich mit peinlicher Sorgfalt die beschmierten Echthände und Handpfoten. Nun, da die kalten Tage in die Tage des Schlamms übergingen, verabscheute er es, den Boden zwischen den Bäumen zu überqueren. Schnee mag ich genauso wenig, überlegte er und bliekte belustigt über sich selbst. Schnee aber schmolz wenigstens irgendwann von selbst und blieb nicht im Fell, um Klumpen zu bilden, die beim Trocknen steinhart wurden. Dennoch, die neue Spanne brachte auch Vorteile mit sich: Wärme zum Beispiel oder Grün. Klettert-flink schnupperte zufrieden die frische Luft, die durch die pelzigen Knospen an den nahezu kahlen Ästen strich. An anderen Tagen wäre er hoch in den Wipfel hinaufgeklettert, um zu genießen, wie der Wind an seinem Fell zupfte. Heute jedoch gab es Wichtigeres zu tun.
Kaum dass er sich fertig geputzt hatte, stellte er sich in der Beuge zwischen Ast und Stamm auf die Hinterbeine und musterte mit scharfem Blick die Umgebung. Keines der Zwei-Beine war in der Nähe, aber das hatte wenig zu sagen: Zwei-Beine steckten voller Überraschungen. Der Clan vom Hellen Wasser, dem Klettert-flink angehörte, hatte bis vor Kurzem nur sehr wenig mit den Zwei-Beinen zu tun gehabt. Andere Clans jedoch beobachteten diese seltsamen Wesen bereits seit ganzen zwölf Spannen. Ganz offensichtlich beherrschten sie Kunstfertigkeiten, auf die sich die Leute nicht verstanden. Zum Beispiel vermochten sie über große Entfernungen hinweg Wache zu halten – aus so großer Ferne, dass die Leute sie weder hören noch riechen, geschweige denn sehen konnten. Dennoch: Klettert-flink bemerkte keinerlei Anzeichen dafür, dass am Ende er selbst beobachtet würde. Geschmeidig schnellte er zum benachbarten Baum hinüber. Nun, da er die letzte Baumgruppe erreicht hatte, sollte er auf den verzweigten Ästen weiterreisen können, ohne ständig mit Echthänden und Handpfoten im Matsch zu landen. Fast lautlos drang er durch die dichten Kronen weiter zur Lichtung vor.
Klettert-flink erreichte den letzten Querast. Lange Augenblicke blieb er reglos sitzen. Sein cremefarben-graues Fell verschmolz mit der Umgebung, mit Baumstämmen und Ästen, die von geschlossenen grünen Knospen wie besprenkelt wirkten. Er saß reglos da, strich sich nur mit einer Echthand unwillkürlich die Schnurrhaare. Mit Gehör und Gedanken gleichzeitig lauschte er und richtete die Ohren auf, als er das schwache Geistesleuchten spürte, das ihm die Anwesenheit der Zwei-Beine verriet. Das war nicht jene klare, deutliche Verständigung, die er bei den Leuten gespürt hätte. Anscheinend waren die Zwei-Beine geistesblind. Dennoch hatte es etwas … Angenehmes an sich. Eigentlich war das erstaunlich. Denn was auch immer diese Zwei-Beine waren, sie waren auf jeden Fall völlig anders als die Leute. Das war von Anfang an offenkundig.
›Worauf lauschst du, Klettert-flink?‹, fragte eine Geistesstimme, und er warf einen Blick über die Schulter.
Schatten-Hetzer trägt seinen Namen zurecht – aus mehrerlei Gründen, dachte er. Vor dem Hintergrund der Netzholzborke war der andere Kundschafter praktisch nicht auszumachen – selbst für Klettert-flink, der dank des Geistesleuchtens seines Begleiters dessen genaue Position kannte. Klettert-flink fürchtete zwar nicht, Schatten-Hetzer könne ihre Anwesenheit den Zwei-Beinen verraten, aber das machte ihn auch nicht zu einem angenehmeren Reisegefährten.
›Auf das Geistesleuchten der Zwei-Beine‹, beantwortete er die Frage und schmeckte Schatten-Hetzers Verärgerung des Ton falls wegen. Klettert-flink hatte nicht zu verbergen versucht, welche Mühe es ihn kostete, sich weiterhin in Geduld zu üben. Schatten-Hetzer hätte die Emotionen ohnehin sofort geschmeckt.
›Warum?‹, erkundigte sich Schatten-Hetzer unverblümt. ›Wir wissen doch längst, dass sie ebenso geistesblind sind wie die Höhlenhuscher oder die Borkenkauer.‹
Die Verachtung, die Schatten-Hetzer für derlei taubstumme Wesen empfand, war in seinem Geistesleuchten deutlich spürbar. Klettert-flink widerstand der Versuchung, zu dem jüngeren Kundschafter hinüberzuspringen und ihm einen kräftigen Klaps auf die Nase zu geben. Stattdessen erinnerte er sich daran, dass Schatten-Hetzer viel jünger war als er selbst – und dass oft gerade diejenigen, die besonders wenig wussten, besonders viel zu wissen glaubten. Dennoch empfand Klettert-flink den Umgang mit diesem jungen Kundschafter als ermüdend. Dass Schatten-Hetzer wie alle Leute die Gefühle seines Gegenübers schmeckte und daher wusste, wie Klettert-flink über ihn dachte, machte es keinen Deut besser.
›Ja, sie scheinen geistesblind zu sein, Schatten-Hetzer‹, erwiderte er nach kurzem Schweigen. ›Aber du solltest nicht den Fehler machen, sie deswegen für ähnlich dumm wie die Höhlenhuscher zu halten! Vermagst du all das zu tun, was die Zwei-Beine können? Die Leute haben uns schon viel über sie berichtet. Kannst du fliegen? Kannst du an einem Nachmittag einen ganzen Goldblattbaum fällen und zerteilen? Du kannst es nicht, oder? Also solltest du nicht vergessen, dass die Zwei-Beine dazu in der Lage sind … genau deswegen hat man uns ja auch ausgeschickt, sie zu beobachten.‹
Er schmeckte Schatten-Hetzers jäh aufflammenden Zorn. Doch wenigstens war der junge Kundschafter schlau genug, sich eine patzige Erwiderung zu verkneifen. Das war allerdings das erste Anzeichen für ein gewisses Maß an Schläue, dass Klettert-flink seit dem Aufbruch vom Clanlager bei seinem Begleiter bemerkt hatte.
Gebrochener-Zahns Idee, dachte Klettert-flink verärgert. Der Älteste des Clans behauptete schon seit einiger Zeit, Klettert-flink wäre von den Zwei-Beinen entschieden zu eingenommen. Wenn es nach ihm ginge, wäre dieser Auftrag an Schatten-Hetzer gegangen, nicht an jemanden, den es eher interessiert, wer oder was diese Zwei-Beine sind und woher sie kommen – und warum –, statt sie einfach nur im Auge zu behalten!
Klettert-flink hatte die Anwesenheit der Zwei-Beine als Erster bemerkt, und war bereit einzugestehen, dass er sie faszinierend fand. Unter anderem deswegen glaubte Gebrochener-Zahn ja auch, Klettert-flink wäre nicht in der Lage, ›seine‹ Zwei-Beine unvoreingenommen zu beobachten. Glücklicherweise vertraute der Rest des Clans durchaus auf sein Urteilsvermögen – allen voran Helle-Klaue, der Älteste Jäger des Clans, und Kurzer-Schweif, der Älteste Kundschafter. Ebenso wie Klettert-flink waren sie der Ansicht, es wäre besser, die Zwei-Beine weiterhin zu beobachten. Niemand hatte es ausgesprochen, dennoch konnte Klettert-flink es in ihrer aller Geistesleuchten deutlich schmecken: Sie allesamt waren der Meinung, diese Aufgabe erfordere jemanden mit deutlich mehr Fantasie, als Schatten-Hetzer je gezeigt hatte. Bedauerlicherweise war es sinnvoll, dass mehr als ein Clankundschafter Erfahrung mit den Zwei-Beinen machte. Klettert-flink sah das ein: Ein anderer Blickwinkel war durchaus von Vorteil.
Selbst wenn es der Blickwinkel von Schatten-Hetzer war.
Klettert-flink wartete noch einen Moment ab, ob sein Begleiter noch etwas hinzuzufügen hätte. Dann aber wandte er sich wieder dem Querast und der Lichtung zu. Wie Glut erlischt, verblasste Schatten-Hetzers Zorn in der Ferne, als Klettert-flink sich lautlos bis zum letzten Netzholzstamm schlich und leichtfüßig zur höchsten Astgabelung emporstieg. Dort auf seinem mit Laub und Zweigen ausgepolsterten Ausguck machte er es sich bequem. Nach den Heimsuchungen der kalten Spanne brauchten Ausguck und Polster einiges an Ausbesserung, aber es eilte nicht. Noch war das Polster benutzbar und recht bequem, und es würde noch etliche Tage dauern, bis die knospenden jungen Blätter das Material lieferten, das Klettert-flink benötigte.
›Komm jetzt!‹, rief er Schatten-Hetzer zu, dann legte er sich behaglich bäuchlings auf eine Seite des Polsters und genoss die milde Wärme der Sonne. In gewisser Weise fand er es schade, dass sich die Blätter schon bald wieder öffnen würden. Danach würde kein Sonnenlicht mehr durch die Zweige der Baumkrone fallen und ihm das Fell wärmen. Gewiss, sein Polster wäre, sicher zu Schatten-Hetzers Wohlgefallen, dann wieder besser versteckt. Aber ginge es nach Schatten-Hetzer, wären sie beide zu diesem Zeitpunkt ohnehin nicht mehr hier.
Leise scharrten Krallen über Borke, als Schatten-Hetzer die letzten Leutelängen hinaufkletterte und sich zu Klettert-flink gesellte. Der jüngere Kundschafter blickte sich auf dem Ausguck um, als suche er etwas, was es zu bemängeln gäbe. Klettert-flink schmeckte Schatten-Hetzers Verärgerung, als er nichts fand. Dann ein rasches Wedeln mit dem Schweif, und Schatten-Hetzer hockte sich neben ihn.
›Das ist ein guter Spähposten‹, gestand der jüngere Kundschafter nach kurzem Schweigen fast widerwillig ein. ›Man hat von hier einen noch besseren Ausblick, als ich gedacht hatte, Klettert-flink. Und so groß hatte ich mir das Lager der Zwei-Beine gar nicht vorgestellt.‹
›Ja, es ist wirklich groß‹, stimmte ihm Klettert-flink zu. Der Bericht eines Kundschafters mochte zwar viele Informationen bergen, das Abschätzen von Größen und Entfernungen aber war immer besonders knifflig. Die Sagen-Künderinnen vermochten derlei Berichte ohne jeglichen Fehler zu wiederholen und konnten anderen Leuten genau das zeigen, was der ursprüngliche Kundschafter gesehen hatte. Dennoch konnten die Leute aus unbekanntem Grund Größenabschätzungen ohne einen irgendwie gearteten Vergleichswert nur sehr schlecht miteinander teilen. Doch das Einzige, was in der Nähe der Zwei-Beine als Vergleichswert heranzuziehen war, war ein hoch aufragender Goldblattbaum, dessen starke Äste dem Lager der Zwei-Beine Schatten spendeten. Goldblattbäume aber ließen neben sich so gut wie alles winzig erscheinen.
›Wofür brauchen sie denn ein so großes Lager?‹, fragte sich Schatten-Hetzer, und Klettert-flink zuckte mit den Ohren.
›Das habe ich mich auch schon gefragt‹, gestand er. ›Aber bislang habe ich noch keine befriedigende Antwort gefunden. Um ein solches Wohnnest zu errichten, müssen sich mehr als ein Dutzend Zwei-Beine sehr anstrengen, trotz all ihrer Werkzeuge. Ich habe sie viele Tage lang beobachtet. Als sie fertig waren, sind sie einfach fortgegangen. Es sind mehr als drei Hände an Tagen vergangen, bis die neuen Zwei-Beine gekommen sind. Und selbst jetzt sind nur drei von ihnen hier.‹
›Ich weiß, was du berichtet hast. Aber jetzt habe ich selbst gesehen, wie groß deren Lager ist, und deswegen erscheint es mir noch sonderbarer.‹
Der Verwirrung in der Geistesstimme des jüngeren Kundschafters wegen blickte Klettert-flink belustigt, ehe er wieder ernst wurde.
›Wenn ich mich nicht täusche,ist das Kleinste der Zwei-Beine noch ein Junges‹, erklärte er. ›Ich bin mir natürlich nicht sicher. Aber wenn das stimmt, frage ich mich, ob seinen Wurfgeschwistern etwas zugestoßen sein könnte. Vielleicht ist ihr Lager deswegen so groß? Wenn die alle ihre anderen Jungen bei einem Unfall verloren haben, nachdem sie schon ein so großes Lager angelegt hatten …‹
Schatten-Hetzer erwiderte nichts, doch Klettert-flink schmeckte sein Verständnis … und auch einen Funken Mitgefühl mit den Zwei-Beinen, die einen solchen Verlust hatten ertragen müssen. Diese unerwartete Emotion ließ Schatten-Hetzer in Klettert-flinks Ansehen ein wenig steigen.
›Es ist sonderbar, dass sie alle so weit voneinander entfernt hausen‹, sagte Schatten-Hetzer schließlich. ›Warum sollten ein vermähltes Paar und ihr Junges ihr Lager so fernab von allen Artgenossen aufschlagen? Damit begeben sie sich doch gewiss jeglicher Möglichkeiten, sich mit anderen Zwei-Beinen zu verständigen! Vorausgesetzt natürlich, sie verständigen sich überhaupt untereinander.‹
›Ich vermute schon, dass sie eine Form der Verständigung nutzen‹, erwiderte Klettert-flink nachdenklich. ›Die Zwei-Beine, die die Lichtung erschaffen und das Lager gebaut haben, müssen sich doch irgendwie miteinander verständigt haben – sonst hätten sie unmöglich derart viele verschiedene Aufgaben in derart kurzer Zeit erfüllen können.‹
Darüber dachte Schatten-Hetzer nach und rief sich noch einmal das Sagenlied ins Gedächtnis zurück, das von Klettert-flinks erster Sichtung besagter Zwei-Beine kündete.
Allzu besorgt war der Clan vom Hellen Wasser nicht gewesen, als die ersten Flugdinger eintrafen, denen dann die Zwei-Beine entstiegen und die Lichtung schufen: Die Clans, in deren Reviere schon vorher eingedrungen worden war, hatten schließlich bereits angekündigt, dergleichen stehe zu erwarten. Die Zwei-Beine konnten gefährlich sein, und sie veränderten unablässig ihre Umwelt. Trotzdem glichen sie weder Todesrachen noch Schneejägern, die nur allzu oft einfach zu ihrem Vergnügen töteten. Klettert-flink und eine Hand voll anderer Kundschafter und Jäger hatten hoch in den Bäumen gesessen und aus der Deckung frostbedeckter Blätter heraus diese erste Gruppe Zwei-Beine beobachtet. Die Neuankömmlinge hatten erst ein paar Netzholz- und Grünnadelbäume gefällt. Dann waren sie ausgeschwärmt und hatten seltsame Gegenstände umhergetragen und immer wieder hineingeblickt. Einige dieser Dinger hatten geglänzt und gefunkelt, andere waren mit flackernden bunten Lichtern besetzt gewesen, wieder andere standen auf langen, dünnen Beinen. Dann trieben die Zwei-Beine in regelmäßigen Abständen Pflöcke aus merkwürdigem Nicht-Holz in den Boden. Daraufhin hatten die Sagen-Künderinnen des Clans vom Hellen Wasser die Lieder anderer Clans wiedergesungen und schließlich erläutert, bei den Gegenständen, wie die Kundschafter sie beschrieben, müsse es sich um unbekannte Werkzeuge handeln. Gegen diese Schlussfolgerung wusste Klettert-flink keinen Einwand zu erheben, auch wenn sich die fremden Werkzeuge in ihrer Form so sehr von den Äxten und Messern der Leute unterschieden wie deren unbekanntes Material von Feuerstein, Holz und Knochen.
Das alles zusammengenommen erklärte natürlich, warum es galt, die Zwei-Beine sehr sorgfältig zu beobachten – und das möglichst heimlich. Die Leute waren zwar klein, aber sie waren auch flink und schlau, und mit ihren Äxten, ihren Messern und dem Feuer vollbrachten sie viele Dinge, zu denen größere, aber weniger kluge Wesen nicht imstande waren. Doch selbst das kleinste Zwei-Bein ragte höher auf als zwei Leute zusammen. Selbst wenn die Werkzeuge der Zwei-Beine also nicht besser gewesen wären als die der Leute (Klettert-flink war sich ganz sicher, dass sie sogar sehr viel besser waren!), mussten diese größeren Körper den Zwei-Beinen mehr Kraft verleihen. Zwar gab es noch keinen Beweis, dass die Zwei-Beine den Leuten übel gewillt wären, doch andererseits sprach auch nichts für das Gegenteil. Deshalb war es zweifelsohne von Vorteil, dass sich die geistesblinden Zwei-Beine so leicht ausspähen ließen.
›Also gut‹, ergriff Schatten-Hetzer schließlich wieder das Wort, und sein Geistesleuchten verriet, wie unwillig er diesen Gedanken aussprach, vielleicht können sie sich wirklich miteinander verständigen … irgendwie. Aber wie du selbst berichtet hast, Klettert-flink, sind sie doch wohl geistesblind.‹ Angespannt legte der jüngere Kundschafter die Ohren an. ›Und das erscheint mir an ihnen das Unverständlichste zu sein. Das … beunruhigt mich.‹
Klettert-flink war überrascht. Ein solches Eingeständnis – oder auch nur eine solche Erkenntnis – hätte er von Schatten-Hetzer nicht erwartet. Doch der jüngere Kundschafter hatte es bemerkenswert treffend beschrieben, denn diese Zwei-Beine waren für die Leute etwas Neues und Beängstigendes.
Etwas völlig Neues allerdings waren sie nicht, und das machte es für die Leute eher noch beunruhigender. Kaum dass die Zwei-Beine vor zwölf Spannen zum ersten Mal aufgetaucht waren, hatten die Sagen-Künderinnen jedes Clans ihre Lieder weithin ausgesandt. Gleichzeitig hatten sie die Lieder der anderen Clans daraufhin untersucht, ob sie ihnen etwas, irgendetwas, über die fremdartigen Geschöpfe verrieten: woher sie stammten … oder wenigstens, aus welchem Grund sie kamen.
Auf diese Fragen aber wusste niemand eine Antwort. Immerhin hatten sich die Sagen-Künderinnen des Clans der Tänzer vom Blauen Berg und des Clans vom Schnelllaufenden Feuer an ein sehr altes Lied erinnert, das schon seit mehr als zwölf mal zwölf Spannen bekannt war. Zwar bot auch dieses Lied keinen Hinweis auf die Ursprünge und Beweggründe der Zwei-Beine, aber es berichtete vom ersten Mal, dass Zwei-Beine von den Leuten gesichtet worden waren. Ein mittlerweile längst verstorbener Kundschafter hatte seinen Sagen-Künderinnen berichtet, wie das eiförmige, silberne Ding der Zwei-Beine unter Licht und Feuer aus dem hohen Himmel herabgesunken war.
›Schon oft habe ich mir gewünscht, die Kundschafter der Tänzer vom Blauen Berg hätten etwas weniger Vorsicht walten lassen, als die Zwei-Beine uns zum ersten Mal besucht haben‹, gestand Klettert-flink seinem Clangefährten. ›Vielleicht hätten wir dann schon herausgefunden, was die Zwei-Beine wollen … oder was wir selbst hätten unternehmen können in jener Zeit, seit wir sie zum ersten Mal gesehen haben und seit sie hierher zurückgekehrt sind.‹
›Aber vielleicht wären dann auch bereits alle Leute auf der ganzen Welt tot‹, erwiderte Schatten-Hetzer. ›Na, aber dann‹, setzte er trocken hinzu, ›bräuchten wir uns jetzt keine Gedanken mehr zu machen, was wir unternehmen sollen.‹
Klettert-flink war hin und her gerissen: Sollte er Schatten-Hetzer jetzt einen Klaps verpassen oder lieber lachen? Doch wieder einmal hatte der junge Kundschafter Wahres gesagt.
Klettert-flink glaubte, dass die ersten Zwei-Beine Kundschafter wie er gewesen sein mussten. Klug genug, Späher auszusenden, waren die Zwei-Beine ganz sicher: So verfuhr jeder Clan, wenn er sein Revier erweitern wollte. Warum aber hatte der Rest des Zwei-Bein-Clans dann so lange gewartet? Und weshalb verteilten sich die Zwei-Beine so weit?
Zweifellos fragte sich nicht nur Schatten-Hetzer, wie – oder ob – sich die Zwei-Beine überhaupt miteinander verständigten. Gab es so etwas wie Verständigung zwischen ihnen, musste sogar Klettert-flink einräumen, dass es in einer völlig bizarren Art und Weise geschah – vollkommen anders als bei den Leuten. Vielleicht stimmte es, und die Zwei-Beine unterschieden sich nicht nur in Bezug auf Größe, Gestalt und Werkzeuge von den Leuten, sondern in jeglicher Hinsicht. Gerade die Fähigkeit, das Geistesleuchten ihrer Gefährten zu schmecken und deren Geistesstimmen zu hören, machte die Leute ja aus. Nur nicht-denkende, primitive Wesen – Todesrachen, Schneejäger oder die kleinen Tiere, die von den Leuten gejagt wurden – lebten abgeschlossen für sich. Waren die Zwei-Beine also geistesblind und hatten sich zudem bewusst dafür entschieden, fernab ihrer Artgenossen zu leben, gehörten sie unmöglich zu den Leuten. So dachten die anderen Kundschafter.
Aber nicht Klettert-flink.
Er wusste nicht warum. Er war anders als die anderen felsenfest davon überzeugt, die Zwei-Beine wären Leute – zumindest in gewisser Hinsicht. Sie faszinierten ihn, und wieder und wieder hatte er dem Lied von den ersten Zwei-Beinen und ihrem Ei gelauscht.
Schatten-Hetzer täuscht sich, dachte er. Die Kundschafter der Tänzer vom Blauen Berg hätten wirklich weniger vorsichtig sein sollen!
Unvernünftig, dieser Gedanke. Schon ehe er ihn zu Ende gedacht hatte, wusste Klettert-flink das. Möglicherweise war es doch der Wunsch jener Kundschafter damals gewesen, Kontakt mit den Fremden aufzunehmen. Bevor es dazu kommen konnte, hatte ein Todesrachen ein Zwei-Bein angegriffen.
Die Leute mochten die Todesrachen nicht. Die riesigen Raubtiere sahen aus wie übergroß geratene Leute, doch im Gegensatz zu ihnen waren Todesrachen alles andere als schlau – man musste es auch nicht sein, wenn man so groß wie ein Todesrachen war. Sie waren die größten, stärksten und tödlichsten Jäger der Welt. Im Gegensatz zu den Leuten töteten sie oft aus purem Vergnügen, und sie fürchteten nichts, was lebte – außer den Leuten. Zwar ließen Todesrachen keine Gelegenheit aus, unvorsichtige Kundschafter oder Jäger zu fressen, wenn sie sie allein am Boden überraschten, doch vom Herzland eines Clans hielten sich auch Todesrachen fern. Größe allein zählte nur wenig, wenn ein ganzer Clan von den Bäumen herab angriff.
Der Todesrachen aber, der seinerzeit das Zwei-Bein angegriffen hatte, musste feststellen, dass es außer den Leuten noch mehr zu fürchten gab. Keiner der Leute, die still zuschauten, hatte jemals so etwas gehört wie das ohrenbetäubende Krachen aus dem Röhrending in den Händen des Zwei-Beins. Der heranstürmende Todesrachen hatte sich einmal in der Luft überschlagen, war auf dem Boden aufgeschlagen und hatte sich nicht mehr gerührt. In seinem reglosen Körper klaffte ein blutiges Loch.
Die Beobachter der Szene überwanden rasch ihr anfängliches Entsetzen. Sie empfanden grimmig Freude über das Schicksal des Todesrachen. Gleichzeitig jedoch war ihnen klar, dass jemand, der einen Todesrachen mit einem einzigen Bellen erlegte, ebenso leicht auch Leute töten könnte. Deshalb hatten sie entschieden, die Zwei-Beine zu meiden, bis man mehr über sie herausgefunden hatte. Die Kundschafter hielten immer noch Wache, als die Zwei-Beine nach etwa einer Viertelspanne ihre merkwürdigen, viereckigen Wohnnester abbauten, in ihr Ei zurückkehrten und wieder im Himmel verschwanden.
All das war lange, lange her, und Klettert-flink bedauerte, dass seither nicht viel mehr über die Zwei-Beine in Erfahrung gebracht worden war.
›Ich wünschte schon, wir hätten mehr erfahren, als die Zwei-Beine vor all den Spannen zum ersten Mal hier erschienen‹, sagte Schatten-Hetzer, fast als hätte er Klettert-flinks echte Gedanken gelesen, nicht nur die Emotionen, die sich in seinem Geistesleuchten widerspiegelten. ›Aber war es ein echter Glücksfall, dass die Kundschafter der Tänzer vom Blauen Berg überhaupt so viel gesehen haben – vor allem, mit welcher Leichtigkeit die Zwei-Beine den Todesrachen töten konnten. Und ein Glück war auch, dass die Sagen-Künderinnen sich an das alte Sagenlied erinnerten – so alt, wie es mittlerweile ist.‹
›Da hast du gewiss recht‹, bestätigte Klettert-flink, obwohl er nicht mit allem einverstanden war, was der junge Kundschafter gerade gesagt hatte. Nein, eigentlich war Klettert-flink in einem ganz anderer Ansicht: Es war ein Unglück, dass das Schicksal jenes Todesrachen die Leute von damals zu sehr verängstigt hatte, um eine Kontaktaufnahme zu wagen. Ein Glück hingegen war, dass noch Erinnerungen an jene längst vergangenen Spannen existierten – und das, obwohl das Lied über die Zwei-Beine für das Alltagsleben der Leute keinerlei Bedeutung mehr besessen hatte, seit es seinerzeit zum ersten Mal gesungen worden war. Doch genau dieses Lied fachte Klettert-flinks brennende Neugier an, was die Zwei-Beine betraf. Unzählige Male hatte er es sich schon angehört. Er wollte mit Hilfe des Liedes begreifen, was die Fremden damals gewollt hatten. Selbst jetzt, wo es schon viele Sagen-Künderinnen gesungen und geglättet hatten, enthielt es noch Untertöne, die Klettert-flink bei den Zwei-Beinen zu schmecken glaubte.
Er kannte nur die Version von Singt-wahrhaftig, der Sagen-Künderin des Clans vom Hellen Wasser, eine von vielen Versionen also. Lieder veränderten sich im Laufe ihrer Überlieferung. Damit musste man bei sehr alten Liedern rechnen … oder bei Liedern, die über lange Strecken weitergegeben wurden. Das Lied über die Zwei-Beine war beides: uralt und aus weiter Ferne. Obwohl seine Bilder nach wie vor klar und scharf waren, hatten die vielen Sagen-Künderinnen, die Singt-wahrhaftig vorangegangen waren, sie doch ein wenig eingefärbt und verzerrt, eine jede auf ihre persönliche Weise. Und so wusste Klettert-flink zwar, was die Zwei-Beine getan hatten, aber nicht weshalb. Letzte Spuren von Geistesleuchten, von dem die lange verstorbenen Beobachter der Ereignisse damals vielleicht noch gekostet hatten, waren über Zeit und Raum verloren gegangen.
Was Klettert-flink bei seinen eigenen Beobachtungen aufgefangen zu haben glaubte, hatte er bisher nur Singt-wahrhaftig anvertraut. Als Kundschafter war es seine Pflicht, den Sagen-Künderinnen Bericht zu erstatten, und diese Pflicht hatte er erfüllt. Er hatte Singt-wahrhaftig allerdings beschworen, seine Vermutungen für sich zu behalten. Denn manch anderer Kundschafter hätte ihn schallend ausgelacht. Vielleicht hätten sie damit Gebrochener-Zahn in dessen Vermutung bestärkt, Klettert-flink wäre für seine derzeitige Aufgabe kaum geeignet. Singt-wahrhaftig hatte nicht gelacht, ihm aber auch nicht zugestimmt. Klettert-flink wusste: Am liebsten wäre sie persönlich zum Clan vom Schnelllaufenden Feuer oder der Tänzer vom Blauen Berg gereist, um von deren ältesten Sagen-Künderinnen das Lied über die Zwei-Beine unverfälscht und direkt zu hören und nicht weitergereicht von einer Künderin zur nächsten.
Doch das stand außer Frage: Sagen-Künderinnen waren das Herz jedes Clans, das Speichernest der Erinnerungen, die Verbreiterinnen der Weisheit. Sagen-Künderinnen waren immer Weibchen; sie zu verlieren, durfte nicht riskiert werden. Damit war egal, was Singt-wahrhaftig gern wollte. Solange ein Clan keinen Überschuss an Sängerinnen besaß, musste er jede der möglichen Nachfolgerinnen schützen; gefährliche Aufgaben oder Unternehmungen waren ihnen strikt untersagt. Klettert-flink sah ein, dass das gut so war. Dennoch fand er die Folgen hinzunehmen schwieriger als die anderen Kundschafter und Jäger seines Clans. Es hatte durchaus seine Nachteile, der Bruder einer Sagen-Künderin zu sein, die es wütend machte, Freiheiten verwehrt zu bekommen, die ihr Bruder ganz selbstverständlich besaß.
Der Gedanke entlockte ihm ein bliekendes Lachen.
›Was ist dennh, fragte Schatten-Hetzer.
›Nichts Wichtiges‹, gab Klettert-flink zurück. ›Ich habe mich gerade an etwas erinnert, dass Singt-wahrhaftig einmal zu mir gesagt hat. Damals war sie gerade sehr wütend.‹
›Beruhigend zu wissen, dass zumindest jemand sie im Zorn lustig finden kann‹, versetzte Schatten-Hetzer trocken, und wieder lachte Klettert-flink.
Es stimmte ja: Zorn und Ärger seiner Schwester konnten bedrohliche Ausmaße annehmen. Der ganze Clan erinnerte sich an jenen Tag, an dem einem sehr viel jüngeren Schatten-Hetzer (er war fast noch ein Junges gewesen) ein Feuersteinmesser aus der Echthand gerutscht war. Vielleicht zwölf Leutelängen tief war es gefallen und hatte sich dann in einen Netzholzast gebohrt – vielleicht zwei Handbreiten neben Singt-wahrhaftigs Schwanz.
Hätte die Klinge ihr unfreiwilliges Ziel nicht verfehlt, wäre das alles überhaupt nicht lustig gewesen. Kurzer-Schweif hatte die letzte Handbreit seines Schweifs bei einem ganz ähnlichen Unfall eingebüßt, und Singt-wahrhaftig hätte ernstlich verletzt werden oder sogar ums Leben kommen können. Aber Schatten-Hetzers Reaktion war lustig gewesen – und hatte ihm seinen Namen eingetragen: Kaum dass Singt-wahrhaftig sich mit all der Macht ihrer Geistesstimme aufzuregen begann, war er wie ein Blitz hinein in den nächsten Schatten geschossen.
›Natürlich hätte sie sich nie einen Teppich für ihr Lager aus dir gemacht, junger Bruder‹, erklärte Klettert-flink voller unerwarteter Zuneigung für den anderen Kundschafter. ›Und mit mir wird sie auch nicht so verfahren -auch wenn es hin und wieder Momente gibt, wo ich mir da nicht ganz sicher bin.‹
›Ich bin nicht übermäßig erpicht darauf herauszufinden, ob du damit recht hast‹, bemerkte Schatten-Hetzer mit Nachdruck.
›Der weise Kundschafter wagt sich nicht in den Bau des Todesrachen, nur um zu sehen, ob er daheim ist‹, pflichtete ihm Klettert-flink bei. Er seufzte wohlig und streckte sich auf dem Bauch aus, die Echthände unter dem Kinn gefaltet. Er richtete sich auf langes Warten ein. Schatten-Hetzer legte sich neben ihn. Kundschafter lernen schon früh Geduld. War beim Erlernen dieser Lektion mehr Eifer erforderlich, gab es genug, was einen dazu anhielt: von gefährlichen Stürzen bis hin zu Angriffen von Todesrachen. Derlei Nachhilfe hatte Klettert-flink nie gebraucht. Deswegen und nicht seiner Verwandtschaft zu Singt-wahrhaftig wegen war er der ranghöchste Späher des Clans gleich hinter Kurzer-Schweif, dem obersten Kundschafter im Clan vom Hellen Wasser – und das, obwohl Klettert-flink noch so jung war.
So wartete er nun reglos im warmen Sonnenschein und beobachtete das merkwürdige, von einer scharfen Kante gekrönte Wohnnest, das die Zwei-Beine mitten auf der Lichtung errichtet hatten.
3
»Was ist dieses Mal der Grund für das Chaos, das du in meiner Werkstatt anrichtest?«, erkundigte sich Stephanies Vater schicksalsergeben; ein unterdrücktes Lachen schwang in seinem Tonfall mit. Er lehnte am Türrahmen seiner Kellerwerkstatt, in der Hand eine halb volle Kaffeetasse. Stephanie lächelte ihn über die Schulter hinweg an.
»Ich habe über das nachgedacht, was Mom über die Selleriediebe erzählt hat,« antwortete sie.
Sie öffnete eine der penibel beschrifteten Schubladen und fand den gesuchten Schaltungschip. Rasch vergewisserte sie sich, dass noch mindestens ein weiterer T-Chip in der Schublade lag. Es gehörte zu den Bedingungen, unter denen Stephanie Werkzeuge und Gerätschaften ihres Vaters nach Herzenslust nutzen konnte, dass sie im Blick behielt, welche Ersatzteile nachbestellt werden mussten. Dann widmete Stephanie ihre Aufmerksamkeit wieder ganz dem Gehäuse des kleinen Geräts, mit dem sie sich gerade befasste.
»Und dieses Nachdenken hat dich zu einer Schlussfolgerung gebracht, die … das hier erklärt?«, fragte ihr Vater nach, hob eine Augenbraue und wedelte mit der Kaffeetasse in Richtung der sonderbaren Apparate, die allmählich Gestalt annahmen.
»Na ja …« Stephanie unterbrach ihre Arbeit und blickte ihren Vater ernst an. »In gewisser Weise schon, ja. Am Anfang kam mir das natürlich auch ziemlich komisch vor. Ich meine … ausgerechnet Sellerie?« Sie verdrehte die Augen, und Richard musste lachen. Sellerie stand auf Stephanies Liste mit Lieblingsspeisen nicht gerade ganz oben: Energisch dazu aufgefordert oder bei großem Hunger konnte sie sich dazu zwingen, das Zeug herunterzuwürgen, aber das war’s auch schon. »Bisher sind laut allen Berichten immer nur eine oder höchstens zwei Knollen verschwunden. Wer macht sich denn so viel Mühe, um dann nur so ein bisschen zu klauen?«
»Ah, ich verstehe.«
Seit fast einem ganzen T-Jahr berichteten mehr und mehr Siedler von kleineren Erntediebstählen. Anfangs hatte man angenommen, es müsse sich um einen bizarren Scherz handeln, weil jedes Mal ausschließlich Sellerie verschwand und das in lächerlich kleinen Mengen.
»Als Mom mir davon erzählt hat, habe ich zuerst gedacht, dahinter stecken irgendwelche Zorkköpfe – jemand, der den Sellerie bloß irgendwo versteckt oder vielleicht sogar wegwirft und das für todkomisch hält«, fuhr Stephanie fort. »Nichts als ein blöder Scherz also – nicht viel blöder als ein paar von den anderen Streichen, von denen ich in Twin Forks schon gehört habe – nein, sogar weniger blöd!«
Nach kurzem Schweigen meinte ihr Vater: »Nun, weißt du … nicht alle Kinder in Twin Forks sind blöd, Steph.«
»Hab ich doch auch nicht gesagt«, stellte sie richtig, klang dabei aber von ihren eigenen Worten nicht überzeugt. »Aber manchmal kann man diesen Eindruck schon bekommen.«
»Nicht bei allen«, widersprach er. »Okay, aber bei einigen schon.« Ein kurzes, bestätigendes Nicken folgte. »Bei diesem Rowdy Chang zum Beispiel.«
»Stan Chang?« Stephanie neigte den Kopf zur Seite; der unverkennbare Zorn in der Stimme ihres Vaters hatte sie überrascht. Er war sonst eher der sanftmütige Typ. »Was hat er denn diesmal angestellt?«, fragte sie zögernd.
»Er sagt, das Ganze habe nur ein Scherz sein sollen – und sein Vater unterstützt ihn darin auch noch«, erklärte Richard. »Aber für den Rottweiler von Ms. Steinman war das ganz und gar nicht komisch! Chang hat eine Stolperfalle gebaut. Wer hineintappt, über den sollten sich bei diesen Temperaturen fünf Liter Wasser ergießen. Haben sie auch – gewissermaßen. Glücklicherweise über Brutus und nicht eines der anderen Kinder.«
»Gewissermaßen?« Stephanie war anzuhören, dass sie innerlich die Augen verdrehte.
»Sagen wir’s so: Ein Schreiner ist an dem Burschen nicht verloren gegangen! Als Brutus die Falle ausgelöst hat, ist das ganze Ding in sich zusammengebrochen.« Richard schüttelte den Kopf, eine eher resignierte Geste, keine zornige mehr. »Der arme Kerl wurde unter einem Holzbalken eingeklemmt. Es hat ihm das rechte Vorderbein zerquetscht. Wir haben fast eine Stunde gebraucht, um ihn rauszuholen. Anschließend war ich mehr als zwei Stunden beschäftigt, den Ärmsten zusammenzuflicken. Ich glaube nicht, dass er sich vollständig von dieser Verletzung erholt.«
Stephanie nickte. Ihr Vater sagte immer, ein Tierarzt könne seine Patienten ja nicht nach ihren Beschwerden fragen. Umgekehrt nützten Erklärungen eines Menschen, wo das Problem liege, auch nichts. Einfühlsam müsse man sein und sehr fürsorglich, um das wettzumachen. Kein Wunder, dass er jetzt so zornig war!
»So richtig leid getan hat’s Stan wohl auch nicht, was?«, fragte sie, und ihr Vater stieß ein raues Lachen aus.
»Nein, den Eindruck hat er nicht gerade gemacht«, pflichtete er seiner Tochter bei. »Ich meine, schließlich ist Brutus ja bloß ein Tier, oder? Und wie Stan sagt: Ist ja nicht so, als wäre der Hund jetzt tot, oder so.«
Kurz blickten die beiden einander an, und wieder einmal spürte Stephanie, wie sehr sie ihren Vater liebte. Es war so typisch für ihn, sich ganz auf die Seite des Hundes zu schlagen. Sie versuchte sich das Gespräch zwischen ihrem und Stans Vater vorzustellen. Dass es ein Gespräch gegeben hatte, stand außer Frage.
Da hätte ich wirklich gern Mäuschen gespielt, dachte sie und schmunzelte. Ich wette, Dad war so wütend, dass Funken gesprüht sind!
»Auf jeden Fall hat Stan damit eindeutig bewiesen, dass man noch viel, viel blödere Dinge anstellen kann, als bloß Sellerie zu stibitzen«, sagte sie dann und rang so ihrem Vater ein Lächeln ab. »Anfangs habe ich gedacht, dahinter steckt jemand, der sich über die Vorstellung scheckig lacht, wie alle aufgescheucht rumlaufen, um dieses Rätsel zu lösen. Aber dann habe ich mal nachgeforscht, wo überall Sellerie verschwunden ist und auf einer Landkarte eingetragen. Stell dir vor: praktisch überall! Da müssten dann so gut wie alle Kinder auf diesem Planeten in den Streich eingeweiht sein!«
»Tja«, gab ihr Vater zurück, »als deine Mom davon erzählt hat, habe ich über die räumliche Verteilung gar nicht nachgedacht.« Er grinste. »Natürlich wäre das angesichts meiner genialen Geistesgaben unweigerlich früher oder später geschehen.«
»Ja, klar«, meinte Stephanie und verdrehte die Augen.
»Spaß beiseite: Das war wirklich eine gute Idee«, sagte er. »Du kannst tatsächlich keiner Herausforderung widerstehen.«
»Stimmt«, pflichtete sie ihm bei. »Und du bist nicht der Einzige, der über die räumliche Verteilung nie nachgedacht hat. Auch ich hätte es nicht bemerkt, wenn die betroffenen Farmer nicht zu Moms Gentechnikprogramm gehören würden.«
Sie schürzte die Lippen, und ihr Vater verkniff sich ein Seufzen.
Sellerie gehörte zu den terrestrischen Pflanzen, die nur schlecht an die Gegebenheiten von Sphinx angepasst waren. Das Projekt, das Stephanies Mutter leitete, sollte genau das ändern. Der Genetiker, der es ins Leben gerufen hatte, war dem letzten Wiederaufflackern der Seuche zum Opfer gefallen. Daher hatte Marjorie Harrington fast ganz von vorn anfangen müssen und eine völlig neue Strategie entwickelt, die mittlerweile im Rahmen von Freilandversuchen erprobt wurde. Die daran beteiligten Farmer erstatteten regelmäßig Bericht, ob sich der gewünschte Erfolg einstellte. Im Zuge eben dieser Berichte hatte sie erstmals von den geheimnisvollen Selleriediebstählen erfahren.
»Auf den zweiten Blick lässt sich ein gewisses Muster erkennen«, sagte Stephanie und wandte sich wieder einem der geheimnisvollen Apparate auf der Arbeitsfläche zu. »In etwa vier oder fünf Regionen scheinen sich die Diebstähle zu häufen. Dazwischen gibt es große Regionen, die überhaupt nicht betroffen sind. Außerdem vermute ich, dass das Ganze schon etwas länger läuft, als bisher angenommen.«
»Ach, und warum?« Richard hob die Augenbrauen.
»Die Leute hier waren ziemlich beschäftigt, Daddy. Erst mussten sie sich mit der Seuche herumschlagen und ums Überleben kämpfen. Danach wollten alle so rasch wie möglich zu einem geregelten Leben zurückkehren. Da war es bestimmt nicht sonderlich knifflig, hier und dort unbemerkt auf Sellerie-Raubzug zu gehen – vor allem, wenn die Knollen wirklich einfach vom Feld stibitzt wurden. Wahrscheinlich ist der Diebstahl nur aufgefallen, weil der Sellerie während der Wintermonate aus den Gewächshäusern geklaut wird. Niemand kann wissen, wie viele Knollen verschwunden sind, ohne dass es bemerkt wurde.«
»Kein schlechter Gedanke«, räumte ihr Vater ein.
»Die Sache ist die …«, fuhr sie fort, »egal, wann es angefangen hat, es passiert an mehr als einem Ort. Aber bislang ist es noch niemandem gelungen, den oder die Diebe auf frischer Tat zu ertappen.«
»Hat man sich denn groß ins Zeug gelegt, um sie zu fassen?«
»Na jaaaa …«
Mit nachdenklich gerunzelter Stirn blickte Stephanie auf. Sie suchte nach den richtigen Worten. In ihren Augen gab es einen großen Unterschied zwischen ›sich ins Zeug zu legen‹ und das mit Sinn und Verstand zu tun. Aber das war nicht die Frage ihres Vaters gewesen, und so zuckte sie mit den Schultern.
»Die meisten vermuten wohl, dass Kinder dahinterstecken«, meinte sie. »Bei den kleinen Mengen Sellerie, die gestohlen wurden, ist ja wohl kaum jemand großartig zu Schaden gekommen. Na ja, und auf Sphinx einen blühenden Schwarzmarkt für gestohlenen Sellerie zu vermuten, halte ich für eher hirnrissig. Sagen wir’s mal so: Die Leute hatten Besseres zu tun, als Selleriediebe zu jagen.
Inzwischen sind die Diebe aber dreister geworden, was die gestohlenen Mengen angeht. Unter den Betroffenen sind daher die ersten, die fürchten, es könnte bald auch noch um etwas anderes gehen als um Sellerie. Außerdem stammt ein Großteil der Knollen aus den Gewächshäusern des Versuchsprojekts, genau wie Mom gesagt hat. Da fällt es natürlich auch am ehesten auf, wenn etwas fehlt. Doch wenn das so weitergeht oder sich auch noch auf andere Versuchsflächen ausdehnt, könnte das einige Langzeitprojekte gehörig durcheinanderbringen. Also nimmt man seit ein paar T-Monaten die Frage ein bisschen ernster, was eigentlich vor sich geht und wie man dem Ganzen ein Ende machen könnte. Und ja, schon gut, mich reizt die Herausforderung.«
»Inwiefern nimmt man die Sache jetzt ernster?«, bohrte ihr Vater nach und erntete ein neuerliches Schulterzucken.
»Na ja, auf den ersten Blick schien ja alles ganz einfach. Manche Tatorte, eigentlich die Mehrheit der Lagerhäuser, sind wirklich verflixt eng. Also hat man sich gedacht: Das waren Kinder. Oder sonst jemand, der nicht sehr groß ist. Man wollte Fallen aufstellen, aber der Forstdienst hat abgewunken. Schließlich gibt es ja immer noch die Elysäische Regel.«
Schlagartig verdüsterten sich die Mienen von Tochter und Vater. Die Elysäische Regel war vor mehr als tausend T-Jahren aufgestellt worden, weil nach einer Kette von Irrtümern und Fehlentscheidungen die gesamte Ökologie der Koloniewelt Elysium zerstört worden war. Die Regel verbot kategorisch den Einsatz tödlicher Gewalt gegen Lebensformen, die unzureichend erforscht und bei denen nicht zwingend belegt war, dass sie eine lebensgefährliche Bedrohung für Menschen darstellten. Niemals hätte eine Planetenverwaltung im Frühstadium der Besiedlung den Verstoß gegen diese Regel in Erwägung gezogen, nur weil wirtschaftlicher Schaden angerichtet wurde – und schon gar nicht wegen des Verschwindens geringer Mengen von Sellerie. Dafür mussten deutlich gewichtigere Argumente ins Feld geführt werden.
»Wir wissen nicht, wer für die Selleriediebstähle verantwortlich ist. Also können wir uns auch keine Fallen überlegen, die in absolut jedem Fall Leben schonen«, erklärte Stephanie. »Trotzdem hat das ein paar Siedler nicht davon abgehalten, Fallen aufstellen zu wollen. Gut, dass Chief Ranger Shelton denen das nicht hat durchgehen lassen!«
Sie grinste befriedigt. In ihren Augen hatte der Chief Ranger seinen Job gut gemacht, ehe sie fortfuhr.
»Statt Fallen wurden dann Sensoren und Alarmsirenen eingesetzt. Alle sind davon ausgegangen, es müssten Kleintiere sein. Deshalb wurden zuerst einfach Stolperdrähte gezogen und mit Lichtquellen und ferngesteuerten Kameras verbunden. Aber das hat nichts gebracht. Unsere Selleriediebe verbringen entweder nicht viel Zeit auf dem Boden, oder sie sind intelligent genug, Stolperdrähte zu umgehen.«
Nachdenklich schwieg sie einen Moment, kniff die Augen zusammen und suchte dann den Blick ihres Vaters .
»Ich glaube auch, dass die Diebe einer einheimischen Lebensform angehören, die ziemlich klein ist und dazu gerissen. Was mir nicht in den Kopf will, ist, warum eine auf Sphinx heimische Lebensform ausgerechnet auf Sellerie versessen ist.«
»Dafür fallen mir gleich mehrere mögliche Gründe ein«, sagte ihr Vater. »Immerhin ist das Manticore-System trotz der höheren Schwerkraft von Sphinx unter anderem deswegen für Kolonisten so interessant, weil die Ökosysteme aller drei Planeten demjenigen bemerkenswert ähneln, in dem sich die Menschheit entwickelt hat.« Sein Blick verfinsterte sich. »Wahrscheinlich konnte die Seuche auch nur deswegen entstehen und uns derart hart treffen.«
Er schüttelte den Kopf. Es wirkte wie eine Entschuldigung.