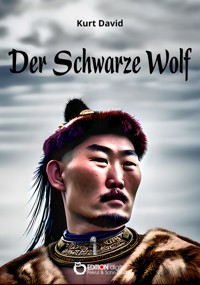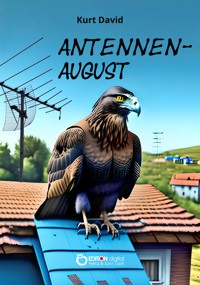7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
In diesem Buch begegnet man einem Mann, der im Alter von 32 Jahren schrieb: „Es fehlte wenig, und ich endigte selbst mein Leben …“ Man fragt sich, warum? Er war taub, unheilbar taub - und Musiker! Aber unsterblich war er an diesem Tag noch nicht. Du hörst und liest, wie er es wurde. Du wirst mit ihm über seine Verzweiflung stolpern und erleben, wie er trotz körperlicher Leiden sein gewaltiges Werk schafft. Du wirst dabei sein, wenn er liebt und unglücklich ist, wenn er hasst und zürnt, wenn er jubelt und aufbegehrt. Niemand kann ihn besiegen! Wenn man ihn verwundet, steht er wieder auf! In diesem Buch begegnet man einem Menschen, der im achtzehnten Jahrhundert geboren wurde. Aber dass er und sein Werk unsterblich sind, erzählen dir auch Begebenheiten aus dem zwanzigsten Jahrhundert: im heutigen Wien, im Bergdorf Poronin, in den Schützengräben einer Dnepr-Insel, in der mongolischen Steppe und anderswo. Seinen Namen kennt die ganze Welt: Ludwig van Beethoven.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Impressum
Kurt David
Begegnung mit der Unsterblichkeit
Ein Beethovenbuch für junge Leute
ISBN 978-3-96521-936-6 (E-Book)
Das Buch erschien erstmals 1970 in Der Kinderbuchverlag Berlin.
© 2023 EDITION digital Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
Die gewaltigste Raserei seiner Kraft, die er ganz leise beschwichtigen konnte, oft aber nicht beschwichtigen wollte, und das Toben seiner Fröhlichkeit übertreffen alles, was man in dieser Art in den Werken anderer Komponisten findet.
G. B. Shaw
Wien
1966
Ein Mann reiste nach Wien, um für sein Buch über Ludwig van Beethoven Studien zu machen. Das war im Sommer des Jahres 1966. Er hieß Sandrino, und wer das hörte, sagte erstaunt: „Aha, Sie sind Italiener?“ Sandrino schüttelte dann vergnügt den Kopf, nannte seinen Vornamen Fritz, und da wussten die Frager, dass er unmöglich ein Italiener sein konnte. Manchmal fügte er hinzu, seine Vorfahren hätten Sandring geheißen. Durch einen Schreibfehler wäre später daraus Sandrino geworden.
Sandrino aber gefiel Herrn Sandrino; denn er liebte die Musik, also auch seinen musikalischen Namen. Seinen Vornamen hatte er als Kind gehasst: Fritz! Frederico, das wäre was gewesen, Frederico Sandrino!
Er trug seinen Koffer am Zug entlang, hastig und schnell, weil er fürchtete, keinen Platz mehr zu bekommen. Aber das Abteil war leer, und da saß er dann allein und dachte: So, nun kann es anfangen. Er hatte sich immer wieder überlegt, womit er denn nun anfangen sollte. In einer Biografie hatte er zu Hause gelesen: „Ludwig van Beethoven ward seinem Vater Johann, einem Sänger in der Kapelle des zu Bonn hofhaltenden Kurfürsten Max Friedrich, Erzbischof von Köln, Mitte Dezember 1770 geboren.“ Nein, so wollte er nicht beginnen, auch nicht so ähnlich, und überhaupt: Ich fahre erst mal nach Wien, und dort werde ich sehen, wo und wie das alles ist.
Der Zug fuhr ab und rollte aus der dunklen Halle in die helle Sonne.
An den Waggons des Zuges war zu lesen: Berlin – Prag – Wien. Die Bauern auf den Feldern blickten zu Sandrino herüber, als wüssten sie, dass er nach Wien fuhr. Manch einer guckte, als wollte er sagen: Der schaukelt vergnügt durch die Landschaft, und unsereins schuftet sich halb tot bei der Hitze.
Es war wirklich heiß, sehr heiß, bereits am Morgen. Dicke gelbe Staub- und Spreuwolken stiegen aus den Mähdrescherkolonnen und zogen in breiten Schwaden gegen die Sonne.
Sandrino reiste nicht das erste Mal nach Wien. Im Kriege war er schon dagewesen. Als er damals der großen Stadt entgegengefahren war, hatte er an die Bücher und Bilder gedacht, die er gelesen und gesehen hatte. Er hatte sich einer Stadt genähert, die er sich in seiner Fantasie und in seiner Liebe zur Musik als die schönste aller Städte vorstellte. Vielleicht hatte er während seiner Träume im Zug sogar den Krieg vergessen und mehr an Beethoven als an Stalingrad gedacht; denn als er die Stadt sah, sah er nicht, was er hatte sehen wollen, weil alles, was die Stadt an Kunst zu bieten hatte, hinter dicken gelben Sandsäcken verborgen oder in tiefen Betonkellern versteckt war. Nur die Gräber von Beethoven, Mozart, Haydn und Schubert hatte er besuchen können. Schutzlos lagen sie da, stumm wie Millionen Gräber, und weil die Stadt der Musik damals ohne Musik war, kam es ihm vor, als wäre alle Musik mit begraben worden.
Der Express des Jahres 1966 hatte Dresden durchfahren, und Sandrino blickte auf die Elbe hinab, die ihm links des Zuges entgegenkam. Das war in der Sächsischen Schweiz. Hinter der Grenze wuchs Hopfen, unendlich viel Hopfen; und dann schlief Sandrino plötzlich ein. Das hatte er natürlich nicht gewollt, und noch schlimmer: Er erwachte erst wieder weit hinter Prag. Zu seinem Erstaunen saß ein Herr am Fenster. Irgendwo musste der zugestiegen sein. Da vor Sandrinos Augen noch ein bisschen Schlaf hing, glaubte er für einen Moment, das Titelblatt eines feinen, wirklich superfeinen Herrenmodejournals klebe an dem gegenüberliegenden Polstersitz. Der Mann war total neu! Selbst Gesicht und Hände wirkten wie die Prüfungsarbeit von vier Kosmetikerinnen. Nicht waschen, las Sandrino am blauen Etikett des silbergrauen Mantels im Winkel des Platzes.
Der Schaffner kam.
„Bittschön“, sagte der feine Mann. Auch Sandrino sagte etwas, worauf der Bittschön-Mann freudig ausrief: „Da schau her, a Deitscher!“
Fritz Sandrino nickte. Er freute sich, gleich während der Fahrt einen Österreicher vor sich zu haben.
Der Zug fuhr jetzt durch die letzten Ausläufer des Böhmerwaldes: Die hohen Tannen standen dunkel und schön gegen das gelbe Nachmittagslicht der Moorlandschaft. Lange Gräser und schwarze Wassertümpel. Manchmal glitt ein Dörfchen vorbei, mit grauen Schindeldächern und braunweiß gefleckten Kühen.
„A bisserl traurig, die hiesige Landschaft, net? Schaut alles aus, als wär grad einer gstorben“, meinte der Mann und blickte mitleidsvoll wie auf ein Begräbnis.
„Und mir kommt’s vor, als hörte ich Musik“, sagte Sandrino leise. „Durch Böhmens Hain und Flur sozusagen.“ Er lächelte freundlich zu dem Österreicher hinüber, aber der guckte ganz verdattert.
„Musik? I hör keine. Was für Musik hörns denn da?“, fragte er misstrauisch und blickte sich im Abteil um.
„Durch Böhmens Hain und Flur“, wiederholte Sandrino ebenso leise wie vorhin.
„Aha.“ Der Mann schaute misstrauisch.
„Ich meine“, sagte Sandrino, „wenn ich diese Landschaft sehe, höre ich Smetanas Musik Durch Böhmens Hain und Flur.“ Das Gesicht des andern hellte sich wieder auf. „Wissens, jetzt versteh ich“, sagte er, „der Smetana war also ein Musikant und hat zu der Landschaft da draußen“, er deutete mit dem Kopf in die Richtung, „die Musik gmacht.“
„So ungefähr“, sagte Sandrino.
„Sie müssen wissen, ich versteh von so was nix, rein gar nix. Ich handle nur mit Därmen und …“
„… womit?“
„Mit Därmen für die Würst. Ich vertret eine spanische Firma.“
„Ach.“
„Ja, schon neinzehn Jahr“, rief er aus und machte ein Gesicht, als wundere er sich, dass Sandrino das nicht wusste.
Der betrachtete den Mann nur mit Missbehagen. Er sah den eleganten Anzug, die tadellos gebundene Krawatte auf dem makellos weißen Oberhemd und den silbergrauen Mantel. Oben im Gepäcknetz lag ein schwarzer Koffer. Sicher voll „Därme für die Würst“, dachte Sandrino und schaute wieder hinaus auf die ernsten Tannen und die geduckten Häuser mit den Schindeldächern. Der Mann sieht aus wie ein Diplomat, dachte er, aber eben nur aussehen tut er so.
Der Schnellzug donnerte an der Donau entlang. Sie war nicht blau, sie war abenddunkel, und breit war sie, und die Wochenendhäuser, schon auf Pfähle gebaut, standen im Wasser des übergetretenen Flusses. Lange Lichtgirlanden flitzten wie blitzende Perlenschnüre vorbei. Irgendwo in schwarzblauer Ferne, noch von sanften Bergen verdeckt, musste die große Stadt sein. „Wo fahrens eigentlich hin?“, fragte der Vertreter.
„Nach Wien.“
„Ja, da schau her, na Wien!“ Und leiser: „Da bin i gboren. Und was wollens da machen, mein Herr?“
„Studien über Beethoven.“
Der Händler hatte jetzt den Mund offen. „Studien, aha, Studien.“ Er beguckte sich den Fremden, der da Studien über Beethoven treiben wollte, von Fuß bis Kopf.
„Ich will über Beethoven schreiben.“
„Schriftsteller also.“ Er kniff ein wenig die Augen zusammen. „Ja, mei Gott, lohnt sich denn das heitzutage noch? I mein, wird dabei was verdient?“
Sandrino schwieg verlegen.
Der Wiener stand auf, hob seinen Koffer aus dem Gepäcknetz und sagte: „Pardon, mein Herr, i wollt Sie natürlich net aushorchen, aber als Geschäftsmann interessierts einen halt, was bei solch einer Sach …“ Er brach ab und stellte den Koffer hinaus auf den Gang. „Beethoven“, sagte er und lächelte Fritz Sandrino zu.
Der Zug hielt.
Der Mann ging und drehte sich nicht mehr um. Rechts trug er den schwarzen Koffer, links einen hellen Hut. Den Koffer übernahm ein flinker Gepäckträger. Und nachdem ein Zeitungsverkäufer geschrien hatte: Playboy Nummer eins heiratet Brigitte Bardot, griff der Därmehändler nach dieser Zeitung. Aber zum Lesen während des Gehens war es zu dunkel in der Halle des Franz-Josef-Bahnhofs; der Mann steckte die Zeitung in die Jackettasche und lief zu einem Taxi.
Als das Auto abgefahren war, sah sich Sandrino die Bahnhofshalle an und die Leute, die zu den Zügen liefen und von den Zügen kamen. Während der Playboy Nummer eins noch immer Brigitte Bardot heiratete, rief ein anderer Zeitungsverkäufer: Vergiftetes Eis zum Nachtisch, vergiftetes Eis zum Nachtisch! Ein Polizist rannte durch die Halle. Alle blickten ihm nach, als sei er dem Mann auf der Spur, der das Eis vergiftet hatte, das Nachtischeis.
Sandrino stand vor dem Bahnhof, wie Fremde vor fremden Bahnhöfen stehen: unsicher, ratlos, müde. Wohin? Es fehlte nicht an Aufforderungen; die Lichtreklamen tanzten auf Dächern, sprangen in den Abendhimmel, kletterten grellbunt an Fassaden hoch, umliefen Schaufenster und Türeinfassungen, über den nassen, bunt schillernden Asphalt glitten Autos. Die Gesichter hinter dem Glas leuchteten gelb, rot, blau, grün, weiß, und die Reklamesprüche huschten verzerrt über die verchromten Bleche. In diesem Labyrinth der zuckenden Lichter entdeckte Sandrino eine blaue Leuchtschrift: Mozart-Hotel. Man hatte noch ein Zimmer, und sie waren alle sehr nett zu ihm, der Empfangschef, der Portier und Xaverl, der Diener mit der giftgrünen Schürze. Der brachte ihn bis zu seinem Zimmer. Mit müder Stimme fragte Sandrino den Xaverl, ob es draußen in Wien-Heiligenstadt ein Beethovenmuseum gäbe: dort wollte er hin.
Xaverl schüttelte gutmütig den Kopf und meinte, das könnte Herr Sandrino vielleicht in der Hotelzentrale erfahren. „Nach so was bin i noch nie gfragt.“ Und als er wegging, sagte er: „Aber an guten Wein kriegens draußen in Heiligenstadt, an Nußdorfer.“
Die Zentrale des Hotels Mozart vermochte ihm am Morgen auch keine Auskunft zu geben. Und während Sandrino so im Foyer wartete, beobachtete, wie sie seinetwegen in Prospekten und Stadtplänen blätterten, trat er vor den übrigen Hotelgästen etwas scheu zurück. Manche sahen ihn an, als sei er ein bedauernswerter Kauz, der nach etwas gefragt habe, was man hier sowieso nicht beantworten könne. Trotzdem war es für Sandrino interessant, in der Hotelhalle herumzustehen: Die Gäste schritten lautlos über weiche Teppiche, verschwanden im Mozart-Espresso oder im Frühstückszimmer, grüßten mit „Habe die Ehre, Herr Kommerzialrat“ und „Grüß Sie Gott, Herr Hofrat“, und Fritz Sandrino dachte, nun brauchte eigentlich nur noch der selige Kaiser Franz um die Ecke zu kommen und nach einem Martini verlangen. Aber der kam natürlich nicht, trotz aller Kommerzien- und Hofräte.
Ratlos hingegen waren die Herren der Hotelrezeption. Sie bedauerten sehr, nicht helfen zu können, und so fuhr Sandrino einfach los. Erst mit der Straßenbahn, dann mit der Stadtbahn, und später lief er die berühmte Grinzinger Straße hinauf nach Heiligenstadt. Links und rechts standen herrliche Sommerhäuschen in gepflegten Gärten. Schaute er zurück, sah er die große Stadt Wien, die Hauptstadt der Musik, wie sie einst genannt wurde, blickte er geradeaus, schien es ihm, als führen all die blitzenden Autos neben ihm direkt in den blauen Himmel. Wo war Beethoven? Auf dieser Straße, die zu seiner Zeit ein holpriger Weg gewesen sein mag, wird er oft gewandert sein. Sandrino fragte Kinder, ob sie wüssten, wo das Beethovenhaus sei, und sie schüttelten die Köpfe und lachten, weil er nicht so sprach wie sie. Die Erwachsenen lachten nicht, wussten aber genauso wenig wie die Kinder. „Pardon, aber i bin net ausm XIX. Bezirk“, sagte einer, und ein anderer meinte: „Ja, da hab i schon amal was ghört davon, aber i weiß net“, er machte eine Pause und schaute die Straße hinauf, „da gehns vielleicht am gscheitesten die Straßen weiter, und dort, wo so viele Autos herumstehen, da könnts sein.“
Der Mann mit den Autos hatte recht gehabt; denn als Sandrino zufällig in eine der engen Gassen geriet, sah er Wagen für Wagen, feine Wagen aus der großen weiten Welt. Sie parkten mit zwei Rädern auf der Straße und mit zwei Rädern auf schmalen Gehsteigen vor niedrigen alten Weinrestaurants. Über bunt bemalten Türen baumelten grüne Kiefernbüschel. Hier wurde Heuriger ausgeschenkt. Die Gasse hieß Probusgasse, und Fritz Sandrino wusste, in ihr musste das Beethovenhaus sein, das bedeutendste Beethovenhaus. Er fand es auch bald. Eine Tafel war angebracht, so dass er jetzt sicher sein konnte, vor dem Haus zu stehen, in dem Ludwig van Beethoven am 6. Oktober 1802 sein Testament geschrieben hatte.
Die Tür aber war verschlossen.
1802
Als die Tür sich öffnete, trat Beethoven heraus. Das war an einem Sommermorgen des Jahres 1802. Er blickte hinunter zur Stadt. Die Sonne musste gleich aufsteigen. Die Hügel um Wien lagen wie ein Wall vor dem Morgenlicht und sahen schwarz aus.
Beethoven lief die Gasse hinauf, und er lief zwischen den Weinhügeln dahin wie ein Fliehender. Ich werde mir das Leben nehmen, dachte er und ging schneller. Aus einem Hof rollte ein riesiges Fass übers Pflaster. Pferde scheuten. Das Fass polterte über die Gasse und prallte gegen die Hauswand. Beethoven hatte die Arme hochgerissen und etwas geschrien, aber das Fass war vorübergerollt, ohne ihn zu verletzen. „Ja, passens doch auf!“, brüllte der Weinbauer, „glei hätt’s Ihna derwischt!“ Der Mann rannte über die Gasse und hieb mit einem Holzhammer den herausgesprungenen Spund zurück ins Fass.
Beethoven sagte nichts.
Am Gassenrand lief roter Wein durch den Staub.
„Sie stengans da wie a Leich“, sagte der Bauer und lachte. „Ja, ja, das kommt davon, wenn man net richtig ausgschlofe hat. Da hört und sieht ma in der Frua rein gar nix!“ Beethoven starrte den Mann an.
„Was wollns denn von mir?“, fragte der Weinbauer und wich einen Schritt zurück.
„Ich …“, sagte Beethoven leise, verstummte aber gleich wieder und packte den Bauern kurz unterm Kinn an seiner Jacke.
Der blickte in das sonnengebräunte Gesicht und auf die struppigen schwarzen Haare. Und die Hände erst: Sie waren blau, tintenblau, und die Augen, sie glühten vor Zorn.
„Ich …“, sagte Beethoven nochmal leise, und der Weinbauer knickte ein wenig in den Knien zusammen und wurde kleiner.
„Gnä Herr“, stammelte er, „i wer scho aufpassn s nächste Mal!“
„Ja“, antwortete Beethoven und dachte: Was er nur immerfort redet. Er ließ den Weinbauern los und brüllte plötzlich: „Wenn ich schon sterben will, dann nicht durch Euer dummes Weinfass.“
„Er ist nicht normal“, sagte der Weinbauer entsetzt und wich weiter zurück in seinen Hof, wo Frau und Tochter standen. „Was der für wilde Augen hat und so blaue Finger.“
Beethoven schüttelte abweisend den Kopf und sah dem Mann verächtlich nach. Was hat das schon für einen Sinn, dachte er, wenn ich ihm sage, ich höre schwer und manchmal höre ich gar nichts, wenn ich ihm erzähle, dass meine Hände, auf die er guckt, als seien es die Pfoten eines Teufels, so blau sind, weil ich heut Nacht während des Komponierens wieder das Sausen und Brausen in den Ohren hatte und daher in meiner Wut das Tintenglas ins Klavier warf?
„Jetzt geht er“, sagte die Frau im Hof.
Und der Mann fügte hinzu: „Endlich.“
Als sich Beethoven umwandte, stand ein junger Mann vor ihm. „Ist was mit Euch, Meister?“
„Ries!“
„Ich hörte Schreien.“
„Kommt, wir gehen, Ries.“ Beethoven blickte noch einmal zu dem Weinbauern zurück.
„Habt Ihr ihn vielleicht beleidigt?“, rief der junge Ries dem Mann im Hof zu.
„I? Um Himmelswülln, weswegn denn! A Weifassl is über die Gassn grennt, und do wärs glei passiert, weil der Herr net aufpasst hat. Dabei hams des Gepolter gwiss bis drinnen in der Stadt ghört, aber der Mann, mit Verlaub gsagt, hat no a wengerl gschlofn!“
„Geschlafen?“, wiederholte Ries. „Er ist krank an den Ohren, hören Sie, krank! Er hört schwer.“
„Mariaundjosef, dabei is der Herr no so jung!“
„Und Musiker.“
„A des no“, sagte der Weinbauer. „Musik machn und net hörn, des is ja grad aso, wie wenn aner Bilder moln tät und seine Bilder net sehen könnt.“
„Schrecklich“, seufzte die Frau.
„Do kann sie aner glei aufhängn“, bemerkte der Bauer und trampste über die Gasse, um das fortgerollte Weinfass zurückzuholen.
Beethoven und Ries aber waren schon ein Stück fort. Die Sonne schien auf ihre Rücken. Beethoven ging einen Schritt vor Ries, als wollte er ihm davonlaufen.
Ich werde mir das Leben nehmen, dachte er noch einmal.
Die Gasse stieg mächtig an, und oben ging ein wenig der Wind. Aber es war schön hier. Die beiden Männer sahen das kleine Nußdorf und den lieblichen Kahlenberg in der Ferne. Der Weg lief jetzt in die Felder hinaus, war eingefasst von Schwarzpappeln und Ulmen. Eine Kutsche rollte heran, eine adlige Karosse. Zwei Schnellläufer in eigentümlichen Kostümen trabten ihr voraus. Als dieser Zug bunter Uniformen vorbei war und nur grauen Staub hinterlassen hatte, schritten Beethoven und Ries weiter hinein in die Felder.
Warum geht man spazieren, wenn man sich das Leben nehmen will? überlegte Beethoven. Kein Mensch kann das Land so lieben wie ich. Jeder Baum und jeder Bach spricht zu mir. Und: Kann man sich denn das Leben nehmen, so lange es etwas gibt, das man liebt?
Er drehte sich plötzlich um und sagte: „Sprich lauter, Ries.“
„Ich sagte nichts, Meister.“
Beethoven hob den Kopf wie ein erschreckter Vogel und blickte sich misstrauisch um.
Ries dachte: Wie konnte ich so unüberlegt reden und sagen, ich sagte nichts, Meister? Hätte ich zum Beispiel behauptet, gesagt zu haben: Der Kahlenberg ist höher als der Hermannskogel, dann hätte ich ihn von seinem Ohrenleiden abgelenkt, und er hätte mir sofort erklärt, dass der Hermannskogel höher als der Kahlenberg ist. Natürlich würde er das nicht getan haben, ohne mir zu erzählen, woher er das so genau weiß.
„Ein Ast wird’s gewesen sein“, rief Ries lustig und sprang an den Wegrand, hob einen dürren Zweig auf, schrie: „Ja, der dürre Ast war’s. Er ist von der Pappel gebrochen, und dieser Laut war es, der Euch …“
„… schon gut, Ries.“ Beethoven machte eine abweisende Handbewegung und ging weiter.
Der junge Ries betrachtete beim Gehen die kurzen Beine und die breiten Schultern seines Meisters. Den Kopf hatte Beethoven gesenkt und die Hände auf dem Rücken. Ries sah auch auf die Hände, besonders auf die Daumen, die sich wie ein Mühlrad umeinander drehten. Mal vorwärts, mal rückwärts, dann lange vorwärts und ganz kurz rückwärts. Beethoven und Ries liefen gegen den Wind, und Ries, der an Beethoven vorbeigegangen war, um ihn etwas zu fragen, sagte: „Wie ergeht es dem 2. Satz in Eurer 2. Sinfonie, Meister?“
„Besser als mir.“ Beethoven hob den Kopf. „Ich bin traurig, und die Sinfonie ist lustig, mein Leben ist hässlich, voller Elend, und das Leben in der Sinfonie ist heiter, voller Glück.“ Er blieb stehen. „Wie oft habe ich schon mein Dasein verflucht, Ries.“
„Die Sinfonie seid aber Ihr. Vielleicht in Euren Wünschen, Träumen.“
Beethoven schwieg und sah seinen Schüler an, nachdenkend und ernst.
„Ihr solltet so werden, wie Ihr in Eurer Sinfonie vorgebt zu sein, Meister.“
„Also meine Taubheit mit einem Freudenfest feiern?“
Ich weiß, dachte er, wie Ries es meint, weshalb antworte ich ihm so böse?
„Ich wollte sagen“, begann Ries zögernd, „in Eurer Sinfonie, an der Ihr arbeitet, seid Ihr, wie Ihr im Leben sein müsst, wenn Ihr die Finsternis in Euch vertreiben wollt.“
Bei jedem Wort, das Ries sprach, schaute Beethoven auf seinen Mund. Der Schüler gab sich Mühe, die Buchstaben so zu formen, dass sie von seinen Lippen abzulesen waren.
Sie schritten jetzt an einem Bach entlang. Vögel flatterten in den Uferbüschen, und die großen hellen Steine im Wasser sahen aus, als lägen sie unter Glas. Beethoven und Ries setzten sich mitten zwischen die Sommerblumen. Zehn Sträucher bachaufwärts war ein Hirt bei einem Holunderbusch. Seine Herde zog den Hang hinauf, wo sie von zwei Schäferhunden immer wieder zurückgetrieben wurde.
Beethoven lag auf dem Rücken und blickte in den Himmel. Wolken waren nur wenige da, und die Lerchen flatterten an diesem Morgen außergewöhnlich hoch über der Erde. Das schien Beethoven zu beruhigen; denn er meinte sie deshalb nicht zu hören, weil sie so außergewöhnlich hoch an diesem Morgen geklettert waren.
Ries sah den Hirten von dem Holunderstrauch weggehen und sich nahe bei seinen Schafen hinsetzen.
„Ich bin froh, wenn du so bei mir bist, Ries.“
„Ich auch.“
„Und du brauchst mir für die Stunden nichts mehr zu zahlen, Ries.“
„Ich dank auch, Meister.“
„Das Alleinleben ist wie Gift für meine Ohren.“ Aber er sagte Ries nicht, dass er heut früh noch gedacht hatte: Ich werde mir das Leben nehmen.
Ries legte sich auch auf den Rücken, blickte aber nicht in den Himmel, sondern in Beethovens Gesicht. „Ich kann für die Stunden, die Ihr mir gebt, Eure Sachen kopieren.“
„Natürlich, Ries.“
„Da lern ich dabei, Meister.“
Sie sprachen dann wieder eine Weile nichts, und Beethoven hatte die Augen geschlossen. An den zusammengezogenen Brauen und den Falten auf der Stirn war zu erkennen, dass er nicht schlief, sondern grübelte oder vielleicht horchte. Aber zu hören waren nur die Lerchen, trotz der Höhe, und der nahe Bach, und das alles vernahm nur Ries. Beethoven hörte nichts.
„Wie war das Konzert gestern Abend beim Grafen, Meister? Wollt Ihr mir nicht berichten?“
„Doch, Ries, es war genau acht Takte lang, mein Konzert. Ich hörte nämlich, wie sich der Graf mit der Gräfin sehr laut und deutlich unterhielt, als spielte ich gar nicht, als wäre ich nicht im Palais. Und da bin ich aufgesprungen, wütend, wie du dir denken kannst, und habe gesagt: Für solche Schweine spiele ich nicht.“
„Schweine habt Ihr gesagt?“
„Schweine! Stimmt das vielleicht nicht? Schweine grunzen, wann sie gerade wollen, auch bei Musik.“ Beethoven richtete sich erregt auf und meinte: „Du hättest sehen sollen, wie sie dagesessen haben, nachdem ich das gesagt hatte: wie Steine, wie graue, stumme, tote Steine, mit blitzendem Schmuck behangen. Ich habe die Kälte noch in meinem Rücken gespürt, als ich schon das Palais verlassen hatte.“
„Meister!“
Beethoven hob plötzlich den Kopf, lauschte und flüsterte: „Still, sei mal still, Ries, da ist doch was.“
„Der Hirt.“
„Der Hirt?“
„Des Hirten Flöte aus Fliederholz“, sagte Ries und war so froh, dass auch Beethoven die Melodie vernahm.
„Ich höre nichts mehr“, sagte Beethoven leise.
„Ich auch nicht“, schrie Ries und log.
„Wo sitzt er denn, der Hirt?“
Ries merkte das Misstrauen und sagte: „Er muss dort unten sitzen, hinter dem Strauch, Meister.“ Es war die entgegengesetzte Richtung, in die Ries mit dem Finger wies. „Man sieht ihn nicht.“
„So, man sieht ihn nicht.“ Sie schwiegen beide. Der Hirt spielte weiter auf seiner Fliederholzflöte, aber das hörte nur Ries, während Beethoven angestrengt lauschte und in die Richtung blickte, wo nach Ries’ Aussage der Hirt saß.
„Ich höre“, behauptete Beethoven, „ich höre ihn wieder.“
„Ja, aber nur ganz leise“, erwiderte Ries, obgleich der Hirt jetzt gar nicht spielte. „Wo wollt Ihr hin? Meister, warum steht Ihr auf?“
„Ich will sehen, wo er sitzt, Ries. Du hast mir doch den Strauch gezeigt, und da will ich mich überzeugen, ob er auch bei diesem Strauch sitzt.“ Er ging in die entgegengesetzte Richtung.
„Meister, ich vermute nur, dass er …“
„Eben, und deshalb will ich nachsehen. Meinst du, wir finden ihn nicht? Da müsste er ja im Himmel sein und Flöte spielen.“ Beethoven umlief Strauch für Strauch, kam immer dichter an den Bach heran; manchmal blieb er stehen, lauschte, weil er glaubte, je näher er dem Hirten komme, desto besser müsse er sein Flötenspiel hören.
Der Hirt saß allerdings an einer ganz anderen Stelle. Ries hatte gelogen, damit Beethoven nicht merkte, wann der Hirt spielte und wann er nicht spielte. Denn sonst hätte Ries nicht lügen können, und lügen musste er, wenn er den Meister nicht an seine Krankheit erinnern wollte.
Beethoven kehrte zurück. „Dort ist nichts“, sagte er. „Kein Hirt, keine Flöte, du hast dich geirrt, Ries. Komm mit, wir gehen da hinauf.“
Nach ein paar Schritten blieben sie stehen, und Beethoven horchte.
„Nichts“, sagte er. Plötzlich rief er ganz entsetzt: „Dort sitzt er ja, ich seh ihn, er spielt, Ries, er spielt, ich höre nichts, und er spielt! Siehst du, wie er spielt, siehst du, wie seine Finger an dem Fliederholz hinauf- und hinablaufen? Siehst du das, Ries? Oh, ich seh’s, und ich hör es nicht.“
„Ich höre auch nichts“, behauptete Ries. „Der Wind, wisst Ihr, der Wind trägt die Melodie fort un …“
„Der Wind?“ Beethoven blickte wieder misstrauisch auf Ries. „Dann gehen wir noch ein paar Schritt, Ries“, sagte er vorsichtig. Und sie gingen wieder ein paar Schritt, immer den Hirten und die Flöte im Blick. „Stehenbleiben“, befahl Beethoven. „So, hörst du etwas?“
Oh, wie schwer er es mir macht, dachte Ries. Sage ich, nein, ich höre nichts, und er hört etwas, weiß er, dass ich ihn belüge, sage ich, ja, ich höre das Spiel, und er hört es nicht, weiß er, wie schlimm sein Leiden ist.
„Ob du was hörst, Ries?“
„Fast ist mir so, als ob ich etwas hörte.“
„Ich hör gar nichts“, sagte Beethoven. „Ich seh ihn und hör nichts. Das ist wie am Klavier. Bin ich am Klavier oder spiele selber, hör ich’s, also muss ich auch zu dem Hirten, und wenn ich bei ihm sein werde, höre ich die Flöte.“
„Aber vorhin, Meister, habt Ihr den Hirten doch als erster gehört, und so weit ab.“
„Ja, vorhin, Ries. Es ist manchmal so, und manchmal ist es anders, und dann ist wieder das Rauschen in den Ohren und …“ Er verstummte ganz plötzlich, drehte sich um, ging über die Wiese zurück und am Bach entlang, blickte weder nach dem Hirten noch nach Ries. Auch zum Himmel schaute er nicht auf, sondern senkte den Kopf, hielt die Hände wie zuvor auf dem Rücken, und die Daumen, die Daumen drehten sich wieder wie ein Mühlrad, und Ries lief wieder einen Schritt hinter Beethoven her.
Zurück nahmen sie einen anderen Weg. Er führte über einen Hügel voller Felsen. Zwischen den Felsen wuchsen große Eichen. Fast schien es, als wollte Beethoven wieder davonlaufen, so stürmte er den Hang hinauf. Die Leute, die ihnen begegneten, schauten den beiden verwundert nach; hatten sie sich gezankt? Oben angekommen, sagte Ries: „Ihr solltet den Arzt wechseln, Meister.“
„Soso!“ Beethoven stand auf den Steinen, den Blick auf den Bach und die Wiese gerichtet, auf der sie eben noch gewesen waren. „Der eine schickt mich nach Heiligenstadt wegen der guten Quelle. Ich bade. Und? Nichts! Der andere sagt, ich solle heiße Bäder nehmen. Und? Nichts! Der nächste sagt, ich solle laue Bäder nehmen. Und? Nichts! Ganz zu schweigen von den Kräuterkuren, die ich gemacht habe, Ries.“ Er sprang vom Stein. Sein Blick wanderte an den alten Bäumen hinauf. „Die sind gesund.“
Der gelbe Sandweg schlängelte sich durch ein Holunderwäldchen. Als sie es auf der anderen Seite, verließen, standen sie vor einem Wirtshaus, das Zum Weinhimmel hieß.
„Ich habe Hunger“, erklärte Ries.
Beethoven antwortete nicht, ging aber widerspruchslos mit; sie mussten durch ein hohes hölzernes Tor und standen dann in einem gepflasterten Hof mit Stühlen und Tischen. Statt des Himmels war über ihnen der Wein; er rankte an Schnüren und Drähten, schlängelte sich über den Hof. Die Trauben hingen so tief, dass manche Gäste nur den Mund hätten aufzumachen brauchen, um hineinzubeißen.
Von den Wirtsleuten war keiner zu sehen. An Gästen war nur ein alter Mann da. Er saß vor einem Glas Wein und redete mit dem Harfenisten, der auf einem niedrigen Bänkchen im Winkel des Hofes hockte.
Als sich Beethoven und Ries gesetzt hatten, fing der Harfenist sofort zu spielen an, einen Gassenhauer, wie es schien.
Beethoven hatte bisher geschwiegen und auf die Tischplatte gestarrt, als studiere er die Maserung des Holzes. Aber das war nicht so; denn diese Linien nahm er nur verschwommen wahr, seine Gedanken waren bei seinem Ohrenleiden und der Furcht, alle würden bald von seiner Schwerhörigkeit wissen. Bis jetzt hatte er es immer einzurichten gewusst, dass die meisten Menschen glaubten, er wäre nur zerstreut, wenn er sie wiederholt fragte, was sie gesagt hatten. Auch im Orchester, wenn er sich beim Pianissimo weit vorneigte oder gar bei einem Klaviersolo den Kopf nahe an die Tastatur hielt, nahm die Mehrheit an, er wolle damit andeuten, dass er das perfekteste Pianissimo verlangte.
Ries, der sich nach den Wirtsleuten erkundigt hatte, erzählte, sie wären im Heu und kämen gleich. „Übrigens war es nicht nötig, dass ich ging, sie zu holen, Meister. Der Harfenist hat den Auftrag, immer dieses bestimmte Liedchen zu spielen, wenn ein neuer Gast kommt. So wissen sie bei ihrer Arbeit im Heu, dass sie gebraucht werden.“
„Harfenist?“ Beethoven wandte sich um und sah erst jetzt den Wirtshausmusikanten im Winkel. „Ich will hören, was er spielt.“ Er setzte sich in die Nähe des Harfenisten und betrachtete ihn.
Als die Wirtin auftauchte, hörte der Harfenist auf zu spielen.
„Grüß Gott die Herrn, was wünschens denn?“
„Eine Portion Austern“, sagte Ries.
„Für beide?“
Ries guckte zu Beethoven.
„Ich will nichts.“
„Also nur für mich“, sagte Ries verlegen.
„Und der andre Herr? Was darfs denn sein? Hams vielleicht an bsondern Wunsch?“
„Ja“, erwiderte Beethoven, „ich möcht in Ruhe gelassen werden.“
„Wenns davon satt werden?“ Die Wirtin begab sich zur Küche.
„Vielleicht geh ich noch mal zu dem Pfarrer in Sankt Stephan, der mir immer das gelbe Zeug in die Ohren geträufelt hat“, sagte Beethoven.
„Natürlich.“
„Ich werde morgen gleich gehen.“
Ries nickte, und dann wurden die Austern gebracht.
Der Harfenist hatte wieder zu spielen angefangen. Der alte Mann trank den letzten Schluck aus seinem Weinglas. Bevor er den Hof verließ, legte er eine Münze auf den Tisch und warf eine weitere Münze in die Mütze des Musikanten. Als er gegangen war, beendete auch der Musikant sein Lied.
„Spiel weiter – oder war das schon alles?“, schrie Beethoven.
„Sofort, der Herr, sofort! Wenns alles hören wollten, müsstens a paar Tag dableiben.“
„Spiel!“
„Wollt Ihr nicht doch etwas bei der Wirtin bestellen, Meister?“
„Still!“ Beethoven machte eine Kopfbewegung hin zu dem Harfenisten. Der spielte und spielte, und aus seinem Spiel war die Freude zu hören, dass ihn einer gebeten hatte, zu spielen. Da war Wehmut, Lust, Trauer und Lachen, Jubel und Seufzen; und all diese Weisen, oft nur Gassenhauer, schwebten unter dem grünen Himmel aus Weinlaub und Trauben.
Beethoven lauschte. Es war gut, dass er nicht das Schlirren der Austernschalen hörte, wenn sie Ries vom Teller schob. Er wäre wütend geworden, hätte gebrüllt vor Zorn, den Teller vielleicht über den Hof geworfen. Aber nein, er hörte diese Geräusche nicht, sondern lauschte dem Harfenisten. Plötzlich nahm Beethoven ein Päckchen Notenpapier aus seinem Rockschoß und einen dicken Bleistift, wie ihn Zimmermannsleute verwenden, und schrieb, schrieb, kritzelte auf und zwischen den Notenlinien herum und sagte zu dem Musikanten: „Aufhören! Sofort aufhören!“
„Aufhören?“
„Ja doch! Beim Teufel, du sollst aufhören!“
„Da hab i grad erst angfangen und …“
„Sei still“, flüsterte Ries. Beethoven schrieb noch.
Ein vornehmer alter Herr mit einer sehr schönen jungen Dame betrat den Hof. Er trug einen hellbraunen Zylinder mit einer blitzenden Silberschnalle auf der Stirnseite, sie einen mohnroten Flechthut mit einer weißen Schleife, die in den Nacken herabhing.
„Champagner“, rief der vornehme alte Herr und hielt sich an der Dame fest. Und noch einmal rief er: „Champagner! Grüß Sie alle Gott und sans meine Gäst.“ Dabei fuchtelte er mit einem schwarzgelackten Spazierstock in der Luft herum, schlug versehentlich in das Weingerank.
„Ruhe!“, schrie Beethoven. Und Ries befahl er: „Schmeiß diesen geputzten Ochsen raus!“
„Aber Meister!“
„Komm, Nannerl, hier san, glaub ich, Verrückte“, sagte der alte Herr und verließ eilig den Hof.
Als Beethoven zu Ende geschrieben hatte, sagte er fröhlich: „Das war ein Motiv, ein Motiv, Ries, vier Takte. Ich sag ja, in den Gassenhauern stecken Perlen.“
Ries nickte, aber der Musikant saß noch immer ganz verdattert in seinem Winkel.
Beethoven rief die Wirtin. Den Harfenisten lud er an seinen Tisch.
Es war sehr warm geworden, obgleich sie unter dem Himmel aus Weinlaub und Trauben im Schatten saßen. Beethoven bestellte Wein und eine Schüssel gesottene spanische Rebhühner.
Der Musikant schnalzte mit der Zunge. „Mariaundjosef, des wird a Festmohl. Sans vialleicht gar a Fürst?“
Gelächter antwortete ihm.
Ries freute sich, dass Beethoven nun besserer Laune war.
„Die vier Takte aus dem Gassenliedchen waren wohl sehr gut, Meister?“
„Oho, Ries, und wie gut! Du solltest hören, was ich daraus gemacht habe.“ Beethoven aß hastig. Wer ihn nicht kannte, musste annehmen, er fürchte, nicht genug von den spanischen Rebhühnern zu bekommen. Er trank ebenso hastig, stand plötzlich auf und sagte: „Bist du fertig, Ries?“ Und an den Harfenisten gewandt: „Vielleicht erfahrt Ihr später einmal, wie ich aus Euren vier Takten hundert und mehr gemacht habe!“
„Dann werd i mich an dieses fürstliche Essen erinnern, Meister. Wenns wieder amol a paar Takte brauchen, geb ich sie Ihnen und noch zehn gratis dazu.“
Beethoven und Ries ließen den Harfenisten bei der noch halbvollen Fleischschüssel zurück.
„Wir könnten über Nußdorf laufen“, schlug Ries vor.
„Nußdorf? Ein Umweg.“
„Aber Meister, die Luft, das Wetter …“
„Ich muss sofort nach Hause, Ries.“
„Aha, die vier Takte.“
„Ja, sie laufen in mir herauf und herunter, und das kribbelt überall, und überall sind Gedanken und Melodien und Ideen und …“
„Also doch“, unterbrach Ries, „das Beste, so scheint mir, an Euer Übel nicht zu denken, ist Beschäftigung.“
Sie hatten eine Stelle erreicht, von der aus sie auf die Donau hinabschauen konnten, aber Beethoven blieb nicht einmal hier stehen, um diesen schönen Ausblick zu genießen.
Außerhalb eines Gartenzaunes fanden sie ein einzelnes Hühnerei neben einer Distel.
„Wir nehmen’s mit“, sagte Ries.
„Steck’s schon ein.“ Beethoven lächelte und sah zu, wie Ries sich bückte, das Ei ins Taschentuch rollte und in der Hose verschwinden ließ.
„Als wir noch in Bonn wohnten und ich ein kleiner Knabe war, habe ich auch immer Eier gestohlen“, sagte Beethoven.
„Bei der Bäckersfrau Fischer, ich weiß“, sagte Ries.
„Ich habe dir die Geschichte schon erzählt?“
„Fünfmal mindestens, Meister.“
„So“, Beethoven überlegte einen Augenblick und sagte: „Dann erzähl du sie mir mal! Will hören, ob du sie noch weißt, wie ich sie berichtet habe.“
Ries lachte. „Auswendig kann ich sie, Wort für Wort, Meister.“
„Fang an“, forderte Beethoven streng.