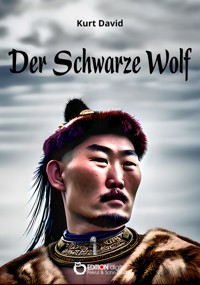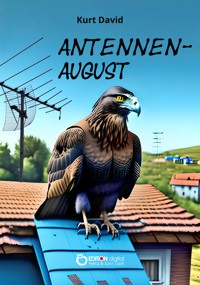6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Die abenteuerliche Geschichte spielt 1921, zur Zeit des nationalen und sozialen Befreiungskampfes in der Mongolei. Im Mittelpunkt steht der fünfzehnjährige Tomor, dessen Vater von den Weißgardisten verschleppt wird. Tomor bricht auf, um seinen Vater freizukaufen, schließt sich der Revolutionsarmee an und nimmt an der Befreiung seines Volkes teil.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Impressum
Kurt David
Der singende Pfeil
ISBN 978-3-96521-932-8 (E-Book)
Das Buch erschien erstmals 1962 in Der Kinderbuchverlag Berlin.
© 2023 EDITION digital Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
Dieses Buch wurde beim Preisausschreiben für Kinder- und Jugendliteratur des Ministeriums für Kultur 1962 mit einem Preis ausgezeichnet.
Für Leser von 11 Jahren an.
Jagd durch die Steppe
Lautlos wie eine Wölfin hatte sich die Finsternis davongeschlichen. Erste Sonnenstrahlen tasteten nach langen Gräsern. Tautropfen blitzten. Steppenlerchen stiegen auf, schrien lustig. Und in der Ferne klagten Kiebitze.
Tomor lag am Berghang und hatte sich mit einem Schafspelz zugedeckt. Er schlief. Neben ihm träumte seine Schwester.
Plötzlich peitschten Schüsse.
„Wölfe!“
Tomor weckte seine Schwester, griff nach dem Gewehr und spähte kniend aus dem hohen Gras. Die Schafe ihrer Herde waren aufgesprungen, schüttelten sich und rannten unruhig durcheinander. Der Hirtenhund umkreiste die Tiere, kam jedoch wieder zu Tomor, setzte sich und sah den Jungen mit großen Augen an, als sollte es heißen: Keine Wölfe.
Und abermals fielen Schüsse.
„In der Schlucht.“ Das Mädchen fuhr sich erregt durchs Haar. Danach presste es die Hände vor den Mund und schloss für Sekunden die Augen.
Tomor und Maral-Goa rannten den Berg hinauf.
„Weine nicht! Vielleicht waren es doch Wölfe“, sagte Tomor, obwohl er selbst nicht mehr daran glaubte.
„Dazu ist es schon viel zu hell.“ Maral-Goa trocknete mit dem blauen Rockärmel die Tränen.
Über dem Gipfel kreiste ein Adler. Während des Kletterns dachte Tomor: Deine Augen möchte ich haben. Du kannst schon alles sehen, die Schlucht, unsere Jurte, den Vater, die Mutter, unsere Schafe und – ja, was und? Tomor kletterte hastiger. Jäh fiel der Adler herab, fing sich, schoss jenseits des Berges in die Schlucht. Beute. Wie hieß sie? Und weil Tomor den Adler nicht mehr sehen konnte, klammerte sich sein Blick an ein weißgelocktes Wölkchen, das über dem felsigen Gipfel dahinzog. Auch du siehst unsere Schlucht, unsere Jurte, den Vater, die Mutter, die Schafe und – ja, was und?
Als Tomor den höchsten Fels erreicht hatte, sah Maral-Goa, wie sich der Bruder duckte und hinter einem rötlichen Steinblock versteckte. Er zog seine Schwester zu sich heran. „Siehst du sie, Maral-Goa, siehst du die Wölfe?“
„Weiße“, flüsterte das Mädchen.
Aus der Schlucht jagte eine Abteilung uniformierter Reiter. Die Weißgardisten waren in Sibirien von der Roten Armee geschlagen worden.
Auf ihrer Flucht fielen sie in die Mongolei ein, wollten ihre geschwächten Abteilungen mit Mongolen auffüllen, um von hier aus, neu geordnet und gestärkt, abermals in die junge Sowjetunion eindringen zu können. Der Anführer ihrer Banden hieß Baron Ungern von Sternberg.
Im Tal rannten Schafe wild umher, flohen die grünen Hänge hinauf, blieben ängstlich stehen und blickten zurück, als wollten sie sehen, ob die Weißen noch da wären.
Tomor und Maral-Goa liefen zu ihren Pferden, sprangen in die Sättel und ritten hinunter zur Schlucht. Ihre zweiundsiebzig Schafe, die sie für den Fürsten dieses Gebietes hüteten, überließen sie dem Hirtenhund.
„Wehe, wenn diese weißen Wölfe unseren Eltern etwas zuleide getan haben! Die skorpionköpfige Göttin Aurita soll ihnen im Nacken sitzen“, schrie Tomor und knallte mit der Peitsche.
Die Mutter saß im Gras und hielt ein stundenaltes Lämmchen im Schoß verborgen. Sie hatte es so in das rote Tuch ihrer weiten Tracht gewickelt, dass auf der einen Seite das Stummelschwänzchen, auf der anderen das Stummelnäschen herausguckte. Die Mutter weinte. Als sie Pferdehufe hörte, duckte sie sich, fürchtete, die Weißen kämen wieder. Erst als die Kinder sie ansprachen und nach dem Vater fragten, sah sie auf.
„Sie haben ihn mitgenommen.“ Die Frau legte das Lämmchen in den Schatten der Jurte. „Du wirst unser Soldat werden, haben sie gesagt. Und wenn du es nicht willst, werden wir dich mit einem Halsbrett, dem Schandkragenholz, schmücken oder an den Schweif unserer Pferde binden und durch die Steppe schleifen, bis nichts übrig bleibt von dir als die Schnur, an der du gehangen hast. So haben sie gesprochen, Kinder.“
„Yama (Der Höllenrichter nach lamaistischem Glauben) soll die Weißen an der Zunge durch die heiße und kalte Hölle schleifen“, schimpfte Tomor. Die Mutter warf ihm einen missbilligenden Blick zu.
Sie weinte nicht mehr.
Nahe der Mutter lag der Hirtenhund. Tot. Auf seinem schwarzen Fell schimmerte Blut.
„Und acht Schafe haben sie abgeschossen, gestohlen.“
Maral-Goa drückte sich an die Mutter. Tomor stand einige Schritte entfernt und hatte zum Zeichen des Zornes die Rockärmel über die Hände gestreift.
„Zorn ist Sache der Gottheiten. Du hast kein Recht, dazustehen wie die fuchsköpfige Göttin mit einer schweren Keule“, tadelte die Mutter. „Beten wir.“
Er wagte nicht zu widersprechen, sondern folgte Mutter und Schwester in die Jurte.
Auf einem bunt bemalten niedrigen Schränkchen glänzte eine bronzene Buddha-Figur. Davor flackerte ein trübes Ollämpchen. Durch den hölzernen Dachkranz fiel schräger Sonnenschein.
Mutter und Kinder knieten vor der Bronzefigur nieder und drückten ihre Stirnen ins kühle Steppengras.
„Om mani padme hum“ (O Kleinod in der Lotosblüte), sagte die Mutter.
„Om mani padme hum“, sagten die Kinder. Tomor aber sah ein Bild: Der Vater, auf einem Pferd gefesselt, wurde von den Weißen verschleppt. Om mani padme hum. Der bronzene Gott auf dem niedrigen Schränkchen schaute Tomor so freundlich, mild und gut an, als wäre Vater noch in der Jurte und die acht Schafe nicht tot.
„Om mani padme hum“, murmelte die Mutter und ließ den Gebetskranz mit den Holzkügelchen durch die Finger gleiten. Plötzlich richtete sich der Junge auf und sprach zu der kleinen Buddha-Figur: „Ich reite ihnen nach.“
„Tu das, Tomor“, erwiderte das Mädchen hastig und schaute den Bruder aus ihren schwarzen Augen bittend an.
Da wandte sich die Mutter um und meinte: „Gut, dann reite zunächst zum Lama und bitte ihn, er möge die Götter fragen, was zu tun ist, Tomor. Nach seinem Rat richte dich.“
Er nahm das Gewehr, reinigte es mit Butter und las die leeren Patronenhülsen auf, welche die Weißen im Grase zurückgelassen hatten. Sie müssen reichlich Patronen haben, wenn sie die Hülsen wegwerfen, dachte Tomor. Wir Hirten heben sie nach jedem Schuss auf und füllen sie wieder.
Am Gestänge des hölzernen Dachkranzes hing rotes Schaffleisch zum Trocknen. Die Mutter schnitt drei Streifen ab und gab sie dem Jungen. „Und in diesem Beutel ist zerstoßener Tee.“ Danach reichte sie Tomor ein blaues Seidentuch, da man zu einem Priester nie ohne Geschenke kommen durfte. „Als ihr noch klein ward, haben die Chinesen (Fast zweihundert Jahre wurden die Mongolen von den Mandschus beherrscht. Es war die schwerste Zeit in der Geschichte des mongolischen Volkes. Erst im Jahre 1911 gelang es der nationalen Befreiungsbewegung, die fremden Eroberer aus dem Lande zu jagen.) den Vater zu ihrem Militär geholt. Mit drei Pferden konnte ich ihn loskaufen. Nimm die silberne Schale mit, Tomor. Wenn du in die große Stadt kommst, erkundige dich, ob sich auch die Weißen auf solch einen Handel einlassen. Tausche die Schale.“
„Wenn sie Schafe stehlen, stehlen sie auch Pferde und brauchen sich keine durch Handel zu verschaffen“, sagte der Junge.
Die Mutter erwiderte: „Die chinesischen Soldaten stahlen und handelten. Mit den Menschen ist es wie mit den Kräutern in der Steppe: Es gibt giftige und gute, mit den einen kann man töten, mit den anderen Menschen gesund machen.“
„Und von mir nimmst du die Korallenschnüre“, sagte Maral-Goa. Die Mutter nahm sie ihnen weg. „Die bleiben hier. Ist die Schale nicht genug? Wenn wir alles hergeben, was wir von den Vätern erhielten, sind wir ihnen gegenüber genauso verloren wie ein Mensch ohne Pferd in der weiten Steppe.“
Tomor ging zu seinem schwarzen Hengst. Er hieß Dschebe – Pfeil. Als er im Sattel saß, meinte die Mutter: „Und denke an die Sprüche der Alten, Tomor: Sei nicht wie ein Löwe, der seinen Grimm nicht unterdrücken kann, sei nicht wie ein Falke, der vor Zorn und im Wahn auf seinen eigenen Schatten niederstößt, sei nicht wie ein Barus-Tier (Tiger), das blindlings anstürmt.“ Sie brachte eine kleine Birkenholzschale mit Milch, tauchte ihre Finger hinein und bespritzte Tomor nach altem Brauch: „Amarchan sain jawaarai.“ („Gute Reise“)
Er ritt aus der Schlucht. Neben ihm Maral-Goa, die zur Fürstenherde wollte, um sie in die Nähe der Jurte zu treiben. „Fürchtest du dich vor den Göttern, Maral-Goa?“
„Warum fragst du, Tomor?“
„Weil ich nachdenke, was zu tun ist, wenn die Götter mir durch den Mund des Lamas sagen lassen, ich dürfte den Weißen nicht nachreiten, um Vater loszukaufen.“
„Und wenn es so ist, Tomor?“
„Deshalb frage ich, ob du vor dem Zorn der Götter Angst hast.“
„Ich habe Angst, Tomor. Die Götter schicken Krankheiten, du weißt es, und diese Krankheiten fressen die Herden auf. Und die Götter schicken den tödlichen Sturm, der Tag und Nacht schreiend und brüllend über die Steppe rast, Jurten zerschlägt, Pferde und Reiter peitscht. Oh, die Götter können zornig sein.“
„Und wenn es so ist, warum schicken die Götter den Weißen keine Krankheiten, bevor sie unsere Herden rauben, den Vater verschleppen? Warum strafen sie uns, die wir keinem etwas gestohlen haben?“
„Ich weiß es nicht, Tomor. Frage den Lama, er weiß alles und kann lesen und schreiben. Durch seinen Mund sprechen die Götter.“
Sie verabschiedeten sich.
Tomor ritt hinaus in die unendliche Steppe. Kein Baum, kein Strauch, nur Gras und Blumen, Himmel und Sonne. Kein Weg schlängelte sich durch die Weite, kein Fluss oder Bach grub sich durch die Ebene. Tomor, der fünfzehnjährige Mongolenjunge, war mit der Unendlichkeit allein. Dschebe, der Pfeil, der schwarze Dschebe raste sorglos und fröhlich dahin. Tomor und das Pferd hatten einen einzigen treuen Gefährten, den dunklen Schatten, der mit ihnen um die Wette lief. Hier und da schreckten sie einen Adler oder ein Steppenhuhn auf. Die Tiere schlugen ärgerlich mit den Flügeln und schwebten über das hohe Gras. Der Reitwind rauschte in Tomors Ohren.
Als die Sonne hoch stand, Schluchten und Bergfalten mit grellem Licht füllte, und die Hitze über dem silbernen Federgras flimmerte, wuchs vor Tomors Augen am Horizont, dort, wo Himmel und Steppe zusammenflossen, ein blaulila Dschungel in den wolkenlosen Himmel. Märchenhafte Riesenbäume zitterten, wurden von unsichtbaren Kräften geschüttelt und niedergebeugt, dass es aussah, als spanne ein Riese seinen Bogen. Dann schnellten die Bäume wieder in die Höhe, malten mit ihren weiten mächtigen Ästen ein dunkles Lila in den gewölbten Himmel.
Tomor beachtete diesen Spuk kaum. Er war eine zu alltägliche Erscheinung in der Steppe. Eine Fata Morgana. Zudem musste er sehr genau darauf achten, die Richtung nicht zu verfehlen. Und da ein Hügel oder Berg dem anderen glich, hatte er auf Winzigkeiten zu sehen. Gut, jeder Berg und jedes Tal trugen einen Namen. Da war der Schlangenberg und dort der Heilige, eine Mulde weiter wuchs der steinerne Pantherkopf ins Blau.
Ritt man ihn vom Westen, Süden oder Osten her an, sah er aus wie der Heilige oder der Schlangenberg und wie sieben andere. Betrachtete man ihn von der Nordseite, entdeckte man zwei Querschnitte, die das Wasser der Vorzeit gegraben hatte. So hatte jeder Berg und jedes Tal sein Zeichen. Tomor hatte es von seinem Vater gelernt, so, wie es für jeden Bewohner der Steppe selbstverständlich ist, die kleinsten Dinge wahrzunehmen. Jede Veränderung teilt ein Hirt dem nächsten mit. Und wenn die Weißgardisten sich Mongolen fingen, so nicht nur, um sie als Soldaten für ihre Interessen zu missbrauchen, sondern auch, weil sie sich ohne mongolische Hirten im Lande schwer zurechtfanden und Umwege sparen wollten.
Als die Sonne unterging und die große Scheibe hinter dem hohen Steppengras verschwunden war, ritt Tomor einen steinigen Hang hinauf, um ein Lager für die Nacht zu suchen. Er hatte geglaubt, an diesem Tage das Dorf zu erreichen, in dem der Lama wohnt. Die Finsternis war schneller.
In einem windgeschützten Felsspalt wucherte wildes Gestrüpp, dornig und ausgedörrt. Tomor brach Zweige, suchte nach trockenem Dung von wilden Schafen und Ziegen. Unter einem vorspringenden Fels machte er sich ein Feuer für die Nacht. Er hatte Durst, doch hier sprudelte keine Quelle. Dschebe graste in der Nähe. Ihm hatte er die Vorderfesseln zusammengebunden. Tomor sammelte im Steppengras wilden Lauch und aß ihn zu getrockneten Quarkstückchen.
Bald stieg der Mond aus der Steppe, zuerst gelb, später bleich und fahl. Die Luft war kühl. Ein sanfter Wind wehte Wermutgeruch über die Weite. Ein Nachtvogel krächzte. Murmeltiere pfiffen. Und blickte Tomor in den Himmel, so schauten die vielen blassgrünen Sterne zu ihm herab, funkelten und zwinkerten wie unzählige Augen.
Tomors Feuerchen schwatzte knisternd in die Stille. Der rotgelbe Schein hellte Gräser und Felswände auf, flackerte gespenstisch in der Finsternis.
Der Junge hatte sich sein Sattelzeug unter den Kopf gelegt und starrte an die steinige Decke des Felsens. Ein silbern schimmernder Käfer, durch Licht und Wärme angelockt, spazierte über den Deckenstein. Auch die Weißen werden nachts nicht reiten, dachte Tomor. Sicher sitzen sie um ein Feuer, und in der Dunkelheit hocken die Gefangenen, darunter mein Vater.
Auf die Frage, was weißt du von den Weißen, würde Tomor wohl geantwortet haben: Das sind Leute mit großen Augen, die aus dem Norden kommen. Sie haben krumme Säbel, lange Flinten, stehlen Schafe und nehmen unsere Väter mit. Und Vater hatte ihm gesagt: Die Weißen sind auf der Flucht vor den Roten. Die Roten hätten in Russland ihren Khan (mongolischer Fürst, in diesem Fall für Zar verwendet) verjagt. Aber außer Roten und Weißen gab es in Tomors Land noch Schwarze. So hießen die Fürsten, Prinzen und Prinzessinnen. Man nannte sie so, weil sie kaftanähnliche schwarze Gewänder trugen. Von den mongolischen Fürsten wusste Tomor, dass er – wie manch anderer – für sie die Herden zu hüten hatte. Wurden in der Fürsten-Herde Tiere von Wölfen zerrissen oder starben an einer Krankheit, musste Vater sie dem Khan aus seiner Herde doppelt ersetzen. Deshalb hat der Khan mehr Schafe und Pferde als wir Hirten, dachte Tomor. Der freut sich über jedes tote Tier, weil dadurch seine Herde immer größer wird. Ob die Roten, die den Khan der Weißen in Russland verjagt hatten, auch unsere Khane vertreiben würden? Doch neben Roten, Weißen und Schwarzen gab es noch Gelbe. Das waren die Lamas, die Priester in Dörfern und Tempeln. Sie gaben Ratschläge, heilten Kranke mit Kräutern und Zaubersprüchen, tanzten um Tote, wenn ihre Heilkunst versagt hatte, damit sie schneller der gelben Lehre gemäß in das Wonnereich der Götter gelangten. Und hörte einer nicht auf die Worte der Lamas, behauptete der Priester, der Ungehorsame käme nach seinem Tode als Eidechse auf die Welt und müsste im heißen Wüstensand der Gobi ein elendes „Leben“ führen.
Während Tomor versuchte, sich im Wirrwarr der Farben, mit denen sich diese Gruppen bezeichneten, zurechtzufinden, während er die Roten mit den Weißen verglich, die Schwarzen mit den Gelben und zu keinem Ergebnis gelangte, dachte er: Weshalb gibt es keine Blauen? Blau ist die Lieblingsfarbe unseres Volkes, blau sind viele unserer Trachten, blau sind viele unserer Jurtentüren, neun Monate im Jahr ist unser großer Himmel blau, und unser Vater sagte mir, dass sich unsere Vorfahren die Himmelblauen nannten.
Tomor nahm seinen Dolch und ritzte mit der Klinge das Zeichen des alten mongolischen Sojombos in den Fels, jenes Sinnbild das, wie er wusste, weder die Weißen noch die Gelben und Schwarzen auf ihren Fahnen trugen. Von den Roten war es ihm nicht bekannt. Das Sojombo besteht aus einer Flamme, die die Wiedergeburt des mongolischen Volkes bedeutet, aus Sonne und Mond, dem ältesten mongolischen Wappen, die besagen, das mongolische Volk lebt ewig. Unter Feuer, Sonne und Mond ist eine nach unten gerichtete Pfeilspitze, die „Tod dem Feinde“ verheißt, und zwei Fische, die das Volk aufrufen, wach zu sein, klug und weise. Links und rechts wird es von zwei senkrechten Säulen eingefasst, die eine Festung ausdrücken und das mongolische Sprichwort verkörpern: Zwei in Freundschaft lebende Menschen sind stärker als Steinmauern.
Auch in ihrer Jurte zu Haus, am Hauptstab, war das Sinnbild zu finden. Vater hatte ihm erzählt, dieses Zeichen hätte immer dann auf den mongolischen Fahnen geleuchtet, wenn Freiheitskämpfer gegen Unterdrücker und Eindringlinge in den Kampf zogen. Gern hätte Tomor unter das Sojombo geschrieben: Tod den Weißen! Aber er konnte nicht schreiben. Es gab keine Schulen im Lande, lediglich eine für Fürstensöhne.
Plötzlich stampfte Dschebe und schnaubte, sprang mit den Vorderbeinen hoch. Steine klirrten.
Tomor horchte in die Nacht.
Ein lang gezogenes Heulen bohrte sich breit durch die Stille. Dschebe beantwortete es mit erneutem Schnauben.
Und wieder heulte es.
Ein Wolf, der Beute entdeckt hatte, rief die anderen, weil er zu feige war, allein anzugreifen.
Tomor schürte das Feuer, warf prasseldürres Gestrüpp hinein. Funken sprühten.
Während das Heulen näher kam, antworteten draußen in der Steppe zwei weitere Wölfe. Danach trat Stille ein.
Tomor suchte sich größere Steine, kroch tiefer unter die vorspringende Felsnase und benutzte den Sattel als Unterlage für das Gewehr. Dschebe stand links in dem Spalt. Von dieser Seite hatten die Wölfe keinen Zugang; sie konnten nur von rechts eindringen, dort öffnete sich die enge Schlucht und mündete in die Steppe.
Stille. Das Feuerchen knisterte. Der Schein fiel auf Dschebes glänzenden schwarzen Leib.
Tomor wartete, fuhr über den Gewehrkolben. Acht Kerben waren darin. Acht Wölfe hat er schon erlegt. Das ist für einen mongolischen Hirtenjungen nichts Außergewöhnliches. Schon mit dem siebenten Lebensjahr reiten sie so gut wie Erwachsene, mit dem zehnten schießen sie wie ihre Väter. Das harte Leben in der Steppe lässt sie nicht lange Kind sein. Tomor hasste die Wölfe ihrer Feigheit wegen. Sie kamen nur nachts, wenn sie Dunkelheit schützte, und sie kamen in Sturm und Regen, wenn ihre Opfer gegen Unwetter kämpften. Acht hatte er erlegt. Sollte es heute der neunte Wolf sein? Die Neun bedeutet Glück, dachte er. Der Gebetskranz hat einhundertacht Holzkügelchen, also zwölf Monate mal neun Gebete, neun Om mani padme hum. Glück! Also wird mich der Lama den Weißen nachschicken, um Vater loskaufen zu können.
Am Eingang der engen Schlucht glühten plötzlich die Augen eines Wolfes. „Dschebe – ruhig – Dschebe!“, flüsterte Tomor dem Pferde zu, das mit den Hufen wild stampfe.
Der Wolf stand zwanzig Meter entfernt, starr und stumm. Tomor riss einen glühenden Zweig aus dem Feuer und warf ihn in die Finsternis. Die Wolfsaugen verschwanden. Der Zweig glimmte und rauchte im Steppengras. Als er verlosch, glühte das Augenpaar sofort wieder auf.
„Dschebe!“
Das Pferd bäumte sich ängstlich.
„Dschebe!“
Hätte ich so viel Patronen wie die Weißen, dass ich die Hülsen wegwerfen könnte, würde ich gleich schießen. Tomor nahm einen Stein und warf. Der Wolf heulte und wurde von der Dunkelheit verschluckt.
Plötzlich trat eine große graue Wölfin furchtlos in den gelbroten Lichtkreis, duckte sich, heulte gierig, stand mit einem Mal auf den Hinterläufen. Tomor schoss. Der Knall zerschlug die fürchterliche Spannung. Die Wölfin sprang hoch, drehte sich, stürzte und blieb still liegen.
Tomor wartete. Manchmal stellen sich Wölfe tot, dachte er. Doch schon tauchten am Schluchteingang zwei neue Augenpaare auf, tatzten näher, fielen über die Wölfin her, zerrten sie zurück in die Finsternis. Ein Schmatzen und Knurren begann. Um das Wolfsmahl in die Länge zu ziehen, warf Tomor von Zeit zu Zeit einen Stein zwischen die Tiere, verscheuchte sie. Bis Sonnenaufgang waren es ungefähr noch eineinhalb Stunden.
Er musste mit der Feuerung sparen. Vielleicht ist der Lama nicht mehr im Dorf, dachte er, als er die neunte Kerbe in den Gewehrkolben schnitt. Nehmen die Weißen nur Hirten mit? Oder auch Lamas? Die Weißen haben einen anderen Gott, sagte der Vater, also werden sie unsere Lamas nicht lieben. Was mache ich, wenn der Lama nicht mehr im Ort ist?
Er warf wieder einen Stein unter die schmatzende Meute, die sich um den Kadaver balgte.
Auch gut, wenn er schon nicht mehr im Dorf ist. Dann kann er mir meinen Wunsch, in die Stadt zu reiten, nicht abschlagen.
Tomor brach sich ein Stückchen harten Quarkes ab und steckte es zwischen die Zähne. Von einer kleinen Tafel solchen Quarkes kann man einen ganzen Tag leben. Er ist steinhart, für Jahre hinaus haltbar, denn er hat mindestens drei Monate in der Sonne zum Trocknen gelegen.
Nach kurzer Zeit erschienen abermals zwei Wölfe am Eingang. Ihr Appetit mochte durch die tote Wölfin noch mehr gereizt worden sein. Der eine lief auf das Feuer zu, als kenne er keine Furcht. Als Tomor anlegte, duckte er sich und schlich widerwillig zurück. Gleich darauf kam der andere, als wollte er seinen Mut beweisen. Er kam so nahe, dass Tomor noch einmal schießen musste. Doch das Tier war nicht tot, sondern sprang zurück und verschwand.
Endlich dämmerte der Morgen. Dschebe guckte mit guten Augen zu seinem Reiter. Er war nun ruhiger und ließ sich im Grase nieder. Tomor legte sich auf seinen bunt bemalten Sattel und konnte jetzt schlafen.
Von dem niedergebrannten Feuerchen stieg dünnfädiger Rauch steil in die Höhe. Über der Schlucht zerfloss er, mischte seinen herben Duft mit dem würzigen Kräutergeruch der Steppe.
Der frische Morgen hatte sich mit vielen schönen Farben geschmückt und grüßte das Land der Weite.
Die weißen und die schwarzen Kugeln
Dschebe jagte mit Tomor wieder über die Ebene. Staub spritzte unter den Hufen weg. „Tschuuii – tschuuii – Dschebe“, feuerte der große Junge das Pferd an. Der kühle Reitwind tat gut. Es gab Stellen, wo das saftige Gras bis zu den Steigbügeln reichte, und kahle Flecke, die ausgebrannt dalagen, über deren rotgelbe Erde schmutzig-grüne Blattflechten krochen. Hier und da bleichte das Knochenskelett eines Kameles in der Sonne.
Eine Hügelkette kam auf Tomor zu. Vom Pass blickte ein Obo ins Land. Das ist ein Haufen zusammengetragener Steine, die wie eine Pyramide aufgesetzt sind und in denen eine lange Holzstange steckt. An der Stange flattern farbige Seidenbänder. Diese Obos findet man in der Mongolei an Flussübergängen, Wegkreuzungen, auf Pässen und Berggipfeln. Sie sollen, nach altem Brauch, böse Geister verscheuchen. Wer an ihnen vorüberkommt, sucht einen Stein, fügt ihn zu den anderen, setzt sich und spricht Gebete. Oft sitzen Hirten vor einem Obo, ruhen, rauchen und schauen in die Steppe. Auch Tomor trug einen Stein zur Höhe.
Was er nicht sehen konnte, war ein einzelner Reiter, der auf der anderen Seite des Berges heraufsprengte. Vor dem Obo begegneten sie sich.
„Viel Gesundheit, Bruder“, sagte Tomor zu dem älteren Mann, der von seinem lederfarbenen Gesicht den Schweiß wischte. Im Stiefelschaft steckte eine lange Pfeife, deren Mundstück, aus Aquamarin gefertigt, herausragte.
Sie stiegen von den Pferden.
Als sie sechs Schritt voneinander entfernt waren, zogen sie ihre Dolche, die ihnen im Taillentuch auf dem Rücken steckten. Die Messer baumelten nun, für jeden sichtbar, an einem Kettchen vor dem Bauch. Das Zeichen: Keiner hegt gegen den anderen Böses.
Wortlos reichte der Fremde Tomor sein Schnupftabakfläschchen, das aus einem weißen Kamelknochen geschnitzt war. Dies galt als Zuneigung.
„Hattest du einen guten Weg?“ Von dem Gesicht des Fremden ging Ruhe aus. Er sprach die Worte deutlich und langsam.
Und während Tomor dem Mann erzählte, was ihm widerfahren war, sog der Fremde an seiner Pfeife. Aus dem kleinen silbernen Kopf kräuselte Rauch.
Der Fremde trug eine dunkelrote Tracht. Das neun Meter lange Seidentuch, das sich um die Hüfte schlang, leuchtete blau wie der Himmel.
„Bei uns waren die Weißen gestern am späten Abend“, sagte der Mann und wies mit der Hand hinunter ins Dorf. Ein Flüsschen blitzte in der Sonne. Am Ostufer lagen Jurten. Die Rundzelte sahen wie umgestülpte Trinkschalen aus. Im Grase wanderten Schafe.
„Unsere Hirtenjungen hatten rechtzeitig von der Ankunft der Weißen gewarnt, so dass sich ein Teil unserer Männer in den Bergen verstecken konnte“, erzählte er. „Vier sind freiwillig mitgegangen, vier junge Leute, die nicht gern arbeiten. Das schien den Weißen zu genügen; sie stahlen uns nichts und zogen wieder ab.“
„Habt Ihr, Bruder, die Weißen nahe gesehen? Hatten sie Gefangene bei sich?“
„Sie nächtigten draußen vor dem Ail (Gruppe von Jurten). Und wo Weiße sind, sind Gefangene, junger Freund.“
„Dann ist der Lama noch im Dorf? Sie haben ihn nicht fortgeschleppt?“
„Du willst zu ihm?“
Tomor nickte.
Lächelnd sagte der Mann, und er sprach wieder so langsam und besonnen, als hätte er jedes Wort, bevor es seinen Mund verließ, noch einmal nachgeprüft: „Ob sie ihn fortgeschleppt haben? Nein, einem Lama tut keiner etwas zuleide. Das taten die Chinesen nicht, und das tun die Weißen nicht. Sie können sich nicht mit allen verfeinden. Wenn sie die Lamas auf ihrer Seite haben, beherrschen sie das Volk; denn das Volk hört auf die Lamas.“
„Und die Schwarzen, Bruder?“
„Auch die Schwarzen brauchen die Lamas. Ohne Lamas keine Fürsten; würden die Lamas sagen: Zahlt keine Steuern an die Schwarzen, gäbe es keine Fürsten mehr, würden die Priester sagen, hütet ihre Herden nicht, so braucht ihr deren Verluste nicht doppelt aus eigener Herde zu ersetzen. Was wären die Fürsten ohne ihre riesigen Herden? Also, wenn die Weißen die Lamas als Freunde haben, sind auch die Schwarzen für die Weißen.“
Solche Worte hatte Tomor noch nie gehört. Er sah den Fremden verwundert an und meinte misstrauisch: „Schön, Bruder, wie Ihr das sagt, aber Ihr glaubt wohl nicht an die Götter? Buddha und Bodhisattwa (buddhistischer Heiliger / Vorstufe zum Buddha) sind Euch nichts; Ihr stellt Eure eigenen Gedanken über ihre Vorschriften?“
„Doch“, antwortete der fremde Reiter überlegend, „ich glaube schon, Junge; es gibt auch einige ehrliche Lamas.“
Das befriedigte ihn. „Ich heiße Tomor, und Ihr?“
„Kombu.“ Und darauf sagte er: „Deine Eltern sind Schluchtensiedler?“
„Woher wisst Ihr das, Kombu?“
„Du fragst viel und wunderst dich mehr als manch anderer. Deine Eltern sind immer allein. Wenn das Gras in einer Schlucht für die Schafe nicht mehr ausreicht, zieht ihr zur nächsten mit eurer Jurte und Herde. Selten trefft ihr andere Menschen. Ihr schließt euch keinem Ail an, das zwar auch von einem Weideplatz zum anderen zieht, jedoch immer zusammenbleibt.“
„Mein Vater sagt: Zwei und mehr Jurten nebeneinander geben Streit“, verteidigte sich Tomor.
„Nicht nur – man lernt auch Gedanken anderer kennen. Abends kommt man in Jurten zusammen, trinkt Stutenmilch und erzählt. Einer sagt dem anderen seine Beobachtungen und Vorschläge. So ein Ail ist stärker als Einzelgänger in Schluchten, auch stärker gegen die Weißen, Tomor. Kennst du die Geschichte unserer Alten?“
Der Junge schüttelte den Kopf.