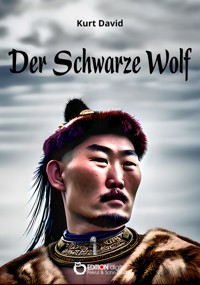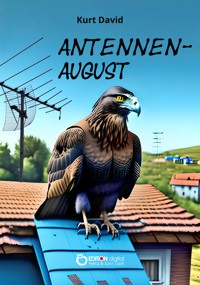7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Begebenheiten, an die sich David erinnert, sind unerhört, manchmal skurril, manchmal grotesk. Er erzählt von bedrückenden Zeiten und lebensbedrohlichen Ereignissen, nicht ohne ernste Heiterkeit, sozusagen mit einem Humor, der zur Weisheit zwingt. ROSAMUNDE? David denkt an die von Schubert, aber er muss die andere ROSAMUNDE spielen, die flotte Polka, und das Stunde um Stunde und immer wieder. Er glaubt sowieso nicht daran, dass MUSIK LEHRE ZUM GEHORSAM sein soll. Warum bläst einer an bestimmten Tagen mit seiner Trompete aus dem Fenster? ICH WEISS NICHT, WAS SOLL ES BEDEUTEN, DASS ICH SO TRAURIG BIN, erfährt er spätestens, wenn die Trompete verstummt. Und dass MOZARTS GRAB nicht in Karlovy Vary sein kann, weiß er auch, aber er geht trotzdem hin. Und die Besteigung eines berühmten mongolischen Berges wird abgebrochen und ist doch nicht umsonst: Der eine lernt Englisch zählen, der andere Mongolisch. Diese und alle anderen Geschichten haben eines gemeinsam: Sie regen zum Nachdenken an und bleiben in uns, auch wenn wir das Buch schon wieder zur Seite gelegt haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 199
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Impressum
Kurt David
Rosamunde, aber nicht von Schubert
Erzählungen
ISBN 978-3-96521-940-3 (E-Book)
Das Buch erschien erstmals 1982 im Verlag Neues Leben Berlin.
Für Christel
© 2023 EDITION digital Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
Man kann alles erzählen, nur nicht sein wirkliches Leben.
MAX FRISCH
Rosamunde, aber nicht von Schubert
Wir hatten alle mächtigen Hunger, als der Zug vom Bahnhof der Stadt L., heute G., abfuhr. Unsere Bewacher achteten streng darauf, dass wir immer sechstausend Mann blieben, genau sechstausend, auch wenn wir mal nicht mehr ganz sechstausend waren. Das Manko glichen sie auf der nächsten Station wieder aus, indem sie sich Männer fingen, die dort gerade etwas zu tun oder auch nichts zu tun hatten. Und da es auf der Welt nicht nur Deutsche gibt, geriet manch ein Mensch irrtümlich in unsere Mitte. Das war für den Betroffenen gewiss ärgerlich, und ich erlebte, wie der eine oder andere jeden Glauben an etwas verlor. Was half’s? Klärende Aussprachen waren seinerzeit so unerwünscht wie unangebracht. Wichtig war: Dass wir immer sechstausend blieben. Und die fuhren vollzählig Tag für Tag dem Abendrot davon. Nie wieder habe ich so zahlreiche Kochrezepte gehört und Speisen, ohne zu essen, genossen. Eine Fuhre von Köchen hätte sich nicht fachgerechter austauschen können. Aber: Wir waren keine Köche.
Der starke Gegenverkehr auf der Strecke verlängerte unsere Fahrzeit wie den Hunger. Hin und wieder standen wir einen halben oder ganzen Tag und die Nacht dazu auf einem Abstellgleis. Unsere Alltagsphilosophen gelangten zu einer Erkenntnis, die sie vor ihrer Gefangennahme mit erheblichem Schauder erwogen hatten:
Je mehr Nachschub der Iwan nach vorn transportiert, desto eher ist der Krieg aus, oder andersherum: Jeder Tag, den der Krieg länger dauert, ist ein Tag länger Gefangenschaft.
Hinter Warschau riss ein Posten die Waggontür auf und brüllte herein: „Dawai, Akkordeon!“ Und kurz darauf: „Anu dawai, Akkordeon!“
Zum Glück findet sich in solcher Situation immer einer, der für alle spricht, und das war ein Feldwebel: „Ein Akkordeon?“
„Akkordeon, dawai!“
„Hört mal her!“, sagte der Feldwebel und wandte sich zu uns um. „Der will allen Ernstes ein Akkordeon!“ Er hatte es mit so viel Hoffnungslosigkeit in seiner Stimme gesagt, dass wir übrigen es schätzten, nicht an seiner Stelle vorn an der Tür stehen zu müssen.
„Dawai!“
„Ich kann ja mal fragen, fragen, verstehste, fragen kann ich ja mal!“
„Fragen, Akkordeon, gutt“, antwortete der Posten und drehte sich geduldig eine Zigarette.
Ratlos sagte der Feldwebel zu uns: „Was mach ich denn nun? Der muss doch wissen, dass wir hier zwischen Warschau und Brest so was gar nicht mehr haben können.
„Sag’s ihm“, meinte einer und schwieg gleich wieder.
„Dawai, Akkordeon“, rief’s abermals an der Tür. Der Wind drückte den Zigarettenqualm in unseren Waggon.
„Nix Akkordeon“, erwiderte der Feldwebel. „Akkordeon nix vorhanden!“
„Nix?“ Der Posten steckte den Kopf durch den Spalt, blickte misstrauisch nach links, nach rechts, schob sein Käppi aus der Stirn ins Genick, fluchte, breitete die Arme aus, schloss sie wieder, breitete sie erneut aus, schloss sie abermals, und nachdem er das öfter wiederholt und irgendetwas dazu gesummt oder geträllert hatte, sagte er: „Nix Akkordeon, taktak?“
„Der will einen Spieler, einen Akkordeonspieler!“, verkündete der Feldwebel, worauf jemand aus dem hintersten Winkel, der die Gesten des Postens nicht hatte sehen können, fragte: „Was denn, Spieler heißt bei denen ,taktak'?“
„Taktak“, sagte der Posten gelassen, fügte aber gleich laut und scharf hinzu: „Anu dawai, Akkordeon, anu dawai!“
Der Feldwebel murmelte, der liebe Gott möge es geben, dass wir einen Spieler unter uns hätten. Und danach fragte er: „Haben wir denn einen?“
Wir hatten, und der erfüllte nichts lieber als musikalische Wünsche, zumal er sich in den vorangegangenen Tagen und Nächten auf den Abstellgleisen äußerst entbehrlich vorgekommen war. Begleitet vom Geflüster und Geraune, „hoffentlich kann der auch spielen“ und „wenn der bloß auf was zu futtern aus ist, meint, er braucht den Quetschkasten nur ein bisschen hin- und herzuzerren, dann haben die ein anderes Taktak für ihn“, stieg ich, über Beine stolpernd, vor zur Tür, sprang hinab ins Freie.
Der Soldat stieß mich, etwas derb, vor sich her, wohl nur, um mir anzudeuten, wo es langginge; denn links, zehn Schritt oder drei Sprünge entfernt, erhob sich ein wunderschöner Wald mit Kiefern, Buchen und Birken. Ich bestaunte ihn wie die erste Ansammlung von Bäumen in meinem Leben, stellte mir vor, wie sicher es sein musste, in ihm davonzulaufen, zu schlafen, wieder zu laufen; nur zu essen bot er noch nichts im März, und: Es wuchs kein Wald auf dieser Erde, der bis zu meinem Heimatdorf reichte.
„Gutt Akkordeon?“, fragte der Bewacher in meinem Rücken, als bangte auch er, ich könnte mich aus was weiß ich für Gründen gemeldet haben. Sicher belastete ihn seine Verantwortlichkeit, mit mir auch die richtige Wahl getroffen zu haben.
„Gutt Akkordeon“, erwiderte ich. Mich selbst zu loben machte mir schon gar nichts mehr aus. Nur um ihn noch mehr zu beruhigen, hätte ich gern hinzugefügt: Otschen charascho Akkordeon! Im allerletzten Moment, wirklich, ich hatte den Mund schon für das O weit aufgesperrt, fiel mir ein, dass ihn ausgerechnet das OTSCHEN CHARASCHO besonders erregen könnte; denn daraus dürfte er unschwer geschlossen haben, ich sei schon in seinem Land gewesen. Und von diesem Gedanken bis zu dem, dass ich mich bei meinem vormaligen Aufenthalt keinesfalls als Akkordeonspieler verdingt hatte, benötigte er nicht mehr Zeit als ein Blitz, um einzuschlagen.
„Artist?“
Diese Frage hätte mich beinahe vom Gleisschotter geworfen, über den wir trotteten, hin zum Ende des Zuges. Möglicherweise hatte ich mich verhört. Ich drehte mich um, fragte zurück: „Was für ein Artist?“
„Artist?“, sagte er wieder und deutete mit der Gewehrmündung auf mich, woraus ich nun nicht folgerte, er wollte mich abknallen, nein, es war nur seine ganz persönliche Art, mir begreiflich zu machen, dass er wissen wollte, ob ich Artist sei.
Indessen sah ich mich übereinandergetürmte Stühle auf magerem Kinn balancieren und Akkordeon spielen und auf Flaschenhälsen einarmig Handstand machen. Ort der Handlung: tief in Sibirien. Mich fror schon jetzt. Enttäuscht, was die alles von einem Musiker erwarteten, antwortete ich betroffen: „Nix Artist!“ und lauschte meiner Absage eine Zeit lang nach, aber außer dem Schottergeklirr unter unseren Füßen vernahm ich nichts, keinen Protest, keinen Befehl zur Umkehr. Mir schien, der Wachsoldat hatte sich abgefunden, keinen Artisten, sondern lediglich einen Akkordeonspieler aufgetrieben zu haben. (Die wirkliche Bedeutung des russischen Wortes ARTIST – Künstler – blieb mir auch danach lange verschlossen, weil wir mit dieser Zunft vorerst nicht in Berührung kamen.) Wie vermutet, endete unser Marsch am letzten Waggon des Gefangenentransports. In ihm wohnte das Begleitkommando, und drin war es richtig schön. Die hässlichen Wände hatten sie mit bunten Teppichen verhangen, und auch der Fußboden war weich ausgelegt. Entlang den Wänden standen sechs weißbezogene Feldbetten, und in der Mitte war noch ein unbezogenes Bett neben einem Kochherd, auf dem in Tiegeln Bratkartoffeln dampften und Spiegeleier brutzelten. Nun war ich gewiss nicht so vermessen, das für meine Empfangsmahlzeit zu halten, aber dass ich schneller atmete und den Essensduft einsog und schluckte, konnte mir keiner verwehren. Es blieb ohnehin unbemerkt. Ein Oberleutnant dirigierte mich unmittelbar neben den Herd mit den Tiegeln auf das unbezogene Bett. Der Wächter musste links von mir sitzen und hatte das Gewehr auf den Boden gestellt und zwischen den Knien festgeklemmt. Der stählerne Spieß obendrauf überragte den Kopf des kleinen Soldaten beträchtlich.
Als der Oberleutnant mir ein Akkordeon brachte und es zu meinen Füßen wortlos absetzte, merkte ich, wie mich die anderen uniformierten Männer anschauten, mehr misstrauisch als erwartungsvoll. Das Instrument war das größte seiner Gattung, hatte einhundertzwanzig Bässe und so viele Register, wie Raum dafür vorhanden gewesen war. Zu Hause hatte ich es, dem Lohn meines Vaters angepasst, nur auf zweiunddreißig Bässe gebracht. Trotzdem: Der Riesenbalg flößte mir keinerlei Furcht ein, der nicht.
Der Posten stieß mir seinen Ellenbogen in die Hüfte. Das empfand ich fast als kumpelhaft, wenn ich bedachte, dass wir zwei uns länger kannten als ich die anderen und sie mich. Und selbstverständlich knurrte er schroff:
„Anu dawai!“ Auf seinem Gesicht hatte sich alles versammelt, womit verantwortungsbewusste Neugier ausgedrückt werden kann. Mit einem gewaltigen Akkord fuhr ich zwischen seine Zweifel. Erschreckt blickte er auf, nickte sich selber anerkennend zu, worauf ich hurtig zum WIENER BLUT überleitete und der Zug anruckte, losfuhr, als hätte der Lokführer auf meinen Einsatz gewartet.
Wir fuhren weder weit noch lange. Das nächste Abstellgleis war auf einer polnischen Landstation mit kümmerlichen Weiden um zwei kleine schwarze Teiche, die wie verweinte Augen traurig den grauen Himmel anstarrten. Mädchen kletterten in den Waggon, boten Mohnzöpfe und rote Würste zum Kauf oder Tausch, dieweil in ihren Rücken ein langer Zug voll Panzer zur Oder donnerte und ich gerade die DONAUWELLEN im Dreivierteltakt plätschern ließ. Was dann passierte, überraschte mich keineswegs: Die Mädchen tanzten mit den Offizieren und Soldaten (oder umgekehrt) und wirbelten durch den Güterwagen, dass die Tiegel auf der Herdplatte mitschepperten. Obgleich ich ihr Vergnügtsein begriff, litt ich sehr unter ihrer Ausgelassenheit. Ich hätte zwar diesen Krieg nicht gewinnen mögen, aber ob es erträglich sein würde, ihn überlebt zu haben, schien mir in diesen Tagen auch unsicher.
Jener Oberleutnant, der mich zum Bett dirigiert und mir das Akkordeon gebracht hatte, stand plötzlich wieder vor mir und sagte ungehalten: „Walswalswals! Wir schon schlafen!“, worauf er die Augen zumachte, schnarchte, müdetuend hin- und herschaukelte. Die Tanzpaare lachten über seinen komischen Auftritt. Der Posten lachte nicht, er war im Dienst, und ich hatte sowieso nichts zu lachen, da mir der Oberleutnant eben zu verstehen gegeben hatte, meine Walzerwalzerwalzer schläferten ein. Und dann hüpfte er. Sie blickten jetzt auf seine stampfenden Füße und Beine, klatschten rhythmisch, und er hüpfte immer toller, schaute argwöhnisch auf mein stummes Akkordeon. Doch so heftig er auch hopste, nachempfinden konnte ich es trotzdem nicht. Nur dass er das Tempo etwas beschleunigt haben wollte, ging mir dabei auf. Und weil mir das alles höchst russisch vorkam, liefen meine von seinem Gehüpfe begleiteten Gedanken in diese Richtung. Zu dieser Zeit kannte ich nur ein russisches Lied, brauchte also nicht lange zu suchen und schon gar nicht zu wählen: STEPAN RASIN. Das verlangte zwar, gemäßigt vorgetragen zu werden, doch hinderte mich nichts, das Lied als Polka zu kredenzen. Anfänglich stutzten die Tänzer. Verständlicherweise erkannten sie die Melodie nicht mehr wieder, zumindest nicht sofort. Dass ich jenes Lied überhaupt kannte, verdankte ich meinem Großvater mütterlicherseits, der lebenslänglich zum Hofknecht verurteilt gewesen war und gelegentlich dieses Lied über Stenka Timofejewitsch nach dem Genuss von zwei, drei Bieren mit einem etwas rebellischen Unterton sang. Nachher erzählte er immer aufs Neue, der Donkosak sei vom Zaren hingerichtet worden, weil er mit den armen Bauern gegen die Leibeigenschaft gefochten habe. Sei es, wie es war: Das Lied war so kurz wie Rasins Leben und viel zu kurz, um mit ihm Tanzende mehr als drei-, viermal hintereinander auf den Beinen zu halten; denn ich sah sie bereits erneut ermüden, und der Oberleutnant schaute zu mir mit einem Blick, der Missverständnis ausschloss.
Nun, von dem zur Polka verhunzten Rasin-Lied bis zu ROSAMUNDE, jener flotten Tschechin, die nicht erst ihre Mama fragen sollte, war es nicht weit. Fast übergangslos glitt ich zu ihr hinüber, merkte gleich nach den ersten Takten, die Tanzenden hatten nichts dagegen. Und obwohl die ROSAMUNDE erheblich länger als RASIN-Timofejewitsch war, aber auch ihr Ende nicht ausbleiben konnte, überlegte ich mir, was ich danach spielen sollte. Mein Repertoire war nicht unerschöpflich in diesem Genre; schließlich spielte ich das erste Mal zum Tanze auf! Trotz angestrengten Überlegens fiel mir nichts mehr ein, was hierhergehört hätte, und eine Rückkehr zum Walzer, nein, die wollte ich nicht riskieren. Also: ROSAMUNDE!
Immer ROSAMUNDE, und immer wieder ROSAMUNDE, MUNDEROSA, ROSAMUNDE, von vorn, von hinten, stückweise, abermals im Ganzen, in Moll, in Dur – soweit der Vorrat reichte – und natürlich mal schnell, dann langsam, und danach wieder so schnell, dass einige Paare vor Lust aufschrien und aus den Kurven in die Betten fielen.
Nachher aßen sie die Mohnzöpfe, die roten Würste, die Bratkartoffeln, die Eier, alles wohlverdient, versteht sich. Aus grünen Blechkanistern, in denen früher, wenn ich mich nicht irre, Benzin gewesen sein musste, gossen sie ein Wässerchen nach dem andern in dickwandige Gläser, prosteten sich zu, und die Mädchen husteten kichernd und hatten erhitzte Köpfe. Indessen untermalte ich die Tanzpause dezent wie ein Wiener-Kaffeehaus- Musikant mit Variationen über ROSAMUNDE, aber es gelang mir trotzdem nicht, anderswo hinzuschauen als in die dampfenden Tiegel. Dem Oberleutnant kann das nicht verborgen geblieben sein. Plötzlich stellte er mir Bratkartoffeln und Eier auf das Akkordeon, das sofort keinen Ton mehr von sich gab. Ich blickte zu dem Mann so verständnislos auf, dass er sich veranlasst sah, mir zu sagen, was ich mit Eiern und Kartoffeln machen sollte: „Du essen!“ Heute will es mir scheinen, ich bin damals von diesem Vorgang so überwältigt gewesen, dass ich dem Oberleutnant zum Dank versprochen hätte, die mir zum Hals heraushängende ROSAMUNDE noch weitere drei Tage hintereinander zu spielen. Wahr ist, ich wusste seinerzeit bereits zu würdigen, was mir eben widerfahren war; denn mir war nicht unbekannt geblieben, dass viele seiner Landsleute in unserer Gefangenschaft nicht einmal „nur“ an Hunger zugrunde gegangen sind. Der Oberleutnant brachte mir dann noch ein Glas mit dem Wässerchen aus einem der grünen Blechkanister. Nachher hatte ich das Gefühl, mit ROSAMUNDE ließe es sich, den Umständen entsprechend, ganz gut leben. Der Oberleutnant deutete mir noch an, dass sie auch gar nichts anderes mehr hören und tanzen wollten. Und so spielte ich es wohl auch immer besser. Selbst der Posten an meiner Seite, nun ebenfalls essend und trinkend, schaute mich fast wohlwollend an, als er sagte: „Du gutt Artist!“ Ich ertrug’s, und da ich zum ersten Mal seit langem nicht mehr hungrig war, lächelte ich ihm zu, worauf er wegschaute und zur Tür hinausblickte, wo der kleine polnische Bahnhof lag mit den zwei Teichen und den traurigen Weiden. Rollten Güterzüge an unserem Abstellgleis vorbei, verschwanden Bahnhof, Teiche und Weiden für eine Weile hinter den klappernden Waggons, und sie jagten in einem Tempo zur Front, als hätten sie Angst, vom nahenden Kriegsende überholt zu werden.
Wie lange der Tanz ging, weiß ich ebenso wenig wie die Zahl der Wiederholungen von ROSAMUNDE. Ich weiß überhaupt nichts vom Aufhören, möglicherweise ergab sich der Schluss von allein – sang- und klanglos –, aber ich weiß noch, wie mich nachts irgendein harter Gegenstand am linken Ohr drückte. Träumend dachte ich an einen der grünen Blechkanister. Doch dann stach’s mich plötzlich am Ohr, und da ein Kanister zwar drücken, aber nicht gerade stechen kann, griff ich mir ans Ohr und hielt das Bajonett mit dem daran befestigten Gewehr meines Wächters in der Hand, der neben mir schlief. Wäre es nicht finster gewesen, hätte ich lieber mein Ohr geopfert, als mich an der Waffe des Postens zu vergreifen und einem Missverständnis auszusetzen, das mich vielleicht mehr gekostet hätte. So aber begrub ich das scheußliche Kriegsgerät vorsichtig zwischen unseren Leibern und lauschte noch eine Weile der Stille im Waggon. Und alle, alle schliefen. Die Tür stand offen, ein wenig erhellt vom Licht des Mondes, der irgendwo auf- oder unterging. Und ich entdeckte jetzt auch, dass die Mädchen nicht mehr da waren, wir den Bahnhof längst verlassen hatten und durch die Nacht fuhren. Fast unbekümmert musste ich wieder eingeschlafen sein; denn munter wurde ich das nächste Mal erst am frühen Morgen. Aus halbgeöffneten Augen sah ich den Oberleutnant allein an der Tür stehen. Der Fahrtwind bewegte sein Haar. Die Sonne im Gesicht, blickte er irgendwohin, und ich hätte gern gewusst, woran er dachte und was er sah, das ich nicht sehen konnte. Und weil er so traurig war, unsagbar traurig, richtete ich mich, jedes Geräusch vermeidend, auf, setzte mich wieder auf den Rand des Bettes und wartete hinter seinem Rücken.
Zu meinen Füßen stand das Akkordeon, stumm und fremd, und mir war nun doch, als wäre alles eine Art von Zwischenaktmusik gewesen, ROSAMUNDE, aber nicht von Schubert.
Der Ganove
Minuten nach Mitternacht trabte ich mit Brockauf im dicksten Regen zum Bahnhof von Z. Dort schlüpften wir unter das Wellblechdach eines Schuppens und versteckten uns zwischen abgestellten Fahrrädern. Auf nassen Schienen glitzerte das Licht hoher Bogenlampen. Über den Bahnsteig schlenderten Leute mit hochgeklappten Kragen und eingezogenen Köpfen.
„Eingestiegen ist er in Berlin“, sagte Brockauf zufrieden und beklopfte seine linke Manteltasche, in der das Fernschreiben raschelte, nach dem Klunkert mit dem D 234 abgefahren war.
Ich erwiderte, noch schöner wäre es, hätten wir auch fernschriftlich Gewissheit, er stiege hier aus. „Was machen wir dann, wenn er den Zug eine Station früher verlässt?“
„Dann hauen wir ab und warten in der warmen Dienststelle auf seine Zuführung!“ Brockauf lachte, etwas selbstgefällig. „Ist doch abgesichert, Mensch!“
Und wirklich, Brockauf ging keiner Tätigkeit nach, ohne sie abgesichert zu haben. Und das nicht allein im kriminalen Bereich, auch den Verkauf von Broschüren, die Werbung um Mitgliedschaften, ja selbst den Absatz von Essenmarken, alles sicherte er ab. Und selbstverständlich jede Diskussion. Ging es trotzdem schief, bekannte er, es wäre eben nicht genügend abgesichert gewesen.
Sein Lieblingswort im Kopf und unsere eigene Sicherheit bedenkend, fragte ich unter dem Wellblechdach des finsteren Schuppens: „Hast du durchgeladen?“
Plötzlich schlug Metall aufeinander. Mir kam es vor, als hätte sich Brockauf vor Wut auf die abgestellten Fahrräder geworfen, die uns zum Glück trennten. Gereizt zischelte er: „Bist du wahnsinnig? Durchgeladen! Ich komme dir gleich hin!“
„Und wenn er schießt?“
„Der schießt nicht!“
„Ich denke, der hat schon einen umgebracht?“
„Eine.“
Ich wandte ein, ich könne keinen besonderen Unterschied darin erblicken, ob es einer oder eine gewesen sei. „Falsch“, sagte er, „erstens war es seine Frau, zweitens hat er sie nicht erschossen, sondern vergiftet, drittens fünfzehn Jahre dafür gesessen, und viertens gibt es keinen Grund durchzuladen, wenn er bloß mit einem Rucksack voll Kaffee und Kakao anreist!“ Er seufzte. Danach sagte er entsetzt: „Hast du nicht eine Belgische?“
Verschämt gab ich es zu.
„Dass du mir die nicht anfasst!“, warnte er mich. „Die kann nämlich schon losgehen, während man sie durchlädt. Für einen Selbstmord“, verkündete er feierlich, „mag sie ganz zuverlässig sein, für mehr taugt sie nicht!“
Bekümmert überdachte ich meine Ausrüstung und sagte: „Ich nahm an, besser ist besser bei so einem. Man hat allerlei gelesen.“
„Ja, zu viel.“ Ich wusste sofort, wie ich das aufzufassen hatte: Er las ausnahmslos nur die ihm verordneten Bücher.
Ich blickte zur Bahnhofsuhr. „In sechs Minuten kommt der Zug.“
Daraus schloss Brockauf, ich sähe Klunkerts Ankunft beklommen entgegen, womit er nicht ganz unrecht hatte, weil ich es bisher meistens mit Scheck- und Wechselfälschern sowie gewieften Buchhaltern zu tun gehabt hatte. Und nun war ich aushilfsweise mit zum Bahnhof geschickt worden, um einen festzunehmen, der, wie mir schien, zu vielem fähig war. Es stimmte: Brockauf war der Meister und ich sein Gehilfe. Also sprach Brockauf wie ein besorgter Vater: „Nun habe nicht solche Angst, Junge; ich sichere die Festnahme allein ab!“
Erschreckt fragte ich zurück: „Was denn, hast du wenigstens durchgeladen?“
„Noch nicht“, antwortete er, betonte jedoch, falls er, was er nicht vermute, trotzdem gezwungen werden sollte, könnte er es sich leisten, er habe keine belgische Pistole, sondern eine russische.
„Marke?“
„Mauser!“
Meine Gedanken wanderten Jahre zurück, zu alten Filmen über Oktoberrevolution und Bürgerkrieg. Ich erkundigte mich, ob das jene Waffe sei, an die man nur herankomme, wenn man vorher den übergroßen Holzkasten aufgeklappt habe. Mir waren da schon prächtige Ausführungen in Edelhölzern unter die Augen gekommen. Brockauf hingegen gab zu, sein Etui sei aus Fichte gearbeitet. Mit ihm spiele jetzt sein Enkel, weil der mauserische Großkasten ihn, Brockauf, wenn er die Waffe unterschnalle, beim Laufen, vor allem beim schnellen Laufen, sehr gehindert habe. Seine Gattin habe ihm ein weniger auftragendes Futteral aus einer abgetragenen Vorkriegshose genäht.
Minutengenau traf der Zug ein.
„Der Lange mit dem Rucksack ist es!“, flüsterte Brockauf.
Seinerzeit reisten viele mit Rucksäcken, doch Klunkert überragte alle auf dem Bahnsteig, und was ihn zusätzlich von anderen Aussteigern unterschied, war, er kam im Gegensatz zu Kartoffel- und Weißkohlrucksackträgern so aufrecht und leichtfüßig daher, als hätte er Heu geladen. Sein Rucksack ließ eine Spezialanfertigung erkennen, die das normale Ausmaß eines solchen Behältnisses erheblich überschritt. Unseren Informationen zufolge füllte Klunkert den in Berlin-Gesundbrunnen erworbenen Kaffee und Kakao in Hundertgrammbeutelchen ab und verkaufte sie zu äußerst unanständigen Preisen, was einigen Kunden nicht so gut schmeckte wie der Kaffee oder Kakao. Diese zwiespältige Art von Unzufriedenheit war zu uns gedrungen, anonym, wie man sich leicht denken kann.
„Wir müssen Sie vorläufig festnehmen!“, sagte Brockauf.
Klunkert erschrak nicht, sondern lächelte charmant und verriet uns, er habe mit dem ersten Blick bemerkt, dass wir von der Kriminalpolizei seien.
„Das glaube ich Ihnen“, antwortete Brockauf. „Sie hatten ja auch fünfzehn Jahre Zeit, sich diesen Instinkt zuzulegen!“
Klunkert tat oder war gekränkt, ließ den Kopf ein bisschen herabhängen und sagte: „Verbüßt ist verbüßt. Sie haben keineswegs das Recht, mir …“
„Schon gut!“, schnitt ihm Brockauf das Satzende weg und sagte zu mir, doch so, dass es Klunkert hören konnte: „Pass auf, das Beste an dem ist, er lässt dich nichts falsch machen, er korrigiert und belehrt dich unablässig, er kennt alle Gesetzbücher, Ausführungsbestimmungen und Tricks. Habe ich recht, Klunkert?“
„Sie übertreiben!“ Er gebe zwar zu, nicht völlig unbewandert zu sein, weil er jene langen Jahre, von denen Brockauf so widerrechtlich gesprochen habe, genutzt und die ihm gebotenen Möglichkeiten ausgeschöpft habe. „Ist das vielleicht schlecht, wenn ich mich mit den bestehenden Gesetzen vertraut mache?“
„Das gerade nicht, aber sinnlos, wenn Sie die nicht einhalten!“ Und zu mir sagte Brockauf: „Handschellen anlegen!“
Klunkert hob abwehrend die Hände. „Auf dem Rücken, meine Herren, ist es nicht erlaubt wegen der Sturzgefahr! Bitte schön vorn!“
„Hörst du’s? Schon geht’s wieder los!“ Und zu Klunkert sagte er: „Rücken wär gar nicht gegangen bei Ihrem Rucksack mit Überlänge.“
Ich schloss den Mann kurz, wie wir das unter uns nannten, und sah ihm in die Augen und auf die trockene Stirn, staunte, dass er weder schwitzte noch sonstwie von seiner jetzigen Situation beeindruckt zu sein schien.
„Ist er neu, der junge Kollege? Anfänger?“, fragte Klunkert.
„Neu? Der ist gar nicht neu“, antwortete Brockauf verdrossen. „Werden wir denn einen Anfänger auf Sie loslassen? Wäre ja eine Unterschätzung Ihrer Person!“
Nachdenklich starrte mir Klunkert ins Gesicht. „Er ist so still, so zurückhaltend.“
„Das täuscht. Wenn Sie den reizen, kriegen Sie die nächsten zehn, zwölf Jahre weder Kakao noch Kaffee zu sehen.“
„Sie drohen mir? Das hätten Sie nicht tun sollen, zumal Ihnen das untersagt ist!“ Klunkert wich protestierend einen Schritt zurück, wie wenn er mit uns nichts mehr zu schaffen haben wollte. „Drohen! Ich verweise auf den Paragrafen …“
„Schluss mit dem Palaver und Abmarsch!“ Brockauf fasste den Mann am Arm und gab mir ein Zeichen, ihn auf der anderen Seite zu packen.
Doch Klunkert stand fest auf den Füßen und sagte nach einer Weile: „Eine merkwürdige Art, einen Menschen festzunehmen! Sie haben mir nicht einmal gesagt, warum Sie das tun.“
Brockauf lachte künstlich, ließ seinen Arm wieder los.
„Die Antwort hängt schwer genug auf Ihrem Buckel. Oder?“
„Das bisschen Zeug!“
„Für eine vorläufige Festnahme reicht es; hinzu kommt selbstverständlich Verdunklungsgefahr, und Fluchtverdacht ist schließlich immer gegeben!“
„Fluchtverdacht?“ Klunkert kicherte höhnisch, schaute hoch, als hätte er vorgehabt, in den Himmel zu entweichen, und jetzt hinderte ihn das Bahnsteigdach daran. „Mit Rucksack und Handschellen kann ich sowieso nicht abhauen, meine Herren.“
„Weiß man’s?“
„Wohin schon?“
„Wo Sie herkommen.“
Schweigend ging er mit uns: Brockauf links, ich rechts. Klunkert in der Mitte. „Na also“, sagte Brockauf nach geraumer Zeit, „warum erst Faxen machen.“
Kurz vor der hell erleuchteten Bahnhofshalle und dem Häuschen mit dem Fahrkartenknipser sagte Klunkert kleinlaut und demütig: „Tun Sie mir einen Gefallen, bitte?“
„Nicht gern“, erwiderte Brockauf, schien aber zu ahnen, was Klunkert wollte, und da ihm daran lag, der Mann möge weiter friedlich bleiben, fragte er freundlich: „Was darf’s denn sein, Herr Klunkert?“
„Ich möchte da nicht durchgehen wegen der Leute“, sagte er; ihm sei es peinlich, vor Publikum abgeführt zu werden. „Verstehen Sie das etwa nicht?“
„Doch, doch“, sagte Brockauf, „das verstehen wir, obwohl uns niemand zwingt, das zu verstehen; verstehen Sie das auch?“
Klunkert nickte.
„Und du, bist du auch einverstanden?“, fragte mich Brockauf mit gespieltem Ernst.
„Ausnahmsweise“, antwortete ich.
„Dann brauche ich nur noch Sie zu fragen, Klunkert!“
„Mich, wieso mich?“
„Könnte ja sein, dass Sie zumindest juristisch etwas dagegen einzuwenden haben!“ Brockauf feixte.
Klunkert bedankte sich höflich, nickte dabei Brockauf und mir zu. Und so liefen wir an der Tür zur hell erleuchteten Bahnhofshalle vorüber, hinter zum Ende des Gebäudes, wo der Ausgang für Eisenbahner ist. Während wir an mit Kalkwasser bespritzten Kohlenhaufen vorbeigingen, sagte Klunkert: „Sie sind nett zu mir. Ich habe gleich gesehen, dass Sie nett sind, als ich Sie vorhin auf mich zukommen sah.“
„Ach“, machte Brockauf. „Kommen Sie uns nicht noch auf die süße Tour!“
„Aber wahr ist es.“
„Unsinn“, widersprach Brockauf und meinte, ein Kriminalist werde geradezu gehindert, nett zu sein, weil er es meist mit Menschen zu tun bekomme, die nicht nett zu ihrer Umwelt gewesen seien. „Nur Unmenschen sind wir keine, das ist es, Klunkert!“
„Das haben Sie sehr schön gesagt“, und ich hörte ihn noch tief Luft einsaugen, dann hörte ich nichts mehr …, sah auch nichts mehr von ihm. Ich musste auf die Knie gestürzt und vornüber aufs Pflaster geknallt sein. Jedenfalls lag ich da, krümmte mich vor Schmerz. Klunkerts Ellenbogen hatte mich genau in der Magengrube getroffen. Ich versuchte mich zu orientieren: Links lag der schwere, große Rucksack, dahinter wohl Brockauf, denn von dort drang sein Stöhnen. „Dieses Schwein, dieser ausgekochte Hund“, sagte er mit schwacher Stimme.
Noch benommen, erreichte ich schwankend den Vorplatz des Bahnhofs. Kein Klunkert war mehr zu sehen, und außer trippelnden Frauenschritten auf den Stufen war kein Laut zu vernehmen. Noch immer fiel Regen, wenn auch jetzt dünner, und Nebel kroch um Lampen und Baumkronen.
Wieder bei Brockauf, hielt der mir die offene Handschelle entgegen. „Wie denn das?“, rief ich ungläubig.
„Wüsste ich’s, wär’s nicht passiert“, sagte er und tastete seinen Magen ab.
Die Handschelle betrachtend, sagte ich: „Dass es so was gibt, wusste ich nicht. Du?“