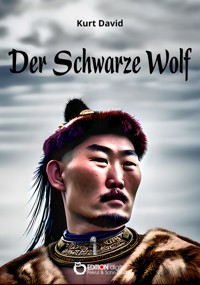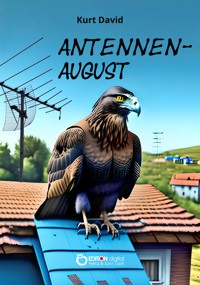6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Frank und Herbert waren Nachbarn und kamen zur gleichen Zeit an die Front. Sie waren Freunde, aber Franks Mutter sah das nicht mehr gerne, nachdem Herberts Vater von der Gestapo abgeholt worden war. In Frankreich werden sie in der Ausbildungskompanie misshandelt. Als ihr Zug unter Beschuss gerät, rettet Frank Herbert das Leben. Der Schinderei überdrüssig, sind alle froh, als es endlich an die Front geht. An der Ostfront erleben sie die Vertreibung und Ermordung der Bevölkerung und das Niederbrennen der Dörfer auf dem Rückzug. Herbert drängt seinen Freund, mit ihm überzulaufen, aber Frank hat zu viel Angst vor den „bösen Russen“. Als er sich endlich durchringt, ist sein Freund tot. Im Gefangenenlager trägt Frank schwer an seiner Schuld, dass sie nicht früher geflohen sind. Er muss im Bergwerk hart arbeiten und hungert sehr, denn auch die Russen haben nichts mehr zu essen. Aber langsam begreift er die Zusammenhänge und weiß, dass er sich nicht noch einmal für einen Krieg missbrauchen lassen wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 291
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Impressum
Kurt David
Die Verführten
Roman
ISBN 978-3-96521-904-5 (E-Book)
Das Buch erschien 1956 im Mitteldeutschen Verlag Halle (Saale) mit Unterstützung des Kulturfonds der Deutschen Demokratischen Republik und des Deutschen Schriftsteller-Verbandes.
© 2023 EDITION digital Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
I. Teil
1
Unterhalb von Saint-Nazaire liegt das französische Dörfchen Mucilac. Achtzehn Häuser und eine Kirche, und draußen vor dem Dorf ist Lehm- und Sandboden, der sich bis hinüber zum Meer streckt. Aber es gibt dort noch etwas: blühenden Ginster! Wie Nadelkissen hocken die grünen Büschel mit den gelben Blüten auf der weiten Fläche.
Unteroffizier Beyer bekam während der vierwöchigen Ausbildung hier sehr schnell einen neuen Namen: Ginster-Beyer.
„Und gepflanzt hat das Luderzeug wahrscheinlich unser Spieß!“, sagte jemand.
Vier Mann der zweiten Kompanie lagen immer im Revier. Wegen Blutvergiftung. Das war schon einkalkuliert.
„Und der fünfte wandert in den Bau!“, meinte Ginster-Beyer. Selbstverstümmlung wurde das genannt. Gewiss, es gab schon Leute darunter, die zum zweiten Mal für acht Tage ins Revier gingen.
„Gibt’s in Russland sozusagen ooch Ginster?“, wollte Knoop wissen.
„Nee, Granatwerferfeuer wie Schnürdelregen!“, sagte der Unteroffizier.
„Egal! Lieber raus!“, jammerte Kirchner.
Der Spieß, Hauptfeldwebel Graubaum, und Oberleutnant Nebbel standen hinter dem Schreibstubenfenster und blickten mit Ferngläsern hinaus auf das Übungsgelände, ob auch Feldwebel und Unteroffiziere vor den Nadelkissen keine Verbeugung machten und zu den Rekruten sagten: Verzeihung, meine Herren, gehen Sie bitte hier herum, lassen Sie das Nadelkissen links liegen!
Aber die zwei konnten unbesorgt sein.
„Hinlegen“, brüllte Ginster-Beyer, „bis in meine Höhe – robben!“
Und nun begann sich der Haufen wie eine Herde Raupen vorwärtszubewegen, und Beyer und andere Ausbilder stierten fieberhaft auf die einzelnen Gestalten, ob auch keiner solch ein Büschel umging.
„Sternberg! – Zwanzig Schritt zurück! – Mamarsch!“
Frank hatte versucht, sich über einen Busch hinwegzuheben, und nun musste er alles noch mal machen.
Beyer stelzte zwischen den Liegenden und Kriechenden umher, wie ein Gärtner in seinen Salatbeeten. Er musste aufpassen, dass er auf keinen Kopf trat.
„Nun sagen Sie mir bloß noch, mein lieber Scholz, das wäre hier eine stachlige Angelegenheit, dann weiß ich alles!“
Unteroffizier Beyer trat zu Herbert Scholz, der gerade durch so ein Nadelkissen gerutscht war und nun nur noch bis zu den Knien drinlag. Die spitzen, giftigen Stacheln pikten durch die Uniform. Man musste ganz ruhig liegen. Nur nicht rühren.
„Na, sticht das etwa, Scholz, hm?“, frotzelte Beyer.
„Sticht!“, sagte Herbert.
„Wie? Sticht? Sind Sie wahnsinnig geworden? – Ich hatte gemeint, es sticht nicht! – Sticht’s?“
„Sticht!“, sagte Herbert trotzig.
„Scholz! Merken Sie sich ein für alle Mal, wenn ich sage, das sticht nicht, dann sticht es nicht, und wenn es tausendmal sticht, klar?“
„Nein!“, brüllte Herbert Scholz.
Ginster-Beyer war ein kleiner, ducksiger Kerl mit einer roten Nasenspitze. Aber jetzt, jetzt blähte er sich auf, feixte, wurde wieder ernst und brüllte: „Mann ! Machen Sie sich nicht unglücklich! – Einen Meter zuuuurück!“
Herbert glitt vorsichtig in den Ginster. Die gespreizten Finger stupste er vorn zwischen die Stängel in den Lehm. Nun lag er mit dem ganzen Körper in dem Strauch.
„Sticht’s?“, grunzte Beyer.
„Sticht!“
Einige lachten.
„Is’ denn so etwas drin? Is’ der Kerl noch normal? So ’n dussliger Hund! – Scholz! – Auf! – Hinlegen! – Auf! – Hinlegen! Auf! – Hinlegen!“ Mit voller Wucht warf sich Herbert in die Stacheln. Die Arme streckte er lang aus, und er gab sich Mühe, möglichst auf den Ellenbogen zu fallen, um so wenigstens die Hände zu schonen.
„Auf!“, befahl Beyer.
Herbert stand in dem Ginsterbusch. Von der einen Wange tröpfelte Blut. Zerkratzt sah er aus, und an der Uniform spießten eine ganze Armee Dornen.
„Nun seht euch diesen Vogel an! Das hat er davon!“, grunzte Beyer.
„Knoop!“
„Unteroffizier?“
„Sticht der Ginster?“
„Wenn der Herr Unteroffizier sozusagen befehlen, der Ginster sticht, dann sticht er, befehlen der Herr Unteroffizier, der Ginster sticht nicht, dann sticht er sozusagen nicht!“
„Sozusagen!“, äffte Beyer. „Sternberg! Sticht der Ginster?“
„Nein, Herr Unteroffizier!“
„Richter?“
„Nein, Herr Unteroffizier!“
„Maytal?“
„Neinnein, Unteroffizier!“, sagte der kleine, klapperdürre Kerl und blickte mitleidig zu Herbert Scholz.
„Kirchner?“
„Nein, Herr Unteroffizier!“
„Nur bei Scholz sticht’s! Komisch, wie?“
Herbert wischte sich das Blut nicht vom Gesicht. Er ließ es vertrocknen.
Auch am Abend waren diese dunkelroten Flecke zu sehen. Sie sahen aus wie Rost, den man mit den Fingernägeln abkratzen möchte.
Herbert Scholz lag teilnahmslos auf seinem Bett.
Ully Knoop trat an Frank Sternberg heran und meinte flüsternd: „Is’n das für einer, der Komische da, hm?“ Er wies auf Scholz.
„Komischer? Der ist schon immer so! Kenn’ ich! Wir sind aus einem Dorf! Der lässt sich gar nichts gefallen!“
„Soo!“
Frank kam es vor, als wolle Knoop, dieser kleine, dickliche Mann, mehr von Scholz wissen; denn mit dem „Soo“ war in seinem Gesicht ein Staunen zu lesen.
Sie traten vor die Tür der kleinen französischen Schule und hockten sich auf einen eingefallenen Gartenzaun.
Knoop blickte Sternberg erwartungsvoll an. Und Frank sagte: „Wir gingen beide noch zur Schule, da wollte er unserem Kupferschmied die Bude anzünden!“
„Ach!“
„Ja, Herberts Vater arbeitete dort. Wir wohnten der Kupferschmiede gerade gegenüber. Und wie ich da eines Tages so am Fenster sitze, schrecke ich plötzlich auf: Der Kupferschmied – der olle Hessel – hatte Scholz eine Ohrfeige gegeben! Ich raus aus der Stube, rum zu Herbert, und dort sagte ich: ,Mensch, Rache! Der Hessel hat deinen Vater geohrfeigt!‘“ Frank machte eine Pause. Knoop lachte wie ein Kind. „Hm, und Herbert sagte wütend: ,Der Hund! Heut nacht zünden wir seine Bude an!‘“
„Und? – Habt ihr das auch gemacht?“, fragte Knoop.
„Quatsch! Das war ja nun nicht so einfach!“ Und nun erzählte Frank, dass Hessels ein großes Haus mit drei Etagen hatten, eine lange Werkstatt und einen hölzernen Hühnerstall. So hätten sich Frank und Herbert tüchtigen Sturm gewünscht. Aber da waren auch schon in Herbert die ersten Bedenken hochgestiegen: Wie, wenn nun das Feuer auf das Nachbarhaus übergreifen würde. Das seien doch nette Leute. Und in ihrer Fantasie hatten sie sich einen Brand ausgemalt, ganz Auenreich in Flammen …
„Na, ihr habt’s aber doch nicht gemacht?“, fragte Knoop.
„Wart doch ab!“, sagte Frank. „Wir wollten dann nur die Werkstatt anzünden. Aber da meinte Herbert, dass dies gleich auf seinen Vater fallen würde. Und da haben wir uns dann auf den Hühnerstall geeinigt.“ Frank machte eine Pause. „Ja, und das mit dem Hühnerstall, das sollte ja nun endgültig sein“, erzählte er weiter. „Punkt zwölf – Mitternacht wollten wir uns bei Hessels Stall treffen. Wir hatten jeder drei Streichhölzer geklaut. Das schlimmste Ding war, aufzupassen, dass wir nicht einschliefen. Ich habe lange im Bett gestanden und bin doch eingeschlafen.“
„Schade“, unterbrach Knoop.
„Wart doch! – Jedenfalls wurde ich kurz vor zwölf wach, durch Lärm auf der Straße. Ich raus, ran ans Fenster, und da sah ich den Stall brennen. Kannst dir vielleicht denken, was ich für eine Wut auf Herbert hatte. Aber da war die Sache ganz anders gewesen. Herbert hatte den Hühnerstall gar nicht angezündet – der war nämlich auch eingeschlafen. Bei Hessels hatten sie damals eine Ursel, als Hausmädchen. Die war’s. Die musste immer die Schuhe mit der bloßen Hand einkremen. Und an diesem Tage hatte sie die Milch überlaufen lassen. Zur Strafe musste das Schulmädel den Hühnerstall ausräumen, den Dreck mit den Fingern.“
„Und da hat sie ihn angezündet!“, sagte Knoop und fand das fast in Ordnung.
„Hm, so war das. Herbert geht ran, wenn’s sein muss, den kenne ich genau!“, sagte Frank. Er sprach aber zu Knoop kein Wort davon, dass Herberts Vater im Dorf damals als „Roter“ bezeichnet wurde.
„Nun verstehe ich auch“, meinte Knoop, „weshalb sich der Scholz im Ginster so die Fresse zerkratzen lässt. Der hat einen harten Schädel.“ Halblaut fügte er hinzu: „Zweck hat’s keinen, Sternberg!“
„Nein!“, sagte auch Frank. „Zweck hat es keinen. Trotzdem habe ich ihn gern. Vielleicht gerade deshalb. Weißt du, er wehrt sich, er wehrt sich dagegen, dass Schwarz weiß und Weiß schwarz sein soll.“
„Geschmacksache!“, meinte Knoop schon wieder gleichgültig.
Am anderen Morgen kam Herbert Scholz ins Revier.
Er hatte hohes Fieber. Die Wunden begannen zu brennen.
„Mensch, du kommst ja schon das vierte Mal zu uns!“, sagte der Sani und griente.
*
Die Ausbildung war vorüber. Mucilac und sein Ginster wurden verlassen, nicht vergessen. Beyer blieb Ginster-Beyer. Auch dann, als er meinte: „So, nun beginnt das richtige Landserleben!“
„Das muss nämlich erst sozusagen verdient werden!“, meinte Knoop.
Die zweite Kompanie kam ans Meer.
„Stützpunktdienst!“, meinte Oberleutnant Nebbel.
An einem schneelosen Dezembermorgen marschierte die Kompanie hinaus. Diesiger Dunst und Nebel krochen über die Weiten.
Sechs Häuser standen auf einer Landzunge, die wie ein Finger in den Atlantik griff.
Ambon hieß das Fischerdorf.
Auf der glitschigen Gasse des Dörfchens standen die zweirädrigen Karren der Franzosen, die mit ihrem Hausrat das Dorf verlassen mussten. Vor einer Stunde hatten sie Befehl erhalten.
„Na, los nun, ah!“, schnauzte Oberleutnant Nebbel hinüber zu den Leuten und gab ein Zeichen mit der Hand. Irgendetwas schien nicht in Ordnung zu sein; denn die Franzosen trampelten verlegen hin und her, gingen aber nicht.
„Ich habe gesagt, ihr sollt euch verduften, Blase!“, brüllte der Oberleutnant über die Gasse und ging auf die Karren zu. Nun, da die Franzosen immer noch wortlos umherstanden, war es auch für Beyer an der Zeit, einiges auf seine Art zu sagen:
„He, ihr wartet wohl auf die Möbelwagen, ihr wandelnden Schlafsäcke?“ Beyer stieß mit der Stiefelspitze an die Räder eines Karrens.
Die Soldaten standen herum, einige feixten, andere rauchten oder guckten in die Fenster. Manche traten zaghaft in die eben geräumten Häuser. Herbert sah verbissen vor sich hin.
Frank sagte: „Mensch, Herbert, guck doch, wir sind am Meer. Am richtigen Meer.“
Herbert gab keine Antwort, sondern beobachtete die Franzosen. Ein kleiner Junge kam aus einem Haus gerannt und brüllte den Franzosen in ihrer Sprache etwas zu, zuckte mit den Schultern. Die Leute schüttelten die Köpfe.
Oberleutnant Nebbel schrie: „Machen wir nicht so einen Zores mit den Affen!“ Und auf Französisch brüllte er: „Zum letzten Mal! Eins – zwei –!“ Und bei „drei“ begannen sich die Räder von fünf Karren zu drehen. Nebbel fuchtelte mit der Pistole herum. „Na also!“, sagte er.
Die Franzosen fuhren langsam aus dem Dorf und sahen sich mehrere Male um. Beyer rannte hinterher und brüllte wie ein Viehtreiber.
Erst jetzt bemerkte Nebbel, dass ein Karren vor einem Haus stehengeblieben war. Er regte sich auf: „Soll’n das?“ Er winkte Leute zu sich.
Der Oberleutnant, ein baumlanger Kerl mit schwarzem Haar, trat in das Haus. Hinter ihm Richter, Frank, Herbert und der kleine Maytal, der von allen „Spund“ gerufen wurde.
„Ist hier jemand?“, schrie Nebbel in den Flur. Niemand antwortete. Im Haus roch es nach Wärme und Essensdunst.
„Jetzt wird’s gut“, flüsterte Richter. Frank und Herbert hielten sich im Hintergrund. Nebbel setzte seine Hand auf eine Türklinke und zerrte daran herum; sie sprang auf, knarrend, fast leicht.
„Aha! Da haben wir’s!“, meinte Nebbel.
Die anderen drängten nach, streckten ihre Hälse. An einem Tisch saß ein alter glatzköpfiger Mann mit einem weißen Vollbart. Das Kinn stützte er auf die angewinkelten Arme, und vor ihm auf dem Tisch stand eine leere Tonschüssel, in der ein Löffel lag. Der Alte blickte nicht einmal auf, sondern starrte auf die Tischplatte. Auch dann noch, als der Oberleutnant sagte:
„raus hier! Penner!“
Richter feixte. Herbert Scholz stieß Frank an und wies mit einer Kopfbewegung auf ein kleines Bild, das an einer tapezierten Wand hing.
Frank gab zu verstehen, dass er nicht wisse, was Herbert meinte.
Da der Alte nicht aufstand oder überhaupt nur einmal den Oberleutnant ansah, ging Nebbel an den Tisch, fasste an seine Kante und zog ihn blitzschnell mit einem Ruck fort. Der Franzose kippte vornüber und knallte auf die Dielen.
„Also!“ Spund war erschrocken. Er blickte auf den Alten.
Richter sah interessiert zu, so, als krabbele da unten auf der Diele ein Hund herum, aber kein Mensch. Frank war erschüttert; gleichzeitig bildete sich in ihm aber auch ein schwer zu erfassendes Gefühl, gemischt aus Wut und Empörung gegen Nebbel und aus einer Scham, die Frank nicht näher hätte erklären können. Es war ihm; als sei er selbst durch Nebbels Vorgehen erniedrigt worden. Der Alte erinnerte ihn plötzlich an seinen Großvater. An Opa Heyding: Wenn dem das passieren würde … In Frank war mit einem Male eine große Leere. Wenn Opa Heyding das passieren würde … war das einzige, was sich hartnäckig in seinen Gedanken behauptete.
„Nun wird er wohl munter werden!“, schnarrte Nebbel und stemmte die Hände in die Hüften. Er wartete.
Mühsam erhob sich der Mann, stellte sich breitbeinig vor Nebbel. In seiner faltigen Gesichtshaut zuckte und zitterte es. Seine Augen flackerten. In seiner Sprache schrie er dem Oberleutnant etwas ins Gesicht.
„Du Vieh!“ – hat er gesagt, Herr Oberleutnant!
Dreckiges Vieh!“, beeilte sich Richter mitzuteilen und fügte hinzu, dass er es verstanden hätte, weil er Oberschüler gewesen sei.
„Das habe ich auch schon so mitgekriegt!“, meinte Nebbel und fasste den Alten an seinem Bart und wollte ihn aus der Stube zerren. Gebückt, krumm wie ein Sägebügel, tappte der Franzose über die Dielen. Einen Meter hatte Nebbel schon geschafft, als er plötzlich auf die Knie fiel. Der Alte hatte ihn in den Bauch getreten. Was dann geschah, ging sehr schnell. Richter sprang auf den Alten. Nebbel zerrte dem Franzosen die Beine fort, und dann lagen die drei am Boden. Der Oberleutnant nestelte an seiner Pistolentasche herum, und Herbert wollte soeben in den Knäuel hineinspringen, da hing ihm schon Frank auf dem Rücken und riss ihn ebenfalls zu Boden.
Zwischendurch bellte dumpf die Pistole Nebbels …
Frank sah, wie der Oberleutnant seine Waffe aus dem Mund des Alten herauszog. Schnell sprangen Frank und Herbert auf.
„Macht ihr denn da, hm?“, fragte Richter misstrauisch.
„Scholz hat mich einen dummen Hund geheißen!“, log Frank.
„Komische Pfeifen seid ihr!“, sagte Richter und half dem Kompanieführer von der Diele.
„Notwehr, klar?“, keuchte Nebbel und zupfte sich die Falten aus seinem Rock. „So ein Aas!“, fügte er hinzu. „Will der Hund noch Faxen machen.“ Und zu Richter: „Notieren Sie mal sich selbst und Maytal als Zeugen!“
„Jawoll, Herr Oberleutnant!“ Richter notierte.
„Und diese zweirädrige Mistfuhre da draußen, die wird abgeladen, das Zeug wieder eingeräumt. Ich nehme das als Quartier!“
„Hier gehörst du hin!“, brummelte Herbert vorn an der Tür. Frank schaute auf den Toten und machte ein entsetztes Gesicht.
„Dieser Mistvogel da!“ Nebbel wies auf den Alten, der wie eine Wachspuppe lag. „Dieser Kerl wird mir weit draußen verscharrt. Und ohne Hügel das Grab! Weit draußen, sage ich!“ Nebbel hustete. „Wer will das machen?“
Herbert Scholz meldete sich.
„Noch einer!“
„Und Sternberg!“, sagte Scholz.
Ich? Ich soll diesen Toten begraben? dachte Frank und sah voller Entsetzen zu Herbert.
Er wollte noch etwas sagen, wollte Herbert bitten, einen anderen Kameraden mitzunehmen, aber die Kehle war ihm wie zugeschnürt, er brachte kein Wort heraus. Es könnte Opa Heyding sein … Die mühsam wiedergewonnene Fassung ging in diesem peinigenden Gedanken unter.
Der Oberleutnant und die anderen verließen den Raum. Richter ging als letzter und drehte sich an der Tür noch einmal um: „Ehrlich gesagt, diese Prügelei vorhin kam mir komischer als komisch vor, hm?“
„Halt deine Schnauze!“, fluchte Herbert. Richter blinzelte über seine Schulter hinweg und ging.
„Ob der was gemerkt hat?“, fragte Frank ängstlich.
„Weiß nicht! – Jedenfalls hast du mich vor einer großen Dummheit bewahrt, Frank!“
Herbert trat an die Wand, nahm das kleine Bild herunter und sagte: „Erinnerst du dich? In unserer Stube hing auch eins. Der Gendarm Leupold hat’s mitgenommen. Und an den Splittern der Wandvase hast du dich geschnitten.“
Frank wusste, was Herbert meinte.
Sie fassten die Leiche an Armen und Beinen und trugen sie aus dem Dorf.
„Wie alt mag der sein?“ Frank sah immer über den Toten hinweg.
„Fünfundsechzig vielleicht!“
Leichter Wind blies über die Dünen. Hoch über der Küste zog ein deutscher Aufklärer seine Bahn.
Sie liefen mit der Leiche weit hinaus. In einer Mulde legten sie den Toten nieder. Herbert setzte sich daneben.
„Was machst du denn da?“, fragte Frank. Herbert schrieb etwas auf einen Zettel und antwortete: „Damit sie später sehen, was hier geschehen ist.“ Er schrieb: Oberleutnant Erich Nebbel von der 333. I. D. hat am 5. 12. 1942 diesen Franzosen aus Ambon erschossen, weil er seine Wohnung nicht verlassen wollte. „So, und diesen Zettel lege ich mit in das Bild.“ Sie gruben ein tiefes Loch, legten den Alten hinein, und Herbert nahm das Bild, steckte es in die Brusttasche des Franzosen.
Sie begannen Erde hinabzuwerfen.
„Warum schaufelst du denn nicht?“, meinte Herbert. „Ach, du betest dein ,Gegrüßet seist Du, Maria‘, hm . Lass mal, Frank, das will der gar nicht. Der wollte, dass er in seinem Dorf bleiben konnte!“
„Und was hat das alles genutzt?“
„Nichts! Ich weiß es. Vielleicht wäre es anders gekommen, wenn alle Bewohner sich geweigert hätten. Vielleicht. Aber der Alte? Der Alte wollte einfach nicht weg von hier. Das war alles! Das Meer war sein Acker. Das Meer war sein Zuhause. Und nicht nur Deutsche haben eine Heimat.“
„Hm“, machte Frank und schwieg nachdenklich.
„Nanu, schaufle doch bald ’n bisschen mehr darauf. Der Kopf ist da unten ja noch zu sehen!“
„Kann ich nicht, Herbert. Das ist so komisch. Immer denke ich, dem fällt Dreck in die Augen.“
„Das ist jetzt nicht mehr schlimm. Vorher, der Schuss in den Mund, wie das Aas seine Pistole dem Alten zwischen die Zähne schob, das war schlimm. Mord!“
Frank ging zur Seite und erbrach sich …
Er war erschüttert. Und hatte er zuvor das „Gegrüßet seist Du, Maria“ gebetet, dann nur deshalb, weil er dazu erzogen worden war. Zu Hause musste er Sonntag für Sonntag zur Kirche gehen. Und für einen Toten musste man beten. Aber das, das ist ein anderer Toter, dachte er. Hier befriedigte ihn das Beten nicht …
„Hügel dürfen wir keinen machen, hat der feine Herr gesagt, aber dass wir einen gewöhnlichen Stein herholen, das nimmt uns doch keiner übel. – Was hast du denn, Frank?“
Der junge Sternberg saß mit käsigem Gesicht im Sand.
„Na, bleib sitzen. Ich hol’ einen Stein!“
Herbert ist ganz anders als ich, dachte Frank. Erst wollte er den Oberleutnant gleich noch mit umbringen, wegen des Alten, und jetzt, jetzt geht ihm der Tod dieses Menschen gar nicht einmal so an die Nerven wie mir.
Herbert kam mit einem Stein zurück. „Nun zieh mir nicht so ein Gesicht, Frank. Davon wird der nicht mehr lebendig. Davon nicht!“
Frank schwieg.
Wortlos gingen sie zurück ins Dorf.
Am Mittag holte sich Frank kein Essen. Erst einen Toten begraben und nachher Makkaroni mit Gulasch? Nein, nein! Das nicht. Er konnte nicht essen. Er wälzte sich auf seinem Lager herum, unruhig und in Gedanken verloren. Er schloss die Augen und sah nur noch das Bild, das sie dem Alten auf die Brust gelegt hatten. Und dieses kleine Bild führte ihn zurück in eine Zeit, in der er erst zehn Jahre alt war …
Frank sitzt zu Haus in der Wohnstube, er lässt ein kleines Feuerwehrauto über die Dielen rollen. Tatüütataa – tatüütataa – macht er. Er fährt damit zur dreischübigen Kommode und ruft: Der Reichstag brennt! Der Reichstag brennt! Und schon leiert er die gelbe Schiebeleiter hinauf zum dritten Schub und löscht und löscht. Der Reichstag brennt immer wieder.
Sein Großvater – Opa Heyding – sitzt auf dem Sofa und jagt müde Winterfliegen, die auf dem Tischtuch spazierengehen. „Biest“, sagt er und schlägt darauf.
„Der Junge spielt Reichstagsbrand“, sagt er kopfschüttelnd. „Der weiß gar nicht, was das bedeutet.“ Nein, das weiß Frank wirklich nicht. Und wenn Opa Heyding sagt, dass die Nazis den Reichstag selber angezündet hätten, so bleibt Frank dies erst recht ein Rätsel. Das wäre ja genauso, als ob Hessels ihren Hühnerstall selber in Brand gesteckt hätten.
„Hat er das Feuerwehrauto zu Weihnachten gekriegt?“, fragt der Opa. Franks Mutter nickt. „Weihnachten“, wiederholt Opa Heyding. „Was bekamen wir früher zu Weihnachten. Ich kann mich noch gut auf unseren Pfarrer Knuppke besinnen! Der verteilte zu Weihnachten in der Schule immer Strümpfe, Jacken und Hosen. Zu mir sagte er jedes Jahr: Du bekommst nichts, bist nur ein lediges Kind!“ –
Frank will wissen, was das ist, ein lediges Kind? „Spiel du“, sagt Opa Heyding und wischt sich Tränen aus den Augen. „Das kann ich dem Pfarrer Knuppke nie vergessen.“
Frank muss wissen, was ein „lediges Kind“ ist. Er steht auf und geht hinüber zu Scholz’ Haus.
„Tag“, sagt er, als er eintritt. Herbert macht ein trauriges Gesicht und sagt: „Willst’n?“
Frank antwortet ihm nicht. Herbert fragt sonst nie, weshalb er kommt. Der Junge führt ihn aus der Küche in die Wohnstube. Wortlos zeigt er in den Raum.
„Das sieht aber aus!“, sagt Frank und guckt auf die aufgerissenen Schübe und Kästen und das am Boden umherliegende Papier.
„Der Leupold-Gendarm war hier. Und dann noch einer in Zivil. Haben alles bei uns umgedreht, sogar die Betten. Und meinen Vater haben sie mitgenommen!“
„Hat er ge…“, Frank überlegt. Herberts Vater kann doch nicht gestohlen haben.
„Plakate und Zeitungen haben sie auch mitgenommen. Und das Bild, das Bild von der Wand auch. Siehst du, von dort!“ Herbert zeigt mit dem Finger auf eine Stelle, deren Farbe sich von der anderen Wand hell abhebt …
Frank öffnete wieder seine Augen. Er war wieder in Ambon, wieder bei dem Alten in der Stube. Bei dem Franzosen an der Wand war an der Stelle, wo das Bild gehangen hatte, auch so ein heller Fleck. Die roten Blümchen der Tapete sahen wie neu aus. Das gleiche Bild hat dort gehangen. Er drückte seinen Kopf wieder in den Mantel hinein, als wolle er nochmals in die Vergangenheit blicken, nochmals in Scholz’ Wohnstube …
„Warum haben sie denn das Bild mitgenommen?“, fragt er Herbert.
„Weiß ich’s? Sogar die kleine bunte Wandvase, die darunterhing, die haben sie zerschlagen.“
Plötzlich steht Frau Scholz hinter den Jungen. Blass, erdfahl im Gesicht. Die langen, blonden Haare hängen ungeordnet und feucht herunter.
„Kommt“, sagt sie, „das räumen wir jetzt alles auf!“
Frank freut sich, dass er bei Scholz’ mit helfen darf, rutscht auf den Knien durch die Stube und sammelt Papier und andere Sachen, legt sie in die Schübe zurück. Als Frau Scholz einmal in die Küche geht, flüstert Herbert: „Du, ich bin ja so froh, dass du bei uns mithilfst. Anfangs dachte ich, du könntest mich nun nicht mehr leiden!“
„Nicht mehr leiden?“
„Ja, weil mein Vater doch von der Polizei …“
„Quatsch, Polizei!“
„Mein Vater ist doch so gut, Frank!“
„Au – so ein Mist!“, schimpft Frank. Er hat sich mit der linken Hand aufstützen wollen und dabei die Innenfläche in einen Glasscherben der Wandvase gedrückt.
Frank Sternberg, der Landser, besah sich die kleine Narbe in der Innenhand. So war das damals gewesen. Und wie ging es doch weiter …?
„Mensch, du wirst ja ganz blass, Frank! – Mutter! Mutter!“
Frank fällt auf die Dielen. Jedes Mal, wenn er Blut sieht, wird ihm schlecht. Frau Scholz bringt ein Glas Wasser. Sie legen den Jungen auf das Sofa in der Küche. Frau Scholz hat den Splitter herausgezogen, und nun hält Frank die Hand in die Waschschüssel mit Seifenwasser.
„Das ist gar nicht schlimm!“, sagt Herberts Mutter und streichelt dem Jungen über die Hand. Sie tritt an den Küchenschrank, entnimmt ihm eine blaugepunkte Dose und gibt Frank einen Kaffeelöffel voll Zucker.
Herbert lacht: „Klar, Frank, das macht nichts. Musst die Zähne zusammenbeißen. Wir sind doch Jungen!“
„Du kannst gut lachen!“, sagt Frank und zieht trotz des Zuckers ein saures Gesicht.
Während Frank mit der Hand in dem Seifenwasser plätschert, geht Herbert wieder in die Stube. Er kommt aber kurz darauf schon zurück, zeigt Frank seine linke Hand und sagt: „Hier, siehst du, jetzt habe ich mich auch geschnitten. Genauso eine Wunde wie du!“
Und da holt auch schon seine Mutter mit der rechten Hand aus, hält aber inne und sagt: „So ein dummer Kerl, wie du gerade bist!“
Sie nimmt die zwei Jungen beim Kopf, presst sie an sich und meint: „Ach ihr …“
Herbert flüstert, während sie so dicht aneinandergepresst werden: „Jetzt sind wir richtige Freunde, ja?“
Und Frank gibt mit Zwinkern zu verstehen, dass sie jetzt „Freunde“ seien.
Draußen schneit es. In der Küche ist es düster, grau und warm. Auf dem Fenstersims steht Herberts Vogelhaus. Frau Scholz sitzt am Tisch, den Kopf auf die Fäuste gestützt. In der Waschschüssel mit dem Seifenwasser rudern zwei linke Kinderhände. Manchmal stoßen sie aneinander …
Ja, so war das gewesen, dachte Frank und blickte von seiner Pritsche aus hinaus auf das Meer.
Danach zu fragen, was ein „lediges Kind“ sei, das hatte er damals dann ganz vergessen. Und jetzt wusste er es schon längst. Eine Gemeinheit von Opas Pfarrer, dachte er. Opa weinte mit 70 Jahren, wenn er das erzählte, so hatte sich das in ihn eingegraben …
„He! Scholz und Sternberg, sofort zum Oberleutnant!“, schrie Richter in das Zimmer.
„Der Affe!“, flüsterte Herbert. Frank wurde unruhig.
„Siehst du, jetzt!“, sagte er.
„Ganz ruhig, mein Lieber, ganz ruhig! Ich habe dich einen dummen Hund geheißen, und du sagst, dass du immer gleich raufst!“
Frank nickte.
Sie traten in das Haus, in dem der Oberleutnant Quartier bezogen hatte.
„Scholz!“ Nebbel stand mitten in der Stube. Fast auf dem Fleck, wo der Alte umgebracht worden war. „Hier an der Wand“, der Oberleutnant wies mit dem Finger auf die Stelle, „hing doch ein Bild!“
Frank und Herbert rührten sich nicht.
„Na, so’n komischer Vogel hing doch da!“
„Vogel?“, wiederholte Herbert.
„Vogel! Vogel! Sie sind auch so ein Vogel! Ich meine, da hing ein Bild, worauf ein Mann abgebildet war. Haben Sie das Bild gesehen?“
„Nein, Herr Oberleutnant!“
„Sternberg?“
„Nein, Herr Oberleutnant!“
„Mann! Machen Sie mich doch nicht blöd! Ich sehe doch jetzt noch die Stelle ganz deutlich, wo es gehangen hat!“
Der Oberleutnant zeigte auf den Fleck, wo die Tapete mit den roten Blümchen hell und neu war.
Herbert und Frank erklärten, dass sie das Bild nicht gesehen hätten. – Aus! Vorbei! dachte Frank. Das hat mir Herbert eingebrockt. Blöde Geschichte. Der „Alte“ braucht jetzt nur noch zu verlangen, dass er an die Stelle geführt wird, wo der Franzose liegt. Wir müssen ihn ausschaufeln. Das Bild wird gefunden, und dann – noch etwas: Herberts Zettel. Frank musste an seinen Vater denken. Lass dich nicht zu sehr mit dem Herbert ein, hörte er ihn sagen.
Mach du deinen Dienst ordentlich, damit dir keiner was anhaben kann, und sei gehorsam gegenüber deinen Vorgesetzten. Vielleicht hatte der Vater recht gehabt … Wenn Herbert die Sache mit dem Bild nicht getan hätte, säßen sie jetzt nicht hier. Und wenn erst die Geschichte mit dem Zettel herauskam, dann … Frank wagte den Gedanken gar nicht zu Ende zu denken.
„Nun möchte ich bloß noch wissen, wer sich in meiner Kompanie, die aus lauter jungen Schlipsen besteht, schon für solche Bilder interessiert!“, sagte Nebbel. „Na, Scholz? – Na, Sternberg? – Haben Sie das Bild vielleicht, ich meine so rein zufällig, in Ihrem Besitz, hm?“
„Ich nicht!“
„Ich auch nicht!“, sagte Frank.
„Richter!“ – Richter, der am Herd stand und Spiegeleier briet, er war Putzer beim Oberleutnant, meldete sich. „Sagen Sie Unteroffizier Beyer, er soll das Gepäck von diesen beiden durchsehen, wegen des Bildes, sofort!“
Richter rannte mit einem Grinsen los.
„Nun, meine Herren? Vielleicht finden wir das Bild. Wäre doch immerhin möglich, nicht?“
Beide verneinten. Frank beeilte sich geradezu, dem Oberleutnant dieses sichere „Nein“ entgegenzuwerfen.
„Sternberg! Sie sind und bleiben eine Memme! Sind schon wieder blass wie so ’ne Nutte. Ich tue Ihnen doch gar nichts. Frage doch nur!“
Der Herbert! Ich bin eigentlich ganz unschuldig! Ich habe mit dem Bild gar nichts gemacht. Franks Gedanken gingen wirr durcheinander. – Eigentlich habe ich doch nur meine Pflicht getan, ordentlich, wie es der Vater gesagt hat. Oder hätte ich Herbert daran hindern sollen, das Bild mitzunehmen und den Zettel zu schreiben? War das seine – Franks – Pflicht? Hatte denn aber Nebbel, als er den wehrlosen Alten erschoss, auch nur seine Pflicht ordentlich erfüllt?
Der liebe Gott straft alles, pflegten die Eltern immer zu sagen. Warum befand sich aber dann jetzt er – Frank – in einer so gefährlichen Situation, und Nebbel, der einen Menschen umgebracht hatte, saß vor ihm und würde ihn, wenn alles herauskäme, mit verurteilen lassen, obwohl er gar nichts getan hatte. Wäre ich nur nicht mit Herbert mitgegangen …
Richter kam zurück. „Befehl ausgeführt! Nichts vorgefunden!“
„Ihr Glück, meine Herren! – Trotzdem gestatten Sie mir, dass ich noch einige Fragen an Sie richte, denn das Bild ist ja damit noch nicht hervorgezaubert. Und da es nicht die Kraft hatte, sich selbstständig von der Wand fortzubewegen, möchte ich doch zu gern wissen, wem dieser Wandschmuck gefallen hat!“
Frank spürte das große Unheil immer näher kriechen. Der Vater hat schon recht gehabt: Lass dich nicht zu sehr mit dem Herbert ein. Jetzt sitz ich drin. Die Angst würgte ihn förmlich. Frank war nahe daran, herauszuschreien: Herr Oberleutnant, ich bin nicht schuld! Ich nicht!
„Ich bitte Herrn Oberleutnant etwas sagen zu dürfen!“, platzte Herbert hervor. Frank blickte erschrocken zu ihm.
„Ja, Scholz?“ Der Oberleutnant streckte den Hals und wippte auf den Stiefelspitzen.
„Ich – ich habe – ich – ich wollte – wir –“ Herbert gab sich wirklich viel Mühe zu stottern.
„Ganz ruhig, Scholz!“, mahnte Nebbel und machte ein wichtiges Gesicht.
„Dem Alten, Herr Oberleutnant, habe ich das Bild in die Tasche gesteckt – – –“
„So – hm – weiter?“ Nebbel presste die Lippen dicht aufeinander.
„Ich dachte, der Mann auf dem Bild sei sein Vater, wissen Herr Oberleutnant “
„Dachten Sie! Falsch gedacht! Weiter!“
„Und dann, dann haben wir Ihren Befehl eben nicht ausgeführt.“
„Was für einen Befehl?“
„Wir sollten doch den Alten begraben. Dazu hatten wir keine Lust. Wir haben ihn einfach ins Meer geworfen. Die Taschen steckten wir voll Steine.“
„Hahahaaa!“ Nebbel krümmte sich vor Lachen. Hätte er bei dieser Geschichte, die Herbert erlog, nicht Scholz, sondern Sternbergs Gesicht beobachtet, er hätte sich mit Herberts Erklärung nicht zufriedengegeben.
„Und da zittern mir diese Scheißkerle, diese Würstchen. Da zittern Sie. Konnten Sie nicht gleich sagen: Herr Oberleutnant, den Kerl haben wir in die Jauche gepfiffen? – Hm! – Übrigens“, Nebbel wurde wieder ernst, „dieser Vogel da auf dem Bild war natürlich nicht sein Vater!“
„Sondern, Herr Oberleutnant?“, fragte Richter vom Herd.
„Ein gewisser Lenin, ein Bolschewik!“
*
„Ich finde dieses Häuschen hier einfach urgemütlich“, sagte Frank und bewunderte sein Quartier, das er mit Herbert Scholz, Kirchner, Knoop und Maytal teilte.
„Gemütlich?“, warf Herbert ein. „Und die Leute, die vorher hier drin gewohnt haben, hm?“
„Krieg ist Krieg!“, sagte Ully Knoop und blies sich dabei auf, machte sich wichtig.
Herbert muss immer etwas dazwischenquatschen, dachte Frank ein wenig ärgerlich. Gemütlich ist es hier! An die Leute darf man freilich nicht denken – da hat er schon recht, der Herbert.
Die Stuben waren niedrig und eng und durch Holzwände geteilt, und auf diesen Holzwänden klebten bunte Tapeten. Am meisten interessierte Frank der offene Kamin. Und blickte man durch die Fensterscheiben, so schaute man das weite Meer, das weit, weit draußen mit einem grellen Strich mit dem Himmel zusammenzufließen schien. Das konnte Frank nie genug bewundern.
„Hier könnte man den ganzen Krieg über bleiben!“, sagte Spund. „Das bisschen Wacheschieben ist harmlos und auszuhalten.“
„Und vor allem gibt’s hier keine Aufundniedergymnastik“, warf Frank ein.
„ – ’n Radio fehlt noch!“, meinte Knoop, „sonst erfahren wir gar nicht mal, wann wir sozusagen vom Frieden überfallen werden. Hier sind wir von allem abgeschnitten. Hier kann man vor lauter Ruhe den Krieg vergessen.“
Frank zweckte die Fotografie der Familie Sternberg neben seiner Pritsche an die Wand. Kirchner brachte einen Strauß gelben Ginster herein und steckte ihn in eine Konservenbüchse. Stellte ihn auf den Tisch.
„Das ist gut“, lachte Herbert. „Dadurch ist Beyer immer in unserer Mitte!“
In diesem Augenblick trat der Unteroffizier auch schon ein.
„Herhören! – Packt eure Klamotten zusammen. Wir werden abgelöst. In einer Stunde kommen die Lkw!“
Entsetzte Gesichter.
„Oooaa“, machten einige. „Wir sind doch erst sechs Tage hier!“
„Gefällt euch wohl, was? – Kann ich mir denken! So privat und so. Riecht alles so nach fröhlichem Wochenend. Lasst man. Wo wir jetzt hinkommen, ist es auch schön. Truppenübungsplatz Guer. War schon mal dort!“
„Jetzt haben wir uns gerade so schön eingerichtet!“, maulte Frank.
Herbert sah ihn böse an.
„Wehrsold und die Sonne in den Arsch scheinen lassen. Könnt euch so passen. Wartet man, Guer ist noch schöner. So etwas habt ihr noch gar nicht gesehen!“ Beyer lächelte hämisch.
„Gibt’s Ginster?“, forschte Ully Knoop.
„Nee, Schlamm und Dreck!“
Maytal war blass geworden. Frank stand da und zog ein Gesicht, als habe man ihn geohrfeigt.
„Und nach Guer, was gibt’s dann?“, fragte Herbert Scholz.
„Bahnfahrt!“
„Wohin?“, wollte Spund wissen.
„Ach, Spundchen!“, seufzte Beyer. „Sie kommen natürlich in ein Sanatorium für unterernährte Soldatelchen! – Also! Fertigmachen!“
Beyer ging.
Ein wüstes Fluchen und Schimpfen begann. Frank entfernte wieder die Fotografie von der Wand. Tornister wurden gepackt, Karten geschrieben.
Auf der Gasse lärmten die Neuangekommenen.
„Mensch, das sind aber alte Papas!“, sagte Herbert und schaute mitleidig zu den Männern hinüber.
Als sie das Dörfchen verließen, blickte Frank noch einmal zum Meer und zu den Dünen. Den einzelnen Stein konnte er nicht sehen. Aber er dachte daran …
*
Eintönig klapperte der Zug durch die mondlose Nacht. Die Soldaten hockten und lümmelten in den Personenwagen auf ihrem Gepäck, lagen auf Bänken, und mancher hatte seine Zeltbahn wie eine Hängematte in einem Meter Höhe aufgespannt.
Es war nur eine der kleinen Provinzbahnen. Fast zierliche Waggons. Und oft schrillte der Pfeifton der Lokomotive hell und grell in die Nacht. Das Pfeifen der französischen Lokomotiven ist eine Sonderheit. Frank hatte sich schon auf manch französischem Bahnhof darüber gewundert. Soviel Lokomotiven, soviel Pfeiftöne. Das war, als sprächen die Dampfrosse miteinander.
Grau dämmerte der Morgen durch die Wagenfenster. Die Fahrt ging in südlicher Richtung. Nebel kroch über die aufgeweichten Felder, darüber stand die Sonne. Und eine Stunde später war der Nebel wie fortgeblasen.
Es schien ein schöner Tag zu werden. Frank rieb sich den Schlaf aus den Augen, gähnte, blickte zu Herbert, der sich aus seinem Mantel schälte.
Plötzlich wirbelten die Tornister, Gewehre und Stahlhelme durcheinander. Es war, als hätte der Zug einen riesigen Schlag erhalten. Er stand, es schrie. Glas- und Holzsplitter. Über den Zug raste ein Knattern dahin. Die Soldaten sprangen aus den Fenstern, rollten den hohen Bahndamm hinunter.
Frank lag neben Herbert.
„Tommys!“, schrie einer. Frank wandte sich um und sah, wie die Flugzeuge erneut den Bahndamm anflogen.
„Los, schnell auf die andere Seite, in den toten Winkel!“, brüllte Frank Herbert zu.
Und schon prasselte es wieder in den Zug hinein. Zu spät. Sie kamen nicht mehr hinüber. Herbert schrie auf und zog das rechte Bein an. Ein Stück Stiefel war abgefetzt, aus der Wade floss Blut. Frank kroch zu ihm. Jetzt konnten sie liegenbleiben, da die Flugzeuge von der gegenüberliegenden Seite kommen mussten. Frank versuchte Herberts Wade zu verbinden.
Auf dem letzten Wagen stand eine Zwei-Zentimeter-Flak und ballerte. Und schon kamen wieder die Flugzeuge. Die Geschützbesatzung wurde vom Wagen gejagt, einer hing tot in seinem Sitz. Das Geschütz schwieg.
„Und jetzt wieder auf die andere Seite!, schrie Frank, und Herbert kroch auf Franks Rücken, umklammerte dessen Hals. Frank kletterte den Bahndamm hinauf, unter den Waggons durch, über den Schotter und den Hang auf der anderen Seite hinunter.
Wieder kamen die Flugzeuge. Diesmal konnten sie ihnen nichts anhaben. Frank schleppte Herbert hinauf, unter den Waggons abermals durch, wieder auf die andere Seite.
Überall schrie es. Die Wagen sahen aus, als hätten Leute mit Äxten und Beilen auf sie eingeschlagen. Ob ich ihn nochmals bis auf die andere Seite bringe? dachte Frank. Herbert schien ganz willenlos. Erneut rasten die Flieger über den Zug und schossen hinein. Frank sah sich um. Kommen sie noch einmal? Dann muss ich Herbert nochmals rüberschaffen!
Doch! Sie kehrten wieder um. „Los, schnell!“, schrie Frank. Herbert blieb liegen. „Los, los, Herbert, halt dich fest. Ich schaff dich rüber, sonst bist du futsch!“
„Lass doch!“, keuchte Herbert.
„Quatsch!“ Frank zerrte Herbert gewaltsam auf seinen Rücken, biss die Zähne aufeinander, und er spürte den salzigen Geschmack des Schweißes, der in seinen Mund rann. Mit letzter Kraft zerrte er Herbert den Bahndamm hinauf, unter den Waggons durch, und fast kraftlos ließ er sich mit ihm den Hang hinabrollen. Dort blieb er liegen. Ängstlich blickte Frank den Flugzeugen nach. Kommen sie wieder? Nein, sie flogen hinaus aufs Meer.
Erst jetzt konnte er sich Herberts Wunde widmen. Herbert musste viel Blut verloren haben. Doch die Wunde war nicht schlimm. Fleischschuss.
„Frank!“, flüsterte Herbert. „Das hätte ich dir fast nicht zugetraut. Ohne dich wäre ich wohl verloren gewesen!“
Frank gab keine Antwort.
Gegen Mittag wurden sie mit Lastkraftwagen abgeholt. Herbert kam ins Lazarett.
Hoffentlich kommt er bald wieder, dachte Frank. Ohne Herbert möchte ich nicht sein …
*
Guer liegt südlich von Rennes. Guer war ein riesiger Truppenübungsplatz, und zwar so groß, dass drei kriegsstarke Divisionen unabhängig voneinander ihre Übungen abhalten konnten, ohne sich gegenseitig in ihrer Bewegungsfreiheit einzuengen.
In Guer gab es keine Franzosen mehr. Wälder und Wälder und schwarze Erde, aufgeweichte Erde, zerwühlt und zerpflügt, und die Wälder waren verstümmelt, die Häuser zerschossen. Von den vielzähligen Baracken, worin die Soldaten lagen, waren es zehn Kilometer, um ins nächste französische Städtchen zu gelangen. Also konnte gar keiner auf den Gedanken kommen, auszugehen.
„Ojeoje!“, seufzten die Soldaten, als sie aus ihren Lastkraftwagen stiegen und in den Morast sprangen. In den Baracken war es kalt und kahl. Nackt. Es gab keine Feuerung. Der Weg zur Küche war weit und führte über Knüppelpfade; über Wassertümpel waren Bretter gelegt. Darunter schimmerte matt eine schmutzige Jauche.
„Das ist wieder was für Beyer!“, sagte Knoop und zog ein finsteres Gesicht.
„Wo sollen wir denn hier die Klamotten trocknen, wenn’s nichts zu feuern gibt?“, fragte Frank.
„Am Arsche!“, antwortete Beyer und feixte.
Schon in den ersten Tagen erkannten die Soldaten, dass es noch Schlimmeres als Ginster gab.
*
Bereits zum vierten Male griff die zweite Kompanie eine markierte Stellung am Waldrand an. Auf dem „feindlichen“ Graben steckten die aus Sperrholz angefertigten „Russen“.