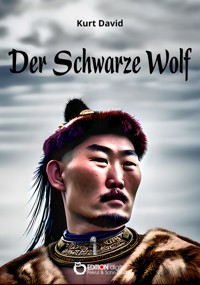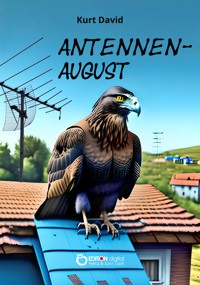6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Autor unternimmt 1961 eine Reise durch Polen. Er besucht die Städte Posen, Warschau, Lodz, Krakau, Zakopane sowie Danzig, Zoppot und Gdingen. Dabei sucht er die Menschen und ihre Geschichten aus Vergangenheit und Gegenwart. Er erfährt auch viel Trauriges aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs und der Judenverfolgung. Immer aber begegnen ihm die Menschen mit großer Offenheit und Freundlichkeit. Ein ausführlicher Zahlenanhang über die Entwicklung nach 1945 im Vergleich zu 1937 zeigt die Entwicklung Polens zu einem entwickelten Industrieland.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 176
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Impressum
Kurt David
Polnische Etüden
Von Sopot bis Zakopane
ISBN 978-3-96521-910-6 (E-Book)
Das Buch erschien 1963 im Verlag Neues Leben Berlin.
© 2023 EDITION digital Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
QUO VADIS? Wohin gehst Du? Nach Polen! Nach Polen?
EIfjährig verschlang ich das Buch QUO VADIS. Über die geträumte Via Appia vor meinem Fenster, eine staubige Dorfstraße ohne Apostel, waren keine cäsarischen Legionen gezogen, kein Virgil und kein Augustus; lediglich die Preußen hatten sie 1866 benutzt, was mich nicht hinderte, in meiner Fantasie mit Henryk Sienkiewicz (Autor des Buches „Quo vadis?“ (1846-1916)) durch Rom zu ziehen. Dieses titanische Gemälde rötete einst Augen, erhitzte Wangen, erregte Herzen, aber – es antwortet nicht mehr. Es war meine zweite Begegnung mit einem Polen; die erste: Chopin.
Nein, dieses Buch suche ich nicht, als ich vor einem Berliner Kiosk stehe und die Bücher mich durch das Fenster anschauen. Liebe Bekannte sind darunter und solche, die ich nicht mag. Gutaussehende, die wie geschminkt wirken und nicht immer die besten sein müssen, und hässliche, die manchmal besser sind als die Gutaussehenden. Ich suche ein Buch über Polen, Reiselektüre, ein Buch, das ich noch nicht kenne. Was soll ich sonst auf den langen Bahnfahrten tun, denn „vom Äußeren des Landes wüsste ich Ihnen nicht viel Reizendes mitzuteilen“, erzählt Heinrich Heine. „Hier sind nirgends pikante Felsengruppen, romantische Wasserfälle, Nachtigallengehölze; hier gibt es nur weite Flecken von Ackerland, das meistens gut ist, und dicke, mürrische Fichtenwälder.“ Aber Herr Heine, Sie waren doch nur bis Posen! Und bis dorthin werde ich lesen.
Ich finde ein Buch: vergilbt, verbogen, unansehnlich und, wie es scheint, von keinem gewünscht. Hast du das verdient? Der ausgeblichene, einst schwarz-weiße Umschlag, holzschnittartig, erinnert an keine Mazurka und keinen Grande Valse mit fliegenden Röcken, eher an einen Marchefunèbre (Trauermarsch). JANUSZ KORCZAK steht auf dem Buch, darunter: Biografie. Muss ich mich schämen, dich nicht zu kennen? Die Verkäuferin stolpert vor Eifer, als ich es verlange. Ich bezahle. Und erst jetzt lächelt sie gläubig. Und sie sagt nicht: Endlich bin ich es los. Sie denkt es.
Im Gehen schlage ich die erste Seite auf: Janusz Korczak sieht mir in die Augen, fest, fragend, unerbittlich. Ein fotografiertes Porträt, ein Christus-Gesicht, kein legendärer Christus, mehr Veit-Stoß-Heiland, unvergesslich wie alles, was echt ist. Schmerz, tiefer Schmerz prägt das alte Antlitz, und die Augen, tief in den Höhlen, lächeln wehmütig und weise über den Tod. Lautlos scheint der leicht geöffnete Mund zu fragen: Quo vadis?
Nach Polen! –
Wer Eisenbahn fährt, macht sich schmutzig.
In meinem Abteil sitzt ein lesender Mann: Karierte Sportmütze mit Regendach für die große Nase, karierter Sommermantel, der zum Schachspiel einlädt, hageres englisches Gesicht, das akademisch aussieht. Fehlt noch etwas, Sir Arthur Conan Doyle? Aha: die Shagpfeife. Sie ist da und raucht. Was mag das sein? Ein Jux? Ein von Originalitätssucht befallener Schriftsteller, ein übergeschnappter Journalist oder ein Edinburgher Chemieprofessor der Konservativen? In der Brusttasche stecken drei Kugelschreiber und zwei Füllfederhalter. Ob er so schreibt, wie er sich anzieht?
Der Schaffner erbittet die Fahrkarten in Deutsch, Sherlock Holmes reicht sie ihm in Englisch. Der Schaffner ist alt und zu ihm viel netter als zu mir. Sicher hat er früher den richtigen gelesen und vor dem falschen, nachgemachten, heiligen Respekt. Anders der junge Grenzpolizist; er verlangt völlig unbelastet unsere Heiligtümer, die Pässe; beide erhalten wir die gleichen Blicke, die gleichen Stempel, die gleichen Grüße. Und von unserem Zollangestellten, dem ich gern sagen möchte, auch im Dienst dürfe er ruhig lächeln, von dem wünsche ich boshaft, er möge doch einen amtlichen Blick in den gelben Koffer dieses entzückenden Kopisten tun, was auch geschieht, und siehe da: Selbst Sherlock Holmes bevorzugt in diesem kühlen Spätfrühling lange Unterhosen.
So fahren wir Frankfurt entgegen. Die Berliner Vorstadtkiefern haben wir längst vergessen, weil die weiten Wälder, die der Zug durchrauscht, prächtiger sind. Obwohl es Juni ist, blühen noch keine Maiglöckchen. Von schmalen Landwegen winken Kinder, winken und lachen, fremde Kinder, die Fremden zuwinken. Man möchte sie allesamt einladen und mitreisen lassen.
Der Frankfurter Bahnhof ist ein verrußter Preuße aus Stein. Man fürchtet, der alte Fritz könne plötzlich auf dem Bahnsteig erscheinen, um einem zu erklären, weshalb die Schlacht bei Kunersdorf schiefgegangen ist. Freilich, käme Heinrich von Kleist, so wäre er mir willkommener. Vielleicht würde er uns das Gegenwartsstück schreiben. Aber er hat ja keine Zeit und muss drin in der Stadt auf seinem Sockel bleiben.
Heute ist Frankfurt Grenzbahnhof, und der Aufenthalt wie ein großes Luftholen, wie ein tiefes Atmen vor dem Gartentor eines Nachbarn, dem man viel Böses zugefügt hat und den man nach Jahren trotzdem besuchen will.
Einer Gruppe Sechzehn- und Siebzehnjähriger, die in die Hohe Tatra fährt, ergeht es nicht so.
Sie kauft Limonade, futtert Kekse, kichert, scherzt. Die Jungen und Mädel sind in den Jahren geboren, als wir in Frankfurt ankamen: Zerlumpt und verzagt, nicht singend, aber mit zitternden, morschen Knochen und ohne dass uns die Welt gehörte. Entlassene Gefangene. Davongekommene. Wir waren ohne Pass über die Grenze gegangen; statt Koffer trugen wir Tornister, statt Fotoapparate – Gewehre, statt Hüte – Helme und unsere Cicerone waren Generale.
Auf dem Bahnsteig stehen polnische und deutsche Eisenbahner im Kreis, reden und lachen miteinander. Hundertfünfzig Jahre hat es gedauert, ehe es zu solchen Gesprächen kam.
Eine ältere Polin mit buntem Kopftuch steigt in unser Abteil, eine Polin mit rotem bäuerlichem Gesicht, eine weinende Frau.
Und auf einmal fährt der Zug, er fährt, als habe man nur noch auf diese Frau gewartet, rollt feierlich – langsam hinunter zum Fluss, über die zitternde Brücke. Außer der weinenden Frau sind alle an die Fenster getreten. Auch hier scheint die Sonne, und auch hier blühen noch keine Maiglöckchen, obwohl es Juni ist. Die Oder ist eine trotzige, alte Dame, die nicht gern in ihrem Bette bleibt. Baumkronen starren wie ertrunken aus den Fluten. Die Lokomotive stößt einen Schrei aus, der Zug rollt ins Land, hinein in die polnische Ebene.
Die Polin mit dem bunten Bauernkopftuch weint noch immer, hält ratlos den Pass in der Hand, sitzt vorn auf der Kante der Bank, als wolle sie gleich wieder aussteigen. Und während sie die Tränen vom Pass wischt und Sherlock Holmes schläft oder nur so tut und vielleicht gerade wieder einmal kombiniert, erzählt sie mir ihre Geschichte wie einem alten Bekannten, breitet sie ihre Papiere vor mir aus, stupst mit dem Finger auf diesen und auf jenen Punkt, weint, schnäuzt sich, weint noch, als der Schaffner eintritt, dem sie die Geschichte auch sofort erzählt, steht auf, als die polnischen Zollleute kommen, die sich ebenfalls die Geschichte anhören müssen, schaut mich an, der ich endlich begriffen habe, worum es geht: Die Frau wollte ihren Sohn in London besuchen, und man hat in Warschau vergessen, sie auf dieTransit-Visa aufmerksam zu machen, die sie für die Zwischenländer benötigt. Vielleicht hat die Dorffrau das Wort Transit, das im Gespräch immer wieder hin und her fliegt, noch nie gehört, aber sie wird es nicht mehr vergessen, weil an ihm dreihundert umsonst verfahrene Bahnkilometer hängen. Im Abteil herrscht traurige Einstimmigkeit: Zoll, Eisenbahner, zwei Männer, die noch zugestiegen sind, und ich, der ich ins Gespräch mit einbezogen worden bin, wir alle schimpfen schön auf den namenlosen Mann in Warschau. Wir schimpfen Deutsch, wir schimpfen Polnisch, und bald schimpfen wir überhaupt nicht mehr, denn die Frau hört auf zu weinen und beginnt zu essen. Ein Pole fragt mich verschmitzt lächelnd, welche Stadt die meisten polnischen Einwohner habe. Ich sage natürlich Warschau, der Mann sagt Chicago. Die Leute lachen. In Chicago leben über vier Millionen Polen, erklärt mir der Mann. In der polnischen Sprache ist das ein Witz, in der deutschen eine erschreckende Information. Und in dieser Stunde, die mit dem Weinen der polnischen Frau begann und mit dem Witz des polnischen Mannes endete, habe ich vergessen, dass es meine erste Begegnung mit Polen seit siebzehn Jahren ist.
Draußen zieht die Landschaft vorüber. Saftige Wiesen, grünende Weiden, träumende Wälder und wieder Weiden und endlich ein Dorf mit Teich, Straße und Pappeln, über ein flammenrotes Mohnfeld schweben Störche. Und Kinder winken, Kinder, die Kühe hüten, fremde Kinder, die auch hier Fremden zuwinken. Das ist ein Stück Polen, eine Landschaft mit ernstem Gesicht, ein Notenblatt mit Chopinscher Melancholie.
Also ist die Zeit gekommen, wo ich nach der Biografie von Janusz Korczak greifen kann. Ich schlage das Buch auf, der Sonnenschein fällt auf sein Gesicht. Er kneift die Augen ein bisschen zusammen. Ich beginne zu lesen, höre noch die Stimmen im Zug, das Schlagen der Türen, das Pfeifen der Lok, das drohende Klicken, wenn wir über die Weichen eines Bahnhofs jagen. Stimmen im Zug, Türenschlagen.
Stille!
Ein Salon ist da. Ein Salon mit kostbaren Möbeln, eine Gouvernante steht herum, die Köchin putzt Silber, das Kindermädchen kommandiert einen Jungen in blauem Samtanzug mit weißem Kragen. Die Mutter des Salonkindes tadelt: „Dieser Junge hat keinen Ehrgeiz, ihm ist es gleichgültig, was er isst, wie er sich kleidet, ob er mit einem Kind unseres Standes spielt oder mit dem Jungen des Hausmeisters.“
Dieser Junge heißt: Henryk Goldszmit, der eigentliche Name Janusz Korczaks.
Ich sehe ihn in der Vorstadt Praga das Gymnasium besuchen, höre ihn in der sechsten Klasse behaupten, „die Welt reformieren heißt die Erziehung reformieren“, träume seine Träume, Schauspieler, Dichter, Feldherr, Rechtsanwalt oder Bauer zu werden, bestaune seinen naiven Ernst, als er sagt: „Das kapitalistische System muss gestürzt werden, ich weiß nur noch nicht, wie.“ Er studiert Medizin und Pädagogik, schreibt seine Bücher, „Die Beichte eines Falters“, „Kinder der Straße“, arbeitet an einer linksgerichteten Zeitschrift mit, wird verhaftet, promoviert zum Doktor, reist als junger Arzt nach Berlin, Paris, London und Wien. Was ihn später an diese und andere Reisen am meisten erinnert, sind Kinder, die er kennenlernte.
Und ich sitze im Zug zwischen Berlin und Poznan. Mir ist, als fahre ich im Zug durch das Leben Henryk Goldszmits, schaue durch ein Fenster in sein Leben, passiere mit ihm die Stationen, sehe ihn sieben Jahre in einer Warschauer Kinderklinik an Betten wachen, hetze mit ihm durch die Stadtnächte, von Patient zu Patient, und fahre mit ihm hinaus auf das Land, in ein Sommerlager armer jüdischer Kinder, Stadtkinder, die er kostenlos in der Natur lehrt, weil sie dort draußen „die polnische Sprache anlächeln wird wie das Grün der Bäume und das Gold des Getreides, diese bezaubernde Sprache, die sich hier mit dem frohen Jubilieren der Waldvögel verquickt, die im Leuchten der Sterne glitzert und im Hauch des Waldwindes atmet. Die polnischen Worte fügen sich wie die Blumen von ganz allein zu fröhlichen Auen, sind strahlend und rein wie die Sonne im Westen.“
Und ei! – wer kommt da – an einem Sonnentage? Eine Gruppe von Wohltätern, eine fidele, viel zu fidele Gruppe mit Almosen.
Und diese Damen und Herren haben eine glänzende Idee: Sie bewerfen lachend die armen Kinder aus ihrer schwarzen Limousine mit Keksen, Bonbons und Apfelsinen. Das macht so viel Spaß, hahaha, so viel Spaß, nein, ist das lustig! Doch die armen, nach den Süßigkeiten hungernden Waisen sind besser erzogen als ihre befrackten, mit Seide bekleideten Almosenspender. Ein Hinweis Korczaks genügt: Die Kinder werfen Kekse, Bonbons und Apfelsinen zurück in das Auto.
Und weiter jagt unser Zug. Die nächste Station ist ein Waisenhaus.
Korczak hat die Kinderklinik verlassen, geht zu elternlosen Kindern, „denn an Sohnes Statt nahm ich die Idee, dem Kinde zu dienen“. Er wäscht und wiegt die Kleinsten, füttert sie mit Lebertran, spielt mit ihnen, verschneidet ihnen die Fingernägel…
Im ersten Weltkrieg muss er seine Kinder vier Jahre verlassen. Als er von den Schlachtfeldern, aus Feldlazaretten und Schützengräben zurückkehrt, bringt er sein dreibändiges Werk mit: „Wie soll man ein Kind lieben?“
Und die Kinder lieben ihren Doktor, den Mann mit dem kahlen Schädel, mit dem rötlichen Spitzbart. Er hilft weiter den Waisen, lebt mit ihnen, hilft den Hilflosen, wärmt die Frierenden, sättigt die Hungernden; zwischendurch schreibt er Artikel und Bücher, und immer über Kinder; „denn in der geistigen Erneuerung des Menschen wird das Kind die Hauptrolle spielen“.
Es dunkelt vor unserem Fenster, es wird Nacht; wir fahren langsamer, fahren der letzten Station entgegen, sehen Korczak mit seinen Waisen im Luftschutzkeller, hören seine sanften Worte, sehen blutende Kinder, die er verbindet, tote, die er beerdigt, kranke, denen er zulächelt.
Die Nazis verbrennen seine Bücher, weil es jüdische Literatur sei. Darunter: „Wie soll man ein Kind lieben?“ Auch Kinder verbrennen …
Als er mit seinen Waisen gezwungen wird, ins Getto umzuziehen, erbittet er sich von Freunden farbige Reproduktionen für das neue Heim hinter der Gettomauer. Das letzte Lächeln der Kunst. Und betteln geht er für seine Kinder, betteln um Geld, um Lebensmittel, und „Das Waisenhaus ist“, wie er in sein Tagebuch schreibt, „ein Altersheim geworden. Die Gespräche mit den Kindern am Morgen kreisen um Temperaturmessungen … Die Kinder schwanken. Nur die Oberhaut ist normal. Darunter lauern Ermüdung, Lustlosigkeit, Zorn, Aufruhr, Misstrauen, Trauer und Sehnsucht“.
Die Mörder umschleichen ihn, schlagen ihn, sperren ihn ein, quälen ihn, lassen ihn frei, schlagen ihn wieder, lassen ihn erneut zu seinen Kindern. „Ein Wachtposten sieht meiner Beschäftigung zu. Ob ihn meine Zimmertätigkeit um sechs Uhr morgens reizt oder rührt?
Er steht da, die Beine gespreizt, und guckt …
Ich gieße Blumen. Meine Glatze im Fenster. Was für ein feines Ziel. Er hat ein Gewehr. Warum steht er da und sieht mir gelassen zu?
Er hat keinen Befehl.
Vielleicht war er als Zivilist ein Dorfschullehrer, vielleicht ein Notar, ein Straßenfeger in Leipzig oder ein Kellner in Köln.
Was würde er tun, wenn ich ihm jetzt zunickte, ihm freundlich winkte? Vielleicht weiß er gar nicht, dass es so ist, wie es ist. Vielleicht ist er erst gestern hierhergekommen, von weit her.
Ich wünsche niemandem Schlechtes. Ich kann es nicht. Ich weiß nicht, wie man das macht …“
August 1942!
„Alle Juden rrraus!“
Pfiffe. Schreie. Kommandos.
„Juden rrraus!“
Weinen. Schluchzen.
„Rrraus!“
Die Kinder sitzen mit ihrem Doktor beim kärglichen Frühstück. „Rrraus!“ „Rrraus!“
Wer schreit es? Der deutsche Dorfschullehrer, der Notar, der Straßenfeger aus Leipzig, der Kellner aus Köln?
Gehorsam stellen sich die Kinder in Fünferreihen auf. Zurück bleiben die Blechnäpfe auf den Tischen, die blauen, die roten, die grünen Blechnäpfe. Sie bleiben zurück. Und der Kaffee dampft noch. Die Kinder leben noch, aber die Kinder sitzen nicht mehr vor den dampfenden Kaffeenäpfen. Sie stehen draußen in der heißen Augustsonne, schmiegen sich an ihren Doktor, weinen, fragen, flüstern, schreien, schweigen, und der Doktor besänftigt sie, versucht ihnen auch jetzt noch zuzulächeln. Kann er helfen?
Er trägt die kleine Halina, er, der dreiundsechzigjährige Mann, trägt sie dem Zuge der zweihundert Waisenkinder voran; sie kann nicht mehr laufen. Und so schleppt sich dieser Zug durch Warschaus Straßen, durch den rauchenden Staub, unter der Glut einer Sommersonne, in der sich auch zu dieser Stunde wohlhabende Menschen und Unmenschen an allen berühmten Küsten Europas rekeln, gedankenlos und gelangweilt. Links und rechts des Zuges stapfen die Männer in guten Stiefeln, die Leute aus Berlin, Leipzig, Hamburg, Hannover, München, Nürnberg und Dresden.
Ob Familienväter unter ihnen sind? Warum nicht! Werden sie zu Hause ihre Kinder auf die Schöße nehmen können, ohne an diese Kinderaugen zu denken?
Sie werden es!
Werden unter ihnen welche sein, die am Weihnachtsabend singen: „Ihr Kinderlein kommet, o kommet doch all …“ ohne an Treblinka zu denken, an die Gasöfen von Treblinka?
Hier scheint die Sonne auf blasse, ängstliche, hungrige Kindergesichter, die Sonne scheint auch auf die Gaskammern von Treblinka, und sie scheint auf die zweihundert toten Kinder und auf den toten Doktor, den Vater der polnischen Kinder.
Und der Himmel ist licht und blau.
Der Rauch über Treblinka aber schwarz.
Ich schlage dieses Buch zu, zögernd, nachdenklich, und nachdenklich blicke ich auf den ausgeblichenen Umschlag. Marche funébre.
In mir klingen Korczaks Worte: „Nach dem Kriege werden sich die Menschen lange Zeit nicht in die Augen sehen können, um nicht die Frage zu lesen: Wie kommt es, dass du lebst, dass du durchgekommen bist? Was hast du getan?“
Aus der Weite kehren die Stimmen im Zug zurück, im Eisenbahnzug. Das Schlagen der Türen ist wieder da, das Pfeifen der Lokomotive.
Die Mitfahrenden im Abteil schlafen.
Auch die Polin mit dem Transitärger hat sich beruhigt und schläft.
Poznan
Die Bahnhofshalle von Poznan blitzt, als habe sie ein Schaumbad genommen. Wandleuchten strahlen wie Ausrufezeichen, Deckenlämpchen glühen am ausgestirnten Marmorhimmel, und Gepäckträger, die Meister der routinierten Höflichkeit, stürzen sich auf schwere Koffer, fette Aktentaschen, hetzen zu den Taxis, dienern, lächeln flüchtig, kassieren in allen Währungen, jagen zurück in die gebadete Halle, um der Flut von Kaufleuten Herr zu werden, die aus den Zügen quillt.
Poznan ist Messestadt mit siebenhundertjähriger Tradition.
Auf den Bahnhofsplatz scheint die Sonne, eine trübe Bahnhofssonne, die hinter dem Rauch der Lokomotiven verwelkt dem Treiben zusehen darf. Der Wind ist kalt, und der Wind ist frech und übermütig, kühn fährt er den schlanken Mädchen unter die bunten Röcke. Und die undankbaren Männer reiben sich fluchend Staub aus den Augen. In einen schwarzen Mercedes, elegant wie ein Magnatensarg, schlüpfen vier Ordensschwestern, die schwarze Soutanen, weiße Häubchen und dicke Diplomaten-Aktentaschen tragen. Hinter dem weißen Lenkrad sitzt die Oberschwester mit einem großen Kruzifix um den kleinen Hals. Ein Verkehrsschutzmann, der zufällig vorüberkommt, schließt höflich den Wagenverschlag.
Die Straßen sind alt, aber breit, voller Autos, voller Menschen; Fußgänger hetzen in Rudeln über die Fahrbahn, Kinder rennen kreischend hinter einem Sprengwagen her, aus vielen Eisgeschäften hängen Fahnen mit der Aufschrift: LODY! Vor großen Schaufenstern drängen sich gut gekleidete Leute. Hinter breiten Gemüse- und Obstständen stehen dicke Frauen, die saftige Erdbeeren und frische grüne Gurken anbieten.
An der Fassade des ehemaligen Schlosses Kaiser Wilhelms II. gähnt ein großes schwarzes Loch. Eine Granate hat es gerissen, Arbeiter stehen auf einem Gerüst und stopfen es. Das Schloss sieht trutzig, finster, mürrisch aus, so nach der Melodie: „Denk ich ans Vaterland, fährt mir ans Schwert die Hand …“ In einem Reiseprospekt las ich, es sei sehenswert.
Heinrich Heine fand vor hundertdreißig Jahren die Stadt „trübsinnig“ und „unerfreulich“. „Das einzig Anziehende ist, dass sie eine große Menge katholischer Kirchen hat. Aber keine einzige ist schön. Vergebens wallfahrte ich alle Morgen von einer Kirche zur anderen, um schöne alte Bilder aufzusuchen. Die alten Gemälde finde ich hier nicht schön, und die einigermaßen schönen sind nicht alt.“
Wie wird auf mich diese tausend Jahre alte Stadt wirken? Die tausend Jahre alte Stadt, die einst Polens Hauptstadt war? Von meinem Fenster im Hotel Poznanski sehe ich die alte Raczynski-Bibliothek mit ihren prächtigen vierundzwanzig korinthischen Säulen. Ein Geschenk des Grafen Raczynski an die Stadt im Jahre 1832. Auf dem Platz davor pflanzen Frauen rote Blumen, fahren zwei Mädchen mit Dreirädern um eine schlanke Riesenrakete, die sich über die Stadthäuser erhebt und ihre silberne Spitze in den blauen Himmel bohrt. Ein Denkmal? Auf ihren Beinen, einem geometrischen Gestrüpp aus Stahlrohr, turnen Kinder. Unter meinem Fenster bimmeln Straßenbahnen, holpern in ihren Gleisen quietschend um die Kurven, werden von Autos überholt. Die Bahnen sind beängstigend überfüllt. Bunte Trauben hängen aus offenen Türen. Es wird während der Fahrt auf- und abgesprungen. Auf Gehsteigen patrouillieren Polizisten, Männer der Miliz, mit heruntergelassenen Kinnriemen und prallen Ledertaschen. Sie sehen streng aus, diese Milizmänner, scheinen es aber im Falle der Straßenbahn-Akrobatik nicht zu sein. Es ist eine Geschäftsstraße, die unter meinem Fenster entlanggeht, mit Läden links und rechts, mit Büros und Gaststätten, mit Buchhandlungen und Zeitungsständen, mit Neugierigen, mit Pärchen, die sich auch hier am kleinen Fingerführen und flüstern, mit heiteren und traurigen Gesichtern und mit den immer wieder fragenden Ausländern, die ihr Hotel suchen, das ihnen im Labyrinth der Straßen und Gassen verloren gegangen ist.
Ich wage mich aus dem Hotel, natürlich nicht, ohne zuvor vom jungen Empfangschef, der fünf Sprachen spricht, nett und freundlich ist, einige Straßennamen auf einen Zettel notiert bekommen zu haben, die mich zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt führen sollen.
Anfangs quält mich der alberne Gedanke, ich könne auffallen: Siehe da – ein Deutscher. Muss die Stadt nicht brennen bei diesem Wort? Müssen nicht Gräber warnen? Kinder weinen? Krüppel fluchen?
Was fühlte Heine? „Die Polen! Das Blut zittert mir in den Adern, wenn ich das Wort niederschreibe, wenn ich daran denke, wie Preußen gegen diese edelsten Kinder des Unglücks gehandelt hat, wie feige, wie gemein, wie meuchlerisch.“ Und welche Last ist inzwischen hinzugekommen?
Der Spätnachmittag ist sonnengelb, die Luft kühl und trocken. Einige voreilige Lichtreklamen zucken nervös an den Fassaden der Häuser. Ich bin in einer polnischen Stadt, ausgestattet mit einem polnischen Wörterbuch, und ich lese immer wieder: Dancing, Parking, Super-Bar, welcome to Poland; importierte Modewörter wie anderswo.
Die meisten Städte haben einen Altmarkt, nicht immer ist er schön, und mancher ist berühmt, ohne dass man dort wohnen möchte. Der Poznaner Altmarkt sieht aus wie ein Gemälde von Canaletto. Freilich, die vielen Autos darf man in diese Vorstellung nicht einbeziehen. Das Rathaus, ursprünglich gotisch, im 16. Jahrhundert von dem Italiener Giovanni Batista di Quadro im Renaissancestil umgebaut, würde jeder römischen Stadt große Ehre machen. Herrliche Fresken schmücken die Ostseite, in prächtigen Bogengängen schlafen tiefe schwarze Schatten. Die Sonnenuhr geht gegenüber der Turmuhr eine Stunde nach. Polen hat Sommerzeit. Im Kriege wurde das Rathaus zerstört. Man hat es, wie die umliegenden Häuser, nach alten Plänen restauriert. Um das Rathaus scharen sich parkende Autos, die stumm vor sich hinstarren, die kleinen Syrenas, die flachen Wartburgs, die breiten Mercedes’, die schnittigen Wolgas, die schmucklosen Warszawas. Und zwischendurch warten Kutschen mit traurigen Pferden und schlafenden Kutschern. Die letzten polnischen Fiaker, und sie warten wie ehedem vor dem Wirtshaus des Fiacrius in Paris, wollen wohl nicht wahrhaben, was wahr ist, oder tun nur so und leben von den skurrilen Launen einzelner Kunden.
Auf diesem Altmarkt hat auch das 20. Jahrhundert seinen Palast errichtet. Er ist länglich, aus Glas und Beton, licht, hell und flachdachig, eine Ausstellungshalle für Kunstmaler. Mit einem Lehrer, der mit seiner Schulklasse vor dem Rathaus steht und seine Kinder auf die architektonischen Kostbarkeiten hinweist, sie ihnen auch sicherlich erklärt, komme ich ins Gespräch. Er berichtet mir in gutem Deutsch von der großen Mühe und den noch größeren Kosten, mit denen das Alte liebevoll erneuert wurde. Und so wandern wir über den Markt, hinter uns die Schar Kinder. Er fragt, wie mir der Neuling unter den Alten gefalle. Noch bevor ich antworten kann, sagt er lächelnd: Man möchte in den alten Städten gern Kontraste schaffen, dies sei modern.
Was mir immer wieder auffällt, sind polnische Plakate. Vor ihnen kann man tatsächlich stehenbleiben; sie fordern auf, sie sagen etwas, sagen es echt und eindringlich, sie täuschen nicht auf den ersten Blick. Meisterwerke der Grafik. Sie kleben an Bauzäunen, Mauern und Schaufenstern. Kunstwerke, allen zugänglich, auch denen, die in keine Galerie oder Ausstellung gehen.