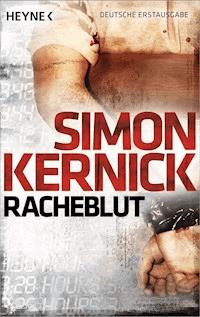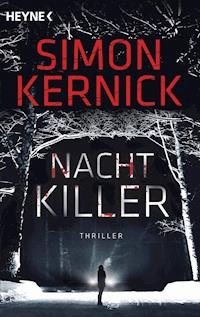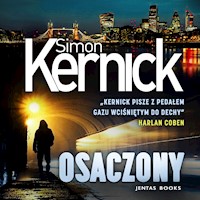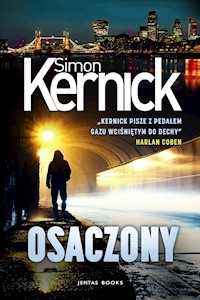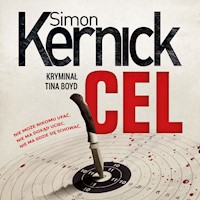5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Begraben, aber nicht vergessen
1990 verschwindet eine junge Frau spurlos in Thailand. Ihr Fall geht durch die Weltpresse. 2016 taucht ihre Leiche im 10.000 km entfernten England wieder auf. Wie kann das sein? Detective Ray Mason hat als Erster eine heiße Spur. Ein Zeuge will ihm erzählen, was damals geschehen ist. Doch noch bevor er seine Aussage machen kann, wird er ermordet. Und plötzlich tauchen noch mehr Leichen von jungen Frauen auf. Mason muss in die Abgründe der menschliche Seele blicken, um die Täter zu fassen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 477
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
DAS BUCH
1990 verschwindet eine junge Frau spurlos in Thailand. Ihr Fall geht durch die Weltpresse. 2016 taucht ihre Leiche im 10.000 km entfernten England wieder auf. Wie kann das sein? Detective Ray Mason hat als Erster eine heiße Spur. Ein Zeuge will ihm erzählen, was damals geschehen ist. Doch noch bevor er seine Aussage abgeben kann, wird er ermordet. Und plötzlich tauchen noch mehr Leichen von jungen Frauen auf. Mason muss in einen Abgrund voller Tod und Verzweiflung abtauchen, um die Täter zu fassen …
DER AUTOR
Simon Kernick, 1966 geboren, lebt in der Nähe von London und hat zwei Kinder. Die Authentizität seiner Romane ist seiner intensiven Recherche zu verdanken. Im Laufe der Jahre hat er eine außergewöhnlich lange Liste von Kontakten zur Polizei aufgebaut. Sie umfasst erfahrene Beamte der Special Branch, der National Crime Squad (heute SOCA) und der Anti-Terror-Abteilung. Mit Gnadenlos (Relentless) gelang ihm international der Durchbruch, mittlerweile zählt er in Großbritannien zu den erfolgreichsten Thrillerautoren und wurde für mehrere Awards nominiert. Seine Bücher sind in dreizehn Sprachen erschienen. Mehr Infos zum Autor unter www.simonkernick.com.
SIMON KERNICK
BEGRABEN
Roman
Aus dem Englischen
von Conny Lösch
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Die Originalausgabe The Bone Field erschien 2017 bei Arrow.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe 02/2019
Copyright © 2017 by Simon Kernick
Copyright © 2019 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Marcus Jensen
Umschlaggestaltung: Cornelia Niere unter Verwendung von Motiven
© Arcangel / Karina Vegas; Shutterstock / Nik Merkulov
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-21949-9V002
www.heyne.de
Erster Tag
Dienstag
Kapitel 1
Es fing damit an, dass ein junger Mann mit seiner Freundin nach Thailand reiste.
Damals, 1990, wurde Thailand gerade erst von Rucksackreisenden »entdeckt«, und an Massentourismus, Hotelburgen, Junggesellenpartys oder Fünf-Sterne-Wellnessbäder war noch nicht zu denken. Der junge Mann hieß Henry Forbes. Er war fünfundzwanzig Jahre alt und Dozent für Humanwissenschaften an der Brighton Polytechnic, der heutigen University of Brighton. Seine Freundin, die ihr Studium dort gerade beendet hatte und mit der er erst seit ein paar Monaten liiert war, hieß eigentlich Katherine Sinn, aber ich erinnere mich, dass in den Berichten über den Fall stand, dass sie meist Kitty genannt wurde.
Kitty Sinn. Den Namen fand ich immer schon schön.
Jedenfalls war die Reise, die kaum einen Monat nach Kittys Abschlussprüfungen begann, auf zwei Monate angelegt. Wir wissen, dass die beiden am 29. Juli 1990, einem Sonntagnachmittag, Bangkok erreichten, weil ihre Einreise dort von der thailändischen Einwanderungsbehörde registriert und ihre Reisepässe abgestempelt wurden. Sie blieben zwei Nächte und fuhren anschließend mit dem Nachtzug nach Phuket weiter, wo sie vier Tage im Club Med von Kata Beach verbrachten. Das Personal erinnerte sich an ein höfliches, stilles Paar, das für sich blieb und sehr verliebt wirkte. Von Phuket aus nahmen sie ein Taxi in den Nationalpark Khao Sok, den ältesten Regenwald Thailands, zweieinhalb Autostunden weiter nördlich, wo sie sich die wilden Tiere und spektakulären Karstlandschaften ansehen wollten, für die die Gegend berühmt ist. Sie übernachteten in dem damals einzigen Gästehaus des Parks, das sie am 5. August, einem Sonntag, erreichten.
Zu diesem Zeitpunkt hielten sich nur vier weitere Gäste dort auf: ein australisches Paar Mitte sechzig und zwei junge niederländische Rucksackreisende. Alle Gäste erinnerten sich, dass Kitty und Henry im Speisesaal aßen und sich anschließend auf ihr Zimmer zurückzogen, wo sie später am Abend derart laut stritten, dass Mr. Watanna, der Inhaber der Pension, sich einschaltete und den beiden mit Rauswurf drohte, sollten sie sich nicht augenblicklich ruhiger verhalten. Laut Henrys späterer Aussage war es bei dem Streit um eine seiner ehemaligen Freundinnen gegangen, und er sei so eskaliert, dass er Kitty eine Ohrfeige verpasst habe, was, wie er behauptete, normalerweise überhaupt nicht seine Art sei.
Am folgenden Morgen hatten sie sich offensichtlich immer noch nicht versöhnt, denn Kitty bat Mr. Watanna, sie in die Küstenstadt Khao Lak zu fahren, und gab ihm fünfhundert Baht für sein Versprechen, Henry nicht zu verraten, wohin er sie brachte. Sie sagte, sie brauche Zeit zum Nachdenken. Henry versuchte sie bei der Abreise noch umzustimmen, entschuldigte sich überschwänglich und schreckte nicht davor zurück, sie auf Knien anzuflehen, doch zu bleiben. Allen Berichten zufolge ließ Kitty sich aber nicht erweichen und reiste mit Mr. Watanna ab.
Laut Mr. Watanna setzte er sie vor den Bungalows des Gerd and Noi Resort unweit des Strands von Khao Lak ab, wo sie ein paar Nächte bleiben und sich ihre nächsten Schritte überlegen wollte. Anschließend fuhr Mr. Watanna zurück zu seinem Gästehaus und traf etwa vier Stunden nach seinem Aufbruch dort ein.
An den folgenden drei Tagen verweilte Henry in der Pension und wagte kaum, das Zimmer zu verlassen, da er auf Kittys Rückkehr wartete. Damals hatte man noch keine Handys und kein Internet, und wenn jemand den Kontakt abbrach, gab es eben keinen. Da Kitty aber nicht zurückkam, überredete Henry Mr. Watanna, ihm zu verraten, wohin er sie gefahren hatte.
Henry rief im Gerd and Noi Resort an, wo man ihm mitteilte, Kitty sei dort nicht abgestiegen. Inzwischen beunruhigt, gab auch er Mr. Watanna Geld, um sich von ihmnach Khao Lak chauffieren zu lassen. Dort suchte er einen Tag lang die Stadt und die wenigen Pensionen ab, die es damals dort gab, musste aber feststellen, dass Kitty in keiner davon übernachtet hatte. Schließlich rief er Kittys Mutter an, die ihre Tochter weder gesehen noch gesprochen hatte. Daraufhin meldete Henry sich bei der thailändischen Polizei und erstattete offiziell Vermisstenanzeige, während Kittys Mutter die Polizei in England informierte.
Sämtliche Polizeistationen der süd-thailändischen Halbinsel wurden alarmiert, und überall suchte man nach Kitty, aber sie tauchte nicht auf.
Kitty war ein sehr hübsches Mädchen, zierlich und dunkel, mit einem niedlichen, fast kindlichen Gesicht. Laut der Mitarbeiter und Studenten an ihrer Hochschule war sie eine reizende Person, die in ihrer Freizeit ehrenamtlich als Telefonseelsorgerin tätig war und aus einem wohlhabenden und angesehenen Elternhaus stammte. Mit anderen Worten, für die Tageszeitungen war sie ein Traum, und ihr Verschwinden in einem damals als so exotisch geltenden, fernen Land, in das es viele junge Briten zog, erregte großes Medieninteresse, sowohl in ihrer Heimat wie auch darüber hinaus.
Schon bald geriet Mr. Watanna in Verdacht, da er der Letzte war, der Kitty lebend gesehen hatte. Er wurde von der thailändischen Polizei verhaftet. Sein Anwalt behauptete sogar, man habe ihn geschlagen und gefoltert. Die Medien und diplomatischen Vertretungen übten enormen Druck auf die Polizei aus, Ergebnisse vorzulegen, und zweifelsohne bekam Mr. Watanna diesen zu spüren, als er über zwei Wochen ohne Anklage festgehalten wurde. Da ihm keinerlei Gesetzesverstöße nachgewiesen werden konnten und man auch keine Leiche fand, musste er schließlich freigelassen werden.
Nachdem Kitty knapp einen Monat lang nicht mehr gesehen worden war, flog Henry, den die thailändischen Behörden ebenfalls mehrfach verhört hatten, nach Hause, wo ihn die Beamten des Sussex CID ihrerseits noch einmal ausführlich befragten. Aufgrund der näheren Umstände von Kittys Verschwinden galt er allerdings zu keinem Zeitpunkt wirklich als verdächtig. Er ließ sich wegen emotionaler Überlastung beurlauben und kehrte erst im darauffolgenden Jahr wieder in seinen Beruf als Dozent zurück.
Inzwischen drängten andere Ereignisse auf die Titelseiten, und obwohl Kitty verschwunden blieb, traten die Ermittlungen in den Hintergrund. Die Menschen verloren das Interesse an dem Fall. Aber die Geschichte blieb rätselhaft – von Kitty wurde nie eine Spur gefunden, und nichts deutete darauf hin, dass sie Thailand je verlassen hatte. Als hätte sie sich in Luft aufgelöst. Viele Leute – und ich muss gestehen, dass ich zu ihnen gehörte – glaubten, Mr. Watanna sei dafür verantwortlich. Er war zwar glücklich verheiratet, bislang nicht vorbestraft, und es gab keinerlei Hinweise, die ihn mit einem möglichen Mord in Verbindung brachten, auch keine Verhaltensauffälligkeiten, die auf emotionale Unruhe infolge eines begangenen Mordes hätten schließen lassen – trotzdem schien er als Täter am wahrscheinlichsten in Frage zu kommen. 1997 starb er recht jung im Alter von sechsundvierzig Jahren, nachdem es ihm nie ganz gelungen war, sich vom Schatten des Verdachts zu befreien. Sollte er gewusst haben, was Kitty tatsächlich widerfahren war, so nahm er sein Wissen mit ins Grab.
Das Leben ging weiter, und ich hatte ein Vierteljahrhundert lang nichts mehr über das seltsame Verschwinden von Katherine »Kitty« Sinn gelesen oder gehört und auch nicht mal mehr daran gedacht, bis mich aus heiterem Himmel ein Anwalt namens Maurice Reedman anrief. Er teilte mir mit, er vertrete einen gewissen – seine Formulierung, nicht meine – Henry Forbes, und dieser habe Informationen, die für die Polizei interessant sein könnten.
Und so kam es, dass wir uns im Esszimmer von Reedmans hochherrschaftlichem Anwesen außerhalb Londons wiederfanden, Henry und unser Gastgeber auf einer Seite des großen Holztisches, ich auf der anderen.
Henry Forbes, gramgebeugt und blass, hatte schlaffe Gesichtszüge mit unerbittlich tiefen Falten, das schwarze Haar, das ich noch von alten Fotos in Erinnerung hatte, war inzwischen grau und schütter. Seine einundfünfzig Jahre sah man ihm an, er wirkte keinen Tag jünger. Seine Augen waren schmal und blickten misstrauisch, ein Schweißfilm bedeckte seine Stirn. Auch schien er kaum stillsitzen zu können. Reedman dagegen musste sich allmählich auf die siebzig zubewegen, verkörperte aber in seinem teuren Nadelstreifendreiteiler, dessen Weste an seinem umfänglichen Bauch spannte, und mit seinen kleinen Händen sowie den perfekt manikürten Fingernägeln ganz den wohlgenährten Vorzeige-Anwalt. Sein dichtes graues Haar glänzte. Alles in allem wirkte er für einen Mann namens Maurice eigentlich viel zu elegant.
Ich schob das Gespräch an. »Sie haben um ein Treffen gebeten, Mr. Forbes?«
»Das habe ich. Ich habe viel über Sie gelesen, DS Mason, und ich vertraue Ihnen. Mr. Reedman ebenfalls.«
Ich sagte nichts. Es war halb neun, und ich hatte noch nicht zu Abend gegessen.
Henry seufzte. »Was ich zu sagen habe …« Er hielt inne, legte die Hände auf den Tisch und starrte sie an. Ein Finger trommelte nervös auf das Holz. »Ich habe ein Geheimnis.« Er schaute seinen Anwalt an, der nickte. »Es betrifft einen möglichen Mord.«
Ich schlug mein Notizbuch auf. »Nun, dann sollten Sie es mir besser verraten.«
Reedman ergriff jetzt das Wort. »Ich habe um ein Treffen bei mir zu Hause gebeten, weil ich die Angelegenheit gerne vertraulich behandeln würde. Mir ist bewusst, wie ungewöhnlich die Bitte ist, aber hören Sie mich zunächst an. Ich habe mich ausführlich mit meinem Klienten beraten und glaube, dass seine Informationen von größter Bedeutung für Sie sind. Allerdings belastet er mit seiner Aussage auch eine Reihe sehr mächtiger Personen und möglicherweise in geringerem Maße auch sich selbst. Im Wesentlichen verhält es sich so, dass er nicht bereit ist, diese offiziell zu Protokoll zu geben, sofern er seitens der Behörden nicht vollen Personenschutz zugesichert bekommt, einschließlich einer neuen Identität und strafrechtlicher Immunität.«
»Sie wissen so gut wie ich, dass ich keine strafrechtliche Immunität zusichern kann, Mr. Reedman«, erklärte ich.
»Eben. Genau deshalb wollten wir dieses Gespräch vertraulich führen. Anschließend halten Sie Rücksprache mit Ihren Vorgesetzten und berichten diesen, was Sie von uns erfahren haben. Auf dieser Grundlage kann entschieden werden, ob man meinem Klienten helfen möchte oder nicht. Wenn nicht, wird er keine weitere Aussage machen, und ich verspreche Ihnen, es wird Ihnen nicht gelingen, ihn umzustimmen.«
Ich legte die Stirn in Falten. Der drohende Unterton Reedmans gefiel mir nicht, aber ich war neugierig zu erfahren, was Henry Forbes wusste.
»Ich habe Ihnen ja bereits am Telefon erklärt, wer mein Klient ist«, fuhr Reedman fort.
»Geht es um das Verschwinden von Kitty Sinn?«
»Sprechen wir im Vertrauen?«
»Unser Treffen findet in inoffiziellem Rahmen statt. Wir befinden uns auf keiner Polizeiwache, und Ihr Klient wurde nicht über seine Rechte belehrt, vor Gericht ist also nichts davon verwertbar.«
»Darf ich Sie dennoch bitten, auf Notizen zu verzichten?«
Ich seufzte und klappte mein Buch zu. »In Ordnung, Hauptsache wir kommen endlich zum Thema. Ich habe Hunger.«
Reedman lehnte sich zurück, bildete ein spitzes Dach mit seinen manikürten Fingerspitzen. »Ja, es geht um Katherine Sinn. Wie Sie möglicherweise bereits erfahren haben, wurden Leichenteile auf dem Grundstück einer Privatschule in Buckinghamshire gefunden.«
Ich hatte etwas darüber in den Nachrichten gesehen. Der Schule war das Geld ausgegangen, und man hatte ein Stück Land an ein Bauunternehmen verkauft, das dort Häuser hochziehen wollte. Als die ersten Bulldozer Gruben aushoben, kamen menschliche Knochen zum Vorschein, anscheinend die einer jungen Frau. Derzeit wurde der Fall von Thames Valley bearbeitet, und soweit ich wusste, hatte man die junge Frau bislang noch nicht identifiziert und auch keine Einzelheiten darüber veröffentlicht, wie oder wann sie gestorben war.
»Mein Klient ist der Überzeugung, dass es sich um die Knochen von Katherine Sinn handelt«, sagte Reedman.
Wie Sie sich vorstellen können, war dies eine relativ schockierende Mitteilung, da alle Zeugen Kitty zum letzten Mal knapp zehntausend Kilometer weit von Buckinghamshire entfernt gesehen hatten.
Ich wandte mich an Henry. »Stimmt das, Mr. Forbes? Sind das Kittys Überreste?«
Henry schluckte, sein Adamsapfel hüpfte auf und ab.
»Ja«, sagte er. »Das sind sie.«
»Und wie ist sie da hingekommen?«
»Sie wurde ermordet.«
»Von Ihnen?«
»Ich will Immunität, bevor ich etwas sage.«
»Ich habe Ihnen bereits erklärt, dass ich Ihnen in einem Mordfall keine strafrechtliche Immunität versprechen kann. Wenn Sie für die Tat verantwortlich sind, liegt es in Ihrem eigenen Interesse, es mir jetzt zu sagen.«
»Ich habe Kitty nicht umgebracht. Das schwöre ich. Ich bin kein Mörder.«
Er holte tief Luft, eine Schweißperle lief ihm über die Stirn, und Reedman schaltete sich ein. »Aber mein Klient kann die Personen benennen, die Ms. Sinn getötet haben.«
Henry sah mich an. »Das sind sehr mächtige Leute. Die haben Freunde. Sie werden mich finden. Und wenn sie wüssten, dass ich hier mit Ihnen rede, würden sie mich umbringen. Ich brauche Straffreiheit und eine neue Identität. Schutz für den Rest meines Lebens. Wenn ich den bekomme, kann ich Ihnen zu einem Riesenerfolg verhelfen, das schwöre ich.«
»Deshalb müssen wir zu einem Deal gelangen, mit dem alle zufrieden sind«, sagte Reedman.
Henry schien aufrichtig Angst zu haben, aber meiner Erfahrung nach bekamen es die meisten sehr schnell mit der Angst zu tun, wenn sie in Schwierigkeiten steckten. Ich bezweifelte, dass die Mächtigen, von denen er sprach, wirklich mächtig oder in der Lage waren, ihm etwas anzuhaben.
Was sich als Irrtum herausstellen sollte.
»So funktioniert das nicht«, sagte ich. »Wir müssen wissen, was Mr. Forbes weiß, bevor wir anfangen können, uns über Deals zu unterhalten.«
»Ich fürchte, das geht nicht, DS Mason«, sagte Reedman und legte Henry eine Hand auf den Arm – eine eindeutige Geste, um ihm zu signalisieren, er möge schweigen.
Ich sah Henry unverwandt an. »Ich könnte Sie sofort wegen Rechtsbehinderung verhaften.«
Reedman schüttelte entschieden den Kopf. »Und mit welcher Begründung? Sie waren einverstanden damit, dieses Gespräch streng vertraulich zu führen. Jetzt haben Sie Knochen, die Katherine Sinn gehören, wie sich unweigerlich herausstellen wird, aber mehr haben Sie nicht. In Hinblick auf meinen Klienten ändert das nichts. Als Katherine verschwand, gab es eine Reihe von Zeugen, die gesagt haben, dass er sie nicht getötet haben konnte. Seine Version der Geschichte hielt sowohl der Überprüfung durch die thailändischen wie auch der britischen Behörden stand und wird dies auch in Zukunft tun. Ein Zusammenhang zwischen ihm und den Knochen wird sich nicht nachweisen lassen. Und nach sechsundzwanzig Jahren ist praktisch ausgeschlossen, dass einer anderen Person eine Verbindung nachgewiesen wird. Sie befinden sich wieder ganz am Anfang, und genau dort werden Sie auch bleiben. Es sei denn …« Er hob einen Finger und sah mich durchdringend an. »Es sei denn, Sie lassen sich auf einen Deal ein. Mein Klient bekommt umfassenden Personenschutz, nachsichtige Behandlung vor Gericht und eine neue Identität im Rahmen eines Zeugenschutzprogramms. Dann wird er Ihnen alles verraten, was er weiß. Und jetzt, DS Mason, müssen wir schnell handeln. Ich bin sicher, dass Mr. Forbes in Gefahr schwebt. Also bitte, fragen Sie Ihren Chef, was er oder sie davon hält.«
»Geben Sie mir mehr Informationen als Argumentationsgrundlage«, entgegnete ich. »Etwas, das diesen Deal überzeugender macht.«
»Der Deal ist überzeugend genug«, sagte Reedman streng.
»Ist er nicht«, sagte ich.
Henry erhob sich, ging zum Fenster und holte ein paarmal tief Luft, dann kam er zurück. »Ich denke, an derselben Stelle wird man weitere Leichenteile finden«, sagte er. »Vielleicht auch mehr als nur die einer einzigen Person.«
»Henry«, fauchte Reedman, »setzen Sie sich, und seien Sie still.«
»Ich weiß, dass die schon vor Kitty getötet haben, und es würde mich nicht wundern, wenn danach noch andere dran glauben mussten.«
»Henry!«, schrie Reedman.
Ich funkelte ihn an, war kurz davor, über den Tisch zu greifen und die Wahrheit aus ihm herauszupressen. »Woher zum Teufel wissen Sie das? Das ist kein lustiges Spielchen. Wir sprechen über Mord. Wenn Sie etwas wissen und es uns nicht sagen, werden wir in Ihrer Vergangenheit wühlen, bis wir herausgefunden haben, was Sie getan haben, und dann wandern Sie sehr, sehr lange hinter Gitter.«
Henry sah aus, als wollte er in Tränen ausbrechen. »Ich habe niemanden umgebracht, das schwöre ich.«
Reedman streckte die Hand aus und zog seinen Klienten wieder auf seinen Stuhl. »Telefonieren Sie, DS Mason«, sagte er. »Bitte.«
Ich stand auf. »Wird fünf Minuten dauern«, erklärte ich und trat aus der Haustür, ließ sie aber angelehnt.
Die Nacht war kühl – es war erst Mitte April – und klar. Reedmans großes freistehendes Haus lag in einem Grünstreifen östlich der M25 zwischen dem Luftwaffenstützpunkt Northolt und Gerrards Cross, vor und hinter dem Grundstück war nichts als freies Feld. Entfernt hörte man das Verkehrsrauschen der M25, und wegen des urbanen Leuchtens im Osten waren keine Sterne zu sehen, trotzdem hatte das Anwesen etwas angenehm Ländliches. Das Grundstück war fast einen halben Hektar groß und das Wohnhaus durch ein schmiedeeisernes Tor über eine lange Auffahrt erreichbar, vermutlich war es insgesamt an die drei Millionen Pfund wert. Aber einem armen Anwalt begegnete man ja ohnehin selten.
Ich ging seitlich ums Haus und zog mein Handy aus der Tasche, wählte die Nummer meines Chefs in der Abteilung für Mord und Schwerverbrechen, DCI Eddie Olafsson, oder Olaf, wie er hinter seinem Rücken genannt wurde. Seit meiner Versetzung aus der Abteilung für Terrorbekämpfung vor sechs Monaten ermittelte ich als Angehöriger eines Teams der Mordkommission der Metropolitan Police von Ealing aus. Fünfzehn Jahre hatte ich dort gearbeitet, mein Abschied war unschön ausgefallen, und man hatte mich fast vier Monate lang suspendiert, bevor ich endlich eine zweite Chance als Detective Sergeant in Olafs Team bekam. Wobei man mir unmissverständlich erklärte, dass er einer von nur sehr wenigen DCIs sei, die überhaupt bereit waren, mich aufzunehmen. Als ich Olaf von Reedmans Anruf und dessen Bitte erzählt hatte, ich möge mich mit ihm und Henry Forbes treffen, war er angesichts unserer hohen Fallbelastung nicht gerade begeistert gewesen. Trotzdem hatte er sich einverstanden erklärt, weil auch er alt genug war, um sich noch an den Fall Kitty Sinn zu erinnern.
Wie es der Zufall wollte, hatten wir in dieser Nacht Bereitschaftsdienst, weshalb ich jetzt keinesfalls Gefahr lief, Olaf bei ausgelassenen Kneipentouren zu stören. Nach dem dritten Klingeln meldete er sich.
»Und? Hatte Henry Forbes was Interessantes zu sagen?«, fragte er.
Ich erzählte ihm, dass Forbes behauptete, die auf dem Gelände der Schule in Buckinghamshire gefundenen Überreste gehörten Kitty Sinn, und er könne mehrere Personen benennen, die in den Mord an ihr verstrickt seien. »Außerdem meint er, dort würden weitere Leichenteile liegen.«
»Bist du sicher, dass er dich nicht auf den Arm nimmt?«, donnerte Olaf mit seiner sehr lauten Stimme.
»Er sagt die Wahrheit. Und er hat Angst. Er behauptet, die für den Mord Verantwortlichen wollen ihn töten.«
»Aber er hat dir keinerlei Einzelheiten darüber verraten, wie es kam, dass Kitty Sinn aus Thailand zurückgekehrt ist, ohne gesehen zu werden, obwohl ihr Gesicht in allen Zeitungen war? Und warum sie schließlich auf dem Gelände eines privaten Internats verscharrt wurde?«
»Nein, dazu hat er sich nicht geäußert. Sein Anwalt hält ihn an der kurzen Leine. Er will nicht, dass Forbes etwas sagt, bevor er nicht eine neue Identität und Personenschutz rund um die Uhr zugesichert bekommt, außerdem einen Deal, der ihn vor einer Haftstrafe wegen Rechtsbehinderung oder Ähnlichem bewahrt. Aber er muss mit dem Mord zu tun gehabt haben, sonst wüsste er nicht, wo die Leiche liegt.«
Olaf gab ein tiefes Grunzen von sich, das, wie ich inzwischen gelernt hatte, seine Art zu seufzen war. Dieser Mann konnte nichts leise tun. »Das denke ich auch«, sagte er. »Na ja, zum Glück ist es nicht unser Problem, sondern das von Thames Valley. Ich kenne den Kollegen, der die Ermittlungen leitet, werde ihn anrufen und berichten, was du mir gerade erzählt hast, dann sehen wir weiter.«
»Bist du nicht neugierig zu erfahren, was aus Kitty Sinn geworden ist?«
»Klar bin ich das. Aber nicht so sehr, dass ich uns den Fall aufhalsen möchte. Lieber lese ich sonntags in der Zeitung darüber.«
Ich wollte gerade fragen, wie mit der Frage der Immunität umzugehen sei, als sich quietschend das große Tor an der Auffahrt öffnete. Ein schwarzer Geländewagen glitt hindurch, sehr langsam und ohne Scheinwerferlicht.
Sofort schrillten alle meine Alarmglocken. So fährt man nur, wenn man weder gehört noch gesehen werden will.
Ich stand gute dreißig Meter entfernt, seitlich am Haus, duckte mich in den Schatten eines Apfelbaums und beobachtete den Wagen, einen BMWX5, der weiter über die Auffahrt schlich. Die hinteren Scheiben waren getönt, aber vorne saßen zwei Männer. Aus der Entfernung konnte ich ihre Gesichter nicht erkennen – bis ich begriff, dass sie Skimasken trugen.
»Ach, du Scheiße«, zischte ich ins Handy. »Ich glaube, wir haben ein Problem. Ein BMWX5 mit maskierten Insassen bewegt sich gerade bei ausgeschaltetem Scheinwerferlicht auf das Haus zu. Schick mir sofort Verstärkung. Bewaffnet.« Ich ratterte Reedmans Adresse runter.
»Mach nichts Unüberlegtes, Ray«, sagte Olaf immer noch im Brüllton. »Hilfe ist unterwegs.«
Ich beendete den Anruf, stellte das Handy auf lautlos und wusste, dass ich schnell handeln musste. Als der Wagen vor dem Haus vorfuhr, entfernte ich mich von dem Apfelbaum, hielt mich aber dicht an der Hecke, die das Grundstück hinten begrenzte, sodass ich außer Sichtweite blieb, und rannte zur Tür des Wintergartens. Bis die Männer mit den Skimasken vorne durch die Haustür kamen, blieben mir vielleicht dreißig Sekunden, um Forbes und seinen Anwalt hinten rauszuholen. Der Garten war nur ungefähr fünfzehn Meter lang und wurde durch einen niedrigen Zaun von den offenen Feldern dahinter getrennt. Ein möglicher Fluchtweg.
Mein Herz schlug heftig, als ich die Tür des Wintergartens erreichte. Ich hörte, wie vor dem Haus die Wagentüren des BMW zuschlugen, und mir fiel ein, dass ich die Haustür angelehnt gelassen hatte. Wer auch immer die Kerle waren, sie konnten einfach hereinspazieren.
Ich schlich mich ins Haus, durchquerte schnell den Wintergarten und die Küche, wollte nicht rufen, aus Angst, die Männer mit den Skimasken auf mich aufmerksam zu machen. Als ich in die Diele trat, hörte ich Henry Forbes und Maurice Reedman lebhaft diskutieren. Es klang nach Streit, aber ich konnte nicht verstehen, was gesagt wurde.
Ich war nur noch wenige Meter vom Esszimmer entfernt, da hörte ich jemanden an der Haustür.
Als diese aufging, sprang ich in den nächstbesten Raum und wusste, dass ich zu spät kam. Noch immer redeten Henry und sein Anwalt miteinander, offensichtlich völlig ahnungslos gegenüber der drohenden Gefahr.
Ich fluchte innerlich, weil ich unbewaffnet war. Nachdem einmal ein Anschlag auf mein Leben verübt worden war, hatte ich früher zu den wenigen Polizeibeamten im Vereinigten Königreich gezählt, die ständig eine Schusswaffe mitführen durften. Nach meinem letzten großen Fall bei der Terrorbekämpfung aber war mir dieses Recht wieder entzogen worden. Aktuell hatte ich nicht mehr zu bieten als einen Dienstausweis und ein paar strenge Worte, und irgendwie glaubte ich, dass diese weder mir noch sonst jemandem helfen würden.
Ich hörte Schritte in der Diele, nur wenige Meter von meinem Versteck entfernt. Anscheinend war ich in die Bibliothek ausgewichen: Bücherregale nahmen zwei der Wände ein, und abgesehen von einem schweren gläsernen Aschenbecher auf dem Tischchen neben dem Lesesessel gab es nichts, das ich als Waffe hätte benutzen können. Ich verhielt mich still, kaum dreißig Zentimeter von der Tür entfernt, bereit, über jeden herzufallen, der sich hereinwagte – gleichzeitig wusste ich, dass mir viel mehr gar nicht übrig blieb.
Ich hörte die Eindringlinge in der Diele gedämpft miteinander sprechen, ihre Stimmen waren kaum mehr als ein Murmeln.
Dann wurde die Tür des Esszimmers geöffnet, erschrockene Rufe und Schreie von Henry und Reedman.
»Hände hoch, sofort!«, brüllte jemand.
Laut. Nordlondoner Akzent. Möglicherweise afro-karibischer Herkunft. Ich zog das Handy aus der Tasche, öffnete die Diktierfunktion und nahm auf.
Sehr langsam schob ich meinen Kopf um die Tür herum. Teilweise wurde mir die Sicht auf das Esszimmer durch das Treppengeländer versperrt, aber durch den schmalen Türspalt sah ich einen der beiden Maskierten. Gedämpfte Stimmen drangen herüber, und der Bewaffnete, den ich gerade hatte sprechen hören, bellte Fragen. Seine Stimme war tief und sonor, und vermutlich würde ich sie wiedererkennen, aber ich war zu weit entfernt, um verstehen zu können, was er oder die anderen sagten.
Wenn ich den Wortwechsel aufnehmen wollte, musste ich näher heran, aber ich würde mich zur Zielscheibe machen, wenn ich in die Diele trat, zumal die Haustür weit offen stand. Möglicherweise waren draußen weitere bewaffnete Männer. Außerdem konnte Reedman oder Henry den beiden im Esszimmer längst verraten haben, dass ich hier war.
Ich verspürte das dringende Bedürfnis, einfach über denselben Weg wieder zu verschwinden, auf dem ich gerade gekommen war, über den Zaun zu springen und auf dem angrenzenden Feld auf Verstärkung zu warten, aber ich beherrschte mich. Es kam mir feige vor, und trotz all meiner Fehler bin ich kein Feigling.
Ich trat einen Schritt in die Diele, hielt das Handy am ausgestreckten Arm von mir weg und hoffte, dass es die Stimmen der Maskierten aufzeichnen würde.
Einige Sekunden lang stand ich reglos da.
Dann hörte ich zwei Schüsse im Esszimmer und Reedman, der vor Schmerz aufschrie. Ich wusste, dass er es war, denn unmittelbar danach heulte Henry und flehte um Gnade, klang dabei zunehmend hysterisch. Mein ganzer Körper verspannte sich. Sie würden ihn töten. Ich bin schon lange Polizist. Davor war ich Soldat. Ich bin es gewohnt, mich für Schwächere einzusetzen. Und jetzt musste ich untätig mit anhören, wie ein Mann ein fünfundzwanzig Jahre altes Geheimnis mit ins Grab nahm.
Der Bewaffnete, der die Befehle gab, brüllte Henry an, er solle den Mund halten, was er unverzüglich tat. Es herrschte Stille, dann erklangen erneut gedämpfte Worte.
Ich machte einen weiteren Schritt in die Diele hinein.
Der erste Maskierte sagte etwas zu Henry, etwas wie »letzte Chance«, aber sicher war ich nicht. Dann sagte er noch etwas, leiser, und ich konnte gar nichts davon verstehen.
Henry stammelte einige Sätze, die sich gegen Ende in flehendes Jammern auflösten, ich wusste, dass er sterben würde, und auch er wusste es. Wieder fing er an zu sprechen, wurde aber von drei weiteren Schüssen unterbrochen, zwei kurz aufeinander, gefolgt von einem Gnadenschuss zum Schluss.
Es war vorbei.
Und da hörte ich sie. Das entfernte Heulen der Sirenen.
Die beiden Killer gingen im Esszimmer umher, und mir fiel ein, dass ich versuchen könnte, sie zu überwältigen, wenn sie zurück in die Diele kamen. Vielleicht bekäme ich eine der beiden Waffen zu fassen. Dies war nicht die erste Schießerei, in die ich hineingeraten war, und bis jetzt hatte ich sie alle überlebt. Aber mein Selbsterhaltungstrieb bremste mich. Zu riskant.
Trotzdem geriet ich in Versuchung, dem ersten der beiden feigen Schweine eins überzuziehen, wenn er den Raum verließ – es ihm mit gleicher Münze heimzuzahlen.
Im Esszimmer brach mit einem Knall ein Feuer aus, unmittelbar danach roch man es auch.
Die Sirenen wurden jetzt lauter, eine zweite war dazugekommen. Wenn sie nicht sofort verschwanden, würden diese Idioten ganz ohne mein Zutun in der Falle sitzen.
»Los, los, los!«, hörte ich den ersten Maskierten schreien, Rauchschwaden drangen aus dem Zimmer.
Ich zog mich ein paar Schritte zurück und wollte gerade wieder hinter der Tür zur Bibliothek verschwinden, als nur wenige Meter von mir entfernt ein dritter Maskierter auf den Stufen vor der Haustür auftauchte.
»Hey!«, schrie er, gerade als einer der anderen mit einem Gewehr aus dem Esszimmer rannte.
Mir schoss Adrenalin ins Blut, ich sprang zurück in die Bibliothek, ließ geistesgegenwärtig mein Handy in der Tasche verschwinden und hörte, wie der dritte Maskierte auf der Treppe den beiden erklärte, wo ich war und dass sie schnell machen sollten, die Bullen seien unterwegs. Jetzt hatten sie’s eilig. Ich musste hoffen, dass sie Fehler begingen.
Ich schnappte mir den schweren Aschenbecher von dem Tischchen und wirbelte herum, da stand plötzlich der mit dem Jagdgewehr im Eingang. Ich warf ihm den Aschenbecher an den Kopf und tauchte ab, als er abdrückte.
Der Aschenbecher traf ihn im Gesicht, er torkelte rückwärts, fasste sich mit der Hand an die Nase und schenkte mir den Bruchteil einer Sekunde, um mich auf ihn zu stürzen. Ich packte das Gewehr mit beiden Händen, lenkte es zur Seite ab, als er zum zweiten Mal abdrückte. Eine Schockwelle fuhr mir durch die Arme. Gleichzeitig warf ich mich mit meinem ganzen Gewicht auf ihn, sodass wir beide durch die Tür flogen und gegen das Treppengeländer knallten. Ich versuchte ihm eine Kopfnuss zu verpassen, aber er drehte sich weg, und ich entdeckte eine schmale weiße Narbe an seinem Hals, die auf das Schlüsselbein zulief. Seine Haut war goldbraun – entweder war er gemischter Abstammung oder Asiate –, aber es gelang mir kaum, dies abzuspeichern, da ich verhindern musste, dass er mich zu Fall brachte.
Aus dem Augenwinkel konnte ich sehen, wie der größere der Maskierten, der Reedman und Henry die Fragen gestellt hatte, eine Pistole auf mich richtete. Aber es war klar, dass er keinen guten Schuss hinbekommen würde, ohne dabei zu riskieren, seinen Freund zu treffen, und ich klammerte mich erbittert an das Gewehr. Ich denke, der Dritte schrie etwas, aber nach dem Schuss war ich vorübergehend so taub, dass ich es nicht verstand.
Mein Gegner war stark und drahtig, er versetzte mir einen harten Stoß, wodurch wir beide zurück in die Bibliothek taumelten. Ich knallte gegen eins der Bücherregale, und ein paar dicke Wälzer fielen mir auf den Kopf. Er presste mir den Lauf quer an den Hals, versuchte mir die Luft abzudrücken. Der Lauf war heiß, weil gerade ein Schuss abgefeuert worden war, aber ich ignorierte den Schmerz, schlug wild um mich, weil ich wusste, dass mein Leben davon abhing.
Es gelang mir, ihn zurückzudrängen, und wir kämpften erbittert miteinander. Erneut löste sich ein Schuss, und dieses Mal warf mich der Rückstoß ein Stück nach hinten. Eine Hand rutschte von der Waffe ab, und schon schlug mir mein Gegner den Kolben ans Kinn.
Dabei verlor ich vollends den Halt und ging zu Boden, knallte noch einmal an das Regal.
Ich lag auf dem Rücken, schaute hoch.
Der maskierte Mann schaute zu mir herunter. Mir fiel auf, dass der Ärmel seiner Jacke über dem Handschuh hochgerutscht und ein Stück von einer Tätowierung zu sehen war, die anscheinend den ganzen linken Unterarm bedeckte. Allerdings hatte ich keine Zeit, sie genau zu betrachten, ich war damit beschäftigt, ihn anzuschauen. Er starrte mich an, atmete schwer, seine Augen waren sehr groß, sehr dunkel und sehr kalt. Die Mündung seines Jagdgewehrs befand sich kaum einen halben Meter von meinem Gesicht entfernt.
Mich erfüllte das bleierne Gefühl, unterlegen zu sein. In meinem Leben war der Tod nie weit gewesen, schon seit meiner Kindheit, und so wunderte es mich wenig, dass er mich jetzt offenbar eingeholt hatte.
Der Mann lächelte unter der Skimaske und drückte ab.
Nichts.
Kurz schaute er verwirrt, und eine Sekunde lang bewegte sich keiner von uns beiden. Dann meldete sich erneut mein Überlebensinstinkt, und ich erinnerte mich an das, was ich gelernt hatte. Ich stieß mich mit den Händen vom Boden ab, trat mit dem Fuß aus, erwischte ihn am Schienbein und sprang auf.
Dieses Mal verlor er keine Zeit. Er trat mir in den Magen, woraufhin ich erneut zu Boden ging. Dann drehte er sich um und rannte zur Tür hinaus. Der Brandgeruch wurde immer stärker. Er erinnerte mich daran, wie ich vor langer Zeit in einem brennenden Haus eingeschlossen war. Und an meine Todesangst damals. Ich musste raus.
Schwach und angeschlagen rappelte ich mich auf und stolperte hinaus in die Diele, das Summen in meinen Ohren legte sich allmählich, und ich hörte weitere Sirenen, jetzt ganz nah.
Die Haustür stand sperrangelweit offen, und ich sah, wie der schwarze BMW in drei Zügen auf dem Rasen wendete und röhrend über die Auffahrt außer Sichtweite raste.
Ich verspürte das dringende Bedürfnis, sofort hinaus an die frische Luft zu laufen, aber ich musste Beweise suchen oder vielmehr vor dem Feuer retten, weshalb ich ins Esszimmer rannte und mir mein Hemd über das Gesicht zog, um mich vor dem beißenden schwarzen Rauch zu schützen.
Maurice Reedman lag angelehnt an eine Glasvitrine, seine Augen waren geschlossen. Er war zweimal im Gesicht getroffen worden. Henry Forbes lag auf dem Rücken auf der anderen Seite des Tisches. Flammen züngelten über seinen Oberkörper dort, wo er mit Benzin übergossen worden war, doch sonst brannte nichts in dem Raum, was bedeutete, dass die Täter es vor allem auf ihn abgesehen hatten. Die Flammen verloschen bereits – Menschen brennen nicht gut, und es war eindeutig, dass Henrys Mörder zu wenig Benzin benutzt hatten – ich rannte zur Toilette, schnappte mir ein Handtuch und hielt es unter kaltes Wasser. Als es nass genug war, ging ich erneut hinein und warf es Henry über den Oberkörper, hockte mich hin und schlug das Feuer mit den Händen aus, auch weil ich dachte, dass immerhin eine geringe Chance bestand, dass er noch lebte. Dann tastete ich nach seinem Puls, aber er hatte keinen mehr. Henrys schwarzes Gesicht war ausdruckslos und seine Augen geschlossen. Auf der Stirn klaffte ein Loch, und in seiner Brust befanden sich zwei weitere. Er war tot.
Und sein Geheimnis hatte er mitgenommen.
Ich zog die Nase kraus wegen des Gestanks nach verbranntem Fleisch. Anscheinend hatte sich das Feuer auf die rechte Seite seines Oberkörpers konzentriert. Sein Hemd war teilweise verbrannt, die Haut darunter verkohlt und voller Blasen, aber mir fiel etwas ins Auge. Da war ein Zeichen auf der Unterseite des Oberarms, anscheinend eine Tätowierung. Sie war zur Hälfte verbrannt, aber ich konnte erkennen, dass es wohl mal ein schwarzer Stern mit drei geschwungenen Linien darin gewesen sein musste.
Zwei Dinge waren dabei eigenartig. Erstens, die Tätowierung befand sich an einer Stelle an seinem Arm, wo man sie normalerweise gar nicht sehen konnte, nicht mal er selbst. Und zweitens schien er mir überhaupt nicht der Typ für so was zu sein.
Ich zog mein Handy heraus, um ein Foto zu machen, dann ging ich schnell raus, musste mich von dem Anblick und dem Leichengeruch entfernen.
In dem Moment hörte ich hektische Schreie »Polizei!« auf den Stufen vor der Haustür.
Endlich war Verstärkung eingetroffen, aber nicht zum ersten Mal in der Geschichte kam sie ein paar Minuten zu spät.
Kapitel 2
Eine halbe Stunde später saß ich auf der Motorhaube meines Wagens, in Maurice Reedmans Auffahrt, als Olaf mit seinem Audi vorfuhr, auf dem Rasen parkte und ausstieg, offensichtlich geladen.
Es wimmelte bereits vor uniformierten Polizisten und Sanitätern, und Olaf lief zwischen ihnen umher, das Handy am Ohr, blaffte Befehle und brachte mit dem ihm eigenen, einzigartigen Charme Ordnung in die Situation.
Nach wenigen Minuten, in denen er allen Anwesenden erfolgreich vermittelt hatte, wer hier das Sagen hatte, entdeckte er mich und kam zu mir, schob dabei das Handy in die Tasche seines Mantels.
Olaf behauptete, väterlicherseits von Wikingern abzustammen, aber um ehrlich zu sein, sah er nicht wie einer aus. Eher wie ein ehemaliger Wrestler. Er war klein, korpulent, völlig kahl, Haare wuchsen nur an seinen Ohren, und sein Kopf war praktisch quadratisch. Früher war er mal sehr dick gewesen, was in erster Linie seiner Ernährung geschuldet war, die hauptsächlich aus Alkohol und schlechtem Essen bestanden hatte, wozu lange Arbeitszeiten am Schreibtisch ohne sportliche Betätigung kamen. Als er jedoch bei einer Besprechung mit dem Commissioner von Scotland Yard einen Stuhl zerlegte, indem er sich darauf niederließ, hatte er fünfundzwanzig Kilo abgespeckt. Seither war in seiner Gegenwart jegliche Erwähnung des Vorfalls mit dem Stuhl, scherzhaft oder sonst wie, streng verboten.
Ich mochte Olaf. Er war ein Polizist, der von der Straße kam, durch und durch, er hatte Erfahrungen beim Flying Squad gesammelt, einer Sondereinheit der Metropolitan Police zur Bekämpfung schwerer und organisierter Kriminalität, wo er auch eine Vorliebe für Pies, Bier, Kraftausdrücke und das Zusammenschlagen Verdächtiger entwickelt hatte. Nach zweiunddreißig Jahren Dienst schien er keinerlei Bedürfnis zu verspüren, in den Ruhestand zu treten, und er war eines der allerletzten Exemplare der aussterbenden Gattung des Polizisten alter Schule. Tatsächlich trug er sogar eine Schaffelljacke, die älter aussah als er selbst.
»Verdammte Scheiße, was ist hier passiert?«, verlangte er zu erfahren und stellte sich vor mich. »Kaum kreuzt du auf, gibt’s Tote. Muss das sein?«
Ich bedachte ihn mit der Art von Blick, die signalisierte, dass ich für scherzhaftes Geplänkel im Moment nicht zu haben war, und er erwiderte diesen mit einem Grinsen. Olaf grinste nicht oft, aber wenn, meinte er es ehrlich.
»Jetzt mal im Ernst«, sagte er. »Wie geht’s dir?«
»Ging mir schon besser«, sagte ich und betupfte mein Kinn mit einem feuchten Taschentuch an der Stelle, wo mich der Maskierte mit dem Kolben des Jagdgewehrs erwischt hatte. Es tat höllisch weh, aber es war vermutlich nichts gebrochen.
»Was ist passiert?«
»Als ich nach unserem Telefonat wieder ins Haus bin, waren die Täter schon drin. Ich hab mich versteckt, während sie Forbes und seinen Anwalt erschossen haben. Eingegriffen hab ich nicht.« Ich hatte so eine Ahnung, dass mir das noch eine ganze Weile lang zu schaffen machen würde.
»Na ja, immerhin ist es dir gelungen, dich mit einem von denen zu prügeln.«
»Nur weil ich entdeckt wurde, als ich die Stimmen mit dem Handy aufnehmen wollte.«
»Hast du die Aufnahme?«
Ich schüttelte den Kopf. »Nicht verwertbar. Ich war zu weit weg.«
Er wirkte enttäuscht. »Das ist schade. Hast du den, mit dem du dich geprügelt hast, genauer gesehen?«
»Ich denke, er war gemischter Abstammung, möglicherweise aber auch Inder oder Pakistani. Außerdem hatte er eine Narbe hier am Hals, und sein ganzer linker Unterarm war tätowiert.«
Olaf nickte. »Nicht schlecht für den Anfang, Ray. Das wird helfen.«
»Das war ein gezielter, professioneller Mord, Chef. Ein dreiköpfiges Team. Ein Fahrer, zwei Schützen, in einem schwarzen BMWX5. Als ich rausging, war das Sicherheitstor vorne geschlossen, und ich bin sicher, dass sie nicht reingelassen wurden, also müssen sie das Tor selbst geöffnet haben. Die wussten genau, wen sie gesucht haben und wo, sie sind direkt ins Esszimmer gelaufen, wo Henry Forbes und sein Anwalt saßen. Beiden haben sie Fragen gestellt. Es muss um den Fall Kitty Sinn gegangen sein.«
Olaf sah nachdenklich zum Haus, dann wandte er sich wieder an mich. »Sie haben gesagt, Henry Forbes hat behauptet, in Buckinghamshire könnten noch mehr Leichen liegen.«
»Richtig. Das war praktisch das Letzte, was er zu mir gesagt hat. Keine Ahnung, ob es Blödsinn ist oder nicht.«
»Ist es nicht. Ich habe gerade mit dem leitenden Ermittler von Thames Valley gesprochen, um ihm mitzuteilen, dass es sich bei seiner Leiche möglicherweise um Kitty Sinn handelt.« Olaf seufzte. »Heute Nachmittag wurden die Überreste einer weiteren Person ausgegraben. Die Kollegen meinen, es könnte ein Teenagermädchen sein, noch nicht identifiziert.«
Ich schüttelte den Kopf, dachte daran, wie kurz ich davorgestanden hatte herauszufinden, was Kitty und auch diesem anderen Mädchen widerfahren war. »Ach du Scheiße.«
»Und an einem der Halswirbel wurden eindeutige Spuren gefunden, die darauf hinweisen, dass dem Mädchen brutal die Kehle durchgeschnitten wurde. Mit wem auch immer wir es hier zu tun haben, es muss ein krankes Arschloch sein.« Er legte mir eine Hand auf die Schulter. »Das war gute Arbeit, Ray. Was du hier erfahren hast, werden wir nutzen, um den Kerl zu finden.«
Damit drehte er sich um und ging ins Haus, ließ mich mit dem Gefühl sitzen, kläglich versagt zu haben. Es wog schwer und hing über mir wie eine Giftwolke.
Kapitel 3
Charlotte Curtis lag in der Wanne und fragte sich, ob sie vielleicht doch endlich über den Tod ihres Mannes hinweggekommen war.
Ihre Ehe war sehr glücklich gewesen. Sie hatten nie Kinder gewollt, was manche, darunter auch einige Familienangehörige, für widersinnig gehalten hatten, da Charlotte Lehrerin war. Aber durch ihren Beruf hatte sie immer ausreichend mit Kindern zu tun gehabt und selbst nie ausgesprochen mütterliche Gefühle entwickelt, und das hatte dazu geführt, dass Jacques und sie sich mit all ihrer Liebe stets aufeinander konzentriert hatten. Zwischen ihnen hatte sich eine Bindung entwickelt, die unzerstörbar schien, und gewiss hätte keiner von beiden sie je gelöst; aber das Schicksal hatte kalt und gefühllos etwas anderes vorgesehen. 2011 wurde dem erst vierundvierzig Jahre alten Jacques Speiseröhrenkrebs diagnostiziert. Seine Aussichten waren schlecht, und in nur sechs Monaten hatte die Krankheit auf seinen Magen und die Lunge übergegriffen. Danach hatte sich sein Zustand rapide verschlechtert, fast als habe er selbst das Ende herbeigesehnt – Jacques war zu stolz gewesen, um langsam zu verkümmern –, und an einem kalten Januartag 2012 war er in einem Hospiz in Charlottes Armen gestorben.
Das war jetzt vier Jahre, drei Monate und zehn Tage her, und seither war kein einziger Tag vergangen, an dem sie nicht an ihn gedacht hatte. Zuerst hatte sie selbst sterben wollen, so entsetzlich weh hatte es getan, aber Schritt für Schritt und mit der Hilfe von Freundinnen war es ihr gelungen, sich aus ihrem schwarzen Loch zu befreien, und ganz allmählich war der Schmerz ein kleines bisschen abgestumpft. Erst im vergangenen Jahr hatte sie endlich wieder das Gefühl gehabt, doch noch leben zu können, und vor drei Monaten tatsächlich jemanden kennengelernt. Lucien war zehn Jahre jünger, auf leicht verwegene Art gut aussehend, absolut unstandesgemäß und genau das, was sie brauchte. Sie wusste, dass die Beziehung nicht von Dauer sein würde, und war nicht mal sicher, ob sie das überhaupt gewollt hätte. Aber in seiner Gegenwart fühlte sie sich endlich wieder wie eine Frau, und dafür war sie dankbar.
Sie tauchte ihren Kopf ins heiße Wasser, dachte daran, dass Jacques Lucien vermutlich gemocht hätte. Sicher würde er sich freuen, weil sie jemanden gefunden hatte. Als er wusste, dass er sterben würde und es absolut kein Zurück mehr gab, hatte Jacques ihre Hand genommen, ihr in die Augen gesehen und ihr sehr ernst erklärt, er würde es ihr niemals verzeihen, wenn sie zuließe, dass die Trauer ihr Leben zerstöre. »Das größte Geschenk, das du mir machen kannst, ist, wieder zu leben«, hatte er gesagt. »Finde einen Mann, der dich so liebt wie ich, und liebe ihn genauso zurück.«
Kaum dachte sie jetzt an seine Worte, stiegen Charlotte erneut Tränen in die Augen. Du lieber Gott. Über vier Jahre war das her, und noch immer machte er das mit ihr. Sie setzte sich in der Wanne auf und holte tief Luft – plötzlich fiel ihr etwas in den Blick.
An einem der Deckenspots stimmte was nicht. Sie runzelte die Stirn, fragte sich, ob sie es sich einbildete. Aber nein. Direkt neben der Metallhalterung des Spots gab es ein winziges schwarzes Loch, das vorher nicht da gewesen war, da war Charlotte sich sicher. Solche Sachen fielen ihr auf. Sie hoffte, dass es nicht an einer modrigen Stelle in der Decke lag. Sie war noch nie gut im Handwerken gewesen, hatte sich immer zunächst auf Jacques und dann auf verschiedene Helfer verlassen, die sich um ihr Haus kümmerten. Außerdem schwamm sie nicht gerade im Geld. Wenn das hier etwas Schlimmes war, steckte sie in Schwierigkeiten.
Ein paar Sekunden lang starrte sie den fraglichen Spot an, stieg widerwillig aus der Wanne, um das Problem genauer zu betrachten. Das warme Wasser wirkte beruhigend, im Badezimmer aber war es eher kühl. Schließlich gab sie sich einen Stoß, wickelte sich in ein Handtuch, holte einen Stuhl aus dem Schlafzimmer und stellte ihn unter die Lampe. Sie war nur einen Meter zweiundsechzig groß, und die Decken im Haus waren hoch, also musste sie sich auf den Zehenspitzen strecken. Eine Hand an der Decke abgestützt, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren, schaute sie mit zusammengekniffenen Augen ins grelle Licht, ihr Gesicht befand sich nur dreißig Zentimeter von dem Loch entfernt, das kaum breiter war als einen halben Zentimeter.
Da sah sie, dass das Loch absolut rund war, wie mit einem Bohrer ins Metall getrieben. Eine winzige Linse lugte in einem Fünfundvierzig-Grad-Winkel daraus hervor. Ein weißes Gehäuse umfasste sie, sodass sie vor der weiß gestrichenen Raumdecke kaum auffiel.
Zunächst reagierte Charlotte einfach nur verwirrt angesichts dessen, was sie da entdeckt hatte, und es dauerte ein paar Sekunden, bis sie begriff, dass es sich um eine versteckte Kamera handelte und diese perfekt angebracht war, um sie in der Badewanne einzufangen.
Sie bekam Gänsehaut und fing an zu zittern, als ihr die gesamte Tragweite bewusst wurde. Jemand war bei ihr ins Haus eingedrungen – das Haus, das sie geliebt hatte, seit sie und Jacques vor achtzehn Jahren die alte heruntergekommene Scheune in jahrelanger harter Arbeit und unendlicher Hingabe in ein wunderschönes Heim mit vier Zimmern verwandelt hatten … jemand war hier eingedrungen, hatte ein Loch in die Decke gebohrt und beobachtete sie nun heimlich, wo sie nackt und angreifbar war. Charlotte liebte es zu baden, liebte ihr allabendliches Ritual. Eine Zeit der Entspannung und des Nachdenkens. Dieses Ritual, das in den vergangenen Jahren so wichtig für sie gewesen war, war jetzt praktisch entweiht.
Sie schnaubte wütend, packte das weiße Kameragehäuse zwischen Daumen und Zeigefinger und zog fest daran. Knackend löste sich das Gehäuse, ein bisschen Putz bröckelte herunter, aber als sie noch einmal daran zog, hielt sie das Ding in der Hand und starrte auf ein pennygroßes Loch in der Decke. Sie fuhr mit dem Finger in das Loch, tastete ringsherum, aber sonst war dort nichts.
Charlotte stieg vom Stuhl und inspizierte die Kamera. Es waren keine Kabel daran befestigt, doch das war nicht unbedingt erstaunlich. Heutzutage funktionierte ja alles Mögliche kabellos. Sie hatte nicht die geringste Ahnung von Minikameras, aber diese hier sah teuer aus.
Was eine sehr unangenehme Frage aufwarf. Wer hatte sie dort installiert?
Bei ihr war nicht eingebrochen worden, und seit Monaten hatten keine Handwerker mehr das Haus betreten. Ihr erster Gedanke war, dass es Lucien gewesen sein musste. Schließlich kannte sie ihn nicht besonders gut, und er war auch mit keinem ihrer Bekannten befreundet. Er wohnte dreißig Kilometer weit entfernt in Villeneuves, und sie hatten sich im Netz kennengelernt, weshalb sie nicht ausschließen konnte, dass er irgendwie pervers war und dies nur ausgezeichnet zu verbergen verstand. Aber schon bald gab sie diese Theorie auf. Lucien mochte zwar ein gut aussehender Macho sein, handwerklich jedoch stellte er sich genauso ungeschickt an wie sie selbst. Außerdem war er nie lange genug unbeobachtet im Haus gewesen, um die Kamera anbringen zu können, und ganz bestimmt hatte er keine nötig, um sie nackt zu sehen. Das hatte er bereits häufig getan.
Also, wer war es dann?
Es gab keine naheliegende Antwort auf diese Frage. Charlotte war eine normale, allgemein beliebte Frau und wegen ihrer Arbeit an der Schule sowohl bei den Einheimischen wie auch innerhalb der Gemeinschaft der Ausgewanderten angesehen. Soweit ihr bekannt war, hatte sie keine Feinde. Seit achtzehn Jahren lebte sie nun unbehelligt und unbedroht in diesem Haus.
Aber jetzt beobachtete sie jemand, und das war relativ neu. Vor einer Woche hatte es diese Kamera noch nicht gegeben, da war sie sicher. Vielleicht noch nicht einmal gestern.
Das Badezimmer fühlte sich beschmutzt an. Schnell trocknete sie sich im Schlafzimmer ab, schlüpfte in Morgenmantel und Hausschuhe. Plötzlich überfiel sie der Gedanke, dass die Person, die die Kamera dort angebracht hatte, sich möglicherweise noch im Haus aufhielt. Was natürlich höchst unwahrscheinlich war, aber sie wollte es nicht drauf ankommen lassen. Sie spürte die Stille, ging hinunter in die Küche und zog ein Tranchiermesser aus dem Messerblock. Kado, ihr kleiner schwarzer Affenpinscher, lag in seinem Körbchen. Er hob nur kurz den Kopf, dann schlief er wieder ein. Er war zu klein für einen Wachhund, aber Charlotte wusste, dass er Krach geschlagen hätte, wäre ein Fremder ins Haus eingedrungen. Andererseits könnte Kado hier draußen, drei Kilometer vom nächsten Ort entfernt und hundert Meter vom nächsten Nachbarn, Monsieur Dalon, der zu allem Überfluss halb taub war, so viel bellen, wie er wollte, es würde niemand hören. Charlotte hatte die Abgeschiedenheit immer als Vorzug betrachtet, als Bollwerk gegen die Außenwelt, aber jetzt nicht mehr. Jetzt fühlte sie sich entsetzlich angreifbar, schutzlos.
Sie sah aus dem Küchenfenster hinaus in die stockfinstere Nacht. Vielleicht war die Person gar nicht drinnen. Sie konnte dort draußen stehen in der Dunkelheit, sie in diesem Moment beobachten, und sie würde es nicht einmal mitbekommen.
Mit dem Messer fest in der Hand ging sie alle Räume ab, vergewisserte sich, dass niemand im Haus war, dann ließ sie sämtliche Jalousien herunter und verriegelte die Türen. Jetzt kam niemand hier herein.
Aber offensichtlich war schon jemand drin gewesen, flüsterte eine ungebetene innere Stimme.
Charlotte holte den widerstrebenden Kado aus seinem Körbchen und zog sich mit ihm in ihr Schlafzimmer zurück, legte sich neben den Hund aufs Bett und das Messer auf den Nachttisch. Kado schlief an sie gekuschelt sofort wieder ein. Sie fühlte sich dadurch besser, nicht weil sie ihn gerne bei sich im Bett hatte – das Gegenteil war der Fall –, sondern weil sie sicher sein konnte, dass niemand sonst im Haus war, denn andernfalls hätte er ein Riesentheater veranstaltet. Kado war kein Freund von Fremden.
Charlotte seufzte und betrachtete das Messer, fragte sich, ob sie es überhaupt fertigbringen würde, auf jemanden einzustechen, dann ermahnte sie sich, ruhiger zu werden. Ja, jemand war in ihr Heim eingedrungen und hatte eine Kamera installiert, um sie in der Badewanne zu filmen, aber vermutlich war es irgendein erbärmlicher Perverser aus dem Dorf, der einfach nicht den Mumm hatte, sie wegen eines Dates anzusprechen. Kein böser Serienkiller, der sie umbringen wollte. Und wenn sie herausgefunden hatte, wer es war – und sie würde es herausfinden –, würde sie sofort zur Polizei gehen und ihn anzeigen.
»Das ist mein Zuhause«, flüsterte sie. »Hier bin ich sicher.«
Aber irgendwie nahm sie es sich selbst nicht ab.
Kapitel 4
Der Junge aus dem brennenden Haus. So hatten mich die Medien damals genannt.
Als ich sieben Jahre alt war, ermordete mein Vater, ein fauler Säufer aus reichem Elternhaus, in einem Anfall von alkoholbedingter Raserei meine Mutter und meine beiden Brüder. Auch mich hätte er umgebracht, hätte er mich erwischt, aber als er durch die Zimmer tobte und mich suchte, versteckte ich mich in einem Schrank oben in unserem weitläufigen alten Landhaus. Er machte den Schrank auf, in dem ich kauerte, entdeckte mich aber nicht unter dem Haufen alter Mäntel und Jacken, die ich über mich gezogen hatte. Ich werde die langen, schrecklichen Sekunden, die sich auf Minuten auszudehnen schienen, nie vergessen, als mein Vater mit der Messerklinge in den Jacken herumstocherte und ich die Spitze schon auf der Haut spürte und die Luft anhalten musste. Ich wagte nicht, mich zu rühren.
Zum Schluss setzte das Schwein unser Haus in Brand, um mich auszuräuchern. So entschlossen war mein eigener Vater, mich zu töten. Selbst jetzt noch lässt mich der bloße Gedanke daran schaudern.
Mir blieb keine andere Wahl, als mein Versteck zu verlassen, und dabei entdeckte er mich. Mit brennender Kleidung und blutverschmiertem Messer in der Hand jagte er mir nach, schrie mir Obszönitäten hinterher. Um ihm zu entkommen, musste ich aus einem Fenster oben springen und landete in einem Blumenbeet, ohne mich dabei ernsthaft körperlich zu verletzen. Hier wurde ich wenig später zitternd und im Schockzustand von Feuerwehrleuten gerettet.
Psychisch allerdings sah das Ganze schon anders aus. Die Nacht verfolgte mich über all die Jahre, und durch keine Therapie der Welt – und glauben Sie mir, ich habe jede Menge gemacht – ist es mir gelungen, sie vollkommen der Vergangenheit zu überstellen, in die sie eigentlich gehört. Es hat dazu geführt, dass mich die Menschen anders behandeln als andere, besonders meine Kollegen. Alle wissen, wer ich bin. Der Junge aus dem brennenden Haus, dessen Familie durch einen einzigen Akt extremer Gewalt ausgelöscht wurde, der danach erst zur Armee ging und dann zur Polizei; ein Mann, der während seiner gesamten beruflichen Laufbahn von Gewalt und Kontroversen verfolgt wurde.
Jemand, dem man nicht wirklich vertrauen darf.
Daher war es eigentlich keine Überraschung, dass meine Hände auf Schmauchspuren untersucht wurden und ich mich jetzt in einem Vernehmungszimmer auf der Wache in Ealing wiederfand, einen Polizeioverall trug, weil die DNA-Spuren an meiner Kleidung analysiert wurden, und zwei ausgesprochen finster dreinblickende Kollegen vom MIT Ealing mir gegenüber Platz nahmen. Es war kurz vor ein Uhr morgens, ich hatte den ganzen Nachmittag und Abend nicht mehr gegessen als ein nach Sägemehl schmeckendes Stück Blätterteig-Käse-Pastete aus der Kantine. Dementsprechend war ich nicht unbedingt bester Laune.
DI Glenda Gardner, Olafs Stellvertreterin, gehörte zu den strengsten und humorlosesten Menschen, denen ich je begegnet war. Alles an ihr war freudlos, angefangen von ihrer Frisur bis zu ihrem Hosenanzug, aber sie verstand es sehr gut, Verdächtigen eine Riesenangst einzujagen, indem sie sich einfach nur dazusetzte und böse Blicke aussandte. Obwohl ich sie nicht leiden konnte – und sie mich genauso wenig –, schätzte ich sie als Polizistin.
Neben ihr saß DS »Taliban« Tom Tucker, der wegen seines enormen Vollbarts so genannt wurde. Er war erst einunddreißig, aber mit seiner Gesichtsbehaarung erinnerte er an einen rothaarigen Weihnachtsmann, und ich war ziemlich sicher, dass er eines Tages Fotos aus dieser Zeit betrachten und sich fragen würde, was zum Teufel er sich dabei gedacht hatte. Eigentlich war er ein recht angenehmer Typ, aber wie viele Polizisten direkt von der Hochschule ein Jasager, der ständig nur die nächste Beförderung im Sinn hatte.
Ich hatte gerade alle abscheulichen Einzelheiten von den Geschehnissen des Abends berichtet und zum ersten Mal begriffen, wie sich Kriminelle fühlten, die hier saßen.
Nur dass diese im Unterschied zu mir normalerweise etwas verbrochen hatten.
»Also«, sagte DI Glenda und fixierte mich mit einem ihrer typischen bösen Blicke, »damit wir uns richtig verstehen. Aus heiterem Himmel erhalten Sie einen Anruf von Maurice Reedman, weil Sie, wie er behauptet, der Einzige sind, dem sein Klient vertraut, obwohl sie diesem niemals persönlich begegnet sind. Dann fahren Sie alleine dorthin, um sich mit den beiden zu treffen. Forbes und Reedman versuchen Immunität für Ersteren herauszuhandeln, und als Sie hinausgehen, um sich mit DCI Olafsson zu besprechen, die Haustür dabei angelehnt lassen, tauchen drei Männer in einem Wagen auf, öffnen das Sicherheitstor, dessen Code sie vermutlich nicht kennen, und fahren vors Haus. Die Männer sehen Sie nicht, sondern betreten das Gebäude direkt durch die offene Haustür und töten sowohl Mr. Forbes wie auch Mr. Reedman. Sie versuchen das Geschehen akustisch mitzuschneiden, nicht etwa zu filmen, wobei die Qualität der Aufnahme so schlecht ist, dass sie nicht ausgewertet werden kann. Als die Schützen fliehen wollen, werden Sie entdeckt, es kommt zum Kampf, Schüsse fallen, aber Sie bleiben unverletzt.«
»Na ja, ich habe einen Schlag ans Kinn abgekriegt.«
»Sie wurden nicht angeschossen«, sagte Taliban.
»Nein, Tom«, sagte ich, »angeschossen wurde ich nicht. Der Täter wollte mich erschießen, aber als er aus kürzester Entfernung abdrückte, hatte er keine Munition mehr. Inzwischen hatten die drei es eilig, denn sie hörten die Sirenen, also sind sie weg.«
»Sie wirken bemerkenswert gefasst, wenn man bedenkt, was Sie mitgemacht haben«, sagte Glenda.
Das stimmte. Äußerlich wirkte ich wohl tatsächlich gefasst, aber nicht deshalb, weil mich die Ereignisse nicht mitgenommen hätten. Das hatten sie. Ich war nur ziemlich gut darin, Emotionen zu unterdrücken. Schließlich hatte ich das mein Leben lang getan.
»Ich bin durchaus erschüttert«, erklärte ich ihr müde. »Aber wie Sie wissen, war ich nicht zum ersten Mal in einer solchen Situation.« Ich zuckte mit den Schultern. »Es wird nicht lange dauern, dann bricht alles über mich herein.«
Ganz bestimmt sogar. Das war immer so. Nur bloß nicht hier, nicht vor denen.
»Ist das, was ich gerade umrissen habe, eine ungefähr korrekte Zusammenfassung der Ereignisse?«, fragte Glenda.
Ich seufzte. »Ich denke doch, ja.«
»Ja oder nein?«
Verstehen Sie, was ich meine in Bezug auf Glenda? Mitgefühl und Anteilnahme waren selten, dort, wo sie herkam. Wieder funkelte sie mich böse an.
Ich funkelte zurück. »Ja, war es. Ich verstehe nicht, weshalb Sie mir unterstellen, ich hätte etwas mit diesen Morden zu tun.«
»Niemand unterstellt Ihnen etwas, DS Mason«, sagte Taliban und sprach mich mit meinem Dienstgrad an, da das Gespräch aufgezeichnet wurde.
»Na ja, wissen Sie, Tom, ich denke doch. Aber Sie können sich ja die Verbindungnachweise für mein Handy geben lassen. Heute wurde ich von Maurice Reedmans Festnetzanschluss aus angerufen. Nicht ich habe ihn angerufen, sondern er mich.«
»Das haben wir bereits überprüft«, erklärte Glenda.
»Also, warum nehmen Sie mich dann in die Mangel?«, fragte ich.