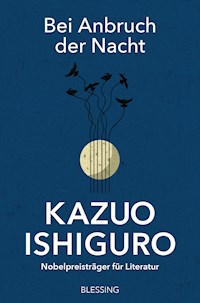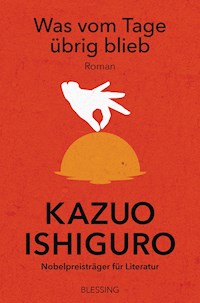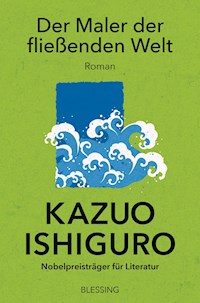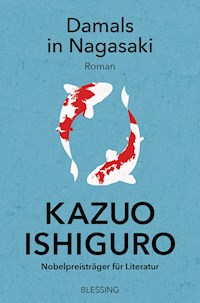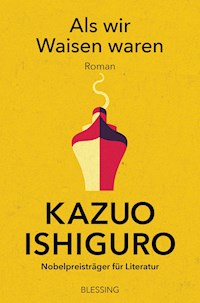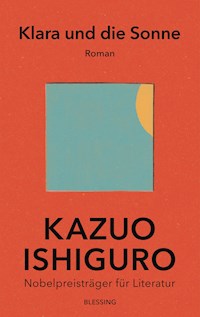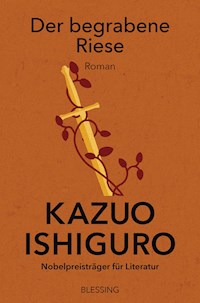Kazuo Ishiguro
Bei Anbruchder Nacht
Aus dem Englischen von Barbara Schaden
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Titel der Originalausgabe: Nocturnes. Five Stories of Music and Nightfall Originalverlag: faber and faber
Copyright © der Originalausgabe 2009 by Kazuo Ishiguro
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2009
by Karl Blessing Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Layout und Herstellung: Gabriele Kutscha
Coverfoto: © Getty Images/Taxi/ Nick White
ISBN: 978-3-641-02784-1V003
www.blessing-verlag.de
www.randomhouse.de
Für Deborah Rogers
Crooner
An dem Morgen, an dem ich Tony Gardner zwischen den Touristen sitzen sah, zog hier in Venedig gerade der Frühling ein. Wir hatten unsere erste ganze Woche draußen auf der Piazza hinter uns – eine Wohltat, kann ich Ihnen sagen, nach den endlosen stickigen Stunden hinten im Café, wo wir der Kundschaft im Weg sind, die ins Treppenhaus will. Es ging ein ziemlicher Wind an diesem Morgen, und unsere brandneue Markise flatterte uns um die Ohren, aber wir fühlten uns alle ein bisschen frischer und fröhlicher, und das hörte man unserer Musik wohl auch an.
Aber ich rede hier, als wäre ich ein reguläres Bandmitglied, dabei bin ich einer der »Zigeuner«, wie uns die anderen Musiker nennen, einer von denen, die rund um die Piazza wandern und aushelfen, wenn in einem der drei Kaffeehausorchester Not am Mann ist. Meistens spiele ich hier im Caffè Lavena, aber wenn nachmittags viel los ist, begleite ich schon mal die Leute vom Quadri bei einem Set oder gehe rüber zum Florian, dann über den Platz zurück ins Lavena. Ich komme mit allen gut aus – auch mit den Kellnern -, und in jeder anderen Stadt hätte ich schon eine feste Anstellung. Aber hier, wo sie alle derart besessen von Tradition und Vergangenheit sind, ist alles umgekehrt. Überall sonst wäre es ein Pluspunkt, wenn einer Gitarre spielt. Aber hier? Eine Gitarre! Die Geschäftsführer der Kaffeehäuser drucksen herum. Das wirkt zu modern, das gefällt den Touristen nicht. Bloß damit mich keiner für einen Rock’n’ Roller hält, habe ich seit letztem Herbst eine klassische Jazzgitarre mit ovalem Schallloch, eine, die zu Django Reinhardt gepasst hätte. Das macht es ein bisschen einfacher, aber die Geschäftsführer sind noch immer nicht zufrieden. Auf diesem Platz hier kannst du als Gitarrist Joe Pass sein, und sie stellen dich trotzdem nicht fest ein, so ist es.
Natürlich ist da noch die Nebensächlichkeit, dass ich kein Italiener bin, geschweige denn Venezianer. Dem großen Tschechen mit dem Altsax geht es nicht anders. Wir sind beliebt, wir werden von den anderen Musikern gebraucht, aber wir passen nicht so ganz ins offizielle Programm. Spielt einfach und haltet den Mund, sagen die Geschäftsführer immer. Dann merken die Touristen nicht, dass ihr keine Italiener seid. Tragt eure Anzüge, Sonnenbrillen, kämmt euch das Haar zurück, dann merkt keiner einen Unterschied, aber fangt bloß nicht an zu reden.
Aber ich mache mich ganz gut. Alle drei Kaffeehausorchester, besonders wenn sie gleichzeitig unter ihren Konkurrenzbaldachinen aufspielen müssen, brauchen eine Gitarre – etwas Weiches, Solides, aber Verstärktes, das im Hintergrund die Akkorde schlägt. Sie denken jetzt wahrscheinlich: Drei Bands gleichzeitig auf ein und demselben Platz, das klingt doch schrecklich! Aber die Piazza San Marco ist groß genug, die verkraftet das. Ein Tourist, der über den Platz schlendert, hört das eine Stück verklingen, während sich das nächste einblendet, ungefähr so, wie wenn er an der Skala seines Radios dreht. Wovon die Touristen nicht allzu viel vertragen, das sind die klassischen Sachen, die ganzen Instrumentalversionen berühmter Arien. Okay, wir sind hier auf dem Markusplatz, sie wollen nicht gerade die neuesten Pop Hits. Aber sie hören gern alle paar Minuten was, das sie kennen, vielleicht eine alte Julie-Andrews-Nummer oder ein Thema aus einem berühmten Film. Ich weiß noch, wie ich letzten Sommer von einer Band zur nächsten pilgerte und an einem einzigen Nachmittag neunmal »The Godfather« spielte.
Jedenfalls waren wir an besagtem Frühlingsmorgen draußen und spielten vor einer ordentlichen Touristenmenge, als ich Tony Gardner entdeckte, der allein vor seinem Kaffee saß, fast direkt vor uns, vielleicht sechs Meter von unserer Markise entfernt. Wir haben ständig Prominente hier auf der Piazza, aber wir machen keinen großen Wirbel darum. Kann sein, dass es sich die Bandmitglieder am Ende eines Stücks zuflüstern: Schau, da ist Warren Beatty. Schau, das ist Kissinger. Diese Frau dort, die war doch in dem Film über die Männer, die ihre Gesichter tauschen. Ist für uns nichts Besonderes. Es ist schließlich der Markusplatz. Aber als mir klar wurde, dass es Tony Gardner war, der hier saß, war es anders, da wurde ich doch sehr aufgeregt.
Tony Gardner war der Lieblingssänger meiner Mutter. Solche Platten aufzutreiben war bei uns zu Hause, damals in der kommunistischen Zeit, fast unmöglich, aber meine Mutter besaß praktisch die gesamte Kollektion von ihm. Als Kind machte ich mal einen Kratzer in eine ihrer kostbaren Platten. Die Wohnung war so eng, und ein Junge in meinem Alter musste sich einfach ab und zu bewegen, vor allem in den kalten Monaten, wenn man nicht raus konnte. Deshalb hatte ich ein Spiel, ich sprang von unserem kleinen Sofa auf den Sessel, immer wieder, aber einmal landete ich daneben und traf den Plattenspieler. Die Nadel schrammte mit einem Ratsch quer über die Platte – das war lang vor den CDs -, und meine Mutter kam aus der Küche herein und fing an, mich anzuschreien. Ich war sehr zerknirscht, weniger, weil sie mich anschrie, sondern weil es eine Tony-Gardner-Platte war und weil ich ja wusste, wie viel ihr die bedeutete. Und ich wusste, dass jetzt auch diese Platte bei jeder Umdrehung dieses knackende Geräusch von sich geben würde, während er seine amerikanischen Schmachtfetzen sang. Jahre später, als ich in Warschau arbeitete und mich auf dem Plattenschwarzmarkt auskannte, besorgte ich meiner Mutter Ersatz für alle ihre abgenudelten Tony-Gardner-Alben, auch für die Platte, die ich ruiniert hatte. Ich brauchte mehr als drei Jahre, aber ich gab nicht auf, beschaffte eine nach der anderen, und bei jedem Besuch brachte ich ihr wieder eine mit.
Sie verstehen also, warum ich so aufgeregt wurde, als ich ihn keine sechs Meter von mir entfernt entdeckte. Zuerst traute ich meinen Augen nicht, und es kann sein, dass ich einen Akkordwechsel versiebte. Tony Gardner! Was hätte meine liebe Mutter gesagt, wenn sie das gewusst hätte! Um ihretwillen, um ihres Andenkens willen musste ich hingehen und etwas zu ihm sagen, auch wenn die Kollegen lachten und sagten, ich führe mich auf wie ein Hotelpage.
Natürlich konnte ich nicht einfach zwischen Tischen und Stühlen hindurch auf ihn zumarschieren. Erst musste das Set zu Ende sein. Es war eine Qual, sage ich Ihnen, noch einmal drei, vier Nummern, und jede Sekunde dachte ich, jetzt steht er auf und geht. Aber er blieb sitzen, ganz allein, starrte in seinen Kaffee und rührte darin herum, als wäre er total erstaunt über das, was der Kellner ihm da gebracht hatte. Er sah aus wie jeder andere amerikanische Tourist, in hellblauem Polohemd und weiten grauen Hosen. Seine Haare, sehr dunkel, sehr glänzend auf dem Plattencover, waren inzwischen fast weiß, aber sie waren noch immer sehr dicht und genauso tadellos frisiert wie damals. Als ich ihn entdeckte, hatte er seine Sonnenbrille in der Hand – ich bezweifle, dass ich ihn sonst erkannt hätte -, aber während der folgenden Stücke, bei denen ich ihn immer im Auge behielt, setzte er sie auf, nahm sie wieder ab, setzte sie wieder auf. Er wirkte geistesabwesend, und dass er unserer Musik gar nicht wirklich zuhörte, enttäuschte mich.
Dann war unser Set vorbei, und ich stürzte unter dem Baldachin hervor, ohne was zu den anderen zu sagen, bahnte mir einen Weg zu Gardners Tisch und war einen Moment lang in Panik, weil ich nicht wusste, wie ich ein Gespräch anfangen sollte. Ich stand hinter ihm, aber irgendein sechster Sinn ließ ihn sich umdrehen und zu mir heraufsehen – wahrscheinlich kam das vom jahrzehntelangen Umgang mit Fans, die auf ihn zutraten -, und sofort stellte ich mich vor und erklärte, dass ich ihn sehr bewunderte, dass ich in der Band sei, die er gehört habe, dass meine Mutter ein große Bewunderin von ihm gewesen sei, das alles in einem einzigen langen Schwall. Er lauschte mit ernster Miene und nickte alle paar Sekunden, als wäre er mein Arzt. Ich plapperte weiter, und von ihm kam weiter nichts als ein gelegentliches »Ach ja?«. Nach einer Weile fand ich es an der Zeit zu gehen und wollte mich gerade entfernen, als er sagte:
»Sie kommen also aus einem Ostblockland. Das muss hart gewesen sein.«
»Ist alles Vergangenheit.« Ich zuckte munter die Achseln. »Jetzt sind wir ein freies Land. Eine Demokratie.«
»Das freut mich zu hören. Und das war Ihre Truppe, die eben für uns gespielt hat. Setzen Sie sich doch. Möchten Sie einen Kaffee?«
Ich sagte, ich wolle nicht aufdringlich sein, aber jetzt war etwas Freundlich-Bestimmtes an Mr Gardner. »Nein, nein, setzen Sie sich. Ihre Mutter hat meine Platten geliebt, sagten Sie.«
Also setzte ich mich und erzählte weiter. Von meiner Mutter, von unserer Wohnung, den Platten vom Schwarzmarkt. Und ich wusste zwar nicht mehr, wie die Alben hießen, aber ich beschrieb ihm die Bilder auf den Hüllen, wie ich sie in Erinnerung hatte, und jedes Mal hob er einen Finger und sagte etwas wie: »Oh, das war sicher Inimitable. Der unnachahmliche Tony Gardner.« Ich glaube, wir genossen beide dieses Spiel, aber dann sah ich Mr Gardners Blick abschweifen und drehte mich um, und genau in dem Moment trat eine Frau an unseren Tisch.
Sie war eine dieser ungemein vornehmen amerikanischen Damen, mit tollem Haar, tollen Kleidern, toller Figur, und dass sie nicht so jung sind, merkt man erst, wenn man sie aus der Nähe sieht. Aus der Ferne hätte ich sie für ein Model aus einer dieser Nobelillustrierten gehalten. Aber als sie sich neben Mr Gardner setzte und ihre Sonnenbrille auf die Stirn schob, sah ich, dass sie mindestens fünfzig war, vielleicht älter. Mr Gardner sagte zu mir: »Das ist meine Frau Lindy.«
Mrs Gardner warf mir ein Lächeln zu, das irgendwie gezwungen war, dann fragte sie ihren Mann: »Und wer ist das? Hast du einen Freund gefunden?«
»Richtig, Liebling. Ich hatte ein sehr nettes Gespräch mit … Entschuldigen Sie, mein Freund, ich weiß Ihren Namen gar nicht.«
»Jan«, sagte ich schnell. »Aber Freunde nennen mich Janeck.«
Lindy Gardner sagte: »Sie meinen, Ihr Spitzname ist länger als Ihr echter Name? Wie geht das denn?«
»Sei nicht unhöflich zu dem Mann, Liebling.«
»Ich bin nicht unhöflich.«
»Mach dich nicht über seinen Namen lustig, Liebling. Sei ein gutes Mädchen.«
Lindy Gardner wandte sich mit einem irgendwie ratlosen Ausdruck an mich. »Wissen Sie, was er meint? Hab ich Sie beleidigt?«
»Nein, nein«, sagte ich, »gar nicht, Mrs Gardner.«
»Ständig sagt er mir, ich sei unhöflich zum Publikum. Aber ich bin nicht unhöflich. War ich jetzt unhöflich zu Ihnen?« Dann, an Mr Gardner gewandt: »Ich rede auf natürliche Art mit dem Publikum, Süßer. Das ist meine Art. Ich bin nie unhöflich.«
»Okay, Liebling«, sagte Mr Gardner, »lass uns das jetzt nicht weiter ausbreiten. Wie auch immer, dieser Mann hier ist nicht Publikum.«
»Ach nein? Was denn dann? Ein verloren geglaubter Neffe?«
»Sei doch nett, Liebling. Dieser Mann ist ein Kollege. Ein Musiker, ein Profi. Er hat jetzt gerade für uns gespielt.« Er deutete zu unserem Baldachin hinüber.
»Ah ja!« Lindy Gardner wandte sich wieder an mich. »Sie haben dort Musik gemacht, ja? Also das war hübsch. Sie waren am Akkordeon, stimmt’s? Wirklich hübsch!«
»Vielen Dank. Ich bin aber der Gitarrist.«
»Gitarrist? Das ist nicht Ihr Ernst! Noch vor einer Minute hab ich Sie beobachtet. Genau dort haben Sie gesessen, neben dem Kontrabassisten, und so wunderschön auf Ihrem Akkordeon gespielt.«
»Verzeihung, aber am Akkordeon, das war Carlo. Der Große mit der Glatze …«
»Sind Sie sicher? Sie nehmen mich nicht auf den Arm?«
»Liebling, bitte. Sei nicht unhöflich zu dem Mann.«
Er hatte nicht gerade geschrien, aber seine Stimme war auf einmal scharf und zornig, und nun herrschte ein merkwürdiges Schweigen. Mr Gardner brach es selbst nach einer Weile und sagte sanft:
»Entschuldige, Liebling. Ich wollte dich nicht anschnauzen.«
Er streckte die Hand aus und ergriff eine der ihren. Ich hätte eigentlich erwartet, dass sie sich losriss, aber das Gegenteil war der Fall: Sie rückte auf ihrem Stuhl näher zu ihm und legte ihre freie Hand auf das gefaltete Händepaar. So saßen sie ein paar Sekunden, Mr Gardner mit gesenktem Kopf, seine Frau mit leerem Blick über seine Schulter hinwegstarrend; sie blickte auf die Basilika jenseits der Piazza, aber ihre Augen schienen nichts wahrzunehmen. In diesem kurzen Moment war es, als hätten sie nicht nur mich an ihrem Tisch vergessen, sondern sämtliche Leute auf dem Platz. Dann sagte sie, beinahe flüsternd:
»Schon gut, Süßer. Es war meine Schuld. Ich hab dich aufgeregt.«
Noch eine Weile saßen sie so da, Hand in Hand. Dann seufzte sie, ließ Mr Gardner los und sah mich an. Sie hatte mich schon zuvor angesehen, aber diesmal war es anders. Diesmal spürte ich ihren Charme. Es war, als hätte sie eine Skala, die von null bis zehn reichte, und hätte in dem Moment beschlossen, ihren Charme mir gegenüber auf sechs oder sieben aufzudrehen. Ich spürte ihn wirklich stark, und wenn sie mich jetzt um einen Gefallen gebeten hätte – zum Beispiel über den Platz zu gehen und ihr Blumen zu kaufen -, hätte ich es mit Freuden getan.
»Janeck«, sagte sie. »So heißen Sie, oder? Es tut mir leid, Janeck. Tony hat recht. Wie komme ich dazu, so mit Ihnen zu reden?«
»Wirklich, Mrs Gardner, machen Sie sich bitte keine Gedanken …«
»Und ich bin in euer Gespräch hineingeplatzt. Bestimmt ein Musikergespräch. Aber wisst ihr was? Ich werde euch zwei jetzt in Ruhe weiterreden lassen.«
»Du musst wirklich nicht gehen, Liebling«, sagte Mr Gardner.
»Oh doch, Süßer. Ich sehne mich regelrecht danach, mir diesen Prada-Laden anzusehen. Ich bin nur hergekommen, um dir zu sagen, dass ich länger weg bin, als ich dachte.«
»Okay, Liebling.« Tony Gardner richtete sich zum ersten Mal auf und atmete tief durch. »Solang du sicher bist, dass es dir Spaß macht.«
»Oh ja, ich werde mich wunderbar amüsieren. Und euch beiden wünsche ich eine nette Unterhaltung.« Sie stand auf und berührte mich an der Schulter. »Passen Sie auf sich auf, Janeck.«
Wir sahen ihr nach, dann fragte mich Mr Gardner das eine oder andere nach dem Leben eines Musikers in Venedig und besonders nach dem Quadri-Orchester, das in dem Moment zu spielen anfing. Er schien meinen Antworten nicht sehr aufmerksam zu folgen, und ich wollte mich schon verabschieden und gehen, aber dann sagte er plötzlich:
»Ich hätte da einen Vorschlag, mein Freund. Lassen Sie mich sagen, was mir vorschwebt, und Sie können mir einen Korb geben, wenn Sie wollen.« Er beugte sich vor und senkte die Stimme. »Darf ich Ihnen was erzählen? Als Lindy und ich zum ersten Mal hierher nach Venedig kamen, waren wir in den Flitterwochen. Vor siebenundzwanzig Jahren. Und obwohl wir nur glückliche Erinnerungen an die Stadt haben, waren wir nie mehr hier, jedenfalls nicht gemeinsam. Und als wir diese Reise planten, diese für uns ganz besondere Reise, sagten wir uns, wir müssen unbedingt ein paar Tage in Venedig verbringen.«
»Ist es Ihr Hochzeitstag, Mr Gardner?«
»Hochzeitstag?« Er blickte erschrocken drein.
»Entschuldigung«, sagte ich. »Ich dachte nur – weil Sie sagten, es ist Ihre ganz besondere Reise.«
Er blickte noch eine Zeit lang erschrocken drein, dann lachte er, ein lautes, dröhnendes Lachen, und auf einmal fiel mir dieses eine Lied wieder ein, das meine Mutter ständig hörte; darin gibt es mittendrin eine gesprochene Passage, wo er sagt, es sei ihm egal, dass diese Frau ihn verlassen hat, und er stößt dieses sardonische Gelächter aus. Jetzt schallte dasselbe Gelächter über den Platz. Dann sagte er:
»Hochzeitstag? Nein, nein, es ist nicht unser Hochzeitstag. Aber was ich vorhabe, ist nicht so weit davon entfernt. Denn ich möchte was sehr Romantisches tun. Ich möchte ihr ein Ständchen bringen. Wie sich’s gehört, nach venezianischer Art. Und hier kommen Sie ins Spiel. Sie spielen auf Ihrer Gitarre, ich singe. Wir tun es von einer Gondel aus, wir lassen uns bis unters Fenster rudern, ich singe zu ihr hinauf. Wir haben ein Quartier in einem Palazzo nicht weit von hier. Das Schlafzimmerfenster geht auf den Kanal hinaus. Wenn es dunkel ist, wird das perfekt sein. Die Laternen an den Hausmauern erzeugen das passende Licht. Unten Sie und ich in einer Gondel, oben tritt sie ans Fenster. Alle ihre Lieblingslieder. Es muss nicht lang sein, abends ist es doch noch ein bisschen kühl. Nur drei oder vier Lieder, stelle ich mir vor. Ich entlohne Sie anständig. Was meinen Sie?«
»Mr Gardner, es wäre mir eine große Ehre. Wie ich schon sagte, Sie waren eine wichtige Person für mich. Wann würden Sie das gerne machen?«
»Warum nicht heute Abend, wenn’s nicht regnet? Gegen halb neun? Wir essen früh, und bis dahin sind wir wieder zurück. Ich denke mir irgendeinen Vorwand aus, um die Wohnung zu verlassen, und treffe mich mit Ihnen. Bis dahin habe ich eine Gondel bestellt, wir lassen uns durch den Kanal rudern, halten unter dem Fenster an. Das wird perfekt. Was meinen Sie?«
Sie können sich wahrscheinlich vorstellen, dass das wie ein Traum war, der Wirklichkeit wird. Außerdem hielt ich es für eine reizende Idee, dieses Paar – er in den Sechzigern, sie in den Fünfzigern -, das sich benimmt wie zwei verliebte Teenager. Tatsächlich war die Idee so reizend, dass sie mich die Szene, die ich vorhin miterlebt hatte, beinahe vergessen ließ. Aber nicht ganz. Ich meine, ich wusste schon zu diesem Zeitpunkt irgendwo tief drinnen, dass die Sache nicht so klar und einfach war, wie er sie darstellte.
Die nächsten Minuten saßen Mr Gardner und ich noch zusammen und besprachen die Details – welche Lieder er wollte, welche Tonarten er bevorzugte, solche Dinge. Dann war es Zeit für mich, ich musste zurück unter den Baldachin und zu unserem nächsten Set, also stand ich auf, gab ihm die Hand und sagte, er könne an diesem Abend voll und ganz auf mich zählen.
Die Gassen waren still und dunkel, als ich abends zu der Verabredung mit Mr Gardner ging. Damals war es noch so, dass ich mich ständig verlief, kaum hatte ich mich ein Stück von der Piazza San Marco entfernt, und obwohl ich mit wirklich viel Vorsprung losgegangen war und die kleine Brücke kannte, zu der mich Mr Gardner bestellt hatte, kam ich ein paar Minuten zu spät.
Er stand direkt unter einer Laterne. Er trug einen zerknitterten dunklen Anzug, das Hemd bis zum dritten oder vierten Knopf offen, sodass man seine Brustbehaarung sah. Als ich mich für die Verspätung entschuldigte, sagte er:
»Was sind ein paar Minuten? Lindy und ich sind seit siebenundzwanzig Jahren verheiratet. Was sind ein paar Minuten?«
Er war nicht verärgert, aber seine Stimmung schien mir ernst und feierlich – ganz und gar nicht romantisch. Hinter ihm schaukelte die Gondel sanft im Wasser, und ich sah, dass der Gondoliere Vittorio war, den ich nicht besonders gut leiden kann. Vordergründig tut Vittorio immer sehr kumpelhaft, aber ich weiß – wusste es schon damals -, dass er über unsereinen, über Leute, die er »Fremde aus den neuen Ländern« nennt, alle möglichen Gemeinheiten erzählt, und alles ist erstunken und erlogen. Deswegen nickte ich bloß, als er mich an dem Abend begrüßte wie einen Bruder, und wartete schweigend, während er Mr Gardner in die Gondel half. Dann reichte ich ihm meine Gitarre – ich hatte meine spanische Gitarre mitgebracht, nicht die mit dem ovalen Schallloch – und stieg ebenfalls ein.
Vorn im Boot wechselte Mr Gardner ständig die Position, und irgendwann setzte er sich so schwerfällig nieder, dass wir fast kenterten. Aber ihm fiel das anscheinend gar nicht auf, und als wir ablegten, starrte er immer nur ins Wasser.
Ein paar Minuten glitten wir schweigend an dunklen Häusern entlang, unter niedrigen Brücken hindurch. Irgendwann erwachte er aus seinen tiefen Gedanken und sagte:
»Hören Sie, mein Freund. Ich weiß, wir haben für heute Abend schon ein Programm vereinbart. Aber ich hab’s mir anders überlegt. Lindy liebt den Song ›By the Time I Get to Phoenix‹. Ich habe ihn vor vielen Jahren mal aufgenommen.«
»Klar, Mr Gardner. Meine Mutter sagte immer, dass Ihre Version besser ist als die von Sinatra. Oder diese berühmte von Glenn Campbell.«
Mr Gardner nickte, und eine Zeit lang konnte ich sein Gesicht nicht sehen. Bevor uns Vittorio um eine Ecke steuerte, stieß er seinen Gondoliereruf aus, der um die Mauern scholl.
»Ich habe ihn ihr oft vorgesungen«, sagte Mr Gardner. »Wissen Sie, ich glaube, sie würde ihn heute Abend gern hören. Sind Sie vertraut mit der Melodie?«
Ich hatte inzwischen meine Gitarre ausgepackt, und ich spielte ein paar Takte des Lieds.
»Ein bisschen höher«, sagte er. »In Es. So habe ich es auf dem Album gesungen.«
Ich wechselte also die Tonart, und nach etwa einer Strophe setzte Mr Gardner ein, er sang sehr leise, fast gehaucht, als wüsste er den Text nur noch halb. Aber in diesem stillen Kanal trug seine Stimme weit. Sie klang sogar sehr schön. Und einen Moment lang war mir, als wäre ich wieder ein Kind und in unserer damaligen Wohnung: ich auf dem Teppich, meine Mutter auf dem Sofa, erschöpft, vielleicht auch mit gebrochenem Herzen, während in der Zimmerecke Tony Gardners Platte lief.
Mr Gardner brach jäh ab und sagte: »Okay. Wir machen ›Phoenix‹ in Es. Dann vielleicht ›I Fall in Love too Easily‹, wie geplant. Und wir schließen mit ›One for My Baby‹. Das ist genug. Mehr wird sie nicht hören wollen.«
Danach schien er wieder in Gedanken zu versinken, und wir glitten zum leisen Plätschern von Vittorios Ruder durch die Dunkelheit.
»Mr Gardner«, sagte ich schließlich, »hoffentlich nehmen Sie mir die Frage nicht übel. Aber erwartet Mrs Gardner dieses Konzert? Oder soll es eine wunderbare Überraschung werden?«
Er seufzte tief, dann sagte er: »Ich schätze, wir müssen es in die Kategorie wunderbare Überraschung einordnen.« Und er fügte hinzu: »Der Himmel weiß, wie sie reagiert. Vielleicht kommen wir gar nicht bis ›One for My Baby‹.«
Vittorio steuerte uns um eine weitere Ecke, auf einmal ertönten Gelächter und Musik, und wir glitten an einem großen, hell erleuchteten Restaurant vorbei. Sämtliche Tische schienen besetzt, die Kellner wuselten herum, alle Gäste wirkten froh und glücklich, obwohl es um diese Jahreszeit so nah am Kanal nicht besonders warm gewesen sein dürfte. Nach der Stille und Dunkelheit, durch die wir gefahren waren, fand ich dieses Restaurant irgendwie beunruhigend. Es war, als wären wir die Bewegungslosen und sähen vom Kai aus dieses glitzernde Partyschiff vorbeifahren. Ein paar Gesichter blickten zu uns her, aber niemand schenkte uns besondere Aufmerksamkeit. Dann lag das Restaurant hinter uns, und ich sagte:
»Das ist doch komisch. Können Sie sich vorstellen, was diese Touristen tun würden, wenn sie wüssten, dass gerade eine Gondel mit dem legendären Tony Gardner an ihnen vorbeigefahren ist?«
Vittorio, der nicht viel Englisch versteht, kapierte immerhin, wovon ich sprach, und lachte kurz auf. Aber Mr Gardner rührte sich eine ganze Weile nicht. Ringsum war es wieder dunkel, wir fuhren in einem engen Kanal an spärlich beleuchteten Hauseingängen vorbei, und er sagte plötzlich:
»Mein Freund, Sie kommen aus einem kommunistischen Land. Deswegen ist Ihnen nicht klar, wie das alles funktioniert.«
»Mr Gardner«, sagte ich, »mein Land ist nicht mehr kommunistisch. Wir sind jetzt freie Menschen.«
»Entschuldigen Sie. Ich wollte nicht Ihre Nation verunglimpfen. Sie sind ein tapferes Volk. Ich hoffe, Sie erlangen alle Frieden und Wohlstand. Aber was ich Ihnen sagen wollte, mein Freund. Ich meine, dass Sie aufgrund Ihrer Herkunft vieles noch nicht begreifen können. Was ganz normal ist. Genauso wie ich in Ihrem Land vieles nicht begreifen würde.«
»Das wird wohl so sein, Mr Gardner.«
»Diese Leute, an denen wir vorbeigefahren sind. Hätten Sie sich vor sie hingestellt und gefragt: ›Hallo, erinnert sich noch jemand an Tony Gardner?‹, dann hätten wohl manche, vielleicht sogar die meisten Ja gesagt. Wer weiß? Aber wenn wir wie jetzt eben an ihnen vorbeifahren, wäre irgendwer, selbst wenn er mich erkannt hätte, in Begeisterung ausgebrochen? Das glaube ich nicht. Die Leute würden nicht die Gabel aus der Hand legen, sie würden nicht ihre Kerzenscheinromantik unterbrechen. Warum auch? Ist doch nur irgendein Schnulzensänger aus einer längst vergangenen Zeit.«
»Das kann ich nicht glauben, Mr Gardner. Sie sind ein Klassiker. Sie sind wie Sinatra oder Dean Martin. Manche Spitzenkünstler kommen nie aus der Mode. Anders als diese Popsternchen.«
»Das ist sehr nett von Ihnen, mein Freund. Sie meinen es gut, ich weiß. Aber gerade heute Abend ist nicht der richtige Zeitpunkt, um Späße mit mir zu machen.«
Ich wollte schon protestieren, aber es war etwas an seinem Verhalten, das mir riet, das Thema insgesamt fallen zu lassen. So fuhren wir weiter, niemand sprach. Um ehrlich zu sein, begann ich mich zu fragen, worauf ich mich da eingelassen hatte, was diese ganze Serenadengeschichte bedeuten sollte. Die beiden waren schließlich Amerikaner. Wahrscheinlich würde Mrs Gardner, sobald er unten zu singen anfing, mit einer Knarre ans Fenster kommen und auf uns schießen.
Vielleicht bewegten sich Vittorios Gedanken in die gleiche Richtung, denn als wir unter einer Laterne an einer Hausmauer vorbeikamen, warf er mir einen Blick zu, der besagte: »Schräger Vogel, wie, amico?« Aber ich reagierte nicht. Undenkbar, dass ich mich mit einem von seinem Schlag gegen Mr Gardner stellte. Vittorio behauptet, dass Ausländer wie ich die Touristen abzocken, Müll in die Kanäle kippen und überhaupt die ganze verdammte Stadt ruinieren. An manchen Tagen, wenn er mies gelaunt ist, stellt er uns als Straßenräuber hin – als Vergewaltiger sogar. Einmal fragte ich rundheraus, ob es stimmt, dass er solche Sachen herumerzählt, und er schwor, das sei alles total gelogen. Er sei doch kein Rassist, wie denn auch mit seiner jüdischen Tante, die er wie eine Mutter verehrt? Aber einmal, als ich nachmittags Pause hatte, lehnte ich in Dorsoduro an einer Brücke und vertrieb mir die Zeit. Unter mir fuhr eine Gondel vorbei. Drei Touristen saßen darin, und Vittorio stand mit seinem Ruder hinter ihnen und verbreitete genau diesen Blödsinn, sodass alle Welt es hören konnte. Also, er kann meinen Blick suchen, so viel er will, mich macht er nicht zu seinem Komplizen.
»Lassen Sie mich Ihnen ein kleines Geheimnis verraten«, sagte Mr Gardner plötzlich. »Ein kleines Geheimnis über den Auftritt vor Publikum. Unter uns Profis. Es ist ganz einfach: Sie müssen etwas wissen – egal, was, aber irgendetwas müssen Sie über Ihr Publikum wissen. Etwas, was für Sie, in Ihrem Kopf, dieses Publikum von einem anderen unterscheidet, vor dem Sie tags zuvor aufgetreten sind. Sagen wir, Sie sind in Milwaukee. Jetzt müssen Sie sich fragen, was ist anders, was ist besonders am Publikum von Milwaukee? Was unterscheidet es von einem Publikum in Madison? Es fällt Ihnen nichts ein, aber Sie müssen es einfach weiter versuchen, bis Ihnen eine Idee kommt. Milwaukee, Milwaukee. Gute Schweinekoteletts machen sie in Milwaukee. Das wird gehen, das verwenden Sie, wenn Sie auf die Bühne rausgehen. Sie brauchen kein Wort darüber zu verlieren, Sie haben es einfach im Kopf, wenn Sie vor ihnen singen. Die Leute vor Ihnen, das sind diejenigen, die gute Schweinekoteletts essen. In puncto Schweinekoteletts setzen sie Maßstäbe. Verstehen Sie, was ich meine? Auf diese Weise wird das Publikum zu Menschen, die Sie kennen, vor denen Sie auftreten können. Sehen Sie, das ist mein Geheimnis. Unter uns Profis.«
»Danke, Mr Gardner. So hätte ich das nie gesehen. Ein Tipp von jemandem wie Ihnen, das vergess ich nie.«
»Heute Abend«, fuhr er fort, »treten wir vor Lindy auf. Das Publikum ist Lindy. Also werde ich Ihnen etwas über Lindy erzählen. Wollen Sie was über Lindy wissen?«
»Natürlich, Mr Gardner«, sagte ich. »Sehr gern möchte ich was über sie wissen.«
Während der nächsten gut zwanzig Minuten saßen wir in der Gondel und drehten Runde um Runde, während Mr Gardner redete. Manchmal senkte sich seine Stimme zu einem Murmeln, als führte er Selbstgespräche. Dann wieder, wenn eine Laterne oder ein vorbeiziehendes Fenster einen Lichtschein ins Boot warf, erinnerte er sich an mich, hob wieder die Stimme, machte einen Einwurf wie: »Verstehen Sie, was ich meine, mein Freund?«
Seine Frau, erzählte er, stamme aus einer Kleinstadt in Minnesota, in der Mitte Amerikas, wo die Lehrerinnen sie ordentlich piesackten, weil sie sich, statt zu lernen, lieber Zeitschriften mit Filmstars ansah.
»Eines ging diesen Damen nie auf, nämlich dass Lindy große Pläne hatte. Und sehen Sie sie jetzt an. Reich, schön, ist in der ganzen Welt herumgekommen. Und diese Lehrerinnen, wo sind sie heute? Was für ein Leben hatten sie? Hätten sie sich ein bisschen öfter Filmzeitschriften angesehen, hätten sie ein bisschen mehr geträumt, hätten vielleicht auch sie manches von dem, was Lindy heute hat.«
Mit neunzehn trampte sie nach Kalifornien, denn sie wollte nach Hollywood. Stattdessen landete sie in einem Vorort von Los Angeles als Kellnerin in einer Raststätte.
»Seltsame Sache«, sagte Mr Gardner. »Dieses Lokal, dieses ganz normale kleine Diner am Highway. Es stellte sich raus, dass sie an keinen besseren Ort hätte geraten können. Denn hierher kamen, von morgens bis abends, alle ehrgeizigen Mädchen. Sie trafen sich hier, zu siebt, zu acht, zu zehnt, bestellten ihren Kaffee, ihren Hotdog, saßen stundenlang zusammen und redeten.«
Diese Mädchen, alle ein bisschen älter als Lindy, kamen aus allen Teilen Amerikas und lebten seit mindestens zwei, drei Jahren in der Umgebung von L.A. Sie kamen in das Diner, um Klatsch und Leidensgeschichten auszutauschen, Taktiken zu besprechen, die Erfolge der anderen im Auge zu behalten. Aber der Hauptmagnet des Lokals, das war Meg, eine Frau in den Vierzigern, Lindys Kollegin.
»Für diese Mädchen war Meg die große Schwester, ihre Quelle der Weisheit. Denn einst, vor langer Zeit, war sie ganz genauso gewesen wie sie. Es waren Mädchen, die es ernst meinten, müssen Sie wissen, wirklich entschlossen und voller Ambitionen. Redeten sie über Klamotten und Schuhe und Make-up wie andere Mädchen? Klar. Aber sie redeten nur darüber, welche Klamotten und Schuhe und welches Make-up hilfreich waren, um sich einen Star zu angeln. Redeten sie über Filme? Redeten sie über die Musikszene? Darauf können Sie wetten. Aber sie redeten darüber, welche Filmstars und welche Sänger Junggesellen waren und welche unglücklich verheiratet, welche eine Scheidung vor sich hatten. Und Meg, verstehen Sie, sie konnte ihnen das alles sagen und noch viel, viel mehr. Meg war diesen Weg vor ihnen gegangen. Wenn es darum ging, einen Star zu heiraten, kannte sie alle Regeln, alle Tricks. Und Lindy saß dabei und ließ alles auf sich wirken. Dieses kleine Hot-Dog-Lokal war ihr Harvard, ihr Yale. Eine Neunzehnjährige aus Minnesota? Ich schaudere, wenn ich mir vorstelle, was ihr alles hätte zustoßen können. Aber sie hatte Glück.«
»Mr Gardner«, sagte ich, »entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche. Aber wieso war diese Meg, wenn sie sich doch in allem so gut auskannte, nicht selber mit einem Star verheiratet? Warum servierte sie Hotdogs in diesem Lokal?«
»Gute Frage, aber Sie verstehen nicht ganz, wie so was funktioniert. Okay, diese Dame, Meg, sie selber hatte Pech. Aber Tatsache ist, dass sie diejenigen beobachtet hatte, die es geschafft hatten. Sie war einmal genauso gewesen wie diese Mädchen, und sie hatte zugesehen, wie die einen es schafften, die anderen scheiterten. Sie hatte die Fallgruben gesehen und die goldenen Treppen. Sie konnte ihnen alle Geschichten erzählen, und die Mädchen waren ganz Ohr. Und manche lernten daraus. Lindy zum Beispiel. Wie gesagt, es war ihr Harvard. Es hat sie zu dem gemacht, was sie ist. Es gab ihr die Kraft, die sie später brauchte, und Mann, sie brauchte sie wirklich. Sechs Jahre dauerte es, bis sie ihren ersten Durchbruch hatte. Können Sie sich das vorstellen? Sechs Jahre manövrieren, planen, sich in die Schusslinie begeben. Immer und immer wieder Rückschläge hinnehmen. Aber es ist genauso wie in unserem Geschäft. Du kannst dich nicht nach den ersten paar Schlägen auf die Seite drehen und aufgeben. Die Mädchen, die aufgeben, die treffen Sie überall, das sind die Ehefrauen nichtssagender Männer, in nichtssagenden Städten. Aber nur wenige, Mädchen wie Lindy, lernen aus jedem Rückschlag und kommen stärker und zäher zurück in den Ring, kämpferisch und wild sind sie wieder da. Glauben Sie, Lindy musste keine Demütigungen hinnehmen? Trotz ihrer Schönheit und ihres Charmes? Den Leuten ist nicht klar, dass Aussehen nicht mal die halbe Miete ist. Setz es falsch ein, und du wirst behandelt wie eine Nutte. Jedenfalls hatte sie nach sechs Jahren endlich ihren Durchbruch.«
»Da hat sie Sie kennengelernt, Mr Gardner?«
»Mich? Nein, nein. Ich tauchte noch eine ganze Weile nicht auf. Sie heiratete Dino Hartman. Haben Sie nie von Dino gehört?« An dieser Stelle stieß Mr Gardner ein leicht hämisches Lachen aus. »Der arme Dino. Ich schätze, Dino hat es nie bis in den Ostblock geschafft. Aber er hatte damals durchaus einen Namen. Er sang viel in Vegas, bekam ein paar goldene Schallplatten. Wie gesagt, das war Lindys großer Durchbruch. Als ich sie kennenlernte, war sie Dinos Frau. So läuft es immer, hatte die alte Meg gesagt. Klar kann ein Mädchen schon beim ersten Mal Glück haben und gleich ganz nach oben kommen, einen Sinatra heiraten oder einen Brando. Aber meistens läuft es nicht so. Sie muss damit rechnen, dass sie erst mal im zweiten Stock aussteigt, sich umschaut. Sie muss sich an die Luft dort gewöhnen. Eines Tages trifft sie in diesem zweiten Stock vielleicht mit jemandem zusammen, der nur für ein paar Minuten aus dem Penthouse heruntergekommen ist, vielleicht um was zu holen. Und dieser Typ sagt zu ihr, hey, wie wär’s, wenn du mich nach oben begleitest, hast du Lust? Lindy wusste, dass es normalerweise so läuft. Es war nicht so, dass sie Dino heiratete, weil sie’s satthatte oder weil sie ihre Ambitionen heruntergeschraubt hätte. Und Dino war ein anständiger Kerl. Ich hab ihn immer gemocht. Und deshalb habe ich keinen Finger gerührt, obwohl es mich ganz schön erwischte, kaum hatte ich Lindy zum ersten Mal gesehen. Ich verhielt mich aber wie der perfekte Gentleman. Später erfuhr ich, dass sich Lindy davon erst recht angestachelt fühlte. Mann, ein Mädchen wie sie kann man nur bewundern! Ich sag Ihnen, mein Freund, ich war ein sehr, sehr heller Stern damals. Ich schätze, das war um die Zeit, als Ihre Mutter mich gehört hat. Dinos Stern hingegen ging ziemlich schnell wieder unter. Für viele Sänger wurde es genau in dieser Zeit hart. Alles veränderte sich. Die Jugend hörte die Beatles, die Rolling Stones. Der arme Dino – er klang zu sehr nach Bing Crosby. Er versuchte es mit einem Bossa-Nova-Album, über das die Leute nur lachten. Für Lindy eindeutig Zeit für den Absprung. Niemand hätte uns in dieser Situation irgendwas vorwerfen können. Ich glaube, nicht mal Dino war uns ernsthaft böse. Also machte ich meinen Zug. So kam sie rauf ins Penthouse.
Wir heirateten in Vegas, wo wir uns vom Hotel die Badewanne mit Champagner füllen ließen. Das Lied, das wir heute Abend vortragen, ›I Fall in Love too Easily‹: Wissen Sie, warum ich das ausgesucht habe? Wollen Sie’s wissen? Einmal waren wir in London, nicht lang nach unserer Hochzeit war das. Nach dem Frühstück kamen wir in unsere Suite zurück, und das Zimmermädchen ist drin und räumt auf. Aber Lindy und ich sind scharf wie die Karnickel. Wir gehen also rein, und wir hören das Mädchen unseren Salon saugen, aber wir sehen sie nicht, sie ist jenseits der Trennwand. Also schleichen wir auf Zehenspitzen durch, wie die Kinder, verstehen Sie? Wir schleichen ins Schlafzimmer, schließen die Tür. Wir sehen, dass das Mädchen das Schlafzimmer schon gemacht hat und vielleicht nicht mehr reinkommt, aber sicher können wir nicht sein. So oder so ist es uns egal. Wir reißen uns die Kleider vom Leib, wir schlafen miteinander, und während der ganzen Zeit ist das Mädchen auf der anderen Seite, geht in unserer Suite herum und hat keine Ahnung, dass wir hier sind. Ich sag Ihnen, wir waren total scharf, aber nach einer Weile fanden wir das Ganze so komisch, dass wir einfach nur noch lachten. Dann waren wir fertig und lagen eng umschlungen da, und das Mädchen war immer noch im Nebenraum, und wissen Sie was? Sie fängt zu singen an! Sie ist mit dem Staubsaugen fertig und fängt zu singen an, lauthals, und Mann, sie sang wirklich beschissen. Wir kringelten uns vor Lachen, versuchten aber möglichst still zu sein. Dann, was glauben Sie, hört sie mit dem Singen auf und schaltet das Radio ein. Und auf einmal hören wir Chet Baker. Er singt ›I Fall in Love too Easily‹, schön, langsam, samtig. Und Lindy und ich, wir lagen einfach zusammen auf dem Bett und hörten Chet singen. Und nach einer Weile singe ich mit, ganz leise, singe mit Chet Baker im Radio mit, und Lindy kuschelt sich in meine Arme. So war das. Deswegen machen wir heute Abend diesen Song. Ich weiß allerdings nicht, ob sie sich noch erinnert. Wer weiß das schon?«
Mr Gardner verstummte, und ich sah, wie er sich Tränen abwischte. Vittorio bog wieder um eine Ecke, und ich merkte, dass wir zum zweiten Mal an dem Restaurant vorbeikamen. Es schien dort jetzt noch lebhafter zuzugehen als vorher, und ein Pianist – Andrea heißt der Typ, das weiß ich – spielte in einer Ecke.
Als wir wieder in die Dunkelheit davonglitten, sagte ich: »Mr Gardner, es geht mich wirklich nichts an. Aber ich sehe, dass es vielleicht in letzter Zeit zwischen Ihnen und Mrs Gardner nicht so gut läuft. Ich möchte Ihnen sagen, dass ich von solchen Dingen durchaus was verstehe. Meine Mutter wurde oft traurig, vielleicht genau so, wie Sie es jetzt sind. Immer wieder dachte sie, sie hätte jemanden gefunden, war selig und sagte zu mir, der Mann würde mein neuer Pa. Die ersten paar Mal nahm ich sie noch ernst. Dann wusste ich schon, dass es wieder nicht klappen würde. Meine Mutter aber hörte nie auf, dran zu glauben. Und jedes Mal, wenn Sie seelisch wieder im Keller war, vielleicht so wie Sie heute Abend, wissen Sie, was sie dann tat? Sie legte eine Platte von Ihnen auf und sang mit. In diesen vielen langen Wintern in unserer winzigen Wohnung saß sie da, die Knie angezogen, ein Glas mit irgendwas in der Hand und sang leise mit. Und manchmal, das weiß ich noch, Mr Gardner, hämmerte der Nachbar von oben an die Decke, vor allem, wenn Sie diese lauten, schnellen Nummern sangen, ›High Hopes‹ zum Beispiel oder ›They All Laughed‹. Dann beobachtete ich meine Mutter immer sehr genau, aber es war wirklich so, als hätte sie nichts davon mitgekriegt, sie hörte nur Sie, nickte mit dem Kopf im Takt, und ihre Lippen bewegten sich zum Text. Mr Gardner, ich möchte Ihnen eines sagen: Ihre Musik half meiner Mutter durch die schweren Zeiten, und sie muss auch Millionen anderen Menschen geholfen haben. Und es ist nur recht und billig, dass sie auch Ihnen hilft.« Ich lachte kurz auf, es war aufmunternd gemeint, aber es kam lauter heraus als beabsichtigt. »Sie können auf mich zählen, Mr Gardner, ich werde alles geben, was ich kann. Ich mach es so gut wie jedes Orchester, Sie werden sehen. Und Mrs Gardner wird uns hören, und wer weiß? Vielleicht wird zwischen Ihnen beiden alles wieder gut. Jedes Paar durchlebt schwierige Zeiten.«
Mr Gardner lächelte. »Sie sind ein lieber Junge. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie mir heute Abend beispringen. Aber jetzt ist keine Zeit mehr zum Reden. Lindy ist in ihrem Zimmer. Ich sehe, dass das Licht brennt.«