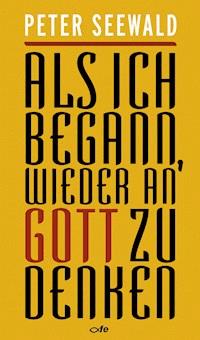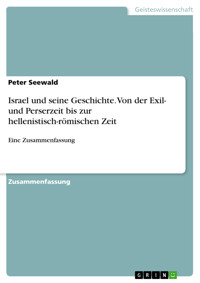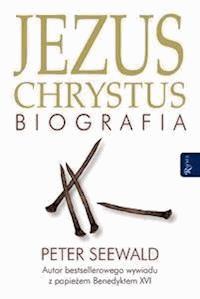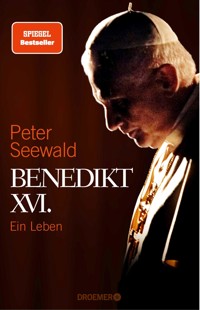
29,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 29,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Peter Seewald "gilt als einer der besten Kenner von Papst Benedikt XVI.", stellte die Wochenzeitung Die Zeit fest. Nun legt Peter Seewald die lang erwartete große Biographie des emeritierten Papstes Joseph Ratzinger vor. Er zeichnet den Werdegang des späteren Papstes Benedikt XVI. von dessen Geburt in Marktl am Inn bis zu seinem Rücktritt vom Amt des Papstes nach. Mehr als ein halbes Jahrhundert stand "der deutsche Papst" im Licht der Öffentlichkeit: - als Theologie-Professor in Münster, Bonn, Tübingen und Regensburg, - als Konzilstheologe und Redenschreiber für Kardinal Frings auf dem II. Vatikanischen Konzil, - als Erzbischof von München, - als Vorsitzender der Glaubenskongregation in Rom - und schließlich als Papst Benedikt XVI. Er hat den Aufbruch der Katholischen Kirche in Rom vor Ort mitgestaltet; er hat als Professor in Tübingen die Studentenunruhen um 1968 herum erlebt; er war mehr als 20 Jahre lang einer der engsten Vertrauten von Papst Johannes Paul II. und in dieser Stellung Zeuge der politischen Umwälzungen in Osteuropa; und er hat 2013 mit seinem Rücktritt ein Zeichen gesetzt, das das Amt des Papstes ein für alle Mal verändert hat. Kurzum: Joseph Ratzinger ist eine Person der Zeitgeschichte. Dass er als Deutscher zum Papst gewählt wurde, war ein Jahrhundertereignis. Kein Journalist oder Autor kennt Joseph Ratzinger besser als Peter Seewald. Er hat für dieses Buch viele Stunden lang mit Joseph Ratzinger gesprochen und konnte aus einem reichen Fundus von Aufzeichnungen schöpfen aus der gemeinsamen Arbeit mit Joseph Ratzinger/Benedikt XVI. an insgesamt vier Gesprächsbüchern, die allesamt internationale Bestseller waren. Peter Seewald konnte für diese Biographie auch mit engen Weggefährten wie Georg Gänswein und dem Bruder Georg Ratzinger sprechen. Auf diese Weise entstand das lebendige Bild eines streitbaren Theologen und Dieners der römisch-katholischen Kirche, das Joseph Ratzinger in einem neuen Licht zeigt und Maßstäbe setzt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1938
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Peter Seewald
Benedikt XVI.
Ein Leben
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Als Joseph Kardinal Ratzinger im April 2005 zum Papst gewählt wird, ist dies ein Jahrhundertereignis: ein Deutscher auf dem Stuhl Petri. Für den Gewählten ist es der Höhepunkt einer unvergleichlichen Karriere. Als Professor, als Erzbischof, als Leiter der Glaubenskongregation und schließlich als Papst Benedikt XVI. steht Joseph Ratzinger mehr als fünf Jahrzehnte lang im Blickpunkt der Öffentlichkeit – ein Jahrhundertleben, das die Dramatik und die Brüche des 20. und 21. Jahrhunderts widerspiegelt.
Peter Seewald begleitet ihn seit über 25 Jahren als Journalist und Buchautor. Er verfügt über das Insiderwissen, das Detailgenauigkeit und ein sicheres Urteil erlaubt. So gelingt es Peter Seewald, ein lebendiges Bild des emeritierten Papstes zu zeichnen, das den Menschen Joseph Ratzinger auf eine neue Weise zeigt.
Inhaltsübersicht
Motto
Vorwort
Teil I: Der Junge
Kapitel 1: Karsamstag
Kapitel 2: Das Hindernis
Kapitel 3: Das Traumland
Kapitel 4: 1933, »Heiliges Jahr«
Kapitel 5: Die »Deutschen Christen«
Kapitel 6: Mit brennender Sorge
Kapitel 7: Die Ruhe vor dem Sturm
Kapitel 8: Das Seminar
Kapitel 9: Krieg
Kapitel 10: Widerstand
Kapitel 11: Das Ende
Teil II: Der Meisterschüler
Kapitel 12: Die Stunde null
Kapitel 13: Der Berg der Gelehrten
Kapitel 14: Schuld und Sühne
Kapitel 15: Umbruch des Denkens
Kapitel 16: Das Glasperlenspiel
Kapitel 17: Augustinus
Kapitel 18: Sturm und Drang
Kapitel 19: Die Schlüssellektüre
Kapitel 20: Die höheren Weihen
Kapitel 21: Der Kaplan
Kapitel 22: Die Prüfung
Kapitel 23: Am Abgrund
Kapitel 24: Die neuen Heiden und die Kirche
Teil III: Konzil
Kapitel 25: Ein Star wird geboren
Kapitel 26: Das Netzwerk
Kapitel 27: Konzil
Kapitel 28: Der Kampf beginnt
Kapitel 29: Die Rede von Genua
Kapitel 30: Der Spindoktor
Kapitel 31: Welt auf der Kippe
Kapitel 32: Sieben Tage, die die katholische Kirche für immer verändern
Kapitel 33: Deutsche Welle
Kapitel 34: Kraftquellen
Kapitel 35: In der Schule des Heiligen Geistes
Kapitel 36: Das Erbe
Teil IV: Der Lehrer
Kapitel 37: Tübingen
Kapitel 38: Tief erschrocken
Kapitel 39: 1968 und die Legende von der Wende
Kapitel 40: Die katholische Krise
Kapitel 41: Neustart
Kapitel 42: Spannungen
Kapitel 43: Die Vision von der Kirche der Zukunft
Kapitel 44: Reconquista
Kapitel 45: Die Lehre vom ewigen Leben
Kapitel 46: Das Amt
Kapitel 47: Das Jahr der drei Päpste
Kapitel 48: Der Fall Küng
Kapitel 49: Das Vermächtnis von München
Teil V: Rom
Kapitel 50: Der Präfekt
Kapitel 51: Ratzingers Report
Kapitel 52: Kampf um die Befreiungstheologie
Kapitel 53: Teamarbeit
Kapitel 54: Der Zusammenbruch
Kapitel 55: Das lange Leiden des Karol Wojtyla
Kapitel 56: Millennium
Kapitel 57: Agonie
Kapitel 58: Konklave
Kapitel 59: Habemus Papam
Teil VI: Pontifex
Kapitel 60: Der erste Papst des dritten Jahrtausends
Kapitel 61: In den Schuhen des Fischers
Kapitel 62: Das Benedetto-Fieber
Kapitel 63: Die Rede von Regensburg
Kapitel 64: Deus caritas est
Kapitel 65: Salz der Erde, Licht der Welt
Kapitel 66: Der Bruch
Kapitel 67: Die »Kondom-Krise«
Kapitel 68: Der Skandal des Missbrauchs
Kapitel 69: Der Hirte
Kapitel 70: Die Ökologie des Menschen
Kapitel 71: Entweltlichung
Kapitel 72: Der Verrat
Kapitel 73: Der Rücktritt
Kapitel 74: Der Beginn einer neuen Ära
Epilog: Papa emeritus
Letzte Fragen an Benedikt XVI.
»Mein Grundimpuls war, unter den Verkrustungen
den eigentlichen Glaubenskern freizulegen
und diesem Kern Kraft und Dynamik zu geben.
Dieser Impuls ist die Konstante meines Lebens.«
Joseph Ratzinger
Vorwort
Es war ein nasskalter Tag im November 1992, als ich meinen ersten »Termin« bei Joseph Ratzinger hatte. Es ging um ein Porträt für das Magazin der Süddeutschen Zeitung, und ich war überrascht, mit welcher Offenheit der »Großinquisitor« auf seinen Besucher einging.
Im Laufe der folgenden Jahre habe ich dem Kardinal, dem Papst, dem Emeritus wohl an die zweitausend Fragen gestellt, vielleicht auch mehr. Bei den allerletzten zögerte er. Eine Beantwortung, so sein Kommentar, würde »unweigerlich eine Einmischung in das Wirken des jetzigen Papstes darstellen. Alles, was in diese Richtung ginge, musste ich und will ich vermeiden«.
Nein, ein Schatten-, Neben- oder gar Gegenpapst ist der emeritierte Benedikt XVI. nie geworden. Er war im Gegenteil peinlich darauf bedacht, seinem Nachfolger nirgendwo in die Quere zu kommen. Ein Schweige-Gelöbnis hat er im Übrigen nie abgelegt. Seine letzten Worte als amtierender Pontifex in Castel Gandolfo unterstrichen: »Ab 20 Uhr bin ich nicht mehr Papst, nicht mehr oberster Hirte der katholischen Kirche … Aber ich möchte weiterhin, mit meinem Herzen, mit meiner Liebe, mit meinem Gebet, mit meinem Denken, mit allen meinen geistigen Kräften für das allgemeine Wohl, für das Wohl der Kirche und der Menschheit weiterarbeiten.«
Was für ein Weg: Ein Bub aus einem bayerischen Dorf am Rande der Alpen wird das Oberhaupt der ältesten, größten und geheimnisvollsten Institution der Welt, der katholischen Kirche mit ihren 1,3 Milliarden Mitgliedern! Mit ihm nahm nach 500 Jahren erstmals wieder ein Deutscher auf dem Stuhl Petri Platz, ein Theologe, dessen kirchliches und wissenschaftliches Werk bereits groß und bedeutend war. Joseph Ratzinger hat Geschichte geschrieben. Als »Greenhorn« des Konzils, als Erneuerer der Theologie, als Präfekt, der an der Seite Karol Wojtylas im Sturm der Zeit das Schiff Kirche auf Kurs hielt. Und noch einmal als der erste regierende Papst überhaupt, der aus Altersgründen von seinem Amt zurücktrat. Niemals zuvor gab es einen »Papa emeritus«. Niemals zuvor hat ein einzelner Mensch das Papsttum von einem Tag auf den anderen so verändert wie dieser.
Die Welt ist zutiefst gespalten, wenn es darum geht, Benedikt XVI. zu verstehen und einzuordnen. Er gilt als einer der klügsten Denker unserer Zeit, gleichzeitig blieb er eine Reizfigur. Ein Unbequemer, der seine Gegner auf die Palme bringt. Sobald die Rede auf Ratzinger komme, merkte der französische Philosoph Bernard-Henri Lévy an, beherrschten »Vorurteile, Unaufrichtigkeit und sogar die glatte Desinformation jede Diskussion«. Die österreichische Medienexpertin Dr. Friederike Glavanovics analysierte in einer wissenschaftlichen Untersuchung, im Umgang mit Joseph Ratzinger sei die Tendenz mancher Journalisten auffällig, negative Nachrichten geradezu zwanghaft in einen noch negativeren Kontext einzubetten. Es sei ein Image konstruiert worden, »das nicht auf Wirklichkeit, sondern nur auf Viabilität verpflichtet ist«, auf ein fiktives Bild, das einem bestimmten Zweck dienen sollte.
Wer ist dieser Mann wirklich? Was ist seine Botschaft? Gab es tatsächlich ein »Trauma von 1968«, das ihn vom progressiven Theologen zum reaktionären Bremser wandelte? War er der »Panzerkardinal«, als der er hingestellt wurde? Hat er im Missbrauchsskandal vertuscht und geschwiegen? War sein Pontifikat ein einziges Scheitern, wie seine Gegner nicht müde werden zu behaupten? Benedikt XVI. Ein Leben geht auf Spurensuche nach der Herkunft, der Persönlichkeit, den dramatischen Wechselfällen im Leben des deutschen Papstes und kommt nicht zuletzt durch die Rekonstruktion von Brüchen wie der Williamson- und der Vatileaks-Affäre zu überraschenden Ergebnissen. Für Fehler, die auch bei gewissenhaftester Prüfung nicht ganz auszuschließen sind, bitte ich um Entschuldigung. Verständnis erhoffe ich für den so nicht geplanten Umfang dieses Werks, der dem Stoff und der Bedeutung des Protagonisten geschuldet ist. Gegebenenfalls empfiehlt sich ein großzügiges Umblättern. Wichtig war, kritische Distanz zu wahren – und dennoch mit jener Unvoreingenommenheit an die Betrachtung zu gehen, ohne die ein echtes Verständnis nicht möglich ist.
Kein Buch kann ohne Mithilfe entstehen, erst recht keine Biografie über ein Jahrhundertleben, das vom Ende der Weimarer Republik bis ins digitale Zeitalter reicht. Mein Dank gilt den rund einhundert Zeitzeugen, die sich für Interviews zur Verfügung stellten. Dazu all den Kollegen und Freunden, die mit Rat und Tat und nicht zuletzt mit ihren Gebeten diese Arbeit begleitet haben. Großes Verdienst haben der Papstbruder Georg Ratzinger für Details aus der Familiengeschichte und der Theologe Dr. Manuel Schlögl, der Gespräche mit Wegbegleitern übernahm und bereit war, das Manuskript durchzusehen. Tanja Pilger hat mit Bravour Berge von Büchern und anderen Materialien exzerpiert. Martina Wendl und meinem Sohn Jakob danke ich für die Transkription der Tonbandaufzeichnungen. Mein Lektor, »Adlerauge« Johannes Lankes, war ein gewissenhafter Korrektor und brachte nicht nur sein katholisches Fachwissen, sondern auch mentale Unterstützung ein. Jürgen Bolz, der Lektor beim Verlag, hat über Jahre hinweg meine Bücher betreut und auch bei diesem Werk mit Gelassenheit Regie geführt. Der frühere Droemer-Verleger Hans-Peter Übleis hat das Buch angestoßen, Margit Ketterle hat trotz diverser Unterbrechungen daran festgehalten, Kerstin Schuster hat dafür gesorgt, dass es in den Sprachen der Welt erscheinen kann. Meiner Frau und meiner Familie danke ich für den beruhigenden Rückhalt, der sich gerade auch in jenen Stunden bewies, in denen der Autor über der Menge an Stoff und die eigene Ungenügsamkeit schier verzweifelte.
Erzbischof Georg Gänswein schulde ich Dank dafür, das Projekt von Anfang an unterstützt und mit beeindruckendem Freimut Zusammenhänge beleuchtet zu haben. Mein besonderer Dank gilt, wem sonst, Papst Benedikt. Er hat mir mit Engelsgeduld über die Jahre hinweg selbst die abwegigsten Fragen beantwortet. Wahrscheinlich war er der einzige regierende Pontifex, der sogar Ansagen für einen Anrufbeantworter auf Band sprach, wie er es für meine Söhne machte. Besonders in Erinnerung ist mir der Sommer 2012. Ich besuchte den Pontifex in Castel Gandolfo. Der Papst war in einem fürchterlichen Zustand. Er schien nicht nur erschöpft, sondern auch auf eine seltsame Art niedergeschlagen. Erst im Nachhinein wurde mir klar, dass er in diesen Wochen um die Entscheidung rang, die das Papsttum für immer verändern sollte.
Als Papst der Zeitenwende ist Benedikt XVI. sowohl das Ende des Alten als auch der Beginn von etwas Neuem, ein Brückenbauer zwischen den Welten. Er hat gezeigt, dass Religion und Vernunft keine Gegensätze sind. Dass gerade die Vernunft der Garant dafür ist, die Religion vor dem Abgleiten in irre Fantasien und Fanatismus zu schützen. Er bestach durch seine noble Art, seinen hohen Geist, die Redlichkeit der Analyse und die Tiefe und Schönheit seiner Worte. Bei ihm wusste jeder, dass das, was er verkündet, vielleicht unbequem sein mag, aber verlässlich der Lehre des Evangeliums, der Kontinuität mit den Kirchenvätern und den Reformen des Zweiten Vatikanischen Konzils entspricht – verbunden mit dem Rat, nicht nur an Äußerlichkeiten herumzubasteln, sondern sich den tiefer gehenden Blick auf das Wesen der Dinge zu gönnen, auf das Eigentliche von Leben und Glauben.
Man muss nicht alle seine Positionen teilen, aber zweifellos kann man Joseph Ratzinger nicht nur einen bedeutenden Gelehrten nennen, den vermutlich größten Theologen, der jemals auf dem Stuhl Petri saß, sondern auch einen spirituellen Meister, der durch Geradlinigkeit und Authentizität überzeugte. Seine Wegweisung hat nichts an Aktualität verloren, ganz im Gegenteil. »Ein großer Papst«, so würdigt ihn sein Nachfolger, »groß ob der Kraft und des Durchdringungsvermögens seiner Intelligenz; groß ob seines bedeutenden Beitrags zur Theologie; groß ob seiner Liebe gegenüber der Kirche und den Menschen.« Und nicht zuletzt »groß ob seiner Tugenden und seines Glaubens«.
Peter Seewald
München, am 11. Februar 2020
Teil IDer Junge
Kapitel 1Karsamstag
Die wenigen Gestalten, die über das Pflaster huschten, hatten ihre Mantelkrägen hochgezogen. Die Luft war kalt, nasskalt. Über den spärlich beleuchteten Straßen lag ein leichter Nebel, aber oben am nachtgrauen Himmel, zwischen den Hausgiebeln, sah man einsam Sterne funkeln.
Es ist Karfreitag, der 15. April 1927. In der Kirche St. Oswald werden letzte Vorbereitungen für die Osterfeiertage getroffen. Gemäß der amtlichen Ordnung vor der durch Pius XI. vorgenommenen Reform wird die Liturgie der Osternacht am Karsamstag-Vormittag gefeiert. Jesus ist tot. Gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen »in die unterste Tiefe«, wie es im griechischen Text des apostolischen Glaubensbekenntnisses heißt, in die Unterwelt, jene Gottverlassenheit, die längst auch in der Oberwelt ihre Kreise zog.
Auf seinem Dienstgang inspiziert Gendarm Joseph Ratzinger den westlichen Teil des Ortes; mit der Dampfsäge der Familie Brühl, der Limonadenfabrik und der von Nonnen geleiteten »Kinderbewahranstalt«. Er gilt als geradliniger, tüchtiger, bis auf die Knochen akkurater Mann. Seitlich kurz geschorene Haare, der »deutsche Schnitt«. Würde und Anstand, das ist seine Haltung, die ausbalancierte Mitte das Ziel. Nirgendwo ein Zuwenig, nirgendwo ein Zuviel. Mit einer Körpergröße von 1,64 Metern hat er nicht eben Gardemaß, dafür aber eine kerzengerade Haltung. Heuchelei, Eitelkeit und Opportunismus sind ihm zuwider. Das hieß auch, Mut aufzubringen, die Wahrheit zu verteidigen. Sein Vater habe zwar nur die Volksschule absolviert, wird Benedikt XVI. später sagen, »aber er war ein Mensch mit Verstand. Er dachte anders, als man damals denken sollte, und das mit einer souveränen Überlegenheit, die überzeugte.«1
Seit zwei Jahren wacht er nun über den Ort. Inzwischen als Stationskommandant und Chef eines Mitarbeiters, den sie den »nassen Sepp« nennen. Die Kirche, das Wirtshaus, das Rathaus bilden das Zentrum. Es gibt sogar ein Kaufhaus. Das Schaufenster zeigt Werkzeuge, Schürzen für Hausfrauen und Spielsachen, wobei ein kleiner Teddybär noch eine gewisse Rolle spielen sollte. Dass er sich als Gendarm nicht mit jedermann gemeinmacht, verstand sich von selbst. Sonntags singt er im Kirchenchor. Zu Hause spielte er leidenschaftlich Zither, ein Erbe seiner böhmischen Mutter. Andererseits neigte er zu Temperamentsausbrüchen.
Ein Zeugnis der Landes-Gendarmariedirektion vom 29. Oktober 1920 bescheinigte: »Im Dienst fleißig, verlässlich, verwendbar, ausreichend befähigt.« Aber eben auch: »leicht erregt«. Immerhin, so der Vermerk, sei seine Führung »nunmehr ohne Klage«2. Die Lokalzeitung bestätigte, der Polizeichef habe »in der verhältnismäßig kurzen Zeit seines Hierseins durch Gerechtigkeitssinn sowie durch Entgegenkommen und Freundlichkeit im Umgang die Achtung der Einwohnerschaft von Marktl erworben«3.
Der Wind hatte zugenommen, die Kälte gefror einem die Nase im Gesicht. In einem letzten Aufbäumen schien sich der Winter gegen den hereinbrechenden Frühling zu wehren, aber die Stille der Heiligen Woche gab dem Ort so etwas wie Frieden nach einer verlorenen Schlacht. Vor zehn Tagen feierte er seinen 50. Geburtstag. War er inzwischen nicht eher ein Großvater als ein Vater? Und Maria, seine Frau? Mit 43 war sie kaum das, was man eine junge Mutter nennen konnte. Einige im Ort lästerten darüber, »dass so ein altes Weib noch ein Kind kriegt«. Jetzt liegt Maria oben im ersten Stock ihrer Wohnung im Polizeigebäude und erwartet unter Schmerzen ihr drittes Kind.
1927 ist ein unruhiges Jahr. Der Sprung vom Kaiserreich in die Demokratie, vom monarchistischen Obrigkeitsstaat zu Mitbestimmung und Emanzipation, hatte Deutschland verändert. Frauen durften wählen, Arbeiter bekamen Rechte. Die gesellschaftlichen Veränderungen provozierten nicht nur ein neues Lebensgefühl, sondern verlangten auch nach neuen Lebensmodellen. »Wir sind in der sonderbaren Lage«, so der damals 20-jährige Klaus Mann, »ständig alles für möglich zu halten.«
Es liegt etwas in der Luft. Der Hereinbruch von etwas Neuem, einer Welle von Veränderungen, die die kulturellen Flussläufe in eine andere Richtung bringen können. In den Metropolen entwickelte sich eine moderne Massenkultur um Film, Modemagazine und Sportevents. Das Theater will nicht mehr nur aufführen, sondern interpretieren. Architekten und Designer entwickeln eine neue Formensprache. Mies van der Rohe wird mit seinen spektakulären Wohnbauten bekannt. Freuds Psychoanalyse verspricht weitreichende Erkenntnisse über die Seele des Menschen und verändert das Verhältnis zur Sexualität.
Insbesondere Berlin verfällt für ein paar Jahre in einen kulturellen Rausch, der alle Tabus der Kaiserzeit zu sprengen sucht. Die entfesselte Hauptstadt will die Welt spüren lassen, dass sie so intensiv und verrückt lebt wie London, Paris und New York zusammen. Dreißig Schauspielbühnen buhlen jeden Abend um die Gunst des Publikums. Im Vergnügungspalast »Haus Vaterland« am Potsdamer Platz feiern jede Nacht bis zu 8000 Partygänger. Es gibt mehr als 100 Kabaretts, Nachtclubs, Kleinkunstbretter, Revuetheater, Schwulen- und Lesbentreffs. Eine der berühmtesten Künstlerinnen ihrer Zeit ist Anita Berber, die am Kurfürstendamm mit Zobelpelz und Monokel aus dem Auto steigt, rote Haare, grell geschminkt. Bekannt wird sie mit expressiven Nacktdarbietungen wie den »Tänzen des Lasters, des Grauens und der Ekstase«. Der französische Schriftsteller Jean Cassou ist entzückt. Berlin, so schreibt er, sei die »jüngste, die systematisch verrückteste, die am unschuldigsten perverse Stadt der Welt«4.
Literarisch gesehen zeigt sich das Geburtsjahr des späteren Papstes von einer schöpferischen Dichte, wie sie selten so geballt in die Welt kommt. Da ist Hermann Hesses aufwühlender Steppenwolf, Franz Kafkas Amerika und der letzte Band von Marcel Prousts A la recherche du temps perdu(Auf der Suche nach der verlorenen Zeit). Ernest Hemingway veröffentlicht 1927Men without Women(Männer ohne Frauen), Arthur Schnitzler sein Spiel im Morgengrauen, Carl Zuckmayer den Schinderhannes. Und der junge Bert Brecht, Schöpfer der Dreigroschenoper mit der weltberühmten Moritat von Mackie Messer, seine Hauspostille. In der Philosophie ist es der deutsche Gelehrte Martin Heidegger, der mit seinem Werk Sein und Zeit, das die Existenzphilosophie begründen sollte, die Formel für das Welträtsel sucht. Einen Kontrapunkt setzt Cecil B. DeMille, Mitbegründer der Filmmetropole Hollywood. Er dreht 1927 den ersten Jesus-Blockbuster der Filmgeschichte. Sein Titel: The King of Kings(Der König der Könige).5
Schien nicht irgendwie plötzlich gar der ganze Globus im Umbruch? Die Sowjetunion beginnt mit der Kollektivierung der Landwirtschaft (der vier Millionen Menschen in der nachfolgenden Hungersnot zum Opfer fallen sollten). Im Oktober hält Mustafa Kemal Pascha, der sich später Kemal Atatürk nannte, in Angora (heute Ankara) vor Abgeordneten und Vertretern der Republikanischen Volkspartei seine programmatische Rede über »Die neue Türkei«. In Italien macht Benito Mussolini, der Duce, den Faschismus hoffähig. In Deutschland prägen zunehmend Inflation, Massenarbeitslosigkeit und der Streit unzähliger politischer Gruppen das öffentliche Klima. Gerade einmal 8 Monate halten im Schnitt die insgesamt 19 Kabinette der Weimarer Republik durch. Geblieben war andererseits die Sehnsucht nach dem neuen Menschen, die Hoffnung auf eine bessere Zukunft, die Erwartung einer Zeitenwende.
Und irgendwo an diesem Rand rieb sich längst schon der allergrößte der Verführer die Hände, ahnend, dass seine Zeit bald gekommen sein würde. Ein gewisser Adolf Hitler gründete im Februar 1925 eine Partei neu, die nach ihrem Verbot 1923 schon abgewirtschaftet zu haben schien, die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP. Nach dem Marsch auf die Feldherrnhalle 1923 in München war er mit fünf Jahren Festungshaft davongekommen. Winifred Wagner, die Schwiegertochter Richard Wagners, schickte Wolldecken ins Gefängnis, eine Jacke, Strümpfe, »Futterzeug« und Bücher. Helene Bechstein, Ehefrau des Pianofabrikanten Edwin Bechstein, ließ ihm ein Grammofon mit Marschmusik zukommen.61927 wird Mein Kampf, Hitlers wirre ideologisch-politische und antisemitische Hassschrift, zum offiziellen Programm der Bewegung erklärt. Sie zählt im Moment 27000 Mitglieder. In drei Jahren wird sie auf 400000 Parteigenossen angewachsen sein.
Marktl am Inn ist die zwölfte Station der nicht unbedingt steil verlaufenen Karriere Ratzingers. Politisch gesehen, gehört der 600-Einwohner-Flecken zu Oberbayern, geistlich zum niederbayerischen Bistum Passau. Ganz in der Nähe, im Dorf Pildenau, 20 Kilometer entfernt, kam ein Papst auf die Welt, Damasus II.7 Als Bischof Poppo von Brixen war er am 16. Juli 1048 mit einer toskanischen Streitmacht in Rom eingezogen. Gleich am nächsten Tag stieß er den amtierenden Papst Benedikt IX. vom Thron. Sein Pontifikat dauerte freilich gerade einmal 24 Tage, dann starb er an der Malaria. Womöglich auch, wie einige Historiker vermuten, an einer Giftampulle.
Die Einsatzorte Ratzingers waren quer über Bayern verstreut gewesen. Auf Station Nummer elf, in Pleiskirchen bei Altötting, kam am 7. Dezember 1921 Tochter Maria auf die Welt, Zweitname Theogona, die Gottgeweihte (nach dem Ordensnamen ihrer Tante). Am 15. Januar 1924 folgte Georg, benannt nach dem Lieblingsbruder der Mutter, der in die USA ausgewandert war. Woran lag es, dass er nirgendwo so richtig heimisch wurde? An seinem Dickschädel? Weil er im Grunde diesen Dienst, den er so gewissenhaft ausführt, gar nicht mag? Wenn es so etwas wie Wiedergeburt gäbe, verriet er einem Nachbarn, würde er mit Sicherheit nicht mehr Gendarm werden, sondern Bauer.
Ratzinger studiert geistliche und politische Literatur und sitzt, eine Virginia im Mund, stundenlang über der Tageszeitung. Sein politisches Idol ist der österreichische Bundeskanzler Ignaz Seipel von der Christlichsozialen Partei, ein Prälat und Theologe, von dem er mehrere Bücher im Schrank hat. Seipel war umstritten, aber selbst die sozialdemokratische Arbeiterzeitung in Wien rühmte, er sei der »einzige Staatsmann europäischen Formats, den die bürgerlichen Parteien hervorgebracht haben«.
Die eigentliche Liebe seines Lebens, seine ganze Leidenschaft, war freilich die Religion, der christkatholische Glaube. Schon als Volksschüler war er als besonders inspiriert aufgefallen, gefördert von einem engagierten Kaplan. Ein anderer Lehrer erkannte die musische Begabung des Kindes und holte ihn in den Kirchenchor. Wie sein religiöses Vorbild, der gütige Klosterpförtner Bruder Konrad von Altötting, trieb auch ihn als junger Mann die Sehnsucht, in den geistlichen Dienst zu treten. Seine Aufnahme im Passauer Kapuzinerkloster Maria-Hilf aber wurde abgelehnt, weil er keine Einverständniserklärung der Eltern vorweisen konnte. »Seine Grundthematik war das Religiöse«, sollte der Sohn bestätigen, und zwar »in einer sehr tiefen, intensiven und männlichen Frömmigkeit.«8
Gendarm Ratzinger hatte seinen Dienstgang beendet. Klirrende Kälte war aufgezogen, und der Schneefall ging in einen leichten Sturm über. Seit Gründonnerstag war in Marktl die Passion Christi in allen Häusern gegenwärtig. Nach der Feier des Letzten Abendmahls waren die Glocken verstummt. Stunde um Stunde führte das Triduum Sacrum, der Zeitraum der drei heiligen Tage von Gründonnerstag bis Karsamstag, auf einen Höhepunkt zu. Am Karfreitag waren die Bewohner aus den umliegenden Dörfern herbeigezogen, um mit dem Priester die 14 Stationen des Kreuzweges zu beten. Alkohol und Fleischspeisen waren tabu. Karfreitag ist der strengste Abstinenztag der katholischen Kirche. Erlaubt ist nur eine einzige Sättigung am Tag. Um 15.00 Uhr, der Todesstunde, versammeln sich die Gläubigen zum Gedenken des Leidens und Sterbens Jesu Christi. In einer Nische des Gotteshauses ist das Grab von Golgatha aufgebaut, vor dem die Menschen andächtig knien.
In der Kirche St. Oswald würde bald der blutjunge Kaplan Joseph Stangl mit den letzten Vorbereitungen für die Auferstehung beginnen. Im Polizeigebäude nebenan, dem ehemaligen kurfürstlich-bayerischen Amtshaus am Marktplatz, brennt im ersten Stock noch immer Licht. Inzwischen war die Hebamme Emilie Wallinger eingetroffen. Das Kind hatte sich Zeit gelassen – und es kam keine Minute zu früh.
Ehemaliges Polizeigebäude und Wohnhaus in Marktl am Inn, in dem Benedikt XVI. in der Nacht zum Karsamstag am 16. April 1927 auf die Welt kam: »Geboren an der Tür von Ostern«, wie er später schrieb, »allerdings noch nicht eingetreten.«
© picture-alliance/dpa/Sven Hoppe
Es ist die Nacht zum Karsamstag, als um 4.15 Uhr gesund und lebensfähig der jüngste Spross des Gendarmen das Licht der Welt erblickt, Joseph Aloisius Ratzinger. Die Mutter ist zu schwach, um aufzustehen, aber der Vater zögert nicht lange. Etwas ungelenk trägt er das Kind in das Haus Gottes. Die Liturgie hatte schon begonnen, alle Fenster der Kirche sind mit schwarzen Stoffbahnen verhüllt, nur Kerzen beleuchten spärlich den düsteren Raum. Bald wird, in die Stille der Dunkelheit hinein, ein Ruf ertönen. Zunächst verhalten, dann immer deutlicher: »Lumen Christi«, Licht Christi. Eine rauschhafte Zeremonie bricht sich Bahn. Die Glocken setzen ein, so heftig, als hätten sie in den Tagen ihrer Stille neuen Atem geholt. Die Orgel hebt an zum Gloria. »Christus ist auferstanden«, stimmt der Priester an. Und mit einem Schlag fallen alle Vorhänge – und eine Flut von Licht bricht sich Bahn, die die Menge förmlich blendet.
Es ist 8.30 Uhr, genau 4 Stunden und 15 Minuten nach der Geburt, als der Gendarm sein Kind in die Arme der Ordensfrau Adelma Rohrhirsch legt. Sie vertritt seine Schwester Anna, die eigentliche Taufpatin, die nicht mehr anreisen konnte. Während der Priester die Segensworte spricht und das soeben geweihte, allerfrischeste heilige Wasser über den Täufling fließen lässt, wird das Kind buchstäblich mit Leib und Seele eingetaucht in das Geheimnis von Ostern. Vielleicht ist es der glücklichste Moment im Leben des Vaters. Sein Kind ist gesund. Es heißt Joseph, wie er selbst. Und wie auch sein Vater. »Gott fügt hinzu«, ist die hebräische Bedeutung des Namens. Im hohen Alter hatte es dem Herrn gefallen, ihm diesen Jungen zu schenken, und es war unmöglich, in all den Umständen und Zeichen dieses Ereignisses nicht auch einen besonderen Segen zu sehen, womöglich eine Verheißung, die auf diesem Kinde liegen würde.
Wenn es um Persönliches geht, blieb der spätere Kardinal stets zurückhaltend. Die Umstände seiner Geburt allerdings deutete er selbst als Zeichen eines besonderen Lichtes. Der »Erste des neuen Osterwassers« zu sein, sei gerade auch in der Familie »immer als eine Art Privileg betrachtet worden – als ein Privileg, in dem eine besondere Hoffnung, auch eine besondere Weisung liegt, die sich im Laufe der Zeit enthüllen muss«9. Seine Eltern hätten diese Konstellation »als sehr bedeutungsvoll empfunden und mir das von Anfang an auch gesagt«, erklärte er in unserem Gespräch. Dieses »Bewusstsein« habe ihn stets »begleitet« und sei »immer stärker in mich eingedrungen«. Er habe diese Dinge als »eine Anrede« für sich verstanden und versucht, »sie immer tiefer zu verstehen«. Seine Texte über die Karsamstagssituation Christi seien deshalb auch »nicht etwas Erdachtes, sondern etwas mit meinem Grund, mit dem Beginn meiner Existenz Verwobenes, in das ich nicht nur hineindachte, sondern auch hineinlebte«.10
In der Aussage des Karsamstags liege dabei etwas »von der Situation der menschlichen Geschichte überhaupt, von der Situation unseres Jahrhunderts«, ergänzte er – aber auch »meines Lebens«. Da seien »einerseits die Dunkelheit, das Ungewisse, das Fragende, die Gefährdungen, das Drohende, aber auch die Gewissheit, dass es Licht gibt, dass es sich lohnt, zu leben und weiterzugehen«. Insofern sei dieser Tag, »über dem dann Christus steht – geheimnisvoll verborgen und zugleich anwesend –, ein Programm für mein Leben geworden«.
Den Marktlern freilich blieb das Jahr 1927 zunächst wegen einer ganz anderen Geschichte in Erinnerung. Nach langer Bauzeit war endlich die neue Brücke über den Inn fertig geworden. Sie wurde mit einem feierlichen Umzug eingeweiht. Voran das Kreuz mit Ministranten, Pfarrer und viel Weihrauch. Im Anschluss an die Zeremonie folgte ein Festgelage mit Bier und Blasmusik. Kommandant Ratzinger war zur Stelle und wachte darüber, dass alles seine Ordnung hat. Dass das Kind, das seine Maria in diesem Jahr auf die Welt brachte, ebenfalls ein »Brückenbauer« werden sollte – ein Pontifex, wie das auf Latein heißt –, konnte er nicht ahnen.
Kapitel 2Das Hindernis
Es war nicht seine Schuld, dass er und Maria so spät heiraten konnten. Erst nach der Beförderung zum Wachtmeister mit einem monatlichen Gehalt von 150 Mark durfte Ratzinger es wagen, die Gründung einer Familie zu planen. Und mochten die beiden auf den ersten Blick auch sehr unterschiedlich wirken, waren die Gemeinsamkeiten doch unübersehbar.
Beide waren intelligent, tüchtig und gut aussehend. Beide stammten aus geachteten und kinderreichen Familien. Beide hatten früh den Vater verloren (Maria mit 28, Joseph mit 26 Jahren). Beide pflegten eine grundanständige katholische Frömmigkeit. Aber vor allem: Beide waren noch zu haben. Nicht zuletzt auch deshalb, weil Bäckermeister Schwarzmeier, ein Witwer aus München mit zwei Kindern, dem Maria einmal vorgestellt wurde, sich für ihre Schwester Sabine entschied. Sie war neun Jahre jünger.
Ausgangspunkt ihrer Liaison war der Altöttinger Liebfrauenbote, ein Wochenblatt, das in der Region nahezu jeden katholischen Haushalt erreichte. In der Ausgabe vom 11. Juli 1920 konnte Maria folgenden Text lesen: »Mittl. Staatsbeamter, led., kath., 43 J. a., tadellose Vergangenheit, aus dem Lande, sucht sich m. e. gut kath. reinl. Mädchen, das gut kochen u. alle Hausarb. kann, auch im Nähen bewandert ist und Einrichtung besitzt, baldm. zu verehelichen.« Der Inserent, der offenbar durch möglichst viele Abkürzungen möglichst viel Geld sparen wollte, erwartete »Angebote wenn mögl. m. Bild«11. Die Annonce war nicht der erste Anwerbeversuch des Gendarmen. Vier Monate zuvor hatte er mit ähnlichen Textbausteinen nach einer Frau »mit Aussteuer u. etwas Vermögen« gesucht, jetzt schraubte er die Formulierung auf »Vermögen erwünscht, jedoch nicht Bedingung« herunter. Allerdings war er in der Zwischenzeit befördert worden, was aus dem vormaligen »Niederen Staatsbeamten« den attraktiveren »Mittleren Staatsbeamten« machte.
Nach einer Tochter war der Vater des späteren Papstes der erstgeborene Sohn einer Bauernfamilie mit neun Kindern. Geboren wurde er am 6. März 1877 in Rickering in Niederbayern, einem Weiler mit 6 Wohnhäusern und etwa 40 Einwohnern. Nach der Schulzeit musste er sich auf fremden Höfen als Knecht verdingen. Mit 20 wurde er zum Militär eingezogen. Den zweijährigen Wehrdienst leistet er vom 14. Oktober 1897 an beim Königlich Bayerischen 16. Infanterieregiment in Passau ab, der 2000 Jahre alten Römerstadt an der Donau. Er bringt es zum Gefreiten und wird gar zum Unteroffizier befördert. Ein schneidiger, fescher Kerl mit modischem Schnurrbart, ausgezeichnet mit der Goldenen Schützenschnur für besondere Zielsicherheit.
Nach seiner Entlassung aus dem aktiven Dienst am 19. September 1899 bleibt er noch weitere drei Jahre beim Militär. Sein Vater ist inzwischen alt und krank, und auf dem Hof in Rickering, dessen Erbe ihm eigentlich zusteht, hat sich nicht nur die ältere Schwester, sondern auch sein Bruder Anton eingerichtet. Am 22. August 1902 wechselt er als Unteroffizier der Reserve in das Königlich Bayerische Gendarmariekorps. Als im April 1919 in München der Revolutionäre Arbeiterrat um die Anarcho-Literaten Erich Mühsam und Ernst Toller die erste sozialistische Räterepublik auf deutschem Boden ausruft, legt er sein Amt nieder. »Ich habe auf den König geschworen«, beharrt er, »ich kann jetzt nicht der Republik dienen.«12 Erst als der resignierte König Ludwig III. seine Staatsdiener explizit vom Eid befreit, nimmt er den Dienst wieder auf.
Die Ratzingers waren kein Stamm wie andere auch. Fast könnte man von einer Priesterfamilie sprechen. Jedenfalls waren sie seit Urzeiten im kirchlichen Dienst. Die ersten Spuren lassen sich im 14. Jahrhundert finden. Sie liegen im Fürstbistum Passau, einer von dem irischen Missionsmönch Bonifatius gegründeten Diözese, die einmal bis nach Ungarn reichte. In einer Urkunde des Domkapitels aus dem Jahre 1304 taucht ein Hof zu Recing auf, angesiedelt in Freinberg. Aus Recing wurde das Gut von Ratzing, aus den Recingers die Räzingers, dann die Ratzingers. Frühester Namensnachweis ist um 1600 ein Georg Räzinger, gefolgt von Jakob Räzinger, der mit seiner ersten Frau Maria und nach deren Tod mit seiner zweiten Gattin, Katharina, die beachtliche Schar von insgesamt 17 Kindern zeugte.13
Die Ratzingers zogen weiter, übernahmen ein Anwesen des Passauer Domkapitels im Bayerischen Wald und 1801 schließlich einen Hof des Klosters Niederaltaich an der Donau, eben jenes Rickering Nr. 1 in der Pfarrei Schwanenkirchen, in dem Joseph geboren wurde. Der Hof musste einiges leisten für die Ausbildung seiner begabtesten Söhne und Töchter. Direkt und indirekt brachte das Waldhausergut nicht weniger als zwei Ordensfrauen und fünf Priester hervor. Darunter den streitbaren Dr. Georg Ratzinger, der als bedeutender katholischer Sozialpolitiker und Reichstagsabgeordneter in die bayerische Geschichte einging, und dessen begabten Bruder Thomas, der allerdings sein Theologiestudium abbrach, um Jurist zu werden. Nicht zuletzt die Brüder Joseph und Georg, die dem Stammhaus ewig die Treue hielten und den Hof Jahr für Jahr besuchten, immer am letzten Sonntag im August.
Josephs Maria, am Tag ihrer Hochzeit 36 Jahre alt, ist eine lebenslustige Natur, spontan, herzensgut und gesellig. Eine Frau mit Gefühl, die sich fürs Theater interessiert. Mit Fleiß und Geschick hatten es ihre Eltern vor Beginn des Ersten Weltkrieges zu beträchtlichem Wohlstand gebracht. Der Vater, Isidor Rieger, war ursprünglich ein Handwerksbursche aus dem Schwäbischen, die Mutter, Maria Peintner, verdingte sich als Haushaltshilfe. Im österreichischen Ort Hopfgarten hatten die beiden eine Bäckerei gepachtet, bevor sie in einem Leiterwagen mit ihren erstgeborenen Kindern – Maria und Benno – nach Bayern zogen, um am Chiemsee eine eigene Bäckerei und eine kleine Landwirtschaft zu betreiben. Das dritte Kind, Georg, musste zunächst bei Pflegeeltern zurückbleiben. Es sollten noch sieben weitere Kinder geboren werden, zwei davon konnten nicht überleben. Als »arbeitsame brave Leutchen«, die »auch den Segen Gottes« haben, beschrieb eine Tante namens Rosl den Alltag der Rieger-Familie. »Vor und nach Tisch wurde immer gebetet, auch abends meistens Rosenkranz.«14 Der Vater stand in der Backstube; von Mitternacht an bis meist um 16 Uhr. Die Mutter versorgte frühmorgens um 4 Uhr im Stall drei Kühe, ein Schwein und ein Pferd.
Auch für die kleine Maria begann der Tag in der Nacht. Vor Schulbeginn mussten Brot, Brezen und Semmeln ausgetragen werden. Zur Arbeit in der Bäckerei kam bald auch die Sorge um die sieben jüngeren Geschwister, während die Mutter mit Pferd und Wagen Großkunden belieferte. Neben der Volksschule besucht Maria jeden Sonntag von 12.30 bis 15 Uhr den religiösen Unterricht in der »Sonn- und Feiertagsschule«. Immerhin hatten zwei ihrer Onkel die Altäre von St. Andreas in Salzburg sowie der Klosterkirche der Ewigen Anbetung in Innsbruck gestaltet. Vater Isidor wiederum gründete in Rimsting nicht nur einen Dorfverschönerungsverein, sondern auch einen »Seelsorge-Verein«. Ihm war es zu verdanken, dass die Gemeinde zur ordentlichen Pfarrei aufstieg und jeden Sonntag Gottesdienst gefeiert werden konnte.
Mit 15 wird die Mutter des späteren Papstes nach Kufstein in fremde Dienste »überwiesen«, wie es in ihrem Schulzeugnis hieß. Anschließend ist sie laut einem »Meld-Schein« der Stadt Salzburg vom 1. Oktober 1900 bis 19. April 1901 als Hausmädchen bei »Concertmeistersgattin« Maria Zinke beschäftigt. Die Adresse lautet: Priesterhausgasse 20, II. Stock. Danach arbeitet sie bei einem General Zech in der Nähe von Frankfurt. Als ihre Brüder im Ersten Weltkrieg Militärdienst leisten, führt sie mit der Mutter und ihrer Schwester Ida die Bäckerei in Rimsting und landet, kurz bevor sie Joseph Ratzinger kennenlernt, im Hotel Neuwittelsbach im Münchner Nobelviertel Nymphenburg, als Süßspeisenköchin.15
Über das erste Rendezvous der Papst-Eltern ist nichts bekannt. Man scheint sich jedenfalls schnell einig gewesen zu sein. Die Zeit drängte. Denn irgendwie war 1920 im Hause Rieger das Hochzeitsfieber ausgebrochen. Schwester Ida heiratete am 6. Januar, Benno am 3. Februar, Bruder Isidor am 16. Oktober. Joseph und Maria ergriffen die Gelegenheit und planten für den 9. November. Zu dieser Zeit lag der Erste Weltkrieg, jene »Urkatastrophe«, die dem 20. Jahrhundert ihren Stempel aufdrückte, gerade einmal zwei Jahre zurück. Mehr als zwei Millionen deutsche Soldaten hatten auf den Schlachtfeldern ihr Leben verloren. 720000 Männer waren schwer verwundet von der Front zurückgekehrt. »Das alte Morsche ist zusammengebrochen«, rief der SPD-Politiker Philipp Scheidemann am Nachmittag des 9. November 1918 vom Balkon des Berliner Reichstags einer aufgewühlten Menge zu. »Die Hohenzollern haben abgedankt! Es lebe die deutsche Republik!«16
Schreckliche Jahre hatte diese junge Republik überstanden, Jahre voller Straßenkämpfe, bewaffneter Streiks, Arbeiteraufstände, Putschversuche und politischer Morde, durch die etwa 5000 Menschen gewaltsam ums Leben gekommen waren. Als am 11. Februar 1919 erstmals die Nationalversammlung zusammengetreten war, geschah das nicht in Berlin, sondern in Weimar, um dem in der Hauptstadt befürchteten »Druck der Straße« zu entkommen. Als schwerste aller Hypotheken erwies sich jedoch der Versailler Vertrag vom 28. Juni 1919, der Deutschland und seinen Verbündeten die alleinige Schuld am Ersten Weltkrieg zusprach – und damit auch die Kosten für alle dadurch entstandenen Schäden.
Elsass-Lothringen fiel an Frankreich, weite Teile von Posen an Polen; insgesamt 70000 Quadratkilometer Landesfläche, ein Gebiet von der Größe Bayerns. Anders ausgedrückt: drei Viertel des Eisenerzes und ein Viertel der Steinkohle. Ende Januar 1921 legten die Alliierten weitere Forderungen vor: 226 Milliarden Goldmark, zahlbar in 42 Jahresraten (später wurde die Summe auf 132 Milliarden reduziert) sowie die Übernahme der Renten alliierter Kriegsversehrter und deren Familien. Deutschland soll ökonomisch radikal geschwächt werden, gleichzeitig aber wollen die Siegermächte von der Wirtschaftskraft des ehemaligen Feindes profitieren. Ein Ding der Unmöglichkeit.
Bald rutscht die Mark in den freien Fall. Kostete Anfang des Jahres 1923 ein Fernbrief noch 15 Pfennig, muss man im Juni dafür schon 100 Mark, im August 1000, Anfang Oktober 2 Millionen und im November 100 Millionen dafür auf den Tisch legen. Ein Dollar kostet auf dem Höhepunkt der Inflation im November 19234,2 Billionen Reichsmark. Das Land glich, so der britische Historiker Frederick Taylor, »einem außer Kontrolle geratenen Eisenbahnzug, der mit zunehmender Geschwindigkeit einem unbekannten Ziel« entgegenrast.17
Zehn Tage vor dem geplanten Hochzeitstermin ersuchte »Wachtmeister Joseph Ratzinger I« – die »I« wurde amtlich zugeteilt, um Verwechslungen mit einem Namensvetter zu vermeiden – in einem handgeschriebenen Brief »An die Gendarmerie Hauptstation Altötting« um die »erforderliche Genehmigung«, sich »mit der ledigen Köchin Maria Peintner zu verehelichen«. Der Brief war gerade zur Post gebracht, marschierten Joseph und Maria auch schon ins Pfarramt von Pleiskirchen, dem aktuellen Einsatzort Ratzingers, um vor dem Pfarrer und den Zeugen Franz Hingerl und Josef Mitternmeier einen »Verlobungsvertrag« zu schließen.18
Alles war vorbereitet. Doch unmittelbar vor der Vermählung tauchte urplötzlich ein riesiges Problem auf, ein »Ehehindernis«, wie es amtlich hieß. Was war passiert? Das »Hindernis« hatte fünf Buchstaben, und es tauchte in einem Beiblatt zum Verlobungsvertrag auf. »Maria Peintner, kath. Köchin, Rimsting am Chiemsee«, stand da unter den Angaben zur Braut. Aber dann kam noch dieses verfängliche Kürzel hinzu: »illeg.« – illegitim. Im Klartext: Maria war nicht nur unehelich geboren, sie war auch nicht »legitimiert«, also nachträglich als leibliches Kind anerkannt worden. Und damit ohne die notwendigen Papiere.
Auch aus dem Taufbuch der Pfarrei ging zwar der Name von Marias Mutter hervor, einer »Maria Peintner aus Mühlbach bei Brixen, Dienstmagd in Kufstein«, aber ein Vater ist nicht genannt. War der Bäcker Isidor Rieger folglich nur ihr Ziehvater? Und wo war sie überhaupt geboren? Auf dem »Polizeimeldebogen«, der am 6. Mai 1920 in München anlässlich ihres Arbeitsbeginns im Hotel Neuwittelsbach angelegt wurde, gab sie selbst als Geburtsort »Mühlbach bei Brixen, Österreich« an. Aber stimmte das auch? Und warum kannte man Maria in der Schule in Rimsting einerseits nur als »die Rieger-Tochter« – in ihren Zeugnissen aber war sie stets als »Maria Peintner« geführt worden?
Bis in unsere Zeit hinein herrschte Unklarheit über die Herkunft der Papst-Mutter. Selbst als Erwachsene nahmen Joseph, Georg und Maria noch an, ihre Mutter sei in Südtirol auf die Welt gekommen. Um die Sache aufzuklären: Maria war ein uneheliches Kind. Und nicht nur sie. Auch ihre Mutter und selbst ihr Vater – die Großeltern des späteren Papstes – waren unehelich geboren worden. Was gemeinhin als Schande galt, war so ungewöhnlich auch wieder nicht. Gemäß den Taufbüchern waren in der Gemeinde Mühlbach in Südtirol, dem heutigen Rio de Pusteria, im 19. Jahrhundert rund ein Drittel der Frauen, die bereits Kinder hatten, nicht verheiratet. Eine Ehe zu schließen konnte sich nur erlauben, wer dafür auch die nötigen finanziellen Mittel hatte; und ganz viele hatten sie eben nicht.
Marias Vater Isidor Rieger wiederum war der uneheliche Sohn eines Johann Reiss aus Günzburg, eines Handwerkers, der sich sein Geld mit der Reparatur von Mühlen verdiente, und einer Maria Anna Rieger, Tochter eines Taglöhners. Er wurde am 22. März 1860 um 8 Uhr früh in Welden bei Augsburg geboren und mittags »eilig«, wie es wörtlich im Geburtsregister heißt, in der Pfarrkirche Mariä Verkündigung getauft. Er war ebenfalls nie von seinem Vater »legitimiert« worden.19
Die zusätzliche Verwirrung erklärte sich dadurch, dass die Großmutter und die Mutter des späteren Papstes nicht nur denselben Vor- und Nachnamen trugen, sie hatten auch den gleichen Geburtsort: Mühlbach. Nur lag das eine Mühlbach, das der Großmutter, eben wirklich in Südtirol (in der alten Mühle eines Dorfes namens Raas), das andere Mühlbach, das der Tochter, bei Kiefersfelden im Landkreis Rosenheim. Ohne dass sie von ihrer Mutter je darüber aufgeklärt wurde, kam Maria am 8. Januar um 16 Uhr im Haus einer Familie zur Welt, wie der Heimatforscher Johann Nußbaum recherchierte, die sich darauf spezialisiert hatte, ledigen Schwangeren Geburtshilfe zu leisten. Dass die Tochter später nicht legitimiert wurde, erklärt sich aus der Sparsamkeit der Mutter. Mädchen würden durch eine Heirat, argumentierte sie, später ohnehin einen anderen Namen bekommen.
Nach all der Aufregung konnte die Hochzeit dann doch noch stattfinden. Wie geplant, gaben sich Maria und Joseph am 9. November 1920 im Standesamt Pleiskirchen das Jawort. Bei der kirchlichen Hochzeit in St. Nikolaus am selben Tag assistierten der Landwirt Anton Ratzinger und der Kassenassistent Johann Ratzinger als Trauzeugen. Das Altarbild zeigte eine Darstellung der Empfängnis Mariens, über dem Tabernakel thronte das Lamm Gottes auf dem Buch mit den sieben Siegeln.
Die »Ehehindernisse« aus dem Weg geräumt hatte der Bürgermeister von Rimsting, der amtlich erklärte, Maria Peintner sei »die eheliche Tochter der Bäckersleute Isidor und Maria Rieger, geborene Peintner«. Punktum. »Rieger Maria führt den Namen Peintner«, hieß es im Schreiben des Bürgermeisters, »da bis jetzt die Vaterschaftsanerkennung unterblieb und die notwendigen Nachweise aus Tirol wegen der Besetzung durch die Italiener nicht erholt [beigeholt] werden können.« Dass Isidor Rieger auch wirklich sein Großvater und der Vater seiner Mutter ist, davon war Benedikt XVI. fest überzeugt. Die fehlende Legitimation sei ein »juristisches Versäumnis« gewesen. Seine Großeltern hätten sich früh das Eheversprechen gegeben, aber ohne festen Wohnsitz zunächst einfach noch nicht geheiratet.20 Isidor habe seine Tochter Maria »sehr geliebt – und sie ihn auch«.
Kapitel 3Das Traumland
In seinem Geburtsort sah Joseph Ratzinger elementare Dinge seines Lebens grundgelegt: Es ist »der Ort, an dem mir meine Eltern das Leben geschenkt haben; der Ort, an dem ich meine ersten Schritte auf dieser Erde getan habe; der Ort, da ich sprechen gelernt habe«. Und, dies vor allem: Es ist »der Ort, an dem ich getauft worden bin am Karsamstagmorgen und so Glied der Kirche Jesu Christi wurde«21.
Die Symbolik des Karsamstags ließ ihn nicht mehr los. Dieses »dunkelste Geheimnis des Glaubens«, das zugleich »das hellste Zeichen einer Hoffnung« ist. Zeit seines Lebens sollte er darüber nachdenken. In der Nacht des Abstieges Christi sei »das Undenkbare« geschehen: »Die Liebe ist eingedrungen in das Reich des Todes: Auch in der extremsten Dunkelheit können wir eine Stimme hören, die uns ruft, eine Hand suchen, die uns ergreift und uns nach draußen führt.«22
An konkreter Erinnerung an Marktl nahm er nur mit, was ihm Eltern und Geschwister überlieferten. Die Geschichte von der Zahnärztin zum Beispiel, die mit dem Motorrad in ihre Praxis kam. Geblieben war ihm der Teddy aus dem kleinen Kaufhaus von gegenüber, den er sich so sehr gewünscht hatte. Zuletzt landete er in Rom. Auf einem Stuhl im Schlafzimmer des päpstlichen Appartamento.
Geblieben war ihm auch die Sorge um seine Gesundheit. Denn der Spätgeborene war nicht nur ein besonders zartes, sondern auch ein besonders schwächliches Kind. Als er an Diphtherie erkrankte, stand sein Leben auf der Kippe. Die verzweifelte Mutter hatte den jüngsten Bruder ihres Mannes vor Augen, der nach einer Diphtherie-Erkrankung halbseitig gelähmt blieb. Der kleine Joseph konnte kein Essen aufnehmen und weinte Tag und Nacht. Gerettet hatte ihn letztlich Schwester Adelma, seine Taufpatin, die ihn mit Haferschleim fütterte. Dass ein Arzt wenige Jahre später einen Herzfehler diagnostizierte und die Mutter ihn hütete wie ihren eigenen Augapfel, hatte sicher dazu beigetragen, dass sich der spätere Professor und Kardinal stets als gesundheitlich wenig robust empfand.
Nur noch zwei Jahre blieb die Familie in Marktl. Am 11. Juli 1929 machte sich der Gendarm mit Kind und Kegel auf den Weg in die 20 Kilometer entfernte Barockstadt Tittmoning. Der inzwischen zum Sicherheitskommissär beförderte Beamte versprach sich hier bessere Bildungschancen für seine Kinder. Für Joseph ist es ein Volltreffer. Denn wenn es eine Epoche gibt, in der er vollkommen glücklich ist, dann waren dies die Jahre seiner Kindheit in einer Umgebung, für die er später nur einen Begriff kannte: »Traumland«.
Schon die Ankunft war berauschend. In Marktl war ihr Wohnhaus imposant gewesen, in Tittmoning jedoch bezogen die Ratzingers das schönste Gebäude der ganzen Stadt, das sogenannte Stubenrauchhaus am Stadtplatz Nr. 39. Die herrschaftliche Toreinfahrt, die barocke Schmuckfassade, und dann auch noch eine Wohnung mit Erker! Vom zweiten Stock aus hatte man einen Blick auf die malerische Piazza der Stadt, mit den mächtigen Toren, den noblen Brunnen, den Türmen der alles überragenden Stiftskirche. Hie und da sah man eine Pferdedroschke, gelegentlich auch ein Automobil. Wenn Viehmarkt war, feilschten die Bauern um die besten Preise, Festumzüge wurden angeführt von prächtig geschmückten Rössern. Nur vor dem Nachtwächter erschraken die Kinder anfangs, der mit monotoner Stimme zur vollen Stunde die Zeit ansagte: »Hört ihr Leut’ und lasst euch sagen, unsre Uhr hat zwölf geschlagen.«
Links vom Haus gab es eine Eisenwarenhandlung, rechts davon ein Textilgeschäft. Im Rückgebäude war die Polizeistation untergebracht. Die Mannschaft bestand aus je einem von der Stadt und einem vom Staat gestellten Gendarmen (der eine in blauer, der andere in grüner Uniform) sowie dem Sicherheitskommissär. Die Aufklärungsquote wird bald bei 100 Prozent liegen. Einmal sollte der Kommissar sogar gegen den eigenen Hausbesitzer vorgehen, nachdem sich dessen Dienstmagd Rosa über brutale Behandlung beklagt hatte.
Das Nachbarhaus war Sitz der Verlagsbuchhandlung Anton Pustet. Das Schaufenster zeigte die aktuellen Bucherscheinungen. Etwa Erich Maria Remarques Im Westen nichts Neues oder Alfred Döblins Berlin Alexanderplatz. Später wird auch Lion Feuchtwangers Schlüsselroman Erfolg dort zu finden sein, ein facettenreiches Gesellschaftspanorama der frühen Zwanzigerjahre. Unverkennbar waren in einer Figur namens Rupert Kutzner und seiner Bewegung der »Wahrhaft Deutschen« Adolf Hitler und die NSDAP gezeichnet.23
Für die Mutter ist es eine Plackerei, wenn sie im Stubenrauchhaus ihre Einkäufe, Holz und Kohlen hochschleppt. Die Treppen sind eng, die Pflaster brüchig, die Zimmer verwinkelt. Für die Kinder aber ist das Refugium ein Abenteuerspielplatz. Das Gebäude gehörte einst katholischen Stiftsherren. Dass sie sich nach den Wirren des Dreißigjährigen Krieges zu einer Wohngemeinschaft zusammentaten – dem »Institut der in Gemeinschaft lebenden Weltpriester« – und die Regel des heiligen Augustinus reaktivierten, machte sie zu einem Modell, das in ganz Europa Aufsehen erregte. Bartholomäus Holzhauser, der Gründer, beriet Fürsten und Herzöge und fand gar Unterstützung bei Papst Innozenz X. Just das Zimmer, in dem die Ratzinger-Kinder schliefen und spielten, war der frühere Kapitelsaal, in dem die Stiftsherren über gemeinschaftliche Angelegenheiten berieten und sich aus den Schriften Augustinus’ vorlasen. Holzhauser starb im Ruf der Heiligkeit. Im Stubenrauchhaus schrieb er nicht nur eigene »geheime Visionen« auf, sondern hinterließ auch eine Auslegung der Geheimen Offenbarung des Johannes.24 In seinen Erinnerungen wies Ratzinger ausdrücklich auf die »apokalyptischen Gesichte« Holzhausers hin, mit denen er sich offenbar früh beschäftigte.
Tittmoning ist mit viereinhalbtausend Einwohnern eine Handels- und Künstlerstadt, einst Zentrum bedeutender Baumeister, Bildhauer, Maler und Goldschmiede. Straßen und Plätze sind von malerischer Schönheit, geziert von prächtigen Fassaden, Brunnen, Skulpturen. Die Klosterkirche der Augustiner-Eremiten ist ein barockes Juwel in Schwarz, Weiß und Gold. Auf einer Anhöhe thront eine imposante Burganlage. In den Zwanzigerjahren beherbergt sie eine Gruppe der von Romano Guardini unterstützten katholischen Jugendbewegung Quickborn. Und wäre es der Idylle nicht schon genug, wird das städtebauliche Kleinod gesegnet von einem Panorama aus Alpengipfeln, sanften Bergrücken, Mischwäldern und fetten grünen Hügeln, als wäre der gesamte Rupertiwinkel (benannt nach dem heiligen Rupert) direkt vom weißblauen Himmel gefallen.
Vor allem ist Tittmoning eine geistliche Stadt, in der die Bewohner offenbar gar nicht genug kriegen konnten von Kirchen, Kapellen und Klöstern, Marien- und Nepomuksäulen, von Prozessionen und Kirchweihfesten. Mit Sakralbauten und Wegkreuzen füllte die Religion den Raum, mit der Liturgie des Kirchenjahres die Zeit.
Mit der Mutter spazieren die Ratzinger-Kinder zur Zollstation an der Brücke – und staunen darüber, mit nur wenigen Schritten in Österreich zu sein. Im »Bienenheim«, einem kleinen Park, in dem die Bürger Bienen halten, dürfen sie spielen. Dann gibt es den Auer Maxl, der in der Nähe des Friedhofs wohnt. Sein großes Plus: Maxl besitzt ein Harmonium, und er hat kein Problem damit, wenn Georg darauf herumklimpert. Georgs »innere Affinität zur Musik«, schrieb Ratzinger in einer Würdigung seines älteren Bruders, sei schon in Marktl erkennbar gewesen, wo alles, »was mit Musik zu tun hatte, sein innerstes Interesse« erweckte.
Die Geschwister Ratzinger um 1930 im Sonntagsstaat im Fotoatelier in Tittmoning. Kindergartenkind Joseph hält seinen Ball wie einen Reichsapfel. »Ich werde mal Kardinal«, ist er sich sicher.
© Archiv Walter
Zu den schönsten Erinnerungen an Tittmoning gehörten für den späteren Kardinal die Spaziergänge hinauf zur Wallfahrtskirche Maria Brunn. Das barocke Heiligtum liegt mitten im Wald, am Rande eines rauschenden Bergbaches. Eines der Deckengemälde zeigt Jesus als lehrenden Knaben im Tempel von Jerusalem. Höhepunkte im Alltag der Familie sind Aufführungen im Freilichttheater und Ausflüge nach Oberndorf an der Salzach, in dem 1818Stille Nacht, heilige Nacht entstand, das berühmteste Weihnachtslied aller Zeiten.
In St. Radegund, ebenfalls in Österreich, besucht die Familie die Passionsspiele. Ratzinger weist in der Rückschau darauf hin, dass hier Franz Jägerstätter gelebt hat. Der Landwirt und Familienvater, Mitglied des Dritten Ordens des heiligen Franziskus, wurde als Kriegsdienstverweigerer am 9. August 1943 von den Nazis hingerichtet. Vierundsechzig Jahre später, am 26. Oktober 2007, wurde in Rom seine Seligsprechung gefeiert – zelebriert von genau jenem Joseph Ratzinger, der schon als Kind von seinem Vater von dem mutigen Bauern gehört haben mag.
Was Tittmoning für den Drei- bis Fünfjährigen im Eigentlichen zu einem »Traumland« macht, ist die geistliche Identität des Ortes. Besonders fasziniert ihn »der geheimnisvolle Glanz der Klosterkirche mit ihrer barock gestalteten Liturgie«. Da ist »der aufsteigende Weihrauch«, der psychedelische Klang der gregorianischen Choräle, die feierliche Kirchenmusik, das Ewige Licht in einem roten Glasgefäß, das, obwohl es ewig währen soll, scheinbar nur an einem seidenen Faden hängt. Oder aber auch »die Verwunderung, wie jemand der Säule zur Kanzel entsteigen konnte«, ohne vorher gesehen zu werden.
Immer wieder schreiten die beiden Buben in dem historischen Kirchenjuwel vor einem Bild des leidenden Christus auf und ab, voller Staunen darüber, dass Jesus sie mit den Augen verfolgt, als wär er eben wieder lebendig geworden. Georg ist in einer weißen Kutte bald Stabträger, wenn eine der Bruderschaften Tittmonings hier im Gotteshaus ihre monatliche Prozession exerziert. Seinen staunenden kleinen Bruder sieht man förmlich mit weit aufgerissenen Augen, wenn er die merkwürdig-mystischen Wandbilder betrachtet, mit seiner Mutter eine Litanei mitbetet und mit traumwandlerischer Leichtigkeit eintaucht in die für ihn so phantastische wie aufregende Welt des Glaubens, voller Zärtlichkeit, Schönheit und Geheimnis. An diesem Ort, so Ratzinger in einer Predigt am 28. August 1983, habe er »die ersten persönlichen Erfahrungen mit einem Gotteshaus« gemacht. Und »wie alles Erste«, das jemand erfährt, habe all das auf ihn »einen lang anhaltenden Eindruck« gemacht. Es sei dabei nicht nur um die »vordergründigen und naiven Bilder« gegangen, die ein kindliches Gemüt naturgemäß leicht beeindrucken können, sondern dahinter hätten sich früh schon »tiefgründige Gedanken festgesetzt«.25
Gerade einmal 3 Monate und 13 Tage leben die Ratzingers in ihrer neuen Heimat, als an der New Yorker Börse am 24. Oktober 1929 die Kurse einbrechen. Die Nachricht erreichte die alte Welt durch die Zeitverschiebung erst nach Schließung der Aktienmärkte. In Europa kam es deshalb erst am Freitag, dem 25. Oktober, zu einer Panik an den Börsen – dem Black Friday. Der größte Börsencrash aller Zeiten löst in den USA die »Great Depression« aus. Banken brechen zusammen, Firmen gehen bankrott. Es ist der Auftakt einer Wirtschaftskrise, die Millionen von Menschen in Arbeitslosigkeit und Armut stürzt. Mit einem Schlag glich der Tanz auf dem Vulkan, der den Golden Twenties Glanz und Glamour gab, einem Totentanz.
Auf die politische Auseinandersetzung in Deutschland wirkte der Blackout der Börsen wie ein Brandbeschleuniger. NSDAP und Kommunistische Partei verzeichneten einen Mitgliederzustrom wie noch nie. Insbesondere von jungen Menschen, die sich von den bürgerlichen Parteien nicht mehr vertreten fühlen. Geschickt hatten sich die Nazis als die wahre Volkspartei in Szene gesetzt. Den Bauern gegenüber betonten sie »die Erhaltung des Ackers«, der die »Grundlage unseres Daseins« werden müsse. Verschuldeten Mittelschichtlern und verarmten Angestellten präsentieren sie sich als Retter gegen soziale Not, den Arbeitern als sozialistische Alternative, der jungen Generation als »Aufbruch der Jugend« und Bewegung gegen das verkalkte und reaktionäre »System« der »Bonzen«.
Das Programm der NSDAP fordert ein »Selbstbestimmungsrecht der Völker« und eine »Gewinnbeteiligung an Großbetrieben«. »Wir haben die sinkende Fahne des Sozialismus aufgegriffen«, versichert NS-Propagandaleiter Joseph Goebbels enttäuschten Anhängern der Linken. Seine Partei werde »im Herzen Europas einen sozialistischen Staat aufbauen«. Gregor Strasser, als Reichsorganisationsleiter einer der mächtigsten Männer der Partei, sekundierte: »Das Volk protestiert gegen eine Wirtschaftsordnung, die nur in Geld, Profit, Dividende denkt. Diese große antikapitalistische Sehnsucht ist ein Beweis dafür, dass wir vor einer ganz großen, vor einer grandiosen Zeitenwende stehen.«26 Vor allem positionierte sich die NSDAP als Partei, die den Versailler Vertrag rückgängig machen werde. »Zehn Jahre Schmach« hätten das Deutsche Reich entehrt und geschändet. Es sei an der Zeit, die Dinge zu ändern.
Massenaufmärsche der Braunhemden boten einen Vorgeschmack auf das Gemeinschaftserlebnis einer zukünftigen Welt von germanischen Helden. In die »Sturmabteilung« (SA) der NSDAP drängten bald 455000 neue Parteigenossen. Ihr harter Kern versammelte sich in »Sturmlokalen« und richtete Volksküchen für arbeitslose Mitglieder ein. Es gab sogar eine eigene SA-Versicherung für »Schadensfälle«. Gemeint waren die Hinterlassenschaften jener »Kämpfer«, die bei Straßenschlachten fremdes Eigentum kurz und klein schlugen.
Am frühen Abend des 10. September 1930 versammelten sich vor dem Sportpalast an der Potsdamer Straße in Berlin Zehntausende Arbeiter und Angestellte, Unternehmer, Studenten und Arbeitslose, um einen der radikalsten Gegner des politischen Systems zu hören: Adolf Hitler. Und Hitler ist in seinem Element. Propaganda müsse ihr geistiges Niveau auf die geringe Aufnahmefähigkeit der Masse einstellen, hatte er in Mein Kampf erklärt. Es gehe nicht um die »Befriedigung einiger Gelehrter oder ästhetischer Jünglinge«. Mit seiner Rede wolle er vielmehr auf Emotionen setzen: »Je bescheidener dann ihr wissenschaftlicher Ballast ist und je mehr sie ausschließlich auf das Fühlen der Masse Rücksicht nimmt, umso durchschlagender der Erfolg.«27 In der Sportpalast-Rede geißelt er die »politischen, wirtschaftlichen und moralischen Bankrotteure«. Es gelte, den »Willen des Volkes« durchzusetzen gegen »Kapitalismus und Hochfinanz«. »Das Publikum rast«, notierte Goebbels in seinem Tagebuch.
Hitlers Konzept ging auf. Als vier Tage später die Wahllokale schließen, erschüttert ein politisches Beben, was von den Fundamenten der Republik noch vorhanden war. Zwei Jahre zuvor galt die NSDAP mit nur 2,6 Prozent der erhaltenen Stimmen noch als Splitterpartei. Bei der Wahl am 14. September 1930 jedoch wird sie mit einem Ergebnis von 18,3 Prozent und damit 6,4 Millionen Wählerstimmen die zweitstärkste politische Kraft des Deutschen Reiches, nach der SPD mit 24,5 Prozent und 8,6 Millionen Stimmen. Sie zieht mit 107 Abgeordneten in den Reichstag ein, die SPD mit 143. Auch die Kommunisten verzeichnen Zuwächse. Rund 4,6 Millionen Wähler hatten für die KPD gestimmt, die damit 77 Parlamentssitze erobert.
Die Weimarer Republik hatte die wirtschaftliche Notlage der Menschen nicht verbessern können. Die Reparationsforderungen der Siegermächte erstickten den Finanzhaushalt der jungen Demokratie wie eine Schlinge, die sich immer fester um den Hals zieht. Besonders empfänglich für Hitlers Botschaften zeigten sich nach Erkenntnissen des Parteienforschers Jürgen Falter selbstständige Landwirte in protestantischen Gegenden. Ihre besten Ergebnisse erzielte die NSDAP in Wiefelstede im Wahlkreis Weser-Ems mit 67,8 Prozent und im schleswig-holsteinischen Schwesing mit 61,7 Prozent der Wählerstimmen.28 In den Städten wanderten Protestanten in Scharen zu den den Nazis nahestehenden Deutschen Christen ab, deren Ziel die Errichtung einer überkonfessionellen deutschen Nationalkirche war.
Die katholische Kirche reagierte auf das Erstarken der Hitler-Partei zunächst mit Abgrenzung. Die Mitgliedschaft in der NSDAP, verkündete der L’Osservatore Romano als Amtsblatt des Papstes im Oktober 1930, sei »mit dem katholischen Gewissen nicht zu vereinbaren«. Der Münchner Erzbischof Michael von Faulhaber bezeichnete die NS-Ideologie als »Häresie«, als gottloses Ketzertum. Geistlichen sei »streng verboten«, die Nazis auf irgendeine Weise zu unterstützen. Die Deutsche Bischofskonferenz brandmarkte im August 1932 das Parteiprogramm der NSDAP als »Irrlehre« und »glaubensfeindlich«. Katholiken sei die »Zugehörigkeit zu der Partei« untersagt, Zuwiderhandelnde würden von den Sakramenten ausgeschlossen.29
Auch die Ratzingers blieben vom Börsenkrach und seinen dramatischen Folgen nicht verschont. Die Gehälter der Staatsbeamten waren oft erst mit Verspätung ausbezahlt worden. Aber was noch schlimmer war: Die Inflation hatte ihre Ersparnisse aufgefressen. »Wir waren arm«, wird Joseph später die Situation beschreiben. Man habe »eisern sparen« müssen, berichtete Bruder Georg. Mutter Maria macht alles selbst. Sie strickt. Sie putzt das Dienstzimmer. Sie hält einen Gemüsegarten. Sie stellt sogar Seife selbst her. Vater Joseph schneidet noch dünner als früher Scheibe um Scheibe von einer Wurst ab, um mit exakter Einteilung über die Runden zu kommen. Genügsamkeit wird zum Lehrmeister – und zu einer Tugend, die das Leben prägt.
Nicht verzichten aber wollte die Mutter auf einen gewissen Stil. Dass sie ihre Kinder in der Öffentlichkeit tipptopp kleidete, war auch auf ihre Herkunft aus einer wohlhabenden Bäckersfamilie und jene Formen zurückzuführen, die sie in den vornehmen Haushalten kennengelernt hatte, in denen sie beschäftigt war. Zu Hause aber trugen Maria, Georg und Joseph blaue Schürzen, ihren »Fetzen«, um das gute Gewand zu schonen. »Die Mutter war herzlich, liebevoll, gemütvoll und nicht so rational geprägt«, berichtete Joseph, »sie mochte es, aus dem Einfall, dem Augenblick heraus zu leben.« Insofern seien die Lebensstile seiner Eltern »sehr verschieden« gewesen. Die Strenge des Vaters habe sich darin geäußert, »dass er Pünktlichkeit und Genauigkeit verlangte, dass er bei Übertretungen von dem, was man nicht machen durfte, schon auch kräftig schimpfen und auch mal eine Watsche verabreichen konnte. Das galt damals als ganz normales Erziehungsmittel.«30
Georg sah es anders: »Er achtete eben sehr auf Genauigkeit und Ordnung. Aber er hat einem nie eine Watsch’n verpasst, sondern nur mal auf den Hintern.«31 Die Mutter sei hingegen, wenn es die Balgen allzu bunt trieben, schon mal mit dem Bettklopfer unterwegs gewesen. »Wir waren schon ganz normale Menschen«, kommentierte der spätere Papst. »Es ist nicht so, dass immer alles harmonisch gewesen wäre.« Auch zwischen den Eheleuten habe es »gelegentlich Krach« gegeben, »aber das Gefühl des Beieinanderseins und des Glücklichseins miteinander hat weit überwogen«. Letztlich habe »eine tiefe innere Einheit« bestanden, die diese Ehe zu einer glücklichen Partnerschaft gemacht habe.
Joseph spielt am liebsten zu Hause, in der Nähe der Mutter. Mit einem Holzpferd oder mit einem seiner Stofftiere. »Ein besonderer Bastler war er nicht«, berichtete Georg, »aber mit dem Baukasten sich was ausdenken, das mochte er gerne.« Gelegentlich kommt der fidele Benno aus Rimsting zu Besuch, der Lieblingsonkel. Benno liebt das Theater, fährt mit seiner Frau regelmäßig in einem luxuriösen offenen Sechssitzer-Automobil nach München in die Oper. Er besitzt einen Sportwagen der englischen Edelmarke MG, ein Rennruderboot, sammelt alte Motorräder und leistet sich eine Waffensammlung, die den ganzen Speicher einnimmt. Der Onkel gilt als Weiberheld und Glücksspieler, der das Geld in vollen Zügen aus dem Fenster wirft, aber er überrascht seine Neffen auch mit einem kleinen Altar mit drehbarem Tabernakel, den er gebastelt hatte. Ein anderes Mal packt er eine selbst bemalte Kulisse für die sorgsam gehütete Weihnachtskrippe der Familie aus.
Von Onkel Georg aus Buffalo in Amerika kommt gelegentlich ein Paket mit Lebensmitteln. Väterlicherseits ist Tante Theogona, die Klosterfrau, diejenige, die Kontakt hält. Onkel Alois, der Bruder des Vaters, als Priester ein leidenschaftlicher Anhänger der Volksliturgie, schickt Briefe, gibt ungebetene Ratschläge und mahnt, die Kinder sollten ihn doch häufiger in seiner Pfarrei in Niederbayern besuchen. In der Familie gilt Alois mit seinen oft absonderlichen Einfällen als kuriose Gestalt. »Er war gescheit«, wusste sein Neffe, »aber sehr eigenwillig.«
Die Großfamilie in Rickering im Bayerischen Wald, wo das Stammhaus der Ratzingers steht, um 1932. Anlass des Treffens ist der 80. Geburtstag der Großmutter. Der kleine Joseph sitzt vorn rechts, links sein Bruder Georg, seitlich dahinter Schwester Maria; in der hinteren Reihe rechts die Eltern, sitzend links Onkel Alois, der Priester.
© Archiv Nußbaum
Für Georg beginnt ein neues Kapitel. Er kann nun gemeinsam mit Schwester Maria die Schulbank drücken und ist mächtig stolz darauf. Auch für Joseph ändert sich einiges. Er ist drei Jahre alt, als ihn der Vater im Kindergarten der Englischen Fräulein im ehemaligen Augustiner-Eremiten-Kloster anmeldet. Die Eltern versprechen sich davon einen anregenden Umgang mit Gleichaltrigen und insgeheim wohl auch religiöse Bildung, auch wenn damit zusätzliche Kosten verbunden sind. Die 1855 gegründete »Kinderbewahranstalt« betreut rund 90 Mädchen und Knaben in getrennten Räumen. »Mittags mussten wir mit den aufgelegten Armen auf dem Tisch schlafen«, berichtete ein ehemaliges Kindergartenkind. Die strengen Kommandos, die ganze Zucht, und überhaupt: die Menge an Menschen – besonders anziehend findet »Beppi«, wie die anderen den Neuzugang rufen, die »Anstalt« nicht. Er wäre lieber zu Hause geblieben, bei der Mutter. Immerhin kommt es im Frühling 1931 zu einer Begegnung, die sich tief in sein Gedächtnis eingräbt.
Marktl gehörte zum Bistum Passau, Tittmoning aber ist Territorium des Erzbistums München-Freising, und es ist Michael Kardinal von Faulhaber, der sich für den 19. Juni 1931 zu einem Besuch angesagt hat. Faulhaber sollte eigentlich eine Firmung vornehmen, aber weil er schon mal in der Stadt ist, besucht er auch den Kindergarten. Sicherheitskommissär Ratzinger trägt Festuniform und einen goldglänzenden Helm, aber auch der kleine Joseph steht in Reih und Glied. Als der Fahrer des Kardinals mit dem gewaltigen Auto anhält, ist es mucksmäuschenstill. Erst als sich die Wagentür öffnet und der Kirchenfürst würdevoll aussteigt, beginnt sich die Erstarrung zu lösen. Beeindruckt von so viel Pracht und Ehre ist Joseph sich plötzlich ganz sicher: »Ich werd mal Kardinal.« Ein wenig mag der Ausruf freilich auch eine Replik auf den älteren Bruder gewesen sein. Der hatte, nachdem er den Vater fragte, wie denn die Menschen hießen, die die Musik in der Kirche machten, sofort erklärt: »Ich werde auch einmal Domkapellmeister.« Faulhaber allerdings schien den kleinen Joseph dann doch nicht so beeindruckt zu haben, dass sich das Berufsziel nicht auch wieder korrigieren ließe: »Ich werd mal Maler«, verkündet er wenige Tage später, nachdem ein Anstreicher die Wohnung der Familie in neuem Glanz erscheinen ließ.32