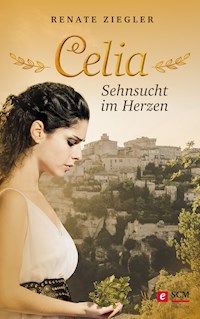Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SCM Hänssler
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Liebe im Alten Rom
- Sprache: Deutsch
Rom 92 n. Chr. - Nach dem gewaltsamen Tod ihres Vaters wird die junge Berenike als Sklavin nach Rom verschleppt. Sie landet im Haushalt des gefühlskalten Prätors Marcus Dequinius und soll sich um seinen Sohn Claudius kümmern. Berenike erkennt schnell, dass Marcus hinter seiner kalten Fassade nur die Angst vor Kontrollverlust verbirgt. Sie verliebt sich in den Witwer. Als er jedoch in gefährliche Machtkämpfe verwickelt wird, muss Berenike die wohl schwerste Entscheidung ihres Lebens treffen. Wird die beginnende Christenverfolgung alles verändern?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 361
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
SCM Hänssler ist ein Imprint der SCM Verlagsgruppe, die zur Stiftung Christliche Medien gehört,einer gemeinnützigen Stiftung, die sich für die Förderung und Verbreitung christlicher Bücher,Zeitschriften, Filme und Musik einsetzt.
ISBN 978-3-7751-7438-1 (E-Book)ISBN 978-3-7751-5864-0 (lieferbare Buchausgabe)
Datenkonvertierung E-Book:Satz & Medien Wieser, Stolberg© der deutschen Ausgabe 2019SCM Hänssler in der SCM Verlagsgruppe GmbHMax-Eyth-Straße 41 · 71088 HolzgerlingenInternet: www.scm-haenssler.de · E-Mail: [email protected]
Die Bibelverse sind, wenn nicht anders angegeben, folgender Ausgabe entnommen:Neues Leben. Die Bibel, © der deutschen Ausgabe 2002 und 2006 SCMR.Brockhausin der SCM Verlagsgruppe GmbH Witten/Holzgerlingen.
Umschlaggestaltung: Kathrin Spiegelberg, Weil im SchönbuchTitelbild: Frau: Ilina Simeonova / Trevillion Images, Kolosseum: Belenos /shutterstock.com; Renate Ziegler: Karin Ruider, Fotostudio Karin in RottenburgSatz: Satz & Medien Wieser, Stolberg
Inhalt
Über die Autorin
1. Clivius
2. Rom
3. Marcus Dequinius
4. Im Hause des Prätors
5. Der erste Tag
6. Erinnerungen
7. Der Patrizier Quintus Varus
8. Vater und Sohn
9. Vor dem Kaiser
10. Ein Pferd für Claudius
11. Das Soldatenspiel
12. Das Eheangebot
13. Bei Gericht
14. Reitstunden
15. Ein Hund für Claudius
16. Ein ernstes Gespräch
17. Das Wagenrennen
18. Berenike und Miran
19. Die erste Nacht
20. Der Tag danach
21. Vergangenheit
22. Glaubenszweifel und Glaubensfragen
23. Freiheit
24. Verlust
25. Berenikes Abschied
26. Griechenland
27. Ein Brief von Quintus Varus
28. Claudius
29. Der Traum
30. Die Gemeinde am Meer
Leseempfehlungen
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Über die Autorin
Renate Ziegler, Jahrgang 1965, arbeitet als Pfarramtssekretärin. Sie ist verheiratet mit Frank, hat zwei Kinder und lebt in Rottenburg am Neckar. Schon seit früher Jugend ist sie fasziniert von Kultur, Leben und Geschichte des Römischen Reiches.
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
1. Clivius
Clivius saß auf seinem Stuhl; er hatte sich zurückgelehnt und musterte das junge Mädchen, das vor ihm stand und trotz ihrer Angst seinem kalten Blick standhielt. Clivius sprach keinen Ton, sah sie nur an, abschätzend, so wie ein Händler die Ware prüft, die er zu kaufen gedenkt.
»Was soll ich mit ihr anfangen, Marcellus? Ist sie das Geld wert, das du verlangst?« Seine Frage galt einem römischen Hauptmann, der hinter dem Mädchen stand.
»O ja, das ist sie.«
Clivius lachte laut auf, rau, mitleidlos. »Sieh sie dir doch an, sie ist zu mager. Kann sie arbeiten? Zupacken?«
Marcellus zuckte mit den Schultern. »Sie hat den Haushalt ihres Vaters geführt«, meinte er fast gleichgültig.
»Ach, hat sie das?« Ungeduldig nahm Clivius ein kleines Messer in die Hand. »Wo hast du sie überhaupt her?« Er hob leicht den Kopf und fing an, mit dem Messer seine Fingernägel zu reinigen. An diesem armseligen Ding hatte er kein Interesse. Sie würde in Rom nicht viel bringen.
Der Hauptmann blieb ruhig. Er war sich seiner Sache sicher. Clivius würde das Mädchen nehmen. »Ihr Vater war ein kleiner Gelehrter, ohne Geld, aber mit einem sturen Kopf. Er war beteiligt an den Unruhen in der Stadt.« Ein zynisches Lächeln huschte über sein Gesicht. »Leider war ein römisches Schwert schneller als er.«
Clivius seufzte gelangweilt. Eine Fliege lief über den Tisch. Mit einem Stoß hatte er sie mit seinem Messer aufgespießt.
»Und?«
»Es heißt, er habe ihr alles beigebracht, was er selbst wusste.«
»Gebildete Sklavinnen sind nicht gefragt.«
Der Soldat machte zwei Schritte auf den Tisch zu und beugte sich vor. »Sie ist die Tochter des Emaios.«
Die Worte verfehlten ihre Wirkung nicht. Mit einem Schlag saß Clivius aufrecht. »Emaios, sagst du?« Als der Hauptmann nickte, sprang er auf, lief um den Tisch herum und fasste das Mädchen am Kinn. Er sah in ihre großen, vor Schreck weit aufgerissenen Augen.
»Du bist also Berenike, die Tochter des Emaios? Du bist das Mädchen, das sich gegen jegliche Heiratspläne erfolgreich zur Wehr setzte? Warum? Du hättest reich heiraten können, aber du wolltest nicht. Die ganze Stadt sprach davon.«
Sie antwortete nicht. Was sollte sie diesem Mann auch erzählen? Er würde sie doch nicht verstehen. Im Grunde kümmerte es ihn auch nicht.
Er fasste sie fester, sodass ihr Kiefer schmerzte. »Hattest du einen heimlichen Geliebten?« Er schüttelte den Kopf. »O nein, du nicht, du warst doch für deine Tugendhaftigkeit bekannt.« Mit einem spöttischen Lachen setzte er sich wieder. »So etwas gefällt in Rom.« Er wandte sich wieder an den Hauptmann. »Es ist nicht erlaubt, eine Sklavin wegen ihrer Unschuld zu einem höheren Preis zu verkaufen. Ich denke, das weißt du. Und trotzdem bietest du sie mir an?« Er sah Marcellus prüfend an. Zufrieden mit dem, was er sah, richtete er seinen Blick wieder auf das Mädchen. »Aber es gibt genügend Männer in Rom, die … nun …«, er machte eine Pause und ließ seinen Blick langsam an ihr hinuntergleiten. »… Jungfrauen bevorzugen.« Mit Genugtuung stellte er fest, dass jegliche Farbe aus ihrem Gesicht wich. »Sie zahlen gut dafür.«
Mit einem zynischen Lächeln setzte er sich wieder. »Hol die alte Hebamme!«, befahl er dem Hauptmann.
Nach einer Weile betrat eine alte, ziemlich dicke und schlampig gekleidete Frau den Raum. Sie musterte das Mädchen mit ihren kleinen dunklen Augen.
»Wie immer?«, fragte sie.
Clivius nickte. Die Alte streckte ihre Hand aus. Der Sklavenhändler gab ihr einen gefüllten Beutel, in den die Alte einen kurzen Blick warf. Dann packte sie das Mädchen am Arm und zog sie hinter sich her.
»Komm!« Sie brachte Berenike in einen Raum, in dem nur eine Liege stand. »Leg dich hin!«, befahl sie.
Entsetzt schüttelte das Mädchen den Kopf. »Nein!«
Aber die Hebamme packte sie am Arm, drückte sie auf die Liege. Berenike begann, sich zu wehren. Was sollte das? Warum durfte diese Frau das mit ihr machen?
»Du wagst es, dich zu widersetzen?« Die Alte lachte.
Jetzt erst bemerkte Berenike, dass die Frau eine Rute an ihrem Gürtel trug. Entsetzt sah sie, wie sie diese löste…
Nach einer Weile kam die Hebamme mit Berenike an ihrer Hand zurück. Das Mädchen war blass, ihr Kleid wirkte unordentlich. Sie zitterte am ganzen Körper und hielt ihren Blick gesenkt.
Berenike fühlte sich leer und beschmutzt. Ihr ganzer Körper schmerzte. Noch nie in ihrem Leben war sie so gedemütigt worden.
Aber das schien den Sklavenhändler nicht zu kümmern. »Und?«, fragte er stattdessen ungeduldig.
»Gute Ware«, meinte die Alte. »Aber widerspenstig. Sie hat doch tatsächlich versucht, sich zu wehren, dieses dumme Ding. Ich musste etwas nachhelfen.« Sie drehte Berenike zur Seite. Das Kleid war am Rücken blutbefleckt. An den Oberarmen hatte sie zwei rote Striemen.
Clivius zuckte gleichgültig mit den Schultern. »Das ist egal«, meinte er herablassend. »Einen Römer, der eine Jungfrau will, kümmert es nicht, ob er sie mit Narben bekommt. Im Gegenteil, es gefällt ihm. Und es wird ihm ein Vergnügen sein, sie zu zähmen.«
Als die Alte gegangen war, nahm er einen prall gefüllten Geldbeutel von seinem Gürtel und warf ihn dem Hauptmann zu. »Du hast gehört, Marcellus, die Ware ist gut. Ihre Stacheln werde ich ziehen. Aber das mindert natürlich den Preis.«
Der Hauptmann nickte, zufrieden mit dem Geschäft, das er gemacht hatte.
»Jetzt geh. Und halte den Mund. Und du«, wandte sich Clivius an das Mädchen, »wirst es dir gut überlegen, ob du noch einmal ungehorsam sein wirst, solange du bei mir bist.«
Und ohne Berenike noch eines Blickes zu würdigen, verließ Clivius nach dem Hauptmann den Raum.
Irgendeine Sklavin würde sich um das Mädchen kümmern, das immer noch zitternd dastand, unfähig, sich zu bewegen oder ihren Tränen freien Lauf zu lassen.
Es dauerte nicht lange und sie wurde in eine Kammer gebracht.
Berenike sah sich um.
In der Kammer waren mehrere schmale, einfache Liegen mit dünnen und zerschlissenen Decken darauf. In der Ecke stand ein Hocker mit einer Schüssel, daneben ein großer Wasserkrug. Sonst gab es keine Möbel. Durch ein kleines Fenster fiel spärliches Licht in den Raum.
Auf einer Liege saß ein junges, zartes Mädchen. Sie hatte sich an die Wand gelehnt und die Beine fest an sich gezogen. Ihr gegenüber lag ausgestreckt ein zweites Mädchen, die Arme unter dem Kopf.
»Nein«, flüsterte die Erste. »Nicht noch eine.«
Die andere, größere stand auf. »So.« Sie verschränkte die Arme über ihrer Brust. »Noch ein wertvolles Schmuckstück.«
Berenike war verwirrt. »Wertvoll?«
»Nun, dir müsste doch klar sein, warum du hier bist?«
»Ja. Aber …« Da erst wurde ihr bewusst, was das Ganze zu bedeuten hatte. »Ihr also auch?«, flüsterte sie.
Das größere Mädchen nickte. »Was hast du denn gedacht?«
»Aber was heißt das genau? Was geschieht jetzt mit uns?«
Das kleinere Mädchen saß noch immer zusammengekauert auf der Liege. »Er wird uns verkaufen. In Rom.«
Die größere deutete auf eine Liege. »Komm. Setz dich erst einmal.« Und als Berenike saß, fuhr sie fort: »Ich heiße Aglaia, das ist Xenia. Clivius hat uns schon vor längerer Zeit gekauft und von seiner Hebamme untersuchen lassen. Ich vermute, du hast sie auch kennengelernt.«
Berenike zuckte zusammen.
»Nun ja. Clivius wird in den nächsten Tagen nach Rom aufbrechen, um dort Sklaven zu verkaufen. Für uns wird er viel Geld bekommen. Darum behandelt er uns auch gut.«
Berenike sah auf die einfachen Liegen und die löchrigen Decken. »Das nennst du gut?«
Aglaia lachte. »Wir bekommen zumindest ausreichend zu essen und zu trinken. Wir bekommen Wasser zum Waschen und Kämme, um unser Haar zu machen. Und falls du frieren solltest, obwohl Sommer ist, bekommst du sicher eine bessere Decke. Es nützt ihm nicht, wenn du krank wirst.«
Das jüngere Mädchen nickte. »Clivius muss besonders gut auf uns aufpassen. Mit uns verdient er das Vielfache von dem, was er für eine einfache Sklavin erhält.«
Berenike zog ihre Knie an und legte ihre Arme um sie. Sie merkte, wie die Angst in ihr hochkroch. Immer stärker wurde ihr klar, dass sie dem Ganzen nicht entrinnen konnte und diesem Mann hilflos ausgeliefert war. »Aber was passiert mit uns, wenn ein Römer uns gekauft und getan hat … Ich meine, wenn er …« Es wollte ihr nicht über die Lippen. »Danach sind wir doch wertlos für ihn!«, rief sie schließlich.
Aglaia zuckte mit den Schultern. »Das liegt ganz an dir, was dann mit dir passiert. Ich habe vor, mich dem Römer so hinzugeben, dass er nicht genug von mir bekommen kann und mich zu seiner Geliebten macht. Dann habe ich mehr, als ich brauche. Schmuck, kostbare Kleider, allen Luxus, den man sich denken kann. Und ich muss nicht arbeiten. Die Geliebte eines reiches Römers zu sein ist nicht das schlechteste Leben.«
»Nein!« Berenike war entsetzt. »Das hieße sich verkaufen, das will ich nicht. Und das kann ich nicht. Ein solcher Mann erkauft das Recht, mich zu beschmutzen. Und ich danke es ihm noch, indem ich mich ihm ganz überlasse? Für Schmuck und Luxus? Nein!«
»Das musst du selbst wissen. Die Kleine da …« Mit einer abfälligen Handbewegung zeigte sie auf Xenia. »Die Kleine da sieht das genau wie du. Aber dann solltet ihr wissen, mit was ihr rechnen müsst.«
Xenia schluckte. Ihre Stimme war kaum ein Flüstern. »Im besten Fall wird uns der Mann, der uns gekauft hat, seinen Gästen anbieten als Zeitvertreib bei ihren ausschweifenden Feiern und Orgien. Vielleicht werden wir auch nur als Haussklavinnen zum Arbeiten eingesetzt. Im schlimmsten Fall verkauft er uns an ein billiges Bordell.«
Berenike zuckte zusammen. »Wie alt bist du, Xenia?«
»15 Jahre.«
»So jung?« Es war entsetzlich.
»Umso besser, wenn sie das Beste daraus macht«, meinte Aglaia ungerührt. »In ihrem Alter kann sie sicher noch am meisten erreichen.«
Berenike sprang auf. »Aglaia! Wie kannst du nur so etwas sagen? Es wird sie zerbrechen.«
Aglaia streckte sich auf ihrer Liege aus. »Es ist mir gleichgültig, was ihr macht. Ich weiß, was ich zu tun habe.«
Aglaia behielt recht mit ihrer Ankündigung. Clivius ließ die Mädchen auf das Beste mit Speisen und Getränken versorgen. Er selbst überzeugte sich jeden Tag von ihrem Wohlergehen.
Berenike fürchtete diese kurzen Augenblicke, wenn er in der Tür stand und sie nacheinander musterte. Jedes Mal hielt er eine Peitsche in der Hand, um ihnen deutlich zu machen, was sie bei einem Fluchtversuch erwartete.
Sein dreckiges Grinsen war Berenike zuwider. Und die Angst vor dem, was er mit ihnen vorhatte, bedrückte sie von Tag zu Tag mehr.
Dann war es so weit. Die Abreise war für den nächsten Tag angesetzt.
Xenia setzte sich am letzten Abend zu Berenike aufs Bett, ganz nahe. Berenike legte ihren Arm um sie, hielt sie fest. Wie so oft in den letzten Tagen.
»Darf ich dich etwas fragen?«
Berenike nickte. »Was möchtest du wissen?«
»Wie alt bist du?«
»Ich bin 19 Jahre alt. Warum fragst du?«
»Wie bist du in seine Hände gekommen? Mich hat er meinem bisherigen Herrn abgekauft, der mich nicht brauchte. Meine Eltern …« Xenia schluckte schwer. »Meine Eltern sind noch dort.« Nach einer kleinen Pause fuhr sie mit betont fester Stimme fort. »Aglaia wurde ihm von ihrer Herrin für wenig Geld überlassen, weil sie faul und widerspenstig war.«
Berenike schloss die Augen. Sie wollte nicht darüber sprechen, konnte Xenia aber auch nicht ohne Antwort lassen. »Ich war keine Sklavin«, sagte sie schließlich. »Ich war frei. Es ist etwas passiert …« Sie atmete tief durch. »Xenia, bitte sei mir nicht böse, ich möchte nicht darüber sprechen. Es ist erst wenige Tage her. Und ich habe es selbst noch nicht wirklich begriffen.« Sie atmete tief durch. »So viel will ich dir sagen: Ich habe meine Freiheit durch ein großes Unglück verloren. Ein Soldat hat mich schließlich an Clivius verkauft.«
Xenia nickte. »Du musst es mir nicht erzählen.« Sie lehnte sich an die Wand, zögerte und fragte dann doch weiter. »Aber, Berenike, eines verstehe ich nicht. Wenn du frei warst, müsstest du da nicht längst verheiratet sein? Mit 19 Jahren?«
Berenike seufzte. Sie dachte an die beiden Männer, die um sie geworben hatten.
»Es gab Männer«, erzählte sie. »Wohlhabende Männer, die mir ein gutes und sicheres Leben bieten konnten. Ein besseres, als ich bis dahin kannte. Aber ich habe mich gegen eine Heirat entschieden, obwohl ich von allen Seiten bedrängt wurde. Niemand verstand, wie ich eine solche Ehe ablehnen konnte.«
»Warum? Was sprach gegen eine Verbindung?« Xenia hatte sich neugierig aufgerichtet. Auch Aglaia spitzte die Ohren.
»Nun, es ist ganz einfach. Ich hätte mein Zuhause verlassen müssen und zu diesen Männern ziehen müssen. Aber das konnte ich nicht.«
Aglaia schnaubte verächtlich. »Warum nicht? Hast du sie etwa nicht geliebt? Das wäre der lächerlichste aller Gründe. Liebe sollte eine Frau nie erwarten. Ein Mann, der sie gut versorgt und ihr einen guten Stand bietet, ist mehr wert als Gefühle!«
Berenike ignorierte Aglaia. Sie wandte sich ganz Xenia zu. »Die Männer waren rechtschaffen und anständig. Aber ich hätte meinen Vater verlassen müssen. Meine Mutter ist schon lange tot. Und so arm mein Vater auch war, so arm wir auch lebten, er wäre nie mit mir gegangen. Unser kleines Haus war der Ort, wo er hingehörte und von dem er sich nie trennen würde. Für ihn wäre es gewesen, als würde er seine Frau, das Leben mit ihr, ein zweites Mal verlieren. Darum war für mich klar, dass ich meinen Vater nie allein lassen werde. Er versuchte zwar, mich von einer Heirat zu überzeugen, weil es mir dann besser gehen würde. Aber ich weiß, dass er im Grunde seines Herzens froh war, dass ich bei ihm geblieben bin.« Und zu Aglaia gewandt fügte sie hinzu: »Das musst du nicht verstehen. Das erwarte ich auch nicht von dir.«
Aglaia schüttelte verächtlich den Kopf. »Dir wird es in Rom übel ergehen«, höhnte sie.
Aber Xenia nahm Berenikes Hand. »Ich verstehe dich gut. Aber …« Sie fasste Berenikes Hand noch fester. »Aber jetzt ist er auch allein, nicht wahr?«
Berenike senkte den Blick, sah auf ihre Hände. »Nein«, sagte sie leise. Sie legte ihren Arm wieder um das jüngere Mädchen. »Er ist tot.«
Stille hüllte sie ein. Der Satz schwebte wie eine dunkle Wolke im Raum. Sie sprachen kein Wort mehr. Selbst Aglaia fühlte sich bedrückt.
Morgen würden sie aufbrechen. Nach Rom. In eine ungewisse Zukunft. Und ihre Vergangenheit würde zurückbleiben müssen.
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
2. Rom
Sie erreichten Rom um die Mittagszeit. Die Sonne brannte vom Himmel. Kein Wind wehte. Die Luft flimmerte in der Hitze.
Clivius ließ die Wagen anhalten. Er sah auf die Stadt, die vor ihnen lag. Ein zufriedenes Lächeln umspielte seine Lippen. Rom. Das bedeutete für ihn die Vergrößerung seines Vermögens.
Den Sklaven befahl er, sein Zelt aufzubauen. Da saß er dann im Schatten, trank Wein und kühles Wasser von einem nahen Brunnen, aß sich an frischem Obst und ausgewählten Speisen satt, während die Sklaven, die ihm dienen mussten, und die, die er verkaufen wollte, sich hungrig und durstig von der langen Reise unter die wenigen Bäume und Sträucher drängten, die nur spärlichen Schatten warfen.
Nur Berenike, Xenia und Aglaia, seine kostbarste Ware, durften in einem der Wagen bleiben. Nur sie bekamen ausreichend zu essen und zu trinken.
Hier würden sie auf die Nacht warten, denn es war verboten, am Tag die Stadt mit Wagen zu befahren. Die Straßen waren sehr eng. Dennoch spielte sich tagsüber das Leben der einfachen Bürger Roms auf ihnen ab, sodass jeder Wagen eine Gefahr bedeutet hätte.
Als es dunkel wurde, brachen sie auf und fuhren in das nächtliche Rom ein.
Die Stadt war durchzogen von Straßen und Gassen, die sich zu gleichen schienen. Kleine Plätze, meist als Marktplätze genutzt, öffneten den Blick zum Himmel. Aber von all dem konnte Berenike nicht viel erkennen, denn die Straßen selbst waren nicht beleuchtet. Zwar trugen die Sklaven Fackeln, aber deren Licht reichte gerade so weit, dass sie den Weg fanden und Hindernissen rechtzeitig ausweichen konnten. Sie konnte aber erkennen, dass links und rechts hohe, mehrstöckige Gebäude standen. Diese Häuser waren die Mietskasernen, die Insulae, in denen die meisten Römer wohnten. Sie hatten vier oder fünf Stockwerke. In den ebenerdigen Geschossen schienen Läden und Handwerksbetriebe zu sein. An manchen Häusern brannte eine Laterne. Das waren die Tavernen, in denen getrunken und gegessen, gefeiert und gespielt wurde. Die Wohnungen darüber waren klein und spärlich eingerichtet, hatten meist nicht einmal eine Küche. Aber das machte nichts. Man holte sein Essen in einer der vielen Garküchen oder aß in den Tavernen. Das Essen dort war billig und nahrhaft zugleich. Ob es auch schmeckte, war nicht wichtig, solange man satt wurde.
Von den großen Häusern und Villen der Reichen und Mächtigen, von den Tempeln, Theatern und Stadien war nichts zu erkennen. Die Dunkelheit zeigte nur die Enge Roms, nicht seine Größe und Pracht.
Und dennoch – hier wohnten auch die Menschen, die Geld und Macht besaßen, von Generation zu Generation vererbt, wie es gerade bei den Adligen, den Patriziern, der Fall war. Sie führten ihren Stammbaum bis auf die Gründer der Stadt Rom zurück, zählten sich zu den direkten Nachkommen von Romulus und Remus. Aus ihren Reihen bildete sich die Regierung Roms, der Senat. Sie stellten die höchsten Richter, die Prätoren, die ihr Amt immer für ein Jahr vom Kaiser verliehen bekamen.
Hier wohnten die Bürger, die im Staatsdienst oder beim Militär zu Rang und Ansehen und damit zu Vermögen gekommen waren oder die eine mächtige und reiche Familie im Hintergrund hatten.
Die meist einstöckigen Villen waren luxuriös ausgestattet. Eine Vielzahl von Sklaven ermöglichte einen bequemen und aufwendigen Lebensstil. Das war aber von außen nicht zu erkennen, denn die meisten Fenster öffneten sich zu den Innenhöfen. Nach außen zeigte sich lediglich eine schlichte Mauer. Nur der Eingang zeugte von dem Reichtum seiner Bewohner.
Berenike hatte von den großen Gebäuden gehört, vom Circus Maximus und dem neu erbauten Stadion des Kaisers Domitian, wo Wagenrennen, Gladiatorenkämpfe und andere spektakuläre Ereignisse stattfanden, von den Theatern und den unzähligen großen und kleinen Tempeln. Ihr Vater hatte ihr von dem neuen Palast des Kaisers auf einem der sieben Hügel Roms, dem Palatin, erzählt, davon, dass dieser an Pracht und Größe nicht zu überbieten war. Sie wusste, dass es große und mit allem Luxus ausgestattete Thermen gab, die der Ruhe und Erholung dienten und die allen Bürgern Roms, egal, ob arm oder reich, zugänglich waren.
Aber all dies blieb in der Dunkelheit der Nacht verborgen.
Schließlich erreichten sie einen Platz, der als Marktplatz diente. Überall standen einfache Holzstände. Wagen mit den verschiedensten Waren fuhren ein und wurden ausgeladen. Die Händler rüsteten sich für den nächsten Tag.
Überwacht wurde das Treiben von Prätorianern, Soldaten, die nachts ihre Rundgänge durch die Stadt machten, um an Orten wie diesen für Ruhe und Ordnung zu sorgen.
Am Ende des Platzes machte Clivius halt. Hier war der Sklavenmarkt. Sie waren am Ziel.
Clivius ließ die Sklaven ein hölzernes Podest aufbauen und einen Vorhang aufhängen, hinter dem er seine Wagen und die Pferde unterbrachte. Berenike und den beiden anderen jungen Mädchen befahl er, dort zu bleiben, bis er sie rufen würde. Wehe, wenn sie es wagten, auch nur einen Blick nach vorne zu werfen!
Bei Tagesanbruch stellte er die anderen Sklaven vor dem Vorhang auf. Er hatte vor, heute gute Geschäfte zu machen. Es würde sich schnell herumsprechen, dass er wieder in Rom war. Und seine besonderen Kunden würden nicht lange auf sich warten lassen.
Berenike fürchtete sich. Was würde nun geschehen? Das, was sie bis jetzt von Rom gesehen hatte, verängstigte sie. Die großen Häuser und die engen Straßen, die fremden Gerüche und Geräusche, nichts glich der kleinen beschaulichen griechischen Stadt, aus der sie kam. Die anderen beiden Mädchen sprachen kein Wort. Xenia war die Angst deutlich anzusehen. Aglaias hochmütiger Blick verdeckte wohl nur, wie es ihr wirklich zumute war.
Trotz des Verbots wagte es Berenike, den Vorhang leicht zur Seite zu schieben und nach vorne zu sehen. Sie musste wissen, wo sie war und was auf sie zukam. »Nicht, Berenike«, flüsterte Xenia erschrocken. »Du hast Clivius doch gehört.« Aber dieser bemerkte überhaupt nicht, was hinter seinem Rücken geschah. Er sprach mit einem Römer, der sichtlich verärgert war und kurz zu Berenike aufsah. Hastig zog sie den Vorhang wieder zurück.
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
3. Marcus Dequinius
Es war noch sehr früh am Morgen. Die Sonne war gerade erst aufgegangen. Der Prätor Marcus Dequinius war in Begleitung zweier Sklaven auf dem Weg zum Forum Romanum, dem wichtigsten Platz Roms. Hier war die Kurie, der Sitz des Senats. Hier waren die Tempel für die wichtigsten Götter. Hier wurden sie verehrt. Hier wurde ihnen geopfert. Und hier war der Platz, auf dem die Senatoren ihre Reden an das Volk hielten, auf dem diskutiert und debattiert und öffentliche Wahlen abgehalten wurden.
Hier stand auch das Gerichtsgebäude, aber heute wurde der Prätor in der Kurie erwartet. Marcus war schlecht gelaunt. Es war das elfte Jahr der Regierung des Domitian, der Senat verlor immer mehr von seiner Macht. Der Weg in die Kurie war daher ohne Bedeutung, das Erscheinen des Prätors dort diente hauptsächlich dazu, den Schein zu wahren. Aber als einer der obersten Richter Roms hatte er keine Wahl.
Es ärgerte ihn, dass er den Senat brauchte, denn dieser unterstützte seine Ernennung zum Prätor. Auch wenn der Kaiser letztendlich bestimmte, wer dieses Amt bekam, und dem Senat ungern Zugeständnisse machte, so hatte er doch nichts in der Hand, um Marcus dieses Amt zu verweigern. Der Prätor wusste, dass Domitian nach Gründen suchte, um ihn loszuwerden, aber er vermied alles, was ihn angreifbar machen konnte. Sein Ansehen in den vornehmsten Kreisen und bei den einfachen Bürgern Roms war hoch. Man fürchtete ihn, da er die Menschen durchschaute, aber man schätzte ihn auch, denn er war von großem Wissen in Recht und Tradition, unbestechlich und zuverlässig.
Der Weg zum Forum Romanum führte durch die Straßen und Gassen der Stadt. Marcus Dequinius und seine beiden Sklaven kamen zu einem der Marktplätze, auf denen die Händler und Handwerker ihre Waren lautstark anpriesen. Sklaven drängten an ihm vorbei, ebneten den Weg für ihre Herren, andere feilschten mit den Bäckern und Gemüsehändlern um die Preise. Lärm und Geschrei bestimmten das Bild des Platzes.
Marcus ließ die Händler hinter sich und überquerte den Sklavenmarkt. Die Sklavenhändler hatten Podeste aufgestellt, auf denen sie die Männer und Frauen, die sie verkaufen wollten, zur Schau stellten.
Marcus hatte gerade die Mitte des Platzes erreicht, als er angesprochen wurde.
»Brauchst du einen Sklaven, Herr?«
Marcus wandte unwillig den Kopf, er kannte diese Stimme. »Was willst du, Clivius?«
Der Prätor war ein großer, stattlicher Mann. Aber es waren nicht allein seine Größe und seine breiten Schultern, die ihm Autorität verliehen, es waren vielmehr die stolze, aufrechte Haltung und die Art, wie er alles mit scharfen Augen genau und distanziert zugleich betrachtete.
Nach dem Tod seiner Frau vor mehr als acht Jahren hatte er sich seinen Kopf kahl rasiert. Dadurch wirkten die Linien seines Gesichtes noch schärfer gezeichnet, sein Blick noch stechender. Er war kein schöner Mann, hatte nicht die klassische Nase und die fein geschwungenen Lippen, die vielen Römern eigen waren. Aber sein Gesicht war ausdrucksstark, und seine dunklen Augen schienen alles zu durchdringen.
Er war ein Mann mit einem starken Willen und festen Prinzipien, bekannt sowohl für seine Gerechtigkeit als auch für seine Härte gegen sich und gegen andere.
Neben ihm wirkte der Sklavenhändler noch kleiner, noch abstoßender.
Clivius wies auf die Männer und Frauen, die hinter ihm standen. Alle trugen den Reif um den Oberarm, der sie als Sklaven kennzeichnete.
»Sieh sie dir an. Es ist gute Ware.« Clivius zog einen jungen Mann zu sich heran. »Der hier ist stark. Und er ist harte Arbeit gewohnt. Er ist zwar ein Jude, aber er kennt sich gut mit Pferden aus. Und er ist …«
»Lass mich mit deinen Sklaven in Frieden, Clivius«, unterbrach ihn Marcus. »Und wage es nicht noch einmal, mich aufzuhalten.« Er wollte sich abwenden, sah dann aber, wie sich ein junges Mädchen hastig hinter den Vorhang zurückzog, den der Sklavenhändler aufgehängt hatte.
Marcus wusste um die schmutzigen Geschäfte des Clivius, er kannte den Handel, den er mit jungen Mädchen trieb.
»Was ist mit ihr? Warum enthältst du sie mir vor?«
Clivius hob abwehrend die Hände. »Sie ist nichts für dich, Herr. Sie ist schwach, kränklich. Nichts für einen so bekannten und geschätzten Mann, wie du es bist«, fügte er schmeichlerisch hinzu, wobei er sich vor dem Prätor leicht verbeugte, die rechte Hand auf die Brust gelegt.
Verächtlich sah Marcus auf diesen Mann hinab, der sich vor den Großen und Reichen duckte und die, die weniger waren als er, mit Füßen trat.
»Du glaubst, du kannst beurteilen, was gut oder schlecht für mich ist?«
»Nein, Herr, nein. Das würde ich mir nie anmaßen.«
»Gut, dann bring sie her.«
Widerwillig und nur mühsam seine Wut verbergend zog Clivius das Mädchen hinter dem Vorhang hervor. Marcus musterte sie lange. Ihr langes dunkles Haar schimmerte in der Sonne rötlich, es war zu einem losen Zopf gebunden. Das schmale Gesicht war blass. Sie hielt den Blick gesenkt. Marcus fasste sie am Kinn. Erschrocken sah sie ihn an, wich aber seinem Blick nicht aus. Ihre Augen waren von einem warmen dunklen Braun. Die Nase war schmal und zeigte leicht nach oben. Sie stand in einem angenehmen Gegensatz zu ihren vollen Lippen. Das Mädchen war schlank, fast mager. Ihr Körper war in ein einfaches Kleid gehüllt, das die schmalen Schultern nur notdürftig bedeckte. Als Gürtel diente ein altes Seil.
»Wie heißt du?«
»Ihr Name ist Berenike, Herr. Sie stammt aus Griechenland«, antwortete Clivius hastig, nur mühsam seine Wut beherrschend.
Für einen Moment zeigte sich Unmut in Marcus' Gesicht. Doch Clivius bemerkte es nicht.
»Wie alt bist du?«
»Sie ist 19 Jahre alt, Herr.«
Mit einer heftigen Bewegung drehte sich Marcus dem Sklavenhändler zu. »Ist sie taub, stumm oder versteht sie unsere Sprache nicht, dass du für sie antwortest?«, herrschte er ihn an.
Clivius wich erschrocken zurück. »Nein, Herr, nein.«
»Gut, dann schweige, wenn ich mit ihr rede.« Marcus wandte sich wieder dem Mädchen zu. Er nahm ihre Hände, sah sie sich genau an. »Du bist harte Arbeit nicht gewohnt. Aber kränklich scheinst du nicht zu sein«, fügte er mit einem Seitenblick auf Clivius hinzu. »Was kannst du, wenn nicht arbeiten? Singen? Tanzen?«
Berenike schüttelte den Kopf. »Nein, Herr.«
»Sie ist gebildet, Herr«, wagte Clivius einzuwerfen.
»Gebildet?« Marcus lachte. »Sie ist nur eine Frau. Und darum hebt es den Preis nicht.« Prüfend musterte er ihr Gesicht. »Du kannst lesen und schreiben?«
»Ja, Herr.«
»Du hast eine Schule besucht?«
»Mein Vater hat mich unterrichtet, Herr.«
»Dein Vater? War er denn ein Lehrer?«, fragte er belustigt.
»Ja, Herr.«
»Und was hat er dir noch beigebracht?«
»Alles, was er wusste.«
Wieder lachte Marcus. »Das besagt nichts«, meinte er spöttisch. »Vielleicht wusste er ja nicht viel. Dann konnte er dich auch nicht viel lehren. Aber es ist sowieso nicht wichtig.« Langsam drehte er sich zu Clivius um. »Ich gebe dir zweihundert Denare.«
Clivius sog hörbar die Luft ein. »Ich kann das Zehnfache für sie bekommen, Herr.«
»Sie ist nicht mehr wert.«
»Sie ist gebildet.«
»Wäre sie ein Mann, wäre das etwas anderes, aber so spielt es keine Rolle.«
»Herr, für zweihundert werde ich sie dir nicht geben. Sie ist mehr wert«, betonte Clivius noch einmal.
Marcus nickte bedächtig. »Du vergisst eines, Clivius. Der Wert, den du ihr beimisst, ist für mich ohne Bedeutung. Dich aber kann er die Freiheit kosten.«
Clivius wollte aufbrausen, besann sich dann aber. Marcus war Prätor, er war bekannt, was er sagte, galt etwas. Die Warnung war deutlich genug gewesen. Es war besser, auf dieses Geschäft einzugehen, als alles zu riskieren. Darum nickte er nur ergeben.
»Dann zahle diesen Mann aus«, befahl Marcus einem seiner Sklaven. »Nimm das Mädchen und bring sie zu Camilla. Badet sie, kämmt sie und zieht ihr ein anderes Kleid an. Ich will sie heute Abend sehen.«
Damit wandte er sich um und ging Richtung Forum Romanum davon, ohne Clivius noch eines Blickes zu würdigen.
Dieser überließ laut fluchend das Mädchen dem Sklaven.
O nein, er würde es sicher nie mehr wagen, den Prätor Marcus Dequinius aufzuhalten.
Der Prätor war noch schlechter gelaunt als zuvor von der Kurie im Gerichtsgebäude angelangt. Er war sich wie in einer unwürdigen Komödie vorgekommen, als er dem Senat seinen Bericht gab. Oh, wie er es hasste, wie ein Spielstein hin und her geschoben zu werden, nur um einen Glanz vorzutäuschen, der schon lange nicht mehr bestand. Aber er wollte auf keinen Fall, dass der Schreiber und die Rechtsgelehrten, die sich außer den streitenden Parteien im Gerichtssaal aufhielten, bemerkten, in welcher Stimmung er war, und es durfte nicht sein, dass die Parteien oder das Verfahren unter seiner Wut litten. Mit einer heftigen Handbewegung schob er seinen Unmut zur Seite und betrat den Gerichtssaal, um sich den Menschen zu widmen, die sich von ihm eine Entscheidung erhofften.
Wie immer war das Verfahren öffentlich. Viele Zuhörer waren zugegen, bereit, ihre Meinung zu den Aussagen durch lautes Rufen, Lachen oder Klatschen zu kommentieren.
Als Prätor würde Marcus heute noch kein Urteil fällen. Seine Aufgabe war es, die Parteien anzuhören, abzuwägen, ob die Klage, die erhoben wurde, berechtigt war und in einem Gerichtsverfahren geklärt werden sollte. Er hatte heute nur darüber zu entscheiden, ob der Fall auf die Prozessliste gesetzt wurde und welchem Gericht er zugeteilt wurde. Das eigentliche Urteil wurde in einem Geschworenengericht gefällt. Dort führte er zwar den Vorsitz, an der Entscheidung selbst war er aber nicht beteiligt.
Also saß er da und sah sich die Männer an, die vor ihm standen und sich um das Besitzrecht an einem Sklaven stritten. Es war ein kleiner Fall, ermüdend und eigentlich sinnlos.
Der eine von ihnen gab an, einen jungen Sklaven vom anderen gekauft zu haben und damit der Eigentümer zu sein, der andere wiederum behauptete, nicht den vollen Kaufpreis erhalten zu haben und deshalb bis zu dessen Zahlung als Einziger ein Recht an dem Mann zu haben.
Marcus ließ die Männer reden, hörte sich schweigend an, was sie vorzubringen hatten, und musterte dabei ihre vom Streit erhitzten Gesichter. Oft war hier die Wahrheit eher zu finden als in dem, was gesagt wurde.
Die Zwischenrufe der Zuhörer ignorierte er. Daran hatte er sich längst gewöhnt.
Irgendwann merkten die Männer, dass der Prätor kein Wort sagte. Ihre Argumente und Streitereien schienen ihm gleich zu sein. Verwirrt hörten sie auf, sich gegenseitig Beleidigungen und Vorwürfe zuzuschreien. Abwartend standen sie da. Aber ihr Richter sagte kein Wort. Er lehnte in seinem Stuhl, den linken Ellbogen aufgestützt, die Hand am Kinn. Keine Miene verriet, was er über den Fall dachte, wie er ihr Gerede aufgenommen hatte. Nur seine dunklen Augen waren auf die Männer gerichtet, aufmerksam und abwartend zugleich.
Auch die Zuhörer wirkten gespannt. Was war heute von ihrem Prätor zu erwarten?
Es war unangenehm, dazustehen und gemustert zu werden. Jeder fürchtete diesen Blick, der kühl und distanziert auf den Menschen ruhte und der alles zu durchdringen schien.
Eine fast unheimliche Stille legte sich über die Szene. Schließlich wagte sich einer der Männer einen Schritt vor. »Was ist nun, Herr? Wirst du meine Klage zulassen?«, fragte er vorsichtig.
Marcus ließ seinen Blick von einem zum anderen gleiten. Dann wandte er sich an den, der gefragt hatte. »Du, Liber, hast also den Sklaven verkauft?«
»Ja, das habe ich.«
»Der Preis?«
»Eintausend Denare.«
Die Zuhörer pfiffen durch die Zähne. Was für eine Summe!
Der Prätor nickte bedächtig. »Ein stolzer Preis, mein Freund.«
»Es ist ein guter Sklave. Und er versteht sich sehr gut auf Pferde. Ich hatte ihm meinen ganzen Stall anvertraut.«
»Und warum hast du ihn dann verkauft, wenn er so wertvoll ist?«
»Weil, ja, weil – ich war in Geldnot.«
Die Zuhörer lachten laut auf. Ein spöttisches Lächeln huschte über Marcus' Gesicht. Dieser Mann, der vor ihm stand, war sowohl für seine Betrügereien als auch für seinen Reichtum bekannt.
»Und wie viel hat dir Aulus gegeben?«
»Nur sechshundert Denare.«
»Ist das wahr?«
Aulus nickte. »Ja, das ist wahr. Dieser Preis war ausgehandelt worden.«
Marcus versank wieder in Schweigen, während er die beiden Männer miteinander verglich. Liber mit dem unsteten Blick, den Händen, die ständig in Bewegung waren, da an einer Falte zupften, dort ein Haar entfernten. Und Aulus, bekannt für seine Ruhe und Ehrlichkeit, aber auch für seinen plötzlich auftretenden Jähzorn, der ihn auch hier wieder hingerissen hatte.
»Ihr seid alleine gekommen. Wurde der Vertrag denn nicht vor Zeugen geschlossen? Ihr habt keine bei euch, wie ich sehe.«
»Nein«, erwiderte Aulus ernst. »Ich habe auf die Ehrlichkeit dieses Mannes vertraut.«
»Gibt es wenigstens eine schriftliche Vereinbarung?«
Aulus und Liber schüttelten den Kopf.
Marcus seufzte. Er hasste diese Art von Streitereien, bei denen es keine Beweise gab, nur Menschen, die versuchten, sowohl ihn als auch andere zu betrügen. Sie verlangten, dass er Recht sprach, aber das konnte er nicht. Hier war nur eine Entscheidung möglich.
»Ihr seid gebildete Männer. Und ihr wisst beide, wie die Entscheidung vor Gericht ausfallen wird. Ihr habt einen Vertrag geschlossen, aber ihr habt dabei nicht beachtet, was das Gesetz und die Tradition verlangen. Es waren keine Zeugen zugegen, als ihr eure Vereinbarung getroffen habt. Ihr wisst deshalb, dass euer Handel daher nicht vom Gesetz geschützt ist. Und dennoch wollt ihr, dass ich die Klage annehme und einen Gerichtstermin festsetze?«
Die beiden Männer bejahten die Frage.
Marcus nickte. Schließlich wies er den Gerichtsschreiber an, den Fall auf die Prozessliste zu setzen. Liber wollte ihn noch dazu drängen, den Prozesstermin bereits auf einen der nächsten Tage festzulegen. Aber Marcus gab ihm mit einem Blick zu verstehen, dass er von der ganzen Sache genug hatte und dass sie damit entlassen waren.
Unter dem Gespött der Zuhörer verließen die beiden Parteien den Gerichtssaal.
Als die beiden Männer weg waren, lehnte sich Marcus wieder zurück und schüttelte den Kopf. Er ärgerte sich, wenn er seine Zeit mit Fällen verschwenden musste, die lächerlich klein waren und eigentlich unwichtig. Aber das römische Recht ließ ihm keine Wahl. Beide waren Bürger Roms. Sie hatten einen Anspruch darauf, wenigstens von ihm gehört zu werden. Und auch wenn klar war, dass Liber den Fall verlieren würde, so musste er doch den Gerichtstermin festsetzen und wahrnehmen.
Er stand auf und trat durch eine kleine Tür hinaus auf einen schmalen Balkon. Unter ihm erfüllte das Leben der Menschen die Straßen. Und die Begebenheit vom Morgen kam ihm wieder in den Sinn.
Warum hatte er das Mädchen nur gekauft? Er konnte sie eigentlich zu nichts gebrauchen. War es wirklich nur die Tatsache gewesen, dass Clivius der Händler war und er dessen Machenschaften nicht gutheißen konnte? Nein, das war es nicht allein. Was gingen ihn die Geschäfte dieses Sklavenhändlers an! Darum sollten sich andere kümmern.
Dann dachte er wieder an ihr Gesicht, die Angst und der Stolz, der aus ihren klugen Augen sprach. Vielleicht war es das gewesen. Schon immer hatten die Menschen am meisten seine Aufmerksamkeit erregt, deren Denken und Fühlen, deren ganzes Wesen in ihren Augen zu liegen schien, Menschen, die sich über ihren Blick mitteilten, bewusst oder unbewusst.
Aber was sollte er mit ihr anfangen? Sie einfach der Sklavin Camilla überlassen, die sich immer und immer wieder darüber beklagte, dass zu viel Verantwortung auf ihren Schultern lastete? Regelmäßig stöhnte sie darüber, dass sie sich zusätzlich auch noch um seinen Sohn Claudius kümmern musste. Marcus verfolgte diesen Gedanken weiter. Er war zwar froh, dass Camilla seinen Haushalt führte, sie war gewissenhaft und zuverlässig, aber das war auch alles. Es wäre sicherlich gut, wenn Claudius außerhalb der Schule von jemandem betreut wurde, dem er nicht lästig war. Vielleicht sollte er es mit diesem Mädchen versuchen. Wenn es stimmte, was sie gesagt hatte, besaß sie eine gewisse Bildung. Das konnte seinem Sohn nicht schaden. Er wusste, dass es nicht ganz ungefährlich war, Claudius einfach dieser jungen Sklavin zu überlassen. Das Mädchen hatte zwar einen guten Eindruck auf ihn gemacht, aber woher sollte er wissen, was sie dachte, was sie ihm erzählen und welche Flausen sie ihm in den Kopf setzen würde? Aber wusste er es bei Camilla? Wusste er überhaupt, was sein Sohn dachte?
Der Schreiber erschien in der Tür. »Herr, es ist schon spät, und es sind noch einige Fälle zu behandeln.«
Marcus nickte. Er sah noch einmal auf die vielen Menschen hinab. Ja, er würde es wagen und diesem Mädchen seinen Sohn anvertrauen.
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
4. Im Hause des Prätors
Camilla hatte die Hände in die Hüften gestemmt und musterte die neue Sklavin. Zuerst galt es, ihr klarzumachen, wen sie da vor sich hatte.
»Ich bin Camilla, und ich führe den Haushalt des Prätors. Ich bin für alles verantwortlich, was im Hause geschieht. Damit meine ich den Wohnbereich und die Gärten, nicht die Ställe und die Nebengebäude. Ich stehe als Erste auf und gehe als Letzte zu Bett. Jeden Tag. Nur ein Sklave hat den gleichen Rang wie ich, und das ist Lygius. Er trägt die Verantwortung für alles außerhalb des Wohnbereiches. Du wirst ihn morgen kennenlernen, wenn wir zu Mittag essen. Du weißt, was das bedeutet? Du bist mir gegenüber zu absolutem Gehorsam verpflichtet.«
Camilla vergewisserte sich mit einem Blick, dass Berenike sie verstanden hatte. Dann sah sie sich das Mädchen genauer an, musterte sie von oben bis unten. »Ja«, meinte sie. »Ein Bad hast du wirklich nötig. Also zieh dich aus«, befahl sie barsch.
Berenike löste ihren Gürtel und schlüpfte aus dem Kleid. Camilla nahm ihr die schmutzigen Sachen ab und warf sie angewidert in eine Ecke des Raumes.
Dabei entdeckte Camilla die Striemen auf ihrer Haut. Sie fasste Berenike an den Schultern und sah sich ihren Rücken an. Sie seufzte leicht. »Das werde ich dem Prätor melden müssen.« Sie sah die Angst und Unsicherheit in Berenikes Augen und lächelte ihr aufmunternd zu. »In diesem Haus hast du nichts zu befürchten.«
Berenike erwiderte nichts. Sie dachte an die kühlen Augen ihres Herrn, an seine hochmütige und spöttische Art und daran, wie er über sie gelacht hatte. Sie hatte Angst vor diesem Mann, wusste nicht, was er von ihr wollte. Woher sollte sie auch wissen, dass sein Verhalten ihr gegenüber nur dazu gedient hatte, Clivius in seine Schranken zu weisen?
Camilla betrachtete das Mädchen. Sie war eine stolze Frau, die sich ihrer Stellung unter den Sklaven sehr wohl bewusst war. Marcus hatte ihr nach dem Tod seiner Gemahlin die Führung des Haushalts anvertraut. So würde es auch ihre Aufgabe sein, Berenike in die Lebensgewohnheiten dieses Hauses einzuführen und ihr ihren Platz unter den Sklaven zuzuweisen.
Camilla war vierzig Jahre alt, aber ihr forsches und strenges Wesen hatte ihr Gesicht geprägt und ließ es älter erscheinen. In ihrer Jugend musste sie von einer herben Schönheit gewesen sein.
»Berenike«, versuchte sie das Mädchen zu beruhigen, und ihre Stimme klang plötzlich erstaunlich weich. »Vor was fürchtest du dich?«
»Vor ihm.«
Camilla schüttelte den Kopf. »Er wird dir nichts zuleide tun.«
»Er ist ein Römer.«
»Spricht das gegen ihn?«
Berenike antwortete nicht. Sie fühlte sich allein, verlassen. Sie war bisher ein freier Mensch gewesen, hatte ein freies Leben geführt. Ihr Vater hatte sie immer vor den Römern gewarnt. »Sie führen ein ausschweifendes Leben, Kind. Nichts ist ihnen heilig. Achtung vor den Frauen, ja, vor den Menschen überhaupt ist ihnen fremd. Nimm dich vor ihnen in Acht.« Und jetzt war sie in Rom, mitten unter diesen Menschen, die ihr Vater so verachtet hatte. Sie wusste nicht, ob sie Camilla vertrauen konnte. Aber war das überhaupt von Bedeutung? Sie war eine Sklavin, der Willkür ihres Herrn ausgeliefert. Gegen ihn würde sie sich nicht wehren können. Und diese Frau genoss sein Vertrauen. Immerhin, sie war freundlich zu ihr. Berenike beschloss, es einfach zu versuchen. Sie hatte ja nichts mehr zu verlieren.
»Was habe ich von ihm zu erwarten?«, fragte sie. »Ich meine – als Frau«, fügte sie leise hinzu.
Berenike erschrak, als Camilla ihr sanft über die Wange strich. »Davor also fürchtest du dich! Es gab wohl noch keinen Mann in deinem Leben?«
Berenike schüttelte den Kopf.
»Ich verstehe. Und du denkst, dass dies der Grund ist, warum er dich gekauft hat?«
»Er möchte mich heute Abend sehen.«
»Ja, aber nicht, um dich zu besitzen. Man sagt, er habe seit dem Tod seiner Gemahlin keine Frau mehr angerührt. Er wird bei dir keine Ausnahme machen. Er mag auf dich einen harten, herzlosen Eindruck machen, aber glaube mir, er würde nie einem Sklaven ein Leid zufügen. Wir sind zwar sein Eigentum, aber im Gegensatz zu vielen anderen in dieser Stadt betrachtet er uns auch als Menschen. Tu nur deine Pflicht und halte dich im Hintergrund, mehr verlangt er nicht von dir.«
»Und was ist meine Pflicht?«
»Das zu tun, was ich dir auftrage.«
Marcus war spät nach Hause gekommen. Er hatte seinen Sohn begrüßt und zusammen mit diesem eine kleine Mahlzeit zu sich genommen. Dann hatte er sich in seinen Arbeitsraum zurückgezogen. Er war über seine Bücher gebeugt, als Camilla mit Berenike eintrat.
»Herr, ich bringe dir das Mädchen.«
Marcus legte die Schriftrolle, die er in der Hand hielt, auf den Tisch und lehnte sich zurück, wobei er den linken Ellbogen auf die Stuhllehne stützte. Lange sagte er kein Wort, sah die junge Sklavin nur prüfend an.
Sie stand aufrecht und erwiderte seinen Blick. Aber ihre Angst blieb nicht vor ihm verborgen. Er sah die Anspannung in ihrem Gesicht, die Blässe um Nase und Mund, das leichte Zittern ihrer Hände.
Schließlich wandte er sich an Camilla. »Ich möchte, dass sie dir zur Hand geht. Ich will sie nicht in der Waschküche sehen und nicht bei schwerer Arbeit. Sie soll da sein, wenn ich esse, und mir abends den Wein bringen. Außerdem soll sie sich hier im Haus um Claudius kümmern und ihn zur Schule begleiten. Einzig, wenn er sich mit seinen Freunden trifft, wird sie keine Verantwortung für ihn tragen. Das bleibt Ulbertus' Aufgabe.«
Camilla war überrascht. Schon lange hatte er ihr nicht mehr vorgeschrieben, welche Arbeit sie einer Sklavin geben sollte. Aber sie war mit seiner Entscheidung mehr als zufrieden. Daher nickte sie gehorsam.