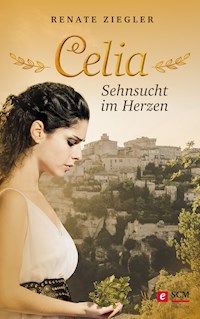
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SCM Hänssler
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Liebe im Alten Rom
- Sprache: Deutsch
Was man im Herzen trägt, vergisst man nicht Rom 95 n. Chr., die Ereignisse überschlagen sich: ein geplanter Anschlag geht schief, die Mutter der 4-jährigen Julia wird schwer verletzt und das Mädchen ist plötzlich auf der Flucht. 14 Jahre später: An all das kann sich die hübsche Julia, die nun Celia heißt, nicht erinnern. Für sie erscheint die Welt in Larisa bei ihren Eltern völlig in Ordnung. Doch dann gerät alles ins Wanken: Ihr Vater wird wegen seines Glaubens fast getötet, der berechnende Statthalter Titus Pectore könnte Celias Rettung sein und lange verschüttete Erinnerungen brechen hervor. Welcher Sehnsucht in ihrem Herzen soll sie folgen? Und wo kann sie Antworten auf die brennenden Fragen nach ihrer Vergangenheit finden?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 378
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SCM Hänssler ist ein Imprint der SCM Verlagsgruppe, die zur Stiftung Christliche Medien gehört, einer gemeinnützigen Stiftung, die sich für die Förderung und Verbreitung christlicher Bücher, Zeitschriften, Filme und Musik einsetzt.
ISBN 978-3-7751-7483-1 (E-Book)ISBN 978-3-7751-6009-4 (lieferbare Buchausgabe)
Datenkonvertierung E-Book:Satz & Medien Wieser, Aachen
© 2020 SCM Hänssler in der SCM Verlagsgruppe GmbHMax-Eyth-Straße 41 · 71088 HolzgerlingenInternet: www.scm-haenssler.de; E-Mail: [email protected]
Umschlaggestaltung: Nakischa Scheibe / Stephan SchulzeTitelbild: Dorf Provence: © Oleh Slobodeniuk / iStock, Frau: © Diana Hirsch / iStock,Renate Ziegler: © Karin Ruider / Fotostudio Karin in RottenburgSatz: Satz & Medien Wieser, Aachen
Inhalt
Über die Autorin
I Rom ‑ 95 nach Christus ‑
1. Priscilla
2. Briefe
3. Freundschaft
4. Verrat
5. Abschied
II Larisa ‑ 109 nach Christus ‑
6. Der neue Statthalter
7. Im Gefängnis
8. Das Angebot
9. Im Hause des Statthalters
10. Streit
11. Ungerechtigkeit
12. Was ist Wahrheit
13. Zweiter Versuch
14. Wunsch und Wirklichkeit
15. Der Graben
16. Geständnisse
III Sumelocenna ‑ 112 nach Christus ‑
III Sumelocenna
Leseempfehlungen
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Über die Autorin
Renate Ziegler, Jahrgang 1965, arbeitet als Pfarramtssekretärin. Sie ist verheiratet mit Frank, hat zwei Kinder und lebt in Rottenburg am Neckar. Schon seit früher Jugend ist sie fasziniert von Kultur, Leben und Geschichte des Römischen Reiches.
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
I Rom‑ 95 nach Christus ‑
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
1. Priscilla
Priscilla hatte die Augen geschlossen und genoss es, Eusebias Hände in ihren Haaren, an ihrem Kopf zu spüren. Sie mochte es, von ihrer Sklavin frisiert zu werden, die darin sehr geschickt war. Priscilla hatte sie kurz nach ihrer Eheschließung mit Gaius Dexter gekauft und zu ihrer Leibsklavin gemacht.
Eusebia steckte die letzte Nadel in das blonde Haar, prüfte noch einmal, ob alles gut und sicher saß. »Herrin, ich bin fertig«, sagte sie.
Priscilla öffnete die Augen und schnippte mit dem Finger. Eine junge Sklavin, die abwartend neben ihr stand, reichte ihr einen mit Blumenranken aus Silber umfassten Handspiegel. Priscilla betrachtete sich wohlgefällig darin. Sie war vielleicht nicht mehr so schön wie vor zwanzig Jahren und hatte vielleicht ein etwas zu rundes Gesicht, aber andere Frauen in ihrem Alter sahen deutlich älter aus. Und Eusebia schaffte es immer wieder, die Frisur so zu legen, dass diese ihre vollen Backen schmaler und ihre kleinen Augen größer wirken ließ. Zufrieden nickte sie. Ja, Eusebia verstand ihr Handwerk sehr gut. Und heute war das besonders wichtig, da Priscilla zusammen mit ihrem Mann beim Kaiser zu Gast sein würde.
Plötzlich durchriss ein lauter Schrei die Stille. Priscilla fuhr auf. »Das war Lia.«
Hastig legte sie den Spiegel zur Seite und verließ den Raum hin zum Peristylium, dem großräumigen Innenhof, der als Garten angelegt war, gefolgt von Eusebia, die ständig »Herrin, deine Frisur!« rief.
Aber Priscilla hörte nicht darauf. Sie durchsuchte das Peristylium mit ihren Augen. Der Garten war groß und umgeben von einem Säulengang, an den die Schlafräume grenzten. So schön er auch war mit den Blumenbeeten und dem kreuzförmigen Wasserbecken in der Mitte, jetzt erschien er Priscilla zu groß, um ihn mit einem Blick erfassen zu können.
Dann aber sah sie ihre kleine Tochter Julia, die von allen nur Lia genannt wurde. Sie lag neben dem Wasserbecken auf dem Boden, ihre drei Brüder hatten sie fest im Griff. Die 16-jährigen Zwillinge hielten sie an den Händen und Füßen fest, während der 18-jährige Gaius versuchte, ihr etwas in den Mund zu stecken. Lia versuchte verzweifelt, sich aus der Umklammerung zu lösen. Aus ihrem Mund kam nur noch ein kaum hörbares Schluchzen. Die Sklavin Tuja, die sich um Lia kümmern sollte, stand hilflos daneben. »Jetzt iss schon!«, rief Gaius und lachte dabei boshaft. »Das wird dir schmecken.«
Außer sich vor Sorge rannte Priscilla zu ihren Kindern. »Gaius. Was tust du da? Was hast du in der Hand?« Entsetzt erkannte sie, dass es sich um einen mit Gipspulver und Wasser getränkten Schwamm handelte, wie er zum Scheuern der Steinböden benutzt wurde. Priscilla war aufgebracht. Was, wenn sich Lia daran verschluckte? Warum mussten die Jungen ihre kleine Schwester immer ärgern, ja, sogar in Gefahr bringen? »Gaius!«, schrie sie. »Hör auf!«
Ihr Sohn richtete sich auf. Aus dem Schwamm, den er immer noch in seiner Hand hielt, tropfte es auf den Bauch seiner Schwester. Sein schlanker Körper straffte sich, mit kalten Augen sah er Priscilla an.
Diese zuckte zusammen und blieb erschrocken stehen. Wie sehr ähnelte ihr ältester Sohn doch seinem Vater!
»Was willst du?« Die Stimme ihres Sohnes klang verächtlich. »Du hast mir nichts zu befehlen.«
»Ich bin immer noch deine Mutter.«
»Na und? Du bist trotzdem nur eine Frau.«
Es war nicht das erste Mal, dass ihr Sohn sie so behandelte. Sie kannte es gar nicht anders. So wandte sie sich an die Zwillinge. »Lasst eure Schwester los!«
Aber beide grinsten sie nur unverschämt an und lockerten den Griff um Arme und Beine von Lia kein bisschen. Dem kleinen Mädchen liefen die Tränen ungehindert über die Wangen, doch sie hatte es aufgegeben zu schreien oder sich zu wehren. Zu stark waren ihre Brüder für sie.
»Das werde ich eurem Vater erzählen. Er wird euch das nicht durchgehen lassen.«
Das Grinsen auf den Gesichtern ihrer Söhne wurde breiter. Priscilla lief es kalt den Rücken hinunter. Nein, ihr Mann würde die Jungen nicht tadeln, sondern sie in ihrem Tun bestärken. Nur schon deswegen, um sie zu demütigen. Und das wussten ihre Söhne.
Die vierjährige Lia lag noch immer leise schluchzend auf dem Boden. »Bitte«, flehte Priscilla. »Lasst sie los.«
Die Zwillinge schauten ihren ältesten Bruder an. Dieser nickte herablassend, sodass sie ihre Schwester freigaben.
Priscilla bückte sich und half dem Mädchen beim Aufstehen. »Komm, mein Liebes.« Sanft strich sie ihr die Tränen aus dem Gesicht. Dann hob sie sie auf und trug sie unter dem höhnischen Gelächter ihrer Söhne aus dem Peristylium hinaus. In ihrem eigenen Schlafraum setzte sie sich mit dem weinenden Mädchen aufs Bett. »Du bleibst heute Nacht hier. Tuja und Eusebia werden auf dich aufpassen, wenn ich weg bin. Deine Brüder können dir heute nichts mehr tun.«
Die kleine Lia ließ sich jedoch nicht beruhigen. Im Gegenteil. Hilflos sah Priscilla zu ihrer Leibsklavin. Diese nickte. »Du kannst dich auf mich verlassen, Herrin. Aber – es ist spät. Deine Frisur ist wieder durcheinandergekommen. Und du musst noch dein Festkleid anlegen.«
Priscilla seufzte. Dieses Fest. Lieber wäre sie zu Hause geblieben, hätte sich um Lia gekümmert. Zärtlich strich sie ihrer Tochter über die Wangen. »Macht es dir etwas aus? Du kannst ja mitkommen und dabei zusehen, wie Eusebia mich zurechtmacht.«
Lia nickte. Sie schluchzte noch einmal auf und wischte sich mit den Händen die Tränen aus dem Gesicht. Dann stand sie auf und nahm die Hand ihrer Mutter. Gemeinsam gingen sie in den Ankleideraum, wo Eusebia ihr Werk vollendete.
Als Priscillas Ehemann, der Tribun Gaius Dexter, wenig später das Haus betrat, kam ihm seine Frau bereits vollständig für den Abend zurechtgemacht entgegen.
Priscilla trug ein blaues Seidenkleid, das ihre Figur in kunstvoll gelegten Falten umspielte und gut zu ihrem blonden Haar passte. Der Saum schloss mit einem schmalen golddurchwirkten dunkelblauen Band ab. Das gleiche Band, doppelt gefasst, diente als Unterbrustband. Der Stoff fiel sanft über Schultern und Brust. Eine Kette aus Gold, ein Armband und Ohrringe, die mit blauen Steinen besetzt waren und die Form einer Schlange nachzeichneten, rundeten das Ganze ab. Priscillas Haare waren zu einer kunstvollen Frisur hochgesteckt. Das gleiche Goldband wie an ihrem Kleid war so eingewoben, dass es immer wieder zwischen den geflochtenen Haaren hervorsah und diesem einen eleganten und zugleich leichten Eindruck bescherte.
Der Tribun musterte sie kurz. Ja, so konnte er sich mit ihr blicken lassen. Er wäre lieber ohne sie gegangen, aber der Kaiser hatte die Einladung ausdrücklich auch für die Ehefrauen ausgesprochen. Da musste er sie wohl mitnehmen.
Ohne Gruß und ohne ein einziges Wort ging er an ihr vorbei, um sich von seinem Sklaven für die Feier rasieren und ankleiden zu lassen.
Priscilla folgte ihm.
»Was willst du?«, fragte Gaius unfreundlich, schaute seine Frau jedoch nicht an, während er weiterging. »Habe ich nicht mal in meinem Ankleideraum Ruhe vor dir?«
»Ich muss mit dir reden. Über deine Söhne. Vor allem über deinen Ältesten. Er ist respektlos mir gegenüber und boshaft zu seiner Schwester. Und die Zwillinge machen es ihm nach.« Sie erzählte ihm, was passiert war.
Ein selbstgefälliges Lächeln glitt über Gaius' Gesicht, während er sich zu ihr umdrehte. »Was regst du dich auf? Er hat recht. Du bist nur eine Frau. Was willst du ihm befehlen? Er ist alt genug, um zu beurteilen, ob er richtig oder falsch handelt. Seine Brüder sehen ihn als Vorbild. Das ist gut. So soll es auch sein.«
»Vorbild in was? In Gemeinheit und Respektlosigkeit?« Priscilla hatte Mühe, ihre Stimme unter Kontrolle zu haben.
»Er ist ein Mann. Ein richtiger Mann. Kein Schwächling. Und was Lia anbelangt: Sie soll sich wehren. Wer schwach ist, verdient es, auch so behandelt zu werden.«
»Gaius, wie kannst du nur? Sie ist erst vier Jahre alt!« Priscilla war entsetzt.
Aber ihr Mann wandte sich gelangweilt ab. »Bist du jetzt fertig? Du verhätschelst die Kleine zu sehr. Sieh zu, dass du das änderst. Meine Söhne sind gut, so wie sie sind. Und jetzt geh hinaus, damit ich mich ankleiden kann.« Er setzte sich und würdigte seine Frau keines Blickes mehr.
Enttäuscht verließ Priscilla den Raum. Wie konnte Gaius nur so reden? Wie sich seiner Verantwortung als Vater entziehen? Wie zulassen, dass sie von ihren eigenen Söhnen gedemütigt wurde?
Es war furchtbar. Aber sie musste sich eingestehen, dass es schon immer so gewesen war. Immer hatte er sich auf die Seite der Jungen gestellt.
Es war nicht einfach, mit einem Mann verheiratet zu sein, der außer Verachtung und Hohn nichts für sie übrighatte.
Gaius Dexter und seine Frau Priscilla betraten den Festsaal. Sie waren nicht die ersten Gäste.
Ein Sklave verneigte sich vor ihnen. »Verzeih mir, ehrenwerte Herrin, aber der Kaiser bittet dich, hier auf deinen Mann zu warten.« Er wandte sich an den Tribun. »Herr, ich soll dich in die Privatgemächer des Kaisers bringen, bevor die Feier beginnt.«
»Was will Domitian?«, fragte Gaius erstaunt.
»Herr, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass er dich sprechen will.«
»Gut.« Gaius straffte die Schultern. »Dann folge ich dir.« Und ohne sich nach seiner Frau umzusehen, ging er mit dem Sklaven davon. Er war gespannt, was der Kaiser von ihm wollte. Furcht empfand er nicht. Warum auch? Es gab nichts, was der Kaiser ihm vorwerfen konnte.
Domitian erwartete ihn bereits. »Gaius Dexter. Sei mir willkommen. Komm, setz dich.« Freundlich lächelnd deutete er auf einen Stuhl. Dem Sklaven befahl er, den Raum zu verlassen.
Als sie allein waren, verschwand sein Lächeln umgehend. »Gaius. Ich muss dich sprechen, weil ich wissen muss, wo du stehst.« Domitian hatte sich ebenfalls gesetzt und sah den Tribun mit einem seltsam ernsten, fast bedrohlichen Blick an. »Du weißt, dass es Menschen gibt, die mir Übles wollen. Sie belauern mich, versuchen, mich auszuspionieren, legen mir Steine in den Weg, wo es nur geht. Ja, sie wünschen mein Unglück und sogar meinen Tod.«
Gaius zuckte mit den Schultern. »Was sollen sie dir schon anhaben, Herr und Gott? Du bist der Kaiser, du stehst über ihnen.«
»Ja, aber ich kann nicht sehen, was hinter meinem Rücken passiert. Ich weiß nicht, was meine Feinde planen. Ich weiß nicht einmal, wer meine Feinde sind.« Der Kaiser war lauter geworden.
»Was erwartest du von mir, Herr? Was soll ich tun?«
»Du bist Soldat. Ich habe dich zum Tribun meiner Prätorianergarde, meiner Leibwache, gemacht, die dazu bestimmt ist, mich und die Stadt zu schützen. Ich muss von dir wissen, ob ich mich voll und ganz auf dich verlassen kann.«
Mit einem eiskalten Lächeln musterte er sein Gegenüber. »Das kann ich doch, Gaius Dexter? Du bist mir doch treu ergeben? Nicht wahr?«
»Natürlich, Herr! Ich weiß, wem ich meinen Eid als Soldat geschworen habe. Du kannst dich auf mich verlassen!« Gaius bemühte sich, mit fester Stimme zu sprechen.
»Kann ich das? Ich frage mich, inwieweit dein Verhalten von der Treulosigkeit deines Schwagers Dequinius beeinflusst wird. Er war Prätor, oberster Richter. Auch er hat einen Eid auf mich und auf Rom geleistet. Auch er stand im Dienst des Staates. Aber war er treu? War dieser Eid bindend für ihn?«
»Herr, glaube mir. Dass er Rom verlassen hat und seine Ämter niedergelegt hat, kann ich weder verstehen noch unterstützen. Er ist ein Verräter, warum also sollte er mir ein Vorbild sein?« Finster sah der Tribun den Kaiser an, während er redete. Es war ihm deutlich anzusehen, dass die Wut auf seinen Schwager echt war. So fügte er entschlossen hinzu: »Wie ich gerade sagte, Herr: Ich weiß, wem ich meine Treue schulde: nur dir, meinem Kaiser und Gott.«
»Gut. Ich wollte nur sichergehen. Es wird dein Schaden nicht sein, wenn du weiterhin zuverlässig deinen Dienst versiehst.« Der Kaiser lächelte herablassend. »Tribun der Prätorianergarde ist ein Posten, den auch manch anderer anstrebt. Ein Posten, den man sich nicht nur verdienen, sondern auch sichern muss.«
»Was verlangst du von mir, Herr?« Der Tribun war sich sicher, dass er seinen Kaiser nicht enttäuschen würde. Sein Wort war ihm Befehl. Er war Soldat, gehorsam und loyal.
»Halte deine Augen und Ohren offen. Wenn du von einer Verschwörung hörst, sie auch nur vermutest, erstattest du mir Bericht. Mir persönlich. Keinem anderen. Verstehst du?«
Gaius nickte. Wenn es weiter nichts war? »Natürlich, Herr, das tue ich.« Er verstand nicht, warum der Kaiser so viel Aufheben um etwas so Selbstverständliches machte.
»Schwöre es! Schwöre es bei deinen Hausgöttern!«
Gaius hob feierlich die Hand. »Ich schwöre es, Herr und Gott, bei den Göttern meiner Vorfahren.« Jetzt erst begriff er, dass es wohl um etwas Konkretes ging. Gespannt fragte er sich, wozu ihn Domitian verpflichten wollte.
Der Kaiser nickte zufrieden. »Gut.« Er stand auf und ging ans Fenster, die Hände hinter dem Rücken verschränkt. »Dann habe ich einen ersten Auftrag für dich: Mein Vetter, Marius Flavius, führt etwas im Schilde. Du wirst ihn beobachten.«
Gaius straffte die Schultern. »Herr, gibt es etwas, das ich dazu wissen sollte?«
»Nein. Aber Menschen, die so wie er um mich herumschleichen, die sich anbiedern und schöntun, haben selten Gutes im Sinn. Behalte ihn im Auge, finde heraus, was er plant.«
»Vielleicht erhofft er sich nur einen guten und einträglichen Posten?«
»Du bist naiv, Tribun. Nicht jeder denkt wie du.«
Gaius zuckte bei diesen Worten zusammen. Aber es war wahr. Er hatte kein Problem damit, aber es so deutlich gesagt zu bekommen, war nicht schön.
Der Kaiser wandte sich ihm mit einem spöttischen Lächeln zu. »Die Welt ist, wie sie ist. Menschen sind, wie sie sind. Genauso du. Und Marius Flavius. Er ist falsch, hinterhältig, brutal. Auch wenn er schön und leutselig tut. Also. Kümmere dich um ihn. Und vor allem: Berichte nur mir! Lass niemanden wissen, was dein Auftrag ist. Traue keinem. Er ist nicht der Einzige, der mir schaden will.« Er kam zurück vom Fenster und klopfte dem Tribun auf die Schulter. »Ich weiß, dass du gute Arbeit leisten wirst. Aber jetzt komm. Wir werden auf dem Fest erwartet.«
Gemeinsam verließen sie die Privatgemächer des Kaisers und betraten den Festsaal.
Der Saal war festlich geschmückt. In der Mitte war ein großer Brunnen, um den sich Platz für Musiker, Tänzerinnen und Artisten befand. Tische und Diwane, meist in Zweier- oder Vierergruppen aufgestellt, standen auf mehreren Ebenen rundherum verteilt, sodass jeder einen guten Blick auf die Saalmitte hatte. Die meisten Gäste waren bereits da, hatten ihre Plätze eingenommen. Sklaven eilten geschäftig zwischen den Gästen herum, reichten Wein, Wasser und Speisen aller Art. Gelächter, lautes Reden und Musik erfüllten den Raum.
Die Gäste erhoben sich, als der Kaiser mit Gaius im Gefolge eintrat. Gespräche und Musik verstummten. »Ave, Caesar.« Der Gruß erscholl durch den Saal. Domitian erwiderte den Gruß, indem er seine Hände hob und seine Gäste mit einer einladenden Handbewegung aufforderte, sich wieder auf ihre Plätze zu setzen. Sofort wurden die Gespräche wieder aufgenommen und die Musiker begannen zu spielen. Domitian ging direkt auf Priscilla zu, die wartend neben dem Platz stand, der ihr zugewiesen worden war. »Ah.« Domitian hob zur Begrüßung freundlich seine Hände. »Edle Priscilla. Sei mir willkommen. Es ist lange her, dass du in meinem Hause zu Gast warst.«
Priscilla verneigte sich. »Ich danke dir, Herr und Gott, dass du uns für würdig ansiehst, an deinem Fest teilzunehmen«, sagte sie ehrerbietig.
Der Kaiser fasste sie am Arm, richtete sie wieder auf. »Ich bitte dich, gute Frau. Dafür brauchst du mir nicht zu danken. Schließlich ist dein Mann mir treu ergeben und bereit, mir in allem zu dienen.« Er klopfte dem Tribun, der neben ihn getreten war, herablassend auf die Schulter. Dann winkte er einen Sklaven herbei. »Sieh zu, dass es meinen Gästen an nichts fehlt«, befahl er. »Und ihr«, wandte er sich erneut an Gaius und Priscilla, »genießt das Fest. Esst, trinkt. Ja, labt euch an dem, was euer Kaiser euch gibt.« Dann wandte er sich von ihnen ab und ging auf seine anderen Gäste zu.
Priscilla war hellhörig geworden. Was war passiert? Was hatte der Kaiser mit ihrem Mann zu besprechen gehabt? Ihr gefiel nicht, wie Domitian ihn behandelt und mit welchem Blick er von seiner Treue gesprochen hatte.
»Gaius, was ist los?«, fragte Priscilla, während sich beide auf ihrem Diwan niederließen. Sie machte sich Sorgen.
Aber ihr Mann lachte nur. »Nichts Besonderes. Der Kaiser hat sich meiner Treue versichert. Und mich an meine Pflichten erinnert.«
»Warum? Gibt es einen Grund dafür?«
»Nein. Das habe ich ihm auch gesagt. Er weiß, dass er sich auf mich verlassen kann. Was man nicht von jedem in seinem Umfeld behaupten kann.«
»Wie meinst du das?«
»O Priscilla! Wie kannst du nur so dumm fragen? Natürlich hat er Feinde. Es gibt immer Menschen, die gerne selbst Kaiser wären. Aber ich werde dafür sorgen, dass diese nicht zum Zuge kommen.« Den Auftrag, den er erhalten hatte, verschwieg er.
»Gaius.« Priscilla ließ sich nicht beruhigen. Sie richtete sich halb auf. »Was verlangt er von dir? Und was passiert, wenn du nicht tust, was er befiehlt?«
Der Tribun winkte ab. »Er verlangt nichts Unehrenhaftes. Nur, dass ich meine Pflicht erfülle. Dass ich im Falle einer Befehlsverweigerung meinen Posten verlieren kann, weiß ich selbst. Ich bin Soldat. Da zählen Befehl und Gehorsam. Er ist der Kaiser, mein Herr und mein Gott. Und mein oberster Befehlshaber. Warum sollte ich ihm nicht gehorchen?«
»Er hat dir gedroht, Gaius?!« Priscilla schüttelte den Kopf und flüsterte, damit die anderen Gäste an den Nachbartischen sie nicht hören konnten. »Nimm dich in Acht! Ich bitte dich, sei vorsichtig. Der Kaiser ist unberechenbar!«
»Unsinn. Ich habe ihn noch nie enttäuscht. Was sollte also passieren?«
»Ja, das stimmt. Du hast ihn noch nie enttäuscht.« Priscillas Stimme klang bitter, aber das merkte Gaius nicht. Er hatte längst nach dem Trinkglas gegriffen und ließ es sich mit Wein füllen. Jetzt wollte er feiern, den Dank Domitians in vollen Zügen genießen. Seine Frau beachtete er nicht mehr.
Priscilla aber vergaß nicht, was der Kaiser gesagt hatte. Vor allem sein kalter Blick und die herablassende Art hatten sie aufschrecken lassen. Ging es wirklich nur um die Erinnerung an die Soldatenpflicht ihres Mannes? Nein, daran konnte sie nicht glauben. Domitian war gefährlich. Aber wie sollte sie das Gaius begreiflich machen?
Der Tribun und seine Frau kehrten tief in der Nacht von dem Fest zurück. Gaius zog sich in seine Räume zurück, ohne Priscilla eine gute Nacht zu wünschen.
Priscilla seufzte. Sie war es nicht anders gewohnt. Aber wenn sie ehrlich zu sich selbst war, musste sie sich eingestehen, dass es ihr so lieber war. Er war seit Jahren nicht mehr zu ihr ins Bett gekommen, außer nach jener durchzechten Nacht, in der er betrunken und schlecht gelaunt von einem Trinkgelage nach Hause gekommen war. Das an sich war noch nichts Besonderes. Ungewöhnlich war, dass er in ihr Schlafgemach gekommen war und sich zu ihr gelegt hatte. Sie hatte es nicht gewollt, aber auch in seinem betrunkenen Zustand war er stärker als sie gewesen. So war sie mit ihrer Tochter Lia schwanger geworden. Später hatte sie erfahren, dass ihr Mann in dieser Nacht lediglich eine lächerliche Wette verloren hatte und sie diejenige gewesen war, an der er seine Wut ausgelassen hatte.
Jetzt saß sie auf dem Stuhl in ihrem Ankleideraum, während ihr Eusebia die Frisur löste. Müde wartete Priscilla, bis die Sklavin ihr die Haare durchgebürstet und für die Nacht zum Zopf gebunden hatte. »Wie geht es Lia?« Ihr war eingefallen, dass das Mädchen in ihrem Bett liegen musste. »Schläft sie?«
»Ja, Herrin. Aber sie ist sehr unruhig, wacht immer wieder weinend auf. Tuja ist bei ihr. Aber ich denke, sie wartet darauf, dass du kommst.«
Priscilla nickte. Ihr kleines Mädchen. Die Nacht, in der Gaius zu ihr gekommen war, versuchte sie immer wieder zu verdrängen. Aber ohne sie hätte sie ihre Tochter nicht. Ihre süße, kleine Lia, die sie über alles liebte. Umso mehr, da das Mädchen ihrem Vater gleichgültig und ihren Brüdern lästig war. »Bist du fertig?«
Eusebia nickte. Sie geleitete ihre Herrin in den Schlafraum.
Priscilla trat an ihr Bett. Lia lag eingerollt in der Mitte des Bettes. Ihre Wangen waren rot vom Schlaf, deutlich waren darauf Spuren von Tränen zu erkennen. Tuja hatte neben dem Bett gesessen, war aber aufgestanden, als ihre Herrin hereinkam.
Priscilla hob die Decke und legte sich zu ihrer Tochter. Das Mädchen wachte auf. »Mutter«, murmelte sie. »Mutter.« Sie kuschelte sich eng an sie und schlief sofort wieder ein. Zärtlich zog Priscilla die Decke über den kleinen Körper. »Ihr könnt gehen«, sagte sie leise, ohne sich zu den Sklavinnen umzudrehen. »Aber lasst ein Licht brennen, wenn ihr hinausgeht. Die Kleine soll nicht erschrecken, wenn sie erwacht.«
Die Sklavinnen taten, was ihre Herrin befohlen hatte, und verließen leise den Raum.
Am nächsten Morgen betrat Priscilla mit Lia an der Hand den Speiseraum. Der Tisch war gedeckt. Brot, klein geschnittener Käse, Früchte und Krüge mit Milch und Wasser standen bereit. Ihre Söhne hatten sich bereits eingefunden und saßen am Tisch, grüßten aber nicht, als ihre Mutter den Raum betrat. Gaius, der in einer Ecke des Raumes stand und einen Becher in der Hand hielt, bemerkte das wohl. Aber er unternahm nichts, hatte er seine Frau doch genauso wenig begrüßt wie die Jungen. Priscilla seufzte. Es war seine Aufgabe, ihren Söhnen Achtung vor den Eltern beizubringen. Aber durch sein eigenes Verhalten ermutigte er sie dazu, ihrer Mutter respektlos zu begegnen.
Anstatt einer Begrüßung zeigte der Tribun auf Lia. »Sie hat bei dir geschlafen?«
Priscilla nickte. »Du weißt, was gestern passiert ist. Und du weißt auch, dass es nicht das erste Mal war. Ich konnte sie nicht ohne Schutz lassen.« Sie hob das Mädchen auf den Platz neben sich und nahm den Milchkrug, um ihrer Tochter den Becher zu füllen.
»Schutz!« Der Tribun trat an den Tisch und nahm sich ein Stück Brot. »Schutz!« Er brach einen Bissen ab und warf den Rest zurück in den Korb. »Wer schwach ist, braucht keinen Schutz. Sie sollte lernen, sich zu wehren. Aber nein, du verhätschelst sie. Und bedienst sie auch noch.« Er riss Priscilla, die sich gerade über den Becher ihrer Tochter gebeugt hatte, den Krug mit der Milch aus der Hand. »Dafür haben wir unsere Sklaven. Oder was denkst du, wofür ich die durchfüttere?«
Hastig nahm ihm eine ältere Sklavin den Krug ab und füllte den Becher des Mädchens.
Die Jungen feixten. Das gefiel ihnen.
Priscilla wurde wütend, durfte das aber nicht zeigen. »Wie oft soll ich es dir noch sagen. Sie ist erst vier Jahre alt. Sie braucht Schutz!«
»Klar«, rief der älteste Sohn. Er riss seiner Schwester den Becher aus der Hand. »Vor ihren bösen, bösen Brüdern.«
Die Zwillinge lachten.
Lia sah ihre Mutter derweil mit großen Augen an. Sie wagte nicht vor ihrem Vater zu weinen. Das würde alles nur noch schlimmer machen. So viel hatte selbst sie schon begriffen. Priscilla stand auf. Sie nahm das Mädchen auf ihren Arm.
Gaius schüttelte den Kopf. »Willst du wieder in die Küche mit der Kleinen und dort mit ihr essen? Wegen eines so kleinen Scherzes?« Er setzte sich neben seinen ältesten Sohn und nahm diesem Lias Becher aus der Hand. »Hol ihn dir und gib ihn deiner verwöhnten Tochter. Vor allem aber!« Gaius wurde laut. »Setz dich wieder. Hier ist dein Platz, nicht in der Küche. Und wage es nicht noch einmal, einfach zu gehen, solange dein Gemahl noch bei Tisch ist.«
Priscilla kämpfte mit den Tränen. Sie nahm ihm den Becher aus der Hand, ohne ihn anzusehen, und stellte ihn auf den Tisch. Er war ihr Mann, sie war ihm zu Gehorsam verpflichtet. Warum demütigte er sie immer wieder vor den Kindern? Was hatte sie ihm getan?
Widerwillig ließ sie sich nieder, behielt Lia aber auf ihrem Schoß. Die Kleine drängte sich ganz nah an ihren Körper, hatte Angst. Sanft strich ihr Priscilla über die Wangen. »Keine Angst, meine Kleine, ich bin da. Komm, trink einen Schluck.«
Sie beachtete weder ihren Mann noch ihre Söhne, kümmerte sich nur noch um Lia. Wenn sie niemanden von den vieren ansah und sich ganz auf ihre Tochter konzentrierte, konnte sie vielleicht für diesen Augenblick vergessen, wie furchtbar ihr Leben in ihrer eigenen Familie war.
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
2. Briefe
Seit dem Fest waren fast drei Wochen vergangen.
Priscilla hatte sich auf eine Bank im Peristylium gesetzt. Die Mittagssonne schien warm auf sie herab. Eusebia hatte ihr Wasser und verschiedene Früchte gebracht. Die Söhne waren fort zum Unterricht, Lia wurde von Tuja betreut. Endlich hatte sie Zeit und Ruhe, den Brief zu lesen, den sie seit dem Morgen bei sich trug.
»Ich, Berenike, grüße dich, meine liebste und teure Freundin Priscilla.
Ich danke dir für deinen offenen Brief. Darf ich dir sagen, dass ich mich jedes Mal freue, von dir zu hören?
Jetzt ist es bereits ein Jahr her, dass mein Mann mich zur Frau nahm, dass er und sein Sohn Rom verlassen haben, um mit mir zu leben. Damals dachte ich, dass sich niemand aus seinem früheren Leben darum kümmern würde, wie es ihm geht. Es gibt viele Freunde in der Gemeinde, aber außerhalb? Ich weiß noch, wie ich mich über deinen ersten Brief gewundert habe. Schließlich sind wir uns nie begegnet, als ich noch als Sklavin im Hause meines Mannes, deines Schwagers, gelebt habe.
Ich gebe zu, dass ich mir zuerst nicht sicher war, ob du eine Freundin bist. Aber heute bin ich froh, dass ich deine Freundschaft angenommen habe.
Dein Brief hat mich nachdenklich gemacht. Was du schreibst, beunruhigt mich.
Du hast mir in deinen Briefen viel von eurer Ehe erzählt. Es schmerzt mich zu hören, was dein Mann dir antut. Ebenso deine Söhne. Dass du in Lia Trost findest, freut mich aber sehr.
Wie sehr muss es dich quälen, dass du deinen Mann mit deiner Sorge nicht erreichst. Einer Sorge, die berechtigt ist! Ja, es geht mir wie dir. Auch ich traue Domitian nicht. Man weiß nie, was er im Schilde führt. Und ja, ich denke auch, dass dein Mann dem Kaiser zu sehr vertraut, sich viel zu sehr auf seine eigene Treue verlässt. Sobald der Kaiser diese anzweifelt, ist er, seid ihr in Gefahr.
Bitte verzeih mir. Aber ich habe deinen Brief meinem Mann gezeigt. Marcus bietet dir seine Hilfe an. Wenn du es möchtest, wird er nach Rom kommen und versuchen, mit Gaius zu reden. Wir wissen alle, dass dein Mann für Marcus nur Verachtung empfindet, dennoch ist er sein Schwager. Er war Prätor, ein angesehener Mann, gebildet und klug. Es besteht trotz allem eine geringe Hoffnung, dass Gaius auf ihn hört oder zumindest über eine Warnung von ihm nachdenkt.
Teure Priscilla, du bist mir Freundin und Vertraute. Deine Sorge ist auch meine Sorge. Heute möchte ich dir nicht wie sonst von meinem Gott erzählen, nur das: Ich werde für dich und für euch beten. Ich weiß, dass Gott mein Gebet hört. Er sieht dich, deine Not, deine Angst. Wende auch du dich an ihn. Ich weiß, dass du viele Fragen hast und den Schritt zum Glauben nicht wagst. Aber versuche dennoch, ihn um Hilfe zu bitten, nicht die toten Götter Roms. Und dann sieh, was geschieht.
Ich befehle dich seinem Schutz an, seinem Rat.
Gott, unser Herr, segne und behüte dich und deine Familie.
In Freundschaft und schwesterlicher Liebe – Berenike«
Priscilla legte den Brief auf ihren Schoß und schloss ihre Augen, während die Gedanken in ihrem Kopf durcheinanderwirbelten. Sollte sie Berenikes Angebot annehmen und ihren Schwager Marcus Dequinius bitten, mit Gaius zu reden?
Sie erinnerte sich daran, wie Marcus Rom verlassen hatte. Er, der Gaius' Schwester geheiratet hatte und viele Jahre nach deren Tod ohne Frau gelebt hatte, hatte sich schließlich seiner Sklavin zugewandt und ihretwegen vor einem Jahr sein Amt als Prätor niedergelegt und Rom den Rücken gekehrt. Gaius hasste seinen Schwager dafür, hielt ihn für schwach, vor allem da Marcus und seine Frau Christen geworden waren. Jämmerlich nannte Gaius ihn. Und einen Verräter Roms.
War es einfältig, zu hoffen, dass Gaius von diesem Mann eine Warnung annehmen würde?
Aber hatte sie eine Wahl? Sie selbst wurde von ihrem Mann nicht ernst genommen. Im Gegenteil. Vielleicht gelang es Marcus, zu ihm durchzudringen. Auch wenn das unmöglich schien – eine geringe Hoffnung bestand.
Seit dem Brief waren mehrere Wochen vergangen. Längst hatte Berenike geantwortet und Marcus Dequinius’ Besuch angekündigt. Bis es so weit war, lief das Leben wie gewohnt weiter.
Der Sommer schritt immer weiter fort, noch waren die Tage lang und warm. Priscilla saß mit Lia im Peristylium und genoss die angenehme Luft, den leichten Wind, der ab und zu ihre Haut streifte.
Lia hielt ihre Puppe in der Hand. Sie ließ sie über den Boden gleiten, wie im Tanz. Dazu sang sie. Sie war völlig vertieft in ihr Spiel.
Ihre Mutter saß auf einer Bank und betrachtete die Tochter liebevoll. Es war schön, ihr beim Spielen zuzusehen.
Jetzt hob das Mädchen den Kopf und unterbrach ihren Gesang. »Weißt du, Mutter, wenn ich groß bin, will ich auch so ein schönes Kleid.« Sie hielt ihre Puppe hoch, die in gelbe Seide gekleidet war.
»Das wirst du haben, mein Kind.«
Lia sprang auf und lief zu Priscilla. Sie kletterte auf die Bank und ließ sich auf deren Schoß fallen. Eng kuschelte sie sich an ihre Mutter. »Werde ich schön sein, wenn ich groß bin? So wie du?«
»Du findest mich schön?«
Das Mädchen lachte und strahlte über das ganze Gesicht. »Du bist die schönste Frau, die es gibt.«
Priscilla betrachtete ihre Tochter. Wie ihr Vater hatte sie schwarz gelocktes Haar und auffallend blaue Augen. Aber sonst glich sie eher ihr selbst. Sie hatte das gleiche runde Gesicht, die gleiche kleine Nase und die vollen Lippen wie Priscilla. Überhaupt, hätte sie braune Augen und blondes Haar, wäre sie das genaue Abbild ihrer Mutter.
»Du siehst genau so aus, wie ich mit vier Jahren ausgesehen habe. Nur die Augen- und die Haarfarbe stimmen nicht überein.«
»Hm.« Lia überlegte. »Hm.« Sie sah ihre Mutter an. »Dann bin ich auch schön, wenn ich groß bin«, stellte sie fest und lachte fröhlich. Damit war das Thema für sie erledigt. Sie kuschelte sich noch enger an ihre Mutter und fing an zu singen. Priscilla stimmte in das Lied mit ein. Sie genoss jeden Moment, jede Berührung, jedes Lachen ihrer Tochter. Die Zeit schien stillzustehen, das Leben war für Augenblicke unbeschwert und frei.
Aber das würde es nicht bleiben. Noch heute erwartete sie die Ankunft von Marcus Dequinius. Dann würde sie sich wieder ihrem Leben stellen müssen.
Gaius Dexter betrat sein Haus. Es war bereits spät, seine Familie hatte sicher schon die Abendmahlzeit eingenommen. Ein Sklave brachte ihm andere Schuhe und nahm ihm die Toga ab. »Herr, du hast Besuch«, sagte er.
»Besuch? Um diese Zeit? Wer ist es?«
Der Sklave zögerte kurz, sagte dann aber mit fester Stimme: »Dein Schwager, Herr, der frühere Prätor Marcus Dequinius.«
Der Tribun packte ihn am Arm. »Das ist nicht dein Ernst.«
Aber der Sklave nickte. »Doch, Herr, er ist bereits um die Mittagszeit gekommen.«
»Und da schickt ihr nicht nach mir?« Wütend ließ der Tribun den Mann wieder los. »Wo ist er?«
»Er befindet sich im kleinen Speiseraum. Zusammen mit deiner Frau.«
Gaius schüttelte den Kopf. Was wollte Dequinius von ihm? Warum war er hier? Vor einem Jahr hatte er Rom verlassen, hatte sich von seinen Ämtern und Pflichten losgesagt und sein Haus verkauft. Und jetzt war er hier? Das machte keinen Sinn.
Schnell durchquerte der Tribun das Atrium und betrat den kleinen Speiseraum. Dort saß seine Frau, neben ihr sein Schwager. Auf dem Tisch standen eine Karaffe mit Wein und zwei Becher, daneben Schalen mit Früchten und Brot. Priscilla hatte den Gast also bewirtet.
Marcus Dequinius erhob sich. Er war ein großer, stattlicher Mann. Sein Kopf war kahl geschoren, sein Gesicht war nicht gerade schön zu nennen, aber seine dunklen und ausdrucksstarken Augen waren das, was als Erstes an ihm auffiel. »Ich grüße dich, Gaius, mein Schwager.« Seine Stimme klang freundlich.
Das machte den Tribun misstrauisch. »Was willst du?«, fragte er in scharfem Ton, ohne den Gruß zu erwidern.
»Nun, ich bin hier, weil deine Frau mich darum gebeten hat.«
»Meine Frau?« Gaius wandte sich ihr zu. »Gibt es etwas, das du mit ihm besprechen musst anstatt mit mir?«
»Gaius, bitte …« Priscilla hob die Hände. »Ich habe versucht, mit dir zu reden, aber du hörst mir nicht zu.«
Verächtlich wandte sich der Tribun von ihr ab und wieder seinem Schwager zu. »Und?«
»Sollten wir uns nicht setzen?«
Gaius zuckte mit den Schultern. »Wenn du meinst.« Er ließ sich auf einem Stuhl nieder, betont lässig lehnte er sich zurück und betrachtete seinen Schwager. »Und jetzt rede.«
Dequinius sah kurz auf seine Hände, hob dann aber wieder den Kopf und sah den Tribun direkt an. »Gaius, als ich vor einem Jahr Rom verlassen habe, tat ich das, ohne mich von dir zu verabschieden. Du weißt wenig von dem, was mich dazu veranlasst hast.«
»Ha!«, unterbrach ihn Gaius. »Da brauche ich nur einen Namen zu nennen. Berenike. Deine Frau.« Er lachte höhnisch auf. »Du hast eine Sklavin geheiratet, mit der du zuvor ein Verhältnis hattest. Du tugendhafter und aufrechter Mann.«
»Du hast mir nie verziehen, dass du sie nicht haben konntest, nicht wahr?«
»Was soll das? Sie hat mir nichts bedeutet.«
Marcus nickte. »Nein, das hat sie nicht.« Er nahm seinen Becher und drehte ihn nachdenklich in seiner Hand. »Aber deswegen bin ich nicht hier.« Er hob den Kopf. »Ich bin hier, um dich zu warnen.«
»Mich? Warnen? Vor wem oder was?«
»Vor dem Kaiser. Du traust ihm, aber er wird dich nur solange dulden, wie du ihm nützlich bist.«
»Der Kaiser weiß, was er an mir hat. Er wird mir nichts tun. Wie kommst du darauf? Ich war Domitian immer treu ergeben, ich habe ihm immer gedient, im Gegensatz zu dir. Wovor also willst du mich warnen?«
Priscilla ergriff das Wort. »Gaius, du weißt, was er zu dir gesagt hat. Bitte pass auf. Es klang wie eine Drohung. Und du handelst nicht nur für dich. Wenn du schon nicht an mich und an deine Tochter denkst, so denk doch wenigstens an deine Söhne.«
»Pah, gedroht! Er hat mir nicht gedroht, er hat mir nur gesagt, dass er ganz mit meiner Treue rechnet. Und das kann er auch.«
Doch seine Frau schüttelte den Kopf. »Nein, du weißt, dass er mehr gesagt hat.«
»O bei Jupiter! Ihr hört Dinge, die so nie gesprochen wurden. Der Kaiser mir drohen! Mir, seinem treuesten Anhänger. Nur weil er sagte, dass auch andere auf diesen Posten warten. Das hat er schon zu vielen gesagt, ohne dass es Folgen hatte. Er will nur, dass ich mir meiner Pflichten bewusst bin. Punkt. Mehr nicht.«
Dequinius hob die Hand. »Gaius, sei nicht leichtsinnig. Nimm den Kaiser ernst. Du weißt, dass er sich verfolgt wähnt. Nicht einmal du kannst übersehen, dass Menschen sterben, ohne dass irgendjemand mit ihrem Tod gerechnet hat. Senatoren, Patrizier, Bürger Roms. Keiner ist vor ihm sicher!«
»Gerüchte sind das. Nur Gerüchte. Warum sollte der Kaiser hinter all dem stecken? Du warst schon immer gegen ihn. Er hat dem Römischen Reich zu ungeahnter Größe verholfen. Und damit ist er noch nicht am Ende. Ha, wenn jemand dem Staat dient, dann er.«
»Nein, Gaius, nein.« Marcus war aufgesprungen. »Er traut keinem mehr. Auch dir nicht. Siehst du das nicht? Glaubst du, er hat die Säulen im Palast glatt polieren lassen, weil er das schöner findet? Nein! Er sieht darin jeden, der sich ihm von hinten nähert. Sie spiegeln ihm das, was in seinem Rücken geschieht. Macht das jemand, der Vertrauen hat? Jemand, der nichts zu befürchten hat? Gaius, öffne deine Augen! Der Kaiser wird dich nicht schonen, wenn es seiner Macht und seiner Sicherheit dient. Er kann dich vernichten, dich und dein ganzes Haus!« Langsam setzte er sich wieder und sah seinen Schwager fest an. »Oder er wird von dir verlangen, dass du deine Treue unter Beweis stellst. Mit welcher Tat auch immer.«
Der Tribun stand auf. »Das höre ich mir nicht länger an. Du warst schon damals ein Verräter, du bist es noch immer. Der Kaiser hat recht, wenn er euch Christen verfolgt. Was wollt ihr mehr als den Untergang Roms? Ich aber bin treu. Der Kaiser kann sich auf mich verlassen.« Er wandte sich zur Tür.
»Gaius. Bitte.« Marcus versuchte es ein letztes Mal. »Glaube mir, dass ich es gut meine. Du bist mein Schwager, und ich möchte dich vor dem Schlimmsten bewahren.«
Der Tribun nahm den Türgriff in die Hand. »Mein Schwager bist du schon lange nicht mehr. Durch den Tod meiner Schwester bist du es vielleicht noch geblieben, aber als du Berenike geheiratet hast, hast du dich endgültig von mir und meiner Familie getrennt. Daran ändert auch dein Sohn nichts.« Er öffnete die Tür. »Ich sollte dich dem Kaiser überantworten. Aber ich bin kein Unmensch, auch wenn du das von mir denkst. Ein letztes Mal will ich mich dir gegenüber gastfreundlich zeigen. Du kannst hier übernachten. Aber morgen bei Tagesanbruch verlässt du mein Haus. Und merke dir: Ich will dich hier nie wieder sehen. Ein zweites Mal werde ich mich dir gegenüber nicht gnädig erweisen. Solltest du noch einmal hier erscheinen, übergebe ich dich und dein ganzes Haus dem Kaiser.« Damit verließ er den Speiseraum.
Priscilla sah Marcus hilflos an. Er erwiderte ihren Blick, nahm ihre Hand. »Verzeih mir. Ich hätte dir gerne geholfen.«
Sie nickte. »Ich weiß«, sagte sie leise. »Jetzt kann ich nur hoffen, dass er in seiner Überheblichkeit keine Dummheiten macht.«
»Wovor fürchtest du dich, Priscilla? Es geht dir nicht um deinen Ehemann, nicht wahr? Du fürchtest um deine Kinder.«
Die Frau nickte. »Ja, das ist wahr. Gaius war mir nie ein guter Gatte. Er hat mich nicht geheiratet, weil er mich liebte, sondern weil es so arrangiert war. Ich weiß, das ist normal. Allen Frauen und Männern geht es so. Aber er hat nicht einmal versucht, mich zu sehen oder mir Achtung entgegenzubringen. Die Jahre an seiner Seite sind für mich verlorene Jahre.«
»Du hast vier Kinder von ihm, Priscilla.«
»Ja, ich weiß. Und ich habe alles getan, um ihnen eine gute Mutter zu sein. Aber du weißt selbst, dass mein Mann unsere Söhne gelehrt hat, mich zu verachten. Von ihnen habe ich nichts zu erwarten. Und egal, was mit Gaius passiert, sie werden ohne mich zurechtkommen können. Sie sind alt genug. Der Große möchte Soldat werden wie sein Vater und bald in die Armee eintreten, die Zwillinge werden ihm zwei Jahre später folgen. Um sie muss ich mich nicht sorgen. Es geht mir um Lia. Sie ist das Einzige, was ich habe, das Einzige, was er mir gelassen hat. Aber auch nur, weil er sich nichts aus ihr macht.« Priscilla umklammerte Marcus' Hand. »Aber wie soll ich sie schützen? Eine Frau, die ein Mädchen schützen soll? Egal, was passiert, mir werden immer die Hände gebunden sein.«
»Ja, Priscilla, leider ist unser Recht so, wie du sagst. Aber eines sollst du wissen: Egal, was kommt, du kannst immer auf mich und auf Berenike zählen. Du und deine Tochter, ihr seid uns immer willkommen. Ihr könnt immer mit unserer Hilfe rechnen. Das verspreche ich bei meinem Gott. Er ist mein Zeuge.«
Da konnte Priscilla ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. »Ich danke dir, Marcus«, flüsterte sie. »Ich danke dir.« Sie senkte den Blick, dachte nach. »Aber was ist, wenn Gaius versuchen wird, jeden Kontakt zu dir zu unterbinden? Bis jetzt konnte ich meine Briefe an deine Frau einem Boten übergeben. Du weißt, wie Gaius von mir denkt. Er hält mich für dumm. Über den Briefwechsel hat er sich immer lustig gemacht. Es hat ihm nie gefallen, aber er hat das immer als lächerlich abgetan und darum geduldet.« Sie hob den Kopf und strich sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Fragend sah sie Marcus an. »Aber jetzt? Wie wird er das Ganze beurteilen, nachdem du da warst und dich in sein Leben eingemischt hast? Ich rechne damit, dass er mir verbieten wird, weiterhin Briefe mit Berenike auszutauschen.«
Marcus überlegte. »Wem in deinem Haus kannst du vertrauen?«
»Meiner Leibsklavin Eusebia und Tuja, die Sklavin, der ich Lia anvertraut habe.«
»Gut. Dann wende dich mit deren Hilfe an den griechischen Arzt Manassos, einer der Ältesten der Gemeinde. Er ist ein guter Freund. Über ihn kannst du mich jederzeit erreichen. Ich werde dafür sorgen, dass die Briefe meiner Frau auf demselben Weg zu dir gelangen werden. Mit Gottes Hilfe wird das gelingen.«
Priscilla nickte. »Wie finde ich diesen Manassos?«
Marcus schüttelte leicht den Kopf. »Mach dir darüber keine Gedanken. Er wird dich finden. Darauf kannst du dich verlassen.«
Priscilla legte ihre Hand auf seinen Arm. »Ich danke dir, Marcus. Von Herzen danke.« Traurig fügte sie hinzu: »So hintergehe ich mit deiner Hilfe meinen eigenen Mann. Aber er lässt mir keine Wahl.« Sie zog ihre Hand zurück. Erleichterung und Freude machte sich in ihr breit. Sie war nicht allein, egal, was kommen würde.
Sie lächelte ihn an. »Aber jetzt erzähle. Wie geht es euch? Wie geht es Berenike? Deinen Kindern? Und verzeih mir, dass ich jetzt erst danach frage.«
Marcus schüttelte den Kopf. »Du musst dich nicht entschuldigen. Das hier war wichtiger.« Er nahm einen Schluck aus seinem Becher. »Es geht uns gut. Claudius hat enge Freunde gefunden. Sie werden zusammen unterrichtet und verbringen viel Zeit miteinander. Mein Sohn genießt es, nicht mehr in der Stadt zu wohnen, und hält sich viel an der frischen Luft auf. Und unsere Tochter wächst und gedeiht. Beide machen uns viel Freude.« Erneut nahm er seinen Becher. Ein kleines Lächeln huschte über sein Gesicht. »Berenike wollte mir zuerst einen Brief für dich mitgeben, aber dann meinte sie, ich solle dir das Neueste erzählen. Sie erwartet unser zweites Kind. Die Niederkunft wird im Winter sein.«
»O Marcus! Das freut mich sehr.« Priscilla hatte erneut seine Hand ergriffen, drückte sie fest. »Wie geht es deiner Frau? Kämpft sie mit Übelkeit? Hat sie eine leichte Schwangerschaft?«
Marcus erwiderte den Griff. »Es geht ihr gut. Sehr gut. Die Zeit der morgendlichen Übelkeit ist vorbei. Berenike genießt jeden Tag. Noch ist es nicht beschwerlich.«
»Grüße sie von mir. Ich wünsche ihr von ganzem Herzen, dass sie eine gute Schwangerschaft erlebt und dass euer Gott sie bei der Geburt beschützen möge.« Sie lächelte. »Ihr Männer könnt das nicht nachvollziehen. Aber es ist etwas Wunderbares. Das eigene Kind im Leib zu spüren. Zu wissen, es wird zur Welt kommen und dann in meinen Armen liegen.«
»Ich erinnere mich. Du warst sehr glücklich, wenn du ein Kind in dir getragen hast.«
»Das hast du gemerkt?«
»Natürlich habe ich das.« Er lächelte seine Schwägerin an. »Ich erinnere mich an alles. Auch daran, wie glücklich du am Tage deiner Hochzeit warst.«
Priscilla wurde nachdenklich. »Auch wenn die Ehe arrangiert war, so habe ich mich doch auf meinen Mann gefreut. Gaius konnte so einnehmend und freundlich sein. Er wusste immer Geschichten zu erzählen. Er war unterhaltsam, humorvoll. Ihm zuzuhören, hat mir immer viel Freude bereitet. Du kennst ihn. Diese Seite zeigt er, wenn er mit anderen zusammen ist. Jeder hört ihm gerne zu. Wo er zu Gast ist, wird es nicht langweilig. Dazu kam, dass er sehr gut aussah. Ich hatte mich in ihn verliebt, in den Mann, den ich gesehen habe. Wie er wirklich ist, wie er mich sieht, habe ich erst gemerkt, als ich mit ihm verheiratet war. Aber auch da hat es lange gedauert, bis ich begriffen habe, wie wenig er für mich empfindet, wie wenig er mich achtet.« Sie seufzte. »Ich war blind, als ich mit ihm vermählt wurde. Blind und dumm.«
»Nein, Priscilla, das warst du nicht. Du warst einfach eine junge Frau, die Träume hatte und davon überzeugt war, dass sich diese mit dem Mann, den man für sie erwählt hatte, erfüllen würden. Gaius war immer, wie er ist. Dass er ein schlechter Ehemann werden würde, hat aber niemand erwartet.«
»Weißt du, wie sehr mich andere Frauen um ihn beneiden? Sie wissen nichts davon, wie er sich hier im Hause verhält. Sie sehen ihn nur, wie ich ihn vor der Ehe gekannt habe. Und die, die es wissen, meinen, dass es ihnen besser ergangen wäre. Es muss an mir liegen, dass er mich so behandelt.« Sie schüttelte den Kopf. »Aber reden wir nicht mehr davon. Lieber erzähle ich dir von Lia. Sie macht mir sehr viel Freude. Sie ist ein lebhaftes und fröhliches Kind. Wenn ihre Brüder nicht da sind und sie quälen, lacht und singt sie ununterbrochen. Ich hoffe nur, dass sie es nicht schaffen werden, ihr Wesen zu verändern.«
»Du liebst sie sehr.«





























