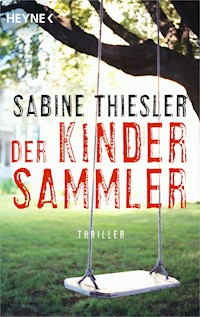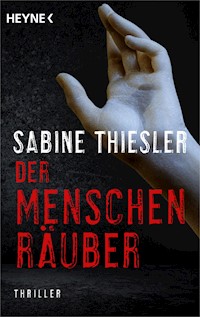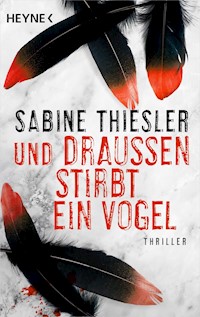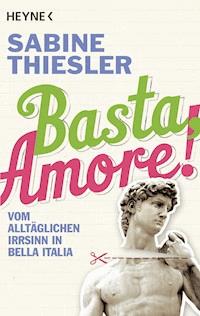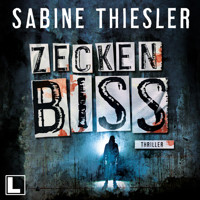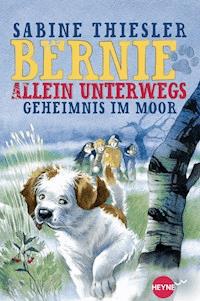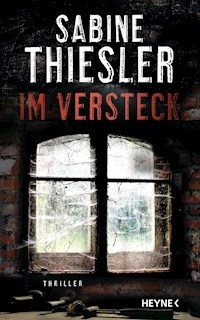9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Die Unglaublichen Abenteuer eines kleinen Bernhardiners
»Der Hund muss weg!« Als der kleine Bernie die Worte seines Züchterfrauchens hört, versteht er die Welt nicht mehr. Er ist doch wie alle anderen Bernhardiner seiner Familie wunderschön und groß und stark! Nur weil ihm die schwarze Maske im pelzigen Gesicht fehlt, will ihn keiner haben? Bernie fasst einen tollkühnen Plan: Ganz allein macht er sich auf den Weg, um einen Platz und eine Aufgabe im Leben zu finden. Für den kleinen Hund beginnt das Abenteuer seines Lebens ... Mit „Bernie allein unterwegs” beweist Bestsellerautorin und Bernhardinerbesitzerin Sabine Thiesler, dass sie auch junge Leserinnen und Leser von der ersten Seite an in ihren Bann ziehen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 160
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Bernie von Lüttelbüttel kommt an einem Gründonnerstag nachts um drei beinah mit einem Kopfsprung zur Welt. Paule, sein Herrchen, kann ihn gerade noch auffangen. Zusammen mit seinen vier Geschwistern hat der kleine Bernhardiner zunächst ein wunderbare Zeit auf Paules Hof – bis die Kaufinteressenten kommen. Während alle anderen Welpen in neuen Familien so tolle Aufgaben wie Bewachen und Lebenretten übernehmen sollen, will offenbar niemand den kleinen Bernie haben.
Was Bernie nicht versteht: Irgendwie halten ihn alle für hässlich, nur weil er keine Gesichtsmaske hat, wie es sich für einen echten Bernhardiner gehört. Und deswegen soll ihm jetzt das Tierheim oder sogar noch Schlimmeres drohen? Dabei ist sich Bernie sicher, dass er eines Tages genauso groß und stark sein wird wie sein Vater Hugo vom Walde. Es gibt nur eine Möglichkeit: Bernie muss fliehen und sich allein auf die Suche nach einem Menschen machen, dem er beweisen kann, dass er für ihn durchs Feuer gehen würde. Für Bernie beginnt eine abenteuerliche Reise, die ihn erst einmal ans Meer führt. Doch kaum hat der kleine Bernhardiner dort neue Freunde gefunden, gerät er auf einem Kutter in einen schrecklichen Sturm …
Inhaltsverzeichnis
Für meine Mutter Emmy, meinen Vater Hugo, meine Geschwister Benno, Bodo, Belinda und Britta, für Paule, Opa Wilhelm, Robbie Williams, Herrn und Frau Redlich, Maike, Tom, Rudi, Ole, Minna, Struppi, Tinka und den langen Hein
Auf gar keinen Fall für Frau Küster, Doktor Schwenker, Tante Hulda und Herrn und Frau Griesmeier
KOPFSPRUNG INS LEBEN
Ich heiße Bernhard von Lüttelbüttel und bin am Gründonnerstag nachts um drei beinah mit einem Kopfsprung auf die Welt gekommen. So hat es Frau Küster jedenfalls immer ihren Freundinnen erzählt und sich dabei kaputtgelacht. Ich hab die Geschichte so oft gehört, dass ich sie irgendwann geglaubt habe.
Herr Küster – »der Paule«, wie ihn Frau Küster immer nennt – war in der Nacht um Viertel vor zwei aufgewacht, weil sein Arm eingeschlafen war. Das hab ich nie so ganz verstanden, warum man aufwacht, wenn was eingeschlafen ist, aber egal. Ist jetzt nicht wichtig. Paule hat für einen Menschen ziemlich gute Ohren, aber im Vergleich mit uns Hunden ist er fast taub.
»Elfriede«, sagte Paule, »da ist was mit Emmy. Sie jault so komisch.«
Emmy ist meine Mutter. Eigentlich heißt sie ja Emilia von Schwarzenberg, aber Paule und Elfriede sagen immer nur Emmy zu ihr.
»Vielleicht ist es so weit«, meinte Elfriede. »Geh doch mal gucken!« Dann drehte sie sich um und schlief weiter.
Paule zog sich seine braun-rot karierten Hausschuhe an, die ich ihm später total zerkaut hab, weil ich sie so todschick fand, und seinen rot-blau gestreiften Bademantel und ging runter in den Zwinger. Emmy lag auf der Seite und winselte. Ihr Bauch war ganz dick, und sie hechelte.
Paule strich ihr über den Kopf und sagte: »Ich hol den Doktor, mein Mädchen, mach dir keine Sorgen!«
Dann rannte er wieder hinauf ins Schlafzimmer zu Elfriede. Also machte er sich doch Sorgen, sonst wäre er ja nicht gerannt.
Zwanzig Minuten später waren alle bei Emmy im Zwinger versammelt. Elfriede, Paule und Doktor Schwenker. Doktor Schwenker untersuchte meine Mutter und machte ein grimmiges Gesicht.
»Verflucht noch mal«, brummte er. »Da steckt einer im Geburtskanal fest.«
Der, der da feststeckte, das war ich.
Plötzlich brach die große Hektik aus. Meine Mutter bekam eine Narkose, Doktor Schwenker schnitt ihr den Bauch auf, Elfriede sagte ständig »ogottogottogott«, und ich rutschte in hohem Bogen auf die Welt. Paule konnte mich gerade noch auffangen, irgendwie hatte man einen Moment lang gar nicht auf mich im Geburtskanal geachtet.
Meine Geschwister wurden behutsam aus Mamas Bauch gehoben, und dann wurde Mama wieder zugenäht. Es ging uns allen richtig gut, meinen Brüdern Benno und Bodo und meinen Schwestern Belinda und Britta von Lüttelbüttel.
Kurz darauf wachte auch meine Mutter auf. Sie grunzte vergnügt, begrüßte uns alle mit einem Nasenstupser und leckte uns sauber. Dann durften wir endlich so viel Milch an ihren Zitzen trinken, wie wir wollten, und Mama achtete darauf, dass wir nach dem Saugen ein »Schäferhündchen« machten. Das heißt, sie wollte, dass wir laut und deutlich rülpsten. Bei Hunde- und Menschenbabys gehört sich das so.
Paule und Elfriede ließen uns und Mama ein paar Tage in Ruhe … Dann kamen die ersten Besucher, und wir wurden vorgestellt. Opa Wilhelm war so begeistert von uns, dass er uns von nun an fast jeden Tag besuchte, sich auf den Rasen legte, und wir durften auf ihm herumtoben. Es störte ihn auch nicht, wenn wir ihn ins Ohr bissen, seine Brille zerbrachen oder auf seinem Bauch Pipi machten.
Es war eine wunderbare Zeit. Wir tobten auf dem Hof herum, schliefen auf warmem Stroh im Zwinger, und wenn es regnete, holte uns Frau Küster sogar manchmal ins Haus. Dort hingen überall Ölgemälde und Fotos von Bernhardinern, alle Plüschtiere waren Bernhardiner, auf den Tellern und Tassen waren Bernhardiner aufgemalt, auf einem Sofakissen war ein Bernhardiner aufgestickt, und sogar auf der Fußmatte war ein Bild von einem Bernhardiner.
Am beeindruckendsten fand ich aber den lebensgroßen Porzellanbernhardiner im Flur. Vor allem wenn Paule sagte: »Man kann sich gar nicht vorstellen, dass diese Winzlinge bald genauso groß sind!« Das konnte ich mir auch nicht vorstellen und glauben erst recht nicht. Aber wenn Paule das sagte, dann musste es stimmen. Alles, was Paule sagte, stimmte.
Als wir zehn Wochen alt waren, kamen die ersten Interessenten. Emmy war wütend und knurrte, aber Paule kraulte sie hinterm Ohr und erklärte ihr, dass die Hundebabys nicht alle im Haus bleiben könnten, da das Haus für alle Hunde zusammen viel zu klein sei. Jedes Hundebaby würde daher in eine neue Familie kommen, wo es den gesamten Platz eines Hauses ganz für sich allein hätte.
Mama legte den Kopf schief und hörte aufmerksam zu.
»Wie soll ich dir das erklären, meine Beste«, seufzte Paule. »Aber glaub mir, es ist richtig so, und deinen Babys wird es gut gehen.«
Paule dachte wahrscheinlich, Mama kapiert nicht, was er sagt, dabei hatten wir alle jedes Wort verstanden. Die Menschen fliegen zum Mond und haben das Fernsehen erfunden, aber sie haben bis heute nicht begriffen, dass wir Hunde alles verstehen, was sie sagen. Alles. Wirklich alles. Wir können bloß nicht antworten, und es ist zum Jaulen, dass die Menschen unsere Sprache überhaupt nicht, kein kleines bisschen verstehen.
Die Leute, die kamen, fanden uns alle süüüß, nahmen uns auf den Arm und streichelten uns, lachten sich kaputt, wenn wir stolperten, und legten uns widerliche kleine bunte Halsbänder um, an denen sie uns auf der Straße hinter sich herzerrten.
Bei vielen Gesprächen hörte ich, dass unser Vater Hugo vom Walde hieß, in Bayern auf einem Bauernhof lebte und ein riesiger Rüde war, der hundertzwanzig Kilo wog. Er hatte langes, dichtes braunes Fell und eine pechschwarze Gesichtsmaske.
Ich fand ihn wunderschön. Er war ein Bild von einem Bernhardiner!
Elfriede zeigte Fotos von Hugo, auf denen er ein kleines Fass um den Hals trug, in dem angeblich Schnaps sein sollte und das die Interessenten am allermeisten beeindruckte.
Ich beschloss, unbedingt so groß und stark zu werden wie mein Vater Hugo, wollte auch mit einem Fass durch die Gegend laufen, und überhaupt war ich ungeheuer stolz, ein Bernhardiner zu sein.
Aber das sollte sich bald ändern.
DIE INTERESSENTEN
Mittlerweile war es Juli, und ich hatte das Gefühl, dass es von Tag zu Tag heißer wurde. Mama lag die ganze Zeit in der schattigsten und kühlsten Ecke des Zwingers und schnaufte schwer. Wir versuchten alles, sie zum Spielen zu bewegen, aber sie hatte keine Lust.
Ich fand es im Zwinger für uns alle inzwischen auch ziemlich eng, vor allem weil Bodo andauernd stänkerte und sofort zuschnappte, wenn ihm jemand zu nahe kam. Ich konnte Bodo nicht ausstehen. Obwohl wir alle unseren eigenen Fressnapf hatten (wir bekamen jetzt nämlich schon richtiges Erwachsenenfutter, nur mit ganz viel Wasser verdünnt), stürzte sich Bodo immer auf den Napf eines anderen und knurrte ihn weg. Und jedes Mal gab es Streit und eine Rauferei. Bodo nervte wirklich.
Wenn man doch nur mit Doktor Schwenker hätte reden können! Dann hätte ich ihn mal gefragt, warum Bodo ständig so eklig war, aber das ging ja nicht, Doktor Schwenker verstand uns ja nicht.
Er kam an einem Vormittag für das »große Programm«. So nannte es Frau Küster. Wir wurden alle auf die Waage gestellt; wir Rüden wogen schon über zehn Kilo, die Hündinnen erst acht. Der Doktor fand es okay. Dann bekamen wir alle eine Spritze. Angeblich war es eine Impfung gegen alle möglichen Krankheiten, die ich nicht kannte, aber ich fand es ekelhaft. Mir hat es auch wehgetan, obwohl Doktor Schwenker zu Frau Küster sagte: »Da merken die Hunde gar nichts von.« Haben die eine Ahnung!
Bevor er ging, gab er Frau Küster noch eine große Packung Anti-Wurm-Tabletten. Die hab ich genau gesehen. Es waren knallrote, längliche Tabletten. Frau Küster hat sie uns sofort unters Futter gemischt, aber ich hab sie nicht runtergeschluckt, sondern im Zwinger wieder ins Heu gespuckt. Ich hab keine Würmer. Das würde ich doch merken! Dass die Menschen die Hunde immer für doof verkaufen müssen.
Bevor Doktor Schwenker wieder ging, sagte er noch, wir wären alle feine und gesunde Hunde (na also!) und es wäre jetzt an der Zeit, dass wir alle in irgendwelche Familien kämen. Nur mit mir stimme was nicht. Als er Frau Küster erklären wollte, was mit mir alles nicht in Ordnung war, gingen die beiden ins Haus, und ich konnte nichts mehr hören.
Ich hab mir dann Sorgen gemacht und die Wurmtabletten im Stroh gesucht, aber ich hab sie nicht mehr gefunden. Sonst hätte ich sie noch genommen. Ehrenwort.
In der Nacht konnte ich überhaupt nicht schlafen, weil ich nicht wusste, ob ich jetzt sterbe oder nicht, ob ich überhaupt einen Menschen finde, der einen Hund wie mich will und ob mich die Küsters behalten, wenn mich keiner will. Bei Mama wäre ich schon gerne geblieben, obwohl Mama in letzter Zeit auch so abweisend war und nur noch ihre Ruhe haben wollte.
Es ist schrecklich, wenn die Zukunft so ungewiss ist! Ich habe die ganze Nacht gewinselt, aber keiner hat es gemerkt, weil Mama so laut geschnarcht hat.
Belinda wurde als Erste abgeholt. Vielleicht weil Paule schon immer »meine Hübsche« zu ihr gesagt hatte. Sie kam zu einem jungen Paar, einer blonden Frau und einem Mann mit Locken und Hakennase, der ziemlich affig aussah. Die beiden waren ganz hysterisch vor Begeisterung, küssten Belinda auf die Nase und sagten mindestens zwanzig Mal, dass sie alles tun würden, um Belinda glücklich zu machen.
Frau Küster sagte, sie würde ihnen nicht raten, Belinda im Bett schlafen zu lassen, weil Bernhardiner nicht nur groß, sondern sogar unverschämt groß werden, aber die blonde Frau kicherte nur, und Belinda knurrte leise, weil sie Frau Küsters Bemerkung absolut überflüssig fand.
Frau Küster nahm dann ein Bündel Geldscheine in Empfang, setzte Belinda der blonden Frau im Auto auf den Schoß, winkte kurz zum Abschied, und dann war Belinda weg.
Ich hatte so ein flaues Gefühl im Magen, als wenn ich viel zu schnell und viel zu viel eiskaltes Wasser getrunken hätte, denn ich konnte mir nicht vorstellen, Belinda jemals wiederzusehen, und war plötzlich furchtbar traurig, dass ich sie nicht mehr hinter den Ohren geknabbert hatte, was Belinda unglaublich schön fand. Sie konnte wundervoll schnurren, was für einen Bernhardiner ziemlich außergewöhnlich war.
Ich winselte stundenlang, so groß war plötzlich die Sehnsucht nach Belinda, und da kam Mama und legte sich neben mich. Jetzt knabberte sie mich hinter den Ohren und erklärte mir, dass jeder Bernhardiner ein menschliches Rudel braucht, um sich weiterzuentwickeln, um gut ernährt, medizinisch versorgt und groß und stark zu werden, um ein langes Leben zu haben und vor allem um im Leben eine Aufgabe zu haben. Insofern sollten wir glücklich und nicht unglücklich sein, dass Belinda ein menschliches Zuhause gefunden hatte.
Das alles leuchtete mir ein, und in der Nacht schlief ich tief und traumlos.
Als Nächstes kamen zwei ältere Damen, die einen Bernhardiner haben wollten, der den lieben langen Tag vor dem Haus liegen und aufpassen sollte. Ich fand das zwar relativ langweilig, aber ich fühlte mich dieser Aufgabe durchaus gewachsen und strich den beiden unentwegt um die Beine. Aber sie hatten gar kein Interesse an mir, sondern nur Augen für Britta, die um die Augen eine ganz schwarze Maske hatte und damit wie eine Gangsterbraut aussah.
Die beiden nahmen Britta mit. Mich hatten sie noch nicht mal gestreichelt. Ich tröstete mich damit, dass die beiden Damen sicher keinen »Mann« im Haus haben wollten.
Bodo und Benno holte das Rote Kreuz. Sie sollten beide als Lawinensuchhunde ausgebildet werden. Ich stellte mir den Job ungeheuer aufregend vor und beneidete die beiden sehr, vor allem weil Bodo überhaupt nicht nett war, aber dann hatte er so ein Glück. Gut riechen konnte ich auch, bestimmt genauso gut wie Bodo und Benno – aber mich wollte keiner.
Ich war unglücklich und fraß nicht mehr. Sie sollten sich Sorgen um mich machen, ich wollte sehen, ob mich noch irgendjemand wenigstens ein kleines bisschen mochte. Aber Paule und Elfriede merkten von meinem Hungerstreik gar nichts, denn Mama fraß meine Portion immer mit auf und war anschließend jedes Mal äußerst zufrieden.
Also fraß ich wieder. Wenn es keiner mitkriegt, muss man sich nicht quälen.
UNGEWISSE ZUKUNFT
Es war bereits August. Paule und Elfriede saßen auf der Terrasse, sahen hinüber zum Zwinger und unterhielten sich über mich. Vollkommen ungeniert, weil sie sicher waren, dass ich kein Wort verstand.
»Er wird immer älter und immer größer, bald ist er kein Baby mehr, und wer will schon so einen abgrundtief hässlichen Hund!«
Mir stockte der Atem. Ich war hässlich? Wieso? Vielleicht hatte ich eine schiefe Nase? Ich rieb mir mit der Pfote die Nase, als würde es mich jucken, aber es fühlte sich alles ganz normal an.
»Aber er ist doch so ein lieber Kerl«, verteidigte mich Paule.
»Vielleicht, aber was nützt das? Dieser Hund hat krumme Beine, schlechte Zähne, ein Triefauge und keine Maske. Wer soll uns den abkaufen? Für die Zucht ist er nicht zu gebrauchen. Im Grunde ist er zu gar nichts zu gebrauchen.«
Ich stand auf und guckte mir meine Beine an. Ich konnte beim besten Willen nichts Krummes entdecken. Für mich waren sie wundervoll, und ich bin mir sicher, dass ich auch ganz schnell rennen konnte, wenn man mich nur mal aus diesem Zwinger herauslassen würde. Und meine Zähne waren schlecht? Und mein Auge triefte? Das war ja etwas ganz Neues. Und sie fanden mich nicht schön, weil ich nicht so schwarz um die Augen war wie Britta? Man musste also aussehen wie ein Gangster, um ein richtiger Bernhardiner zu sein? Du lieber Himmel, das hatte ich ja gar nicht gewusst!
»Der Hund ist jetzt über vier Monate alt«, meinte Frau Küster. »Er sieht schon gar nicht mehr aus wie ein Welpe. Wenn er nicht innerhalb der nächsten zwei Wochen verkauft wird, kriegen wir ihn nicht mehr los.«
»Und dann?« Paule runzelte die Stirn und sah zu mir herüber. Ich saß ganz ordentlich und aufrecht im Zwinger und bemühte mich, gut auszusehen. Als Frau Küster weiterredete, legte ich den Kopf ein bisschen schief, um besser zuhören zu können.
»Dann müssen wir uns was überlegen. Hierbleiben kann er jedenfalls nicht. Er frisst uns die Haare vom Kopf und ist zu nichts nütze.«
»Wir können eine Annonce aufgeben«, überlegte Paule. »Zur Not müssen wir ihn eben verschenken.«
Ich ließ die Ohren hängen. Am liebsten hätte ich geweint, so unglücklich war ich. Aber das würden die Küsters gar nicht merken, sondern nur wieder von meinem »Triefauge« reden. Ich konnte das alles nicht verstehen. Ich war erst ein paar Monate alt, hatte noch gar nichts Schlimmes angestellt, und schon gab es jede Menge Probleme mit mir. Die Küsters taten ja gerade so, als wäre ich grundsätzlich überflüssig auf der Welt.
»Dieser Hund kostet nur Geld«, schimpfte Frau Küster. »Und ich glaube nicht, dass die Annonce was bringt. Wer sich einen so großen Hund anschafft, der viel Arbeit und Dreck macht, der will auch, dass er ein bisschen anständig aussieht. Aber nicht so wie Bernhard! Dieser Hund hat kein Gesicht, das ist einfach fürchterlich.«
Einen Augenblick lang stockte mir der Atem. Was meinte sie denn damit schon wieder? Natürlich hatte ich ein Gesicht! Ich hatte mich selbst im Spiegel gesehen. Ich hatte eine große, dicke schwarze Nase, einen weißen Kopf, kleine Augen und braune Ohren. Bisher hatte ich mich immer wunderschön gefunden, aberjetzt war ich ganz verunsichert. Es gab also eine Vorschrift, wie ein Bernhardiner aussehen musste? Ja, war ich dann gar kein richtiger Bernhardiner? Aber was war ich dann? Mama und Papa waren doch auch Bernhardiner!
Ich versuchte gerade, darüber nachzudenken, als Paule sagte: »Im Tierheim nehmen sie ihn bestimmt. Sie müssen ihn nehmen, sie dürfen ihn gar nicht ablehnen.«
»Hast du eine Ahnung!« Frau Küsters Stimme überschlug sich fast. »Wir sind Züchter! Und wir fliegen aus dem Züchterverband raus, wenn wir die Hunde, die wir nicht loswerden, immer im Tierheim abgeben. Nein, Paule, das taugt alles nichts. Aber ich habe schon mit Doktor Schwenker gesprochen.«
Paule sah seine Frau völlig entgeistert an. Ich konnte bis in den Zwinger riechen, dass ihm der Schweiß ausbrach, und in diesem Moment bekam auch ich es mit der Angst zu tun.
»Nein!«, sagte Paule. »Das kannst du nicht machen! Er ist doch so ein lieber Kerl!«
Das hatte Paule schon einmal gesagt. Mein Herz klopfte wie wild. Ich hatte so eine Ahnung, was Frau Küster meinte, aber ich war mir nicht ganz sicher.
Frau Küster legte die Hand auf Paules Arm, wahrscheinlich um ihn zu beruhigen.
»Wir züchten Bernhardiner, mein Schatz«, säuselte sie kaum hörbar, aber ich stellte die Ohren auf und konnte jedes Wort verstehen, auch wenn Frau Küster so leise sprach. »Wir brauchen das Geld. Dringend. Wir haben den Zwinger gebaut, das muss sich alles erst mal rentieren.«
Paule nickte nur stumm.
»Wenn wir alle Hunde behalten, die wir nicht verkaufen können, weil sie nicht perfekt sind, dann haben wir hier bald ein Tierheim! Das kostet ein Heidengeld, wir haben keinen Platz mehr zum Züchten, haben keine Einnahmen mehr und gehen pleite. Willst du das?«
Paule schüttelte nur stumm den Kopf.
»Also bringen wir ihn zu Doktor Schwenker, wenn nicht in den nächsten Tagen noch ein Wunder geschieht. Er kriegt eine Spritze, und der Fall ist erledigt. Er merkt nichts davon, er weiß nicht, was mit ihm passiert, es tut nicht weh und es geht ganz schnell. Und wir sind die Sorge los.«
Paule sagte gar nichts.
»Wir hätten es schon viel früher machen sollen. Gleich in der ersten Woche. Aber wir hatten ja keine Erfahrung. Wir wussten ja nicht, dass hässliche Hunde unverkäuflich sind. Das nächste Mal sind wir schlauer.«
Ich hatte also doch richtig verstanden. Sie wollten mich einschläfern! Nur weil ich die falsche Fellfarbe hatte! Ein paar Tage nur noch! Es musste ein Wunder geschehen, oder ich war tot!
Paule! Warum sagte er denn nichts? Warum rettete er mich nicht? Warum sagte er Elfriede nicht, dass er da nicht mitspielte. Dass es gemein war, einen kleinen Hund zu töten, nur weil er nicht so aussah wie die andern Bernhardiner in den Hundebüchern. Paule, sag doch was!, schrie ich in Gedanken, aber Paule stand nur schweigend auf und ging ins Haus. Sein Rücken war ganz krumm. Wahrscheinlich war er traurig, aber er war auch feige. Schrecklich feige.
Ich hatte so entsetzliche Angst, dass ich anfing zu jaulen. Mama schnarchte. Sie hatte nichts von dem Gespräch mitbekommen. Auch auf mein Jaulen reagierte sie nicht, vielleicht dachte sie einfach nur, dass ich mich im Zwinger langweilte.
Natürlich langweilte ich mich im Zwinger, aber das war allemal besser, als …
Nur noch ein paar Tage!
»Hör auf zu jaulen«, sagte Frau Küster, als sie ins Haus ging. »Du hast gar keinen Grund. Es ist alles gut.«
Da sah man mal wieder, wie die Menschen lügen konnten.
ABSCHIED
Am nächsten Vormittag ging Frau Küster zum Friseur. Sie ging jede Woche einmal zum Friseur, wahrscheinlich war es ihr zu umständlich, sich allein die Haare zu waschen.
Ich hatte die ganze Nacht kein Auge zugemacht und hin und her überlegt, was ich anstellen könnte, um aus dem Zwinger abzuhauen, aber mir war nichts eingefallen. Ich war dann ganz dicht an Mama herangekrochen und hatte mich an sie gekuschelt. Ihr gleichmäßiger Herzschlag beruhigte mich etwas, aber machte mir mein Unglück auch noch bewusster. Warum durften alle leben, nur ich nicht?
Als ich leise anfing zu winseln, legte mir Mama tröstend ihre schwere Pfote auf den Rücken und schnarchte weiter. Ich beschloss, am Morgen mit ihr zu reden. Vielleicht wusste sie ja einen Rat.
Als Frau Küster weg war, kam Paule zum Zwinger und sah mich nachdenklich an.
»Komm mit, Bernie«, sagte er. »Wir machen einen Spaziergang. «
Ich bekam einen Schreck. Sie wollten doch noch zwei Wochen warten, oder? Warum denn heute schon? Vor lauter Angst bekam ich Schluckbeschwerden und fing an zu schmatzen. Mama legte mir wieder ihre Pfote auf den Rücken.
»Es ist gut«, grunzte sie. »Paule tut dir nichts.«
Da hatte Mama gestern doch nicht so fest geschlafen, wie ich gedacht hatte. Sie wusste also, was Frau Küster und Doktor Schwenker mit mir vorhatten.
»Nutze die Chance«, raunte sie mir zu. »Jetzt, solange Frau Küster weg ist. Du musst dir eben allein einen Menschen suchen. Halte dich an kleine Kinder. Das klappt meist am besten. Noch bist du nicht so groß, dass sie Angst vor dir haben. Geh auf keinen Fall mit Erwachsenen mit, die du nicht kennst. Und vergiss nicht, immer ganz fest an dich zu glauben. Dann schaffst du alles. Du bist doch ein lieber kleiner Kerl. Keine Schönheit, aber ein Bernhardiner ist ein Bernhardiner, weil er stark und treu und hilfsbereit ist. Ein Bernhardiner geht für seinen Freund durchs Feuer. Das allein zählt. Nicht die Farbe in seinem Gesicht.«
»Aber Frau Küster sagt …«, fing ich an, aber Mama fiel mir ins Wort.
»Ich weiß, was Frau Küster sagt. Sie ist eine furchtbar dumme Frau. Wenn ich könnte, würde ich mir auch andere Menschen suchen, aber ich habe nun mal mein Rudel hier. Und Paule ist es wert, dass ich bleibe.«
»Dann werde ich dich jetzt nie wiedersehen?«
»Man soll nie nie sagen«, meinte Mama und zog die Lefzen hoch, sodass sie aussah, als würde sie lächeln. »Und wenn du Probleme hast, geh zu deinem Vater, Hugo vom Walde. Er wohnt in Bayern, in Holzkirchen. Du wirst ihn schon finden. Er ist so riesig, dass man ihn einfach nicht übersehen kann.«
»Wo ist denn die Leine?«, schimpfte Paule und suchte auf dem Hof herum. »Elfriede ist nicht mehr lange weg, und ich finde die verdammte Leine nicht!«
Mama knabberte zum Abschied an meinen Lefzen und biss mich liebevoll ins Ohr. »Mach’s gut, mein Sohn«, brummte sie. »Mein starker, kluger, lieber Sohn. Sei stolz darauf, dass du so bist, wie du bist. Kümmere dich nicht darum, was die anderen sagen.«
Ich leckte Mama dankbar den Kopf und wäre so gerne bei ihr geblieben. Aber ich verstand schon, dass das nicht möglich war.
Endlich hatte Paule die Leine gefunden und schloss die Zwingertür auf. »Komm mal her, Bernie!«, rief er, und ich trabte näher. Er klinkte die Leine am Halsband ein und zog mich mit sich. Ich drehte mich noch einmal um und bellte kurz.
Mama antwortete nicht. Sie lag dicht am Gitter und hatte den Kopf auf die Vorderpfoten gelegt. Aber sie öffnete ein Auge, und es sah aus, als würde sie mir zuzwinkern.
WOHIN?
Paule lief so schnell, dass ich kaum mit ihm mitkam. Ich musste die ganze Zeit rennen. Ich sah immer wieder zu ihm hoch, aber er sah mich gar nicht an. Blickte stur geradeaus und hatte die Lippen ganz fest aufeinandergepresst. So kannte ich ihn gar nicht. Wenn er zu uns in den Zwinger gekommen war, uns auf den Arm nahm oder hinter den Ohren kraulte, hatte er immer gelächelt.
Direkt hinter der Hinkelsteinstraße bogen wir rechts in ein kleines Tannenwäldchen ab. Paule ging jetzt langsamer, wahrscheinlich weil er hier Elfriede nicht mehr begegnen konnte. Er hatte ja keinen blassen Schimmer davon, dass ich ganz genau Bescheid wusste.
Wir gingen noch ungefähr eine Viertelstunde schweigend nebeneinander her, dann blieb Paule stehen.
»So«, sagte er mehr zu sich als zu mir. »Das müsste reichen.«
Er machte mich von der Leine los und nahm mir das Halsband ab. Dann streichelte er mich.
»Mach’s gut, mein Hase«, sagte er.
Ich wusste, dass er es lieb meinte, aber ich fand es schon komisch, dass er jetzt auch noch Hase zu mir sagte.
»Jetzt musst du es allein schaffen, Bernie. Ich wünsche dir von Herzen, dass du einen netten Menschen findest.«
Ich bellte leise, war mir aber nicht sicher, ob er wusste, dass ich ihn verstanden hatte.
Dann schüttete er noch ein kleines Häufchen Trockenfutter, das er in den Hosentaschen gehabt hatte, auf den Waldboden und küsste mich auf den Kopf.
»Du bist ein feiner Kerl.«
Er hatte ganz feuchte Augen, und jetzt musste auch ich weinen.
»Pass auf dich auf, Triefauge!« Er bemühte sich zu lächeln. »Bleib jetzt hier, ja? Lauf mir nicht nach!«
Er strich mir noch einmal übers Fell, dann drehte er sich um und ging den Weg zurück.
Ich blieb ganz brav sitzen und sah ihm nach.
Danke, Paule! Du hast mir das Leben gerettet. Das werde ich dir nie vergessen! Vielleicht würde es mir ja gelingen, als erwachsener Hund noch einmal vorbeizukommen, damit Paule sah, dass es mir gut ging und dass mir nichts passiert war. Ich würde ihm die Hände und das ganze Gesicht ablecken, und Frau Küster würde ich in ihren Hintern beißen.
Der Gedanke amüsierte mich, aber dann wurde ich sofort wieder traurig. Ich war jetzt ganz allein auf der Welt. Hatte keine Mama, keine Geschwister und keinen Paule mehr, der auf mich aufpasste und mir Futter brachte. Und mein Vater lebte in Bayern. Das war verdammt weit weg, das wusste ich, weil Frau Küster einmal zu Paule gesagt hatte: »Noch mal machen wir mit der Hündin die ewige Fahrt zu Hugo vom Walde nicht. Das ist ja Wahnsinn! Ich werde mal im Internet gucken, ob es nicht auch hier in der Nähe einen Rüden gibt, zu dem wir Emilia [also meine Mutter] bringen können.«
Ob meine Mutter den Rüden leiden konnte, von dem sie kleine Hundewelpen kriegen sollte, interessierte Frau Küster nicht.
Ich war völlig ratlos, fraß erst mal das Trockenfutter auf und trabte dann los. Immer geradeaus. Weg von dem Ort, wo ich geboren worden war.
DAS ZIEL
Mama!
Ich hatte solch eine Sehnsucht nach meiner Mutter, dass ich kaum laufen konnte. Ob sie Angst um mich hatte? Ob sie mich vermisste? Dachte sie an mich und machte sich so viele Sorgen, dass sie nicht schlafen konnte?
Als Bodo und Benno abgeholt wurden, hatte sie nur gemurmelt: »Das Rote Kreuz ist ein ehrwürdiger Verein. Sie werden es gut haben.« Also machte sie sich keine Gedanken. Aber um mich konnte man sich schon Sorgen machen.
Es wäre so schön gewesen, wenn ich bei Mama hätte bleiben können. Aber das wollte Frau Küster nicht. Eher hätte sie mich umgebracht. Frau Küster ging einmal in der Woche zum Friseur, sie hatte ein Auto und ein großes Haus mit Bernhardinerporzellanfiguren. Die waren sicher ein Vermögen wert! Aber mich wollte sie wegen der paar Krümel Trockenfutter, die ich am Tag fraß, umbringen.
Es war zum Heulen. Mama!, schrie ich in Gedanken und wäre am liebsten umgekehrt und wieder zurück nach Hause gelaufen. Ich konnte es einfach nicht ohne sie aushalten. Sie war die tollste Mutter der Welt. Immer ganz ruhig, nie schlecht gelaunt. Oft hatte ich gedacht, alles was geschah, wäre ihr gleichgültig – aber das stimmte nicht. Sie beobachtete stumm und sagte uns dann, was wir machen sollten.
Mama!
Ich setzte mich unter einen Baum und weinte ein bisschen. Es war ein schreckliches Gefühl, wenn man kein Zuhause und keine Familie mehr hatte.
Irgendwie musste ich eingeschlafen sein, denn ich träumte von einem großen, hohen, dunklen Tannenwald. Ich hatte einen Hasen aufgestöbert und verfolgte ihn. Der Hase war verdammt schnell, und immer wenn er einen Haken schlug, wollte ich genauso die Richtung wechseln und kam ins Schleudern. Ich wurde immer wütender und hatte Lust, dem eingebildeten Hasen in die Ohren zu beißen. So wie er immer nach rechts und nach links vor mir hersprang, hatte ich das Gefühl, dass er sich über mich lustig machte.
Und plötzlich war er weg! Wie vom Erdboden verschwunden. Ich guckte nach oben, weil ich mir nicht sicher war, ob ein Hase nicht genauso auf Bäume klettern konnte wie eine Katze, aber da war er nicht. Vielleicht war er in einem Loch verschwunden. Ich schnüffelte den ganzen Waldboden ab, aber ich fand ihn nicht. Und allmählich wollte ich dem Hasen nicht nur in die Ohren beißen, sondern ihn ganz auffressen, so schrecklichen Hunger hatte ich. Richtige Bauchschmerzen vor Hunger, und davon wurde ich wach.
Ich sah mich um. Weit und breit war kein Hase in Sicht.
Mühsam rappelte ich mich hoch. Dass Hunger so verflucht wehtun konnte! Es hatte alles keinen Zweck, ich musste schleunigst wieder dorthin, wo Menschen waren. Vielleicht konnte ich in einer Mülltonne etwas Fressbares finden, obwohl es mich ein kleines bisschen ekelte. Frau Küster hatte immer, wenn sie eine Mülltüte über den Hof zur Mülltonne brachte, »Pfui Teufel! « gesagt.
Während ich weiterlief, dachte ich über meine schwierige Situation nach. Es stimmte ja gar nicht, dass ich keine Familie mehr hatte. Ich konnte zwar nicht zurück zu meiner Mutter, aber irgendwo wohnten meine Geschwister, und in Bayern lebte mein Vater Hugo vom Walde.
Ich würde zu ihm laufen. Ja genau, das würde ich tun! Auch wenn es weit war, ich würde es schon schaffen. Mein Vater lebte auf einem großen Bauernhof, wo er sicher eine ganz wichtige Aufgabe hatte. Jeder Bernhardiner hatte eine Aufgabe, und mein Vater war groß und stark. Das hatte Frau Küster immer betont. Vielleicht konnte ich ihm bei seiner Arbeit helfen. Und vielleicht konnte ich sogar eines Tages in seine Pfotenstapfen treten, wenn er zu alt war.
Ich lief schneller, immer schneller, und war richtig fröhlich dabei, denn jetzt hatte ich endlich ein Ziel!
DAS MEER
Ich schaffte es nicht, so lange zu laufen, wie ich eigentlich wollte. Immer wieder musste ich mich hinsetzen und verschnaufen, und dabei schlief ich regelmäßig ein. Das kann doch nicht normal sein, dachte ich und machte mir schon Sorgen, aber dann fiel mir ein, dass Frau Küsters Freundin einmal gefragt hatte: »Wie schaffst du das bloß? Rund um die Uhr die ganze Arbeit mit so vielen Hunden.«
Und Frau Küster hatte geantwortet: »Ach was! Alles halb so wild. Kleine Hunde schlafen sich groß. Die sind ja grade mal drei bis vier Stunden am Tag wach.«
Mir war das früher gar nicht so aufgefallen, dass wir ständig auf einem großen Haufen alle übereinanderlagen und leise schnarchten. Das war so warm und kuschelig gewesen und nicht so trostlos und kühl wie jetzt ohne Mama, ohne Geschwister und ohne gemütliches Stroh.
Ich lag am Rande eines kleinen Grabens neben einer Weide mit riesigen Kühen, die furchterregend aussahen, aber Hundegott sei Dank gar keine Notiz von mir nahmen, und merkte, dass es windiger wurde. Es war, als wenn mir der Wind zum einen Ohr hinein und zum anderen wieder hinaus blies, obwohl ich doch Schlappohren hatte, wie ein dicker Vorhang vor einer offenen Tür – aber selbst die nutzten jetzt nichts mehr. Ich musste weiter.
In der Ferne sah ich einen Hügel. Vielleicht waren dahinter ja Menschenhäuser, wo ich mir etwas zu fressen suchen konnte.
Ich rannte hinauf und blieb vor Schreck so plötzlich stehen, dass ich fast vornüberfiel. Da waren nämlich keine Häuser, sondern nur Wasser! So weit ich gucken konnte Wasser ohne Ende! Das musste das Meer sein, von dem Paule so oft gesprochen hatte! Es glitzerte in der Abendsonne und sah aus, als hätte irgendjemand bis zum Horizont Diamanten ausgeschüttet. Umwerfend schön! Natürlich warf es mich nicht wirklich um, aber ich stand da wie erstarrt. Paule hatte zwar oft davon geredet und manchmal gesagt: »Ich fahr ans Wasser, Elfriede. Muss mal über den Deich spazieren und mir ’ne steife Brise um die Nase wehen lassen, damit ich den Kopf wieder frei kriege …«, aber ich hatte das Meer ja noch nie gesehen, und – ehrlich gesagt – so groß hatte ich es mir nicht vorgestellt.
Ich hielt die Nase in den Wind. Vielleicht pustete er mir ja das Heimweh aus dem Kopf, vielleicht hatte Paule ja so etwas in der Art gemeint.
Einige Minuten stand ich so da, und ich glaube, ich dachte an gar nichts. Mein Kopf war ganz leer. Paule hatte mal wieder völlig recht gehabt.
Aber dann fiel mir auf, dass das Wasser immer dunkler wurde und immer orangefarbener glitzerte. Die Sonne ging unter. Du lieber Himmel! Es wurde Nacht, bald würde es stockfinster sein, und ich hatte keinen Schlafplatz. Geschweige denn etwas zu fressen!
Panik überfiel mich. Ich rannte auf dem Deich entlang. Solange es noch hell war, hatte ich hier oben einen guten Überblick.
Ich lief und lief. Obwohl mir vor Hunger schon ganz schlecht war. Rechts vom Deich, auf der Landseite, lagen einzelne Gehöfte. Riesige Häuser mit riesigen Dächern, die fast bis auf die Erde hinunterhingen. Winzige kleine Fenster, aber ein Dach, das bis in den Himmel ragte. Ganz anders als bei Paule und Frau Küster. Da hatte das Dach oben auf dem Haus gesessen wie ein Deckel auf einem Topf, aber hier waren die Dächer wie Paules Mütze, die er sich weit über die Ohren und bis auf die Nase gezogen hatte, sodass sich Mama immer wunderte, dass er überhaupt noch etwas sehen konnte.
Außerdem waren die Dächer nicht aus Schieferplatten wie bei Küsters, sondern aus Schilf oder Gras oder Stroh … So genau konnte ich das nicht erkennen. In jedem Fall war es komisch, und ich wagte es nicht, hinunterzurennen und mich vor eine Tür zu setzen und zu jaulen, weil ich noch niemanden gesehen hatte, der in so einem Haus wohnte.
Die Sonne war mittlerweile am Horizont verschwunden, und es wurde immer dunkler. Ich konnte kaum noch laufen, aber die Angst saß mir wie eine bissige Raubkatze im Nacken. Also rannte ich weiter.
Plötzlich sah ich am Ufer nicht wie bisher all die klobigen Steine, wo man sich die Beine brechen konnte, wenn man darüberlief, sondern feinen weißen Sand. »Ein Strand!«, jubelte ich. Mama hatte manchmal davon geschwärmt. Es sei das tollste Gefühl überhaupt, durch weichen Sand zu laufen, hatte sie gesagt, es sei Massage für die Pfoten, und man fühle sich wie auf Wolken.
Aber das Beste an dem Strand, zu dem ich jetzt runterlief, war, dass lauter kleine Häuschen darauf standen. Und weit und breit kein Mensch. Also waren die Hütten wahrscheinlich leer. Wie geschaffen zur Übernachtung für kleine, hungrige Bernhardiner.
In einer der Hütten lag ein sandiges Handtuch, das irgendjemand wohl vergessen hatte, in einer anderen fand ich ein paar Brotkrümel und eine zerknüllte Papiertüte. Leider hatte niemand ein paar Schinkenbrötchen liegen lassen!
Egal. Ich war glücklich, in dieser Nacht ein bisschen Schutz zu haben.
Todmüde sprang ich auf den mit blau-weißem Stoff überzogenen Sitz einer der Hütten, rollte mich zusammen und sah hinaus aufs Meer.
Es war jetzt vollkommen dunkel. In der Ferne blinkte ein weißes Licht. Keine Ahnung, ob das einer dieser Leuchttürme oder eine dieser Bojen war, die den Schiffen im Dunkeln den Weg wiesen, wie Mama erzählt hatte, aber eigentlich war es mir auch egal.
Das leise Plätschern des Wassers machte mich noch müder, als ich ohnehin schon war, und ich schlief sofort ein.
Zwei Stunden später wurde ich wach, weil ich vor Angst schlotterte und schon zweimal von der Bank gefallen war. Der Mond stand hell und unheimlich über dem Wasser; eine Möwe schrie heiser. Ich war ziemlich sicher, dass es kein Lebewesen auf der ganzen Welt gab, das so allein war wie ich, und überlegte gerade, ob ich mir nicht lieber ein Loch im Sand buddeln sollte, um mich darin zu verstecken, als ich in unmittelbarer Nähe, vielleicht drei Meter entfernt, einen schwarzen Klumpen liegen sah. Der Klumpen war offenbar ganz nass, denn er glänzte im Mondlicht und sah irgendwie eklig aus. Wie ein riesiger Wurm oder eine rasierte Monsterratte. Ich starrte den schwarzen Haufen an und wagte es nicht, mich zu rühren. Ich konnte mich gut daran erinnern, dass Mama, die uns jeden Abend eine Gutenachtgeschichte erzählt hatte, einmal von einem Meerungeheuer gesprochen hatte, das wie ein riesiger wabbliger Pudding aussah, auf seine Beute zuschlitterte und darüberschwappte, und nach fünf Minuten hatte sich der Mensch oder der Hund darunter in nichts aufgelöst.
Daher war ich mir absolut sicher, dass der schwarze Haufen hier am Strand ein Seeungeheuer war, ein kleines zwar, aber ich wollte es trotzdem nicht auf mich aufmerksam machen, zumal ich jetzt sah, dass sich der Haufen langsam hob und senkte. Das Ungeheuer atmete.
Auf einmal blieb mir fast das Herz stehen: Das Monster bewegte sich, drehte einen schmalen Kopf zu mir herum und sah mich an.
»Hei!«, sagte es und bellte heiser. »Wer bist denn du?« »Ich heiße Bernhard von Lüttelbüttel«, antwortete ich stolz und versuchte, mir nicht anmerken zu lassen, wie erschrocken ich war. »Bin ein gebürtiger, reinrassiger Bernhardiner.«
Copyright © 2011 by Sabine Thiesler und
Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH Einband und Illustrationen von Doris Eisenburger Einbandgestaltung: Eisele Grafik·Design, München Herstellung: Mariam En Nazer Satz: Leingärtner, Nabburg
eISBN 978-3-641-06317-7
www.heyne-fliegt.de
www.randomhouse.de
Leseprobe