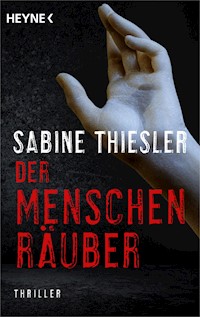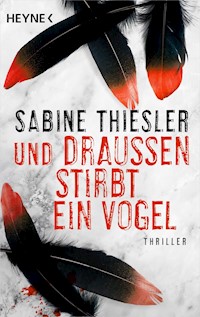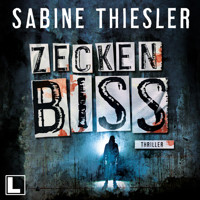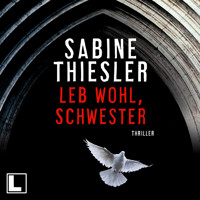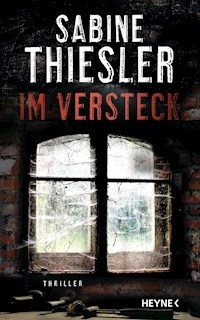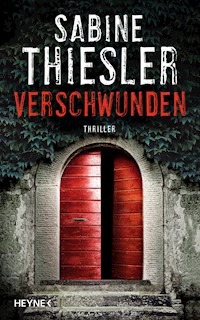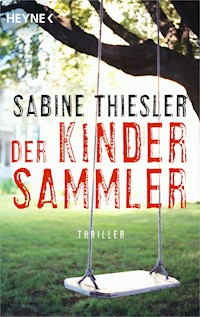
SONDERANGEBOT
SONDERANGEBOT
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Es geschieht am helllichten Tag
Anne und ihr Mann Harald erleben den Albtraum aller Eltern: Während eines Toscana-Urlaubs verschwindet ihr Kind beim Spielen spurlos. Die Suche der Polizei verläuft ergebnislos, und sie müssen ohne ihren Sohn nach Hause fahren. Zehn Jahre später kehrt Anne an den Ort des Geschehens zurück, um herauszufinden, was damals passiert ist. Sie ahnt nicht, wie nah sie dem Täter kommt – und er ihr.
Ein Roman, der einem zuweilen den Hals abschnürt, so schrecklich realistisch ist die Geschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 736
Veröffentlichungsjahr: 2010
4,4 (98 Bewertungen)
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Sammlungen
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
Die Autorin
Widmung
PROLOG
ALFRED
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
ENRICO
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Kapitel 83
Kapitel 84
Kapitel 85
Kapitel 86
Kapitel 87
Kapitel 88
Kapitel 89
Kapitel 90
Kapitel 91
Kapitel 92
Kapitel 93
Kapitel 94
Kapitel 95
Kapitel 96
Kapitel 97
EPILOG
Copyright
Das Buch
Anne und ihr Mann Harald erleben den Albtraum aller Eltern: Während eines Toscana-Urlaubs verschwindet ihr Kind beim Spielen spurlos, und sie müssen zwei Wochen später unverrichteter Dinge nach Hause fahren. Zehn Jahre danach kehrt Anne an den Ort des Geschehens zurück, um herauszufinden, was damals passiert ist. In einem einsamen Tal kauft sie eine romantische Wassermühle von einem charismatischen Deutschen. Der Mann fasziniert sie, und sie vertraut ihm bereits nach kurzer Zeit blind. Sie weiß nicht, dass dieser charmante, freundliche Mann ein Massenmörder ist, der sowohl in Deutschland als auch in Italien mehrere Kinder getötet hat und sich seit Jahren unbehelligt in den toscanischen Bergen versteckt hält.
Die Autorin
Sabine Thiesler, geboren und aufgewachsen in Berlin, studierte Germanistik und Theaterwissenschaften. Sie arbeitete einige Jahre als Schauspielerin im Fernsehen und auf der Bühne und war Ensemblemitglied der Berliner »Stachelschweine«. Außerdem schrieb sie erfolgreich Theaterstücke und zahlreiche Drehbücher fürs Fernsehen (u. a. Das Haus am Watt, Der Mörder und sein Kind und mehrere Folgen für die Reihen Tatort und Polizeiruf 110). Bereits mit ihrem ersten Roman Der Kindersammler stand sie wochenlang auf der Bestsellerliste. Ebenso mit den folgenden Büchern Hexenkind, Die Totengräberin, Der Menschenräuber, Nachtprinzessin, Bewusstlos, Versunken, Und draußen stirbt ein Vogel, Nachts in meinem Haus, Zeckenbiss und Der Keller.
Danke,Klaus,für deinen Ratund deine Liebe.
PROLOG
Toscana 1994
Die Atmosphäre im Tal war eigentümlich. Alle Fenster und Türen der beiden Häuser waren geschlossen, was Allora noch nie erlebt hatte. Weder der Mann noch die Frau waren zu sehen. Aber als sie ganz still war und den Atem anhielt, hörte sie ein leises Wimmern, beinah wie das Jaulen einer Katze.
Allora bohrte in der Nase und wartete ab. Das Jaulen verstummte manchmal für wenige Minuten, setzte aber immer wieder ein. Als sie ein hohes, schrilles Quietschen hörte, zuckte sie zusammen und fing an zu zittern. Angst kroch ihr langsam den Nacken empor. Was war da los? Sollte sie einfach hingehen und anklopfen? Aber sie wagte es nicht. Der Engel war kein Mensch, bei dem man einfach auftauchen und »allora« sagen konnte. Der Engel hatte etwas an sich, vor dem sie zurückschreckte. Als wäre er mit einem unsichtbaren Stacheldraht umwickelt, der einen verletzte und einem die Haut aufschlitzte, wenn man zu nahe kam.
Und zum ersten Mal kam ihr der Gedanke, dass der Engel vielleicht gar kein Engel war.
Die Sonne war längst untergegangen, und die Nacht brach herein. Im Wald wurde es schnell dunkel, viel schneller als auf freiem Feld. Allora dachte noch nicht an den Rückweg, sie starrte unverwandt in Richtung Mühle. Die Laternen links und rechts neben der Tür brannten nicht, und auch im Haus war alles dunkel.
Als Allora das Haus kaum noch erkennen konnte, wurde ihr klar, dass sie die Zeit vergessen hatte, jetzt konnte sie nicht mehr zurück. Sie würde im Wald übernachten müssen.
Plötzlich hörte sie einen Schrei. Einen lang anhaltenden Schrei, der gar nicht mehr enden wollte. Und in diesem Moment wusste Allora, dass das keine Katze war, sondern ein Mensch.
Allora hielt sich die Ohren zu, bis der Schrei verstummte. Danach war es totenstill. Kein Laut drang mehr aus der Mühle zu ihr herüber. Sie rieb sich die Augen, die brannten, als hätte sie zu nahe am Feuer gesessen und zu lange in die Flammen gestarrt.
Sie war wie gelähmt. Saß in ihrem Erdloch, unfähig, sich zu bewegen. Langsam kroch ihr die Kälte in die nackten Füße und die Beine hinauf. Allora wühlte sich noch tiefer in ihr Erdloch und häufte Zweige, Blätter und Moos um sich herum, alles, was sie erreichen konnte, ohne ihre Kuhle zu verlassen. Dann umschlang sie ihre Beine mit den Armen, legte ihr Kinn auf die Knie und wartete weiter. Ihr Atem ging gleichmäßig, ihr Herz schlug jetzt langsamer. Aber sie war hellwach, konzentrierte all ihre Sinne auf die stille Mühle. Doch da war nichts mehr. Kein Laut. Kein Ton. Fenster und Türen blieben geschlossen, der Mann kam nicht mehr aus dem Haus.
Das Käuzchen schrie. So wie das Käuzchen in der Nacht geschrien hatte, als die alte Giulietta gestorben war. Ihre geliebte Nonna.
Allora wusste am nächsten Morgen nicht, ob sie die ganze Nacht so gesessen und gewacht oder ob sie geschlafen hatte.
Im Morgengrauen hörte sie, wie die hölzerne Küchentür in den Angeln quietschte. Die Sonne kam gerade mit den ersten Strahlen über die Bergkuppe, als der Mann aus dem Haus trat. In seinen Armen trug er einen leblosen Jungen, genau so, wie sie ihre Nonna getragen hatte. Der Kopf des Jungen hing weit nach hinten gekippt über dem linken Unterarm des Mannes, der Mund stand offen. Seine blonden Haare bewegten sich leise im Wind. Den rechten Unterarm hatte der Mann unter den Knien des toten Kindes, die Beine baumelten schlaff hin und her, als er mit ihm zum ausgetrockneten Teich ging und es behutsam hineinlegte.
Wenig später begann die Betonmischmaschine mit ohrenbetäubendem Krach zu rotieren, sodass Allora die Flucht ergriff. Der Mann, den sie von nun an nie wieder Engel nannte, hatte sie nicht bemerkt.
Alloras Glieder waren steif und kalt, ihr Atem ging flach, sie musste so viel denken, dass ihr das Laufen schwer fiel. Sie brauchte drei Stunden bis nach San Vincenti. Niemand fragte sie, wo sie in der Nacht gewesen war.
Sie ging in ihr Zimmer und kroch in ihr Bett, ohne sich die Erde von den Armen und Beinen zu waschen. Sie zog sich die Decke über die Ohren und versuchte zu verstehen, was sie gesehen hatte, aber es gelang ihr nicht.
ALFRED
1
Berlin/Neukölln, November 1986
Er war nicht auf der Jagd und hatte nicht vor, sich an diesem nebligen und ungewöhnlich kalten Novembertag sein nächstes Opfer zu suchen. Es passierte einfach, auch für ihn völlig unerwartet. Vielleicht war es schicksalhafte Fügung oder einfach nur ein dummer Zufall, dass er an diesem Morgen verschlafen hatte und anderthalb Stunden später aus dem Haus ging als gewöhnlich.
Ein eisiger Wind fegte durch die Straßen, und es nieselte leicht. Alfred fröstelte und schlug den Kragen seines Mantels hoch. Handschuhe, Schal oder Mütze hatte er nie dabei. Kleidung empfand er als Belastung, den schlichten grauen Pullover und die dunkelblaue Cordhose trug er das ganze Jahr über. Sie waren im Sommer zu dick und im Winter zu dünn und schützten ihn auch jetzt nicht vor dem kalten Wind, der ihm in die Mantelärmel fuhr.
Alfred lebte seit drei Jahren zurückgezogen und vollkommen unerkannt im Berliner Kiez. Er hatte keine Freunde und vermied engere Kontakte, er lehnte Zerstreuung und Unterhaltung jeglicher Art ab, ging nie ins Kino oder Theater und hatte in seiner kargen Hinterhofwohnung auch keinen Fernseher.
Obwohl er erst Anfang dreißig war, zogen sich durch sein volles, leicht gewelltes Haar bereits die ersten grauen Strähnen, was seinem markanten Gesicht einen interessanten Ausdruck verlieh. Auf den ersten Blick war er ein gut aussehender, sympathischer Mann. Seine blassblauen, glasklaren Augen fixierten sein Gegenüber stets sanft und eindringlich und signalisierten großes Interesse. In Wahrheit war eher das Gegenteil der Fall.
Nachdem er kurz überlegt hatte, bog er die nächste kleine Nebenstraße rechts ab, in Richtung Kanal. Es war wenig Betrieb um diese Zeit, die Kinder waren längst in der Schule, und wer nicht unbedingt musste, ging bei diesem Wetter nicht aus dem Haus. Eine Dönerbude, eine Kneipe, ein Bäcker, mehr gab es nicht in dieser Straße. Ein Friseur, ein Zeitungsladen und ein kleiner türkischer Gemüseladen hatten letztes Jahr Pleite gemacht, die Läden waren nicht wieder vermietet worden. Einmal in der Woche kam die Müllabfuhr, das war alles. Die alten Leute waren weggestorben, neue Familien zogen nicht hierher. Nicht in diese Gegend. Viele Wohnungen standen leer, eingeworfene Scheiben wurden nicht mehr erneuert, Tauben nisteten in verdreckten, heruntergekommenen Zimmern und Hausfluren.
In seinen Schläfen begann es dumpf zu pochen. Er wusste, dass dies der Vorbote einer Migräne sein konnte. Gestern Abend hatte er am Küchenfenster gesessen und stundenlang auf die ockergelbe, fleckige Fassade des Quergebäudes und eine graue Mauer gestarrt, die den Hinterhof vom Nachbargrundstück trennte. Der Hof war asphaltiert, irgendjemand hatte einen Blumentopf mit einem verkümmerten Gummibaum neben die Mülltonnen gestellt. Sicher, um ihn loszuwerden, und nicht, um den Hinterhof zu begrünen. Jetzt welkte diese kümmerliche Pflanze schon seit Wochen vor sich hin und war für die Mieter des Hauses die einzige Natur weit und breit.
In der einen Hand hielt er den Brief, den er immer wieder las, und in der anderen das Rotweinglas, aus dem er immer wieder trank. Seine beiden unerträglichen Schwestern, die Zwillinge Lene und Luise, teilten ihm lapidar mit, dass ihre Mutter von einer Nachbarin gefunden worden war. Tot. In ihrer Badewanne. Erst nach der Beerdigung hatten die Zwillinge beim Sichten des Nachlasses die Nummer seines Postfachs gefunden und ihn benachrichtigen können. Sie hatten die Habseligkeiten ihrer Mutter verbrannt und das Haus verkauft. Sein Einverständnis voraussetzend.
Grüße.
Natürlich mussten sie sie irgendwann finden. Er hatte schon lange damit gerechnet.
Im Oktober, als er eine Woche freigehabt und sich gelangweilt hatte, war er zu ihr gefahren. Sie lebte in einem kleinen Haus am Rande eines Dorfes in Niedersachsen. Er hatte seit drei Jahren nichts mehr von seiner Mutter Edith gehört und wollte sehen, wie es ihr ging.
Als er mit seinem weißen Honda auf den Hof fuhr und hupte, regte sich nichts. Es war totenstill. Früher hatte immer der Hund gebellt, wenn jemand kam, und seine Mutter war augenblicklich aus der Tür getreten, mit einer misstrauischen Zornesfalte auf der Stirn, da sie nie etwas Gutes vermutete, wenn unangemeldet jemand vor dem Haus stand.
Doch diesmal kam kein Laut. Nirgends rührte sich etwas. Er hatte das Gefühl, als hielte selbst der Wind einen Moment den Atem an, denn kein Blatt bewegte sich. Keine Katze schlich vorsichtig um die Hausecke.
Es hatte den ganzen Morgen geregnet, aber jetzt kam die Sonne zwischen den Wolken hervor und machte deutlich, wie schmierig und verstaubt die Fensterscheiben des Hauses waren, die seit Jahren niemand mehr geputzt hatte. Das Unkraut zwischen den Pflastersteinen, das seine Mutter immer penibel entfernt hatte, war jetzt kniehoch und überwucherte fast den gesamten Hof, in den Blumenkästen steckten die Strünke von Geranien, die schon vor mehreren Wintern vertrocknet waren.
Der Anblick seines Elternhauses erfüllte ihn mit Entsetzen. Er näherte sich langsam. Leise, um die Grabesstille nicht zu stören, und auch in Erwartung von etwas Schrecklichem.
Er ging an der Hinterseite des Stalls vorbei über ein Beet, auf dem die Brennnesseln ihm bis zur Hüfte reichten. Früher war das ihr Erdbeerbeet gewesen.
Als er um die Stallecke bog, sah er ihn. Ringo, einen Schnauzer-Schäferhund-Mischling, der seiner Mutter immer ein treuer Freund gewesen war. Seine Mutter hatte ihm ihre Zuneigung nur dadurch gezeigt, dass sie ihm abends seinen Fressnapf füllte, aber Ringo liebte sie trotzdem. Er kannte es nicht anders.
Ringo war immer noch angekettet und lag auf der Seite. Seine mageren, steifen Beine sahen aus wie überstreckt. Dort, wo einmal seine Augen gewesen waren, klafften tiefe blutverkrustete Löcher, Krähen hatte die Augen und die größten Teile seines Gehirns herausgepickt. Anschließend hatten sich Würmer in Ringos Schädel eingenistet.
Alfred beugte sich hinunter und strich über das verfilzte Fell, das sich über dem skelettartigen, völlig abgemagerten Körper spannte.
»Du bist verhungert, mein Alter«, flüsterte er. »Sie hat dich doch wahrhaftig verhungern lassen.« Alfred atmete tief durch. Er würde sich später um Ringo kümmern. Jetzt musste er erst mal ins Haus und fürchtete sich vor dem, was ihn erwartete.
Die Haustür war abgeschlossen, einen Schlüssel besaß er schon lange nicht mehr. Er klingelte lange und ausdauernd, aber nichts rührte sich. Auch auf sein Rufen antwortete niemand. Das kleine Flurfenster neben der Tür, das früher immer nur angelehnt gewesen und durch das er als Junge geklettert war, wenn er seinen Schlüssel vergessen hatte, war ebenfalls fest verschlossen. Alfred holte einen Stein, schlug das Fenster ein und stieg ins Haus. Anschließend klopfte er sich die Splitter vom Pullover, durchquerte den Flur und öffnete die Tür zum Wohnzimmer.
Edith Heinrich saß in einem Sessel am Fenster hinter einer zugezogenen Gardine und war nur noch ein Schatten ihrer selbst. Ein magerer kleiner Mensch mit einer derart schmalen Silhouette, dass sie sich kaum von der Rückenlehne des Sessels abhob.
Als ihr Sohn hereinkam, rührte sie sich nicht, zuckte mit keiner Wimper und schien keineswegs überrascht. Als wäre er nur eben mal draußen gewesen, um Petersilie zu holen.
»Ich bin’s, Mama«, sagte Alfred. »Wie geht’s?«
»Blendend«, antwortete sie. Ihr Zynismus war ungebrochen, und ihr Ton war immer noch hart und kalt, obwohl ihre Stimme schwach geworden war. Ihr Blickfeld war stark eingeengt, und auch den Kopf konnte sie nur mit Mühe bewegen. So musste sie den ganzen Oberkörper drehen, um ihm hinterherzuschauen, als er durchs Zimmer ging und die dunklen Vorhänge aufzog. Tageslicht durchflutete den Raum und machte den Staub sichtbar, der wie ein dicker Brei im Zimmer hing.
»Draußen scheint die Sonne«, sagte er.
»Das ist mir egal«, erwiderte sie und schloss geblendet die Augen.
Alfred schaltete die Deckenbeleuchtung aus und öffnete die Fenster, denn im Zimmer roch es muffig wie in einem feuchten Keller, in dem Kartoffeln faulen.
Edith fing augenblicklich an zu zittern und rutschte noch tiefer in ihren Sessel. Er nahm eine klamme Decke vom Sofa und legte sie ihr über. Edith ließ es kommentarlos geschehen und sah ihn mit matten Augen an, die schon lange ihren Glanz verloren hatten.
Dann ging er in die Küche. Seine Mutter musste schon ewig nichts mehr gegessen haben, die Essensreste, die herumstanden, und auch die, die er im Kühlschrank fand, waren uralt und verschimmelt. Unter der Spüle fand er eine Plastiktüte, fegte die Essensreste hinein und ging nach draußen, um sie wegzuwerfen.
Danach öffnete er mit Mühe die schwere morsche Stalltür, die ihm fast entgegenfiel, als er sie vorsichtig aufzog. Das eine Schwein, das noch lebte, lag apathisch auf der Erde und war so mager wie seine Mutter. Er nahm ein Messer und schnitt ihm die Kehle durch. Es quiekte nur kläglich, als es sein einsames, armseliges Leben aushauchte.
Zu ernten gab es nichts. Auch der Apfelbaum, von dem er als Kind gefallen war, hatte eine merkwürdige Krankheit, alle Äpfel waren verschrumpelt und mit schwarzem Schorf bedeckt.
»Du musst ins Heim«, sagte er zu seiner Mutter. »Du kommst allein nicht mehr klar.«
»Gar nichts muss ich«, erwiderte sie.
»Aber allein verhungerst du! Du stehst ja noch nicht einmal auf und gehst in die Küche, um dir was zu essen zu holen!«
»Na und?«
»Ich kann dich doch nicht einfach hier verrecken lassen!«
In Ediths Augen kam für einen Moment Leben zurück, denn sie funkelten wütend. »Wenn der Teufel kommt, um mich zu holen, dann ist das in Ordnung. Halt du dich da raus!«
Alfred wunderte sich, wie viel Kraft noch in dieser abgemagerten kleinen Person steckte.
»Du hast den Hund verhungern lassen. Und das Schwein.«
Sie zuckte nur die Achseln.
»Du hast ihm ja nicht mal Wasser gegeben, dem armen Kerl!«
»Erst hat er tagelang gebellt. Und dann war er still. Also ist er ganz friedlich eingeschlafen.«
Alfred sagte nichts mehr, denn er sah, wie erschöpft seine Mutter war. Wahrscheinlich hatte sie schon jahrelang mit niemandem mehr gesprochen. Er sah, wie ihr Kopf zur Seite sackte, sich ihr Mund leicht öffnete und sie leise zu schnarchen begann.
In der Nähe des Apfelbaumes hob er eine tiefe Grube für den Hund und das Schwein aus. Als er die beiden Tiere beerdigt hatte, fegte er den Hof und säuberte die Küche. Danach ging er zu seiner Mutter, hob sie aus dem Sessel und fing an, sie zu entkleiden. Edith riss erschrocken die Augen auf und schrie. Hoch und schrill wie ein Fasan in der Schnauze des Fuchses. Er achtete nicht darauf und zog sie weiter aus. Pullover für Pullover, Bluse für Bluse, Hemd für Hemd. Edith trug zwiebelartig fast alles übereinander, was sie besaß.
»Was machen die Zwillinge?«, fragte er.
Edith antwortete nicht, sondern schrie weiter wie am Spieß.
Die Badewanne hatte er zuvor geschrubbt und von Jahre altem Dreck und Rost befreit. Das lauwarme Badewasser war dennoch hellbraun und trüb. Widerwillig hielt er den alten, faltigen, aber federleichten Körper in seinen Armen. Seine Mutter zappelte und schlitzte ihm mit ihren ungeschnittenen scharfen Fingernägeln die Wangen auf. Sie wehrte sich mit all ihren Kräften, berührt, getragen, gehoben und gebadet zu werden. Wie eine Wilde schlug sie um sich und schrie ohne Unterlass. Alfred spürte, wie ihm das Blut von den Wangen den Hals hinunterlief und in seinem Pullover versickerte. Seine Mutter kam ihm vor wie ein widerwärtiges Insekt, das er Lust hatte zu zerquetschen.
Immer hatte sie sich gewehrt. Ihr Leben lang. Gegen jede Berührung, jede Liebkosung. Sie war nie in der Lage gewesen, ihre Kinder in den Arm zu nehmen. Und in diesem Moment besaß sie übermenschliche Kräfte und strampelte immer noch, als er ihren winzigen Körper in die trübe Brühe gleiten ließ.
Sie lag in der Wanne, schlapp wie eine Libelle, die mit nassen, schweren Flügeln nie wieder von der Wasseroberfläche starten kann. Ihre dünnen, weißen Zöpfe schwammen auf dem Wasser, ihre Augenlider waren flammend rot, als hätte sie tagelang geweint.
»Du Dreckskerl«, schimpfte sie, »hol mich sofort hier raus!«
Alfred reagierte nicht. Er starrte auf ihre spitzen Knie, die aus dem Wasser ragten. Versuchte zu begreifen, dass dieses hilflos in der Wanne treibende Skelett seine Mutter war, aber es gelang ihm nicht. Mit der Hand verursachte er eine Wellenbewegung, und ihr Körper schlingerte hin und her.
»Du hattest grünes Fruchtwasser«, kreischte sie. »Du bist eine Missgeburt!«
»Ich weiß, Mama«, sagte er leise und lächelte. Dann verließ er das Badezimmer und versuchte die Hilferufe seiner Mutter zu überhören, als er im Wohnzimmer seinen Autoschlüssel suchte.
Sie würde aus eigener Kraft nie mehr aus der Wanne kommen. Das war ihm bewusst, als er das Haus verließ. Und bereits eine Viertelstunde später hatte er sie vergessen.
Als er die dritte Flasche Wein geleert hatte, zerriss er den Brief. Er hatte nicht vor, sich bei seinen Schwestern zu melden. Außerdem würde er sich um ein neues Postfach kümmern.
Betrunken fühlte er sich nicht. Er schaltete die Küchenbeleuchtung aus, blieb in absoluter Dunkelheit sitzen und versuchte im Kopf alle Zahlen von eins bis tausend miteinander zu addieren, um sein Gehirn zu trainieren. Er schaffte es noch nicht einmal bis zwanzig.
Alfred steckte die Hände in die Hosentaschen und ging vornübergebeugt, der Wind blies ihm direkt ins Gesicht und nahm ihm den Atem. Sein Kopfschmerz wurde stechend. Er brauchte dringend ein paar Aspirin und einen heißen Kaffee.
Nur wenige Schritte weiter war die Kneipe »Der Fußballtreff«. Alfred sah durchs Fenster. Zwei Männer saßen an der Bar. Der eine hatte schlohweißes Haar und einen langen Mozartzopf, das war Werner. Natürlich war er um diese Zeit schon da. Werner hatte geerbt, konnte keine großen Sprünge machen, aber wenn er in seiner billigen Wohnung blieb, würde sein Geld reichen, bis er fünfundneunzig war. Werner war davon überzeugt, nicht so alt zu werden und früher zu sterben, und sah dementsprechend hoffnungsvoll in die Zukunft. Zwischen neun und zehn Uhr kam er jeden Morgen in den »Fußballtreff«, begann mit zwei Kännchen starkem Kaffee, Rührei und Brötchen und ging dann allmählich zum Bier über. Er trank langsam, aber kontinuierlich den ganzen Tag, blieb an der Theke sitzen, redete mit den Leuten, die hereinkamen, wusste alles über alle im Kiez und malte ab und zu ein Bild von einem der Gäste.
Um Mitternacht ging er immer nach Hause. Aufrechten Ganges, mit festem Schritt und nie betrunken. Werner gehörte zum festen Inventar des »Fußballtreff«, hier in dieser Kneipe würde ihn der Schlag treffen, hier würde er irgendwann vom Barhocker fallen und mit den Füßen voran hinausgetragen werden.
Seit er Werner kennen gelernt hatte, mied Alfred den »Fußballtreff«, obwohl er dort noch vor kurzem relativ regelmäßig gefrühstückt oder zu Mittag Buletten gegessen hatte. Er hatte Verlangen und Begeisterung in Werners Augen gesehen, als sie sich einmal gegenübersaßen. Werner war von ihm fasziniert, und Alfred wusste, dass er ihn unbedingt malen wollte. Und das wollte Alfred vermeiden.
Eine halbe Stunde noch, dann machte Milli ihren Imbissstand auf. Bei Milli gab es einen großen, heißen Milchkaffee, die besten Currywürste der Stadt und Aspirin gratis. Bis zum Neuköllner Schifffahrtskanal war es nicht mehr weit, er beschloss, noch einen Spaziergang zu machen und danach bei Milli zu frühstücken.
Es hatte aufgehört zu regnen, der starke Wind trieb die Wolken vor sich her und riss ab und zu eine Lücke in die dichte Wolkendecke. Bis zum Kanal waren es nur noch wenige Meter. Ein schmaler Fußweg führte am Ufer entlang. Alfred wandte sich nach rechts, Richtung Britz. Morgens zwischen acht und zehn führten hier viele Hundebesitzer ihre Hunde spazieren, aber um diese Zeit war kaum jemand unterwegs.
Die stillen Spaziergänge am Kanal waren zurzeit in seinem Leben die einzigen Momente, die er wirklich genoss. Er ging langsam und hatte das wunderbare Gefühl, an gar nichts zu denken. Hin und wieder zog ein Lastkahn oder ein Schubverband an ihm vorbei, die meisten aus Polen oder Russland, wahrscheinlich auf dem Weg nach Hamburg oder nach Holland und Frankreich. Er hob jedes Mal grüßend die Hand, und die Kapitäne fassten sich ebenfalls grüßend an die Mütze. Er überlegte seit Tagen, ob er nicht vielleicht versuchen sollte, auf einem Binnenschiff anzuheuern, aber das waren meist Familienbetriebe, und mehr als drei Personen arbeiteten auf so einem Schiff nicht. Der Kapitän, seine Frau und ein Maschinist, der meist Bruder oder Schwager war. Da hatte er als Außenstehender kaum eine Chance. Und mehr als Deckschrubben konnte er nicht. Wenn er wirklich Ernst machen und zur See fahren wollte, musste er nach Hamburg und dort versuchen, auf irgendeinem Containerschiff mitzufahren, um endlich einmal über den großen Teich zu kommen.
Was ihn allerdings davon abhielt, war der Gedanke, über Wochen auf einem Schiff gefangen zu sein, ohne Chance, sich zu separieren, an Land zu gehen oder abzuhauen. Er wollte nicht noch einmal auf engstem Raum mit anderen zusammengepfercht sein und deren Gestank und Macken aushalten müssen. Das hatte er gehabt. Das wollte er nie wieder erleben.
In diesem Moment hörte er den gellenden Schrei eines Kindes, der sofort erstickt wurde. Wie elektrisiert blieb er stehen und drehte sich um. In einiger Entfernung sah er einen kleinen blonden Jungen, der gerade von zwei Jugendlichen, die mindestens fünf bis sechs Jahre älter waren, überfallen und mit einem Messer bedroht wurde.
Alfred rannte los. Es war der 12. November 1986, zehn Minuten vor halb zwölf.
2
Benjamin Wagner gammelte seit heute Morgen um Viertel vor acht in der Stadt herum. Sein blondes Haar lockte sich durch die Nässe, einzelne Regentropfen liefen an seinem Pony herunter und kitzelten ihn an der Nase. Seine Turnschuhe waren völlig durchnässt. Merkwürdigerweise waren beide an den Innenseiten aufgerissen, sodass er zwischen Sohle und Oberleder ein Lineal schieben konnte. Das tat er auch häufig und gerne in der Schule, wenn er sich langweilte, wodurch die Schuhe immer weiter aufrissen. Und es war sein einziges Paar Turnschuhe. Die Stiefel, die ihm sein Vater gekauft hatte und die ihm seine Mutter jeden Morgen aufdrängen wollte, konnte er nicht ausstehen, weil sie an den Fersen scheuerten.
Er fror mittlerweile entsetzlich. Durch seinen Anorak drang zwar kein Wasser, aber der Regen war ihm durch den Halsausschnitt hinten den Rücken hinuntergelaufen, das T-Shirt klebte am Körper und hatte den gleichen Effekt wie ein eiskalter Umschlag. Benjamins Zähne klapperten. Er wusste, dass es ein Fehler gewesen war, die Kapuze nicht aufzusetzen, aber er hasste Kapuzen. Sie schränkten das Blickfeld ein, und wenn er den Kopf drehte, rutschte ihm die Kapuze über die Augen. Außerdem konnte er unter dem imprägnierten Kapuzenstoff auch nicht richtig hören. Was in der Stadt gefährlich war. Man musste immer auf der Hut sein.
In seiner Schultasche, die er seit heute Morgen mit sich herumschleppte, waren zwei Klassenarbeiten, die von seinen Eltern unterschrieben werden sollten. Eine Mathearbeit mit einer Sechs und ein Diktat mit einer Fünf. Er würde die fünfte Klasse nicht schaffen, und dann kam er ins Heim. Davon war er überzeugt, denn ein Junge aus seiner Klasse, der letztes Jahr sitzen geblieben war, war auch ins Heim gekommen. Und Benjamin wollte nicht ins Heim. Alles, aber nicht ins Heim.
Am vorigen Abend hatte er sich in seinem Zimmer verkrochen, hatte den Walkman auf den Ohren und stand am Fenster. »Bitte, Papa, komm. Bitte, bitte, Papa komm doch!« Ab und zu setzte er sich aufs Bett und blätterte in der Bravo, die er sich von seinem Freund Andi geliehen hatte, und las immer und immer wieder einen Bericht übers Küssen. Er konnte kaum glauben, was da stand. Dass sich Menschen gegenseitig die Zunge in den Mund schoben, wenn sie sich mochten, war für ihn unvorstellbar. Aber er hielt das ruhige Sitzen immer nur wenige Minuten aus. Dann schob er die Bravo wieder unter die Matratze, falls seine Mutter hereinkommen sollte, und ging ans Fenster, um dasselbe Stoßgebet noch einmal zum Himmel zu schicken.
»Bitte, Papa, komm doch endlich! Bitte, lieber Gott, mach, dass Papa nach Hause kommt!«
Aber Papa kam nicht.
Seine Mutter Marianne saß unterdessen in ihrem Rollstuhl vor dem Fernseher und sah sich eine Vorabendserie im Fernsehen an. Bis vor drei Jahren war sie eine sportliche junge Frau gewesen, aber dann war sie eines Abends im Bad einfach umgefallen, weil sie ihre Beine nicht mehr spürte. Die Taubheitsgefühle und das ständige Kribbeln in Armen und Beinen hatte sie nicht ernst genommen und ihrem Mann verschwiegen. Bei Marianne Wagner wurde Multiple Sklerose diagnostiziert. Trotz Physiotherapie und starker Medikamente kamen die Schübe immer häufiger, bis der Rollstuhl nicht mehr zu vermeiden war, denn die Tage, an denen sie normal laufen konnte und wieder etwas Gefühl in den Beinen hatte, wurden immer seltener. Depressionen waren die Folge. Marianne litt darunter, ihrem Kind keine vollwertige Mutter und ihrem Mann keine vollwertige Ehefrau mehr sein zu können. Sie weinte viel und fing an zu rauchen, obwohl das ihren Zustand noch verschlechterte.
Benjamin hatte ständig Angst, seine Mutter zu enttäuschen. Er fühlte sich sofort schuldig, wenn sie in Tränen ausbrach, und konnte es überhaupt nicht aushalten, seine geliebte Mutter weinen zu sehen. Er wusste, wie sehr sie darunter litt, dass er so große Probleme in der Schule hatte, weil sie sich ihrerseits Vorwürfe machte, versagt zu haben. Auf keinen Fall durfte sie von den verhauenen Klassenarbeiten erfahren. Denn immer, wenn sie sich sehr aufregte, bekam sie einen neuen Schub und war hinterher noch viel kränker als vorher.
An diesem Abend vor dem Fernseher rauchte sie wieder Kette. An der Art, wie sie die Zigaretten ausdrückte, konnte Benjamin erkennen, wie es ihr ging. Ihre Hände zitterten, sie war fahrig und nervös, ihre Augen waren gerötet. Offensichtlich hatte sie schon geweint und machte sich Sorgen, weil ihr Mann Peter wieder mal nicht nach Hause kam.
Benjamin starrte auf die Straße und hypnotisierte die Straßenecke mit dem orangefarbenen Haus, das erst im letzten Sommer frisch angestrichen worden war. Um diese Ecke bog sein Vater gewöhnlich, wenn er von der Arbeit kam, meist mit so schnellen Schritten, dass man ihn leicht verpasste, wenn man nicht unentwegt auf dieselbe Stelle starrte. Peter Wagner arbeitete bei Siemens am Band und hatte um siebzehn Uhr Feierabend. Er stieg dann am Siemensdamm in die U7 und konnte durchfahren bis zur Karl-Marx-Straße oder zum U-Bahnhof Neukölln. Beides war gleich weit, das Mietshaus im schlichten Baustil der sechziger Jahre, in dem sie seit fünf Jahren wohnten, lag direkt dazwischen. Es war zwar eine verdammt lange U-Bahn-Fahrt, zwanzig Stationen, aber wenn ihm die U-Bahn nicht direkt vor der Nase wegfuhr und alles glatt ging, war er oft schon vor sechs zu Hause. Allerdings ging er in letzter Zeit relativ häufig noch mit seinem Kollegen Ewald, der in der Herrmannstraße wohnte, einen trinken. Ewald stieg dann mit ihm zusammen am Bahnhof Neukölln aus, ersparte sich das Umsteigen und ging anschließend die nur unwesentlich weitere Strecke zu Fuß nach Hause.
Marianne war dieser Ewald ein Dorn im Auge. Sie war wütend über jeden Abend, den ihr Mann in der Kneipe verbrachte und das knappe Geld die Kehle hinunterspülte. Außerdem war sie auch traurig über jeden Abend, den sie nicht mit ihrem Mann verbringen konnte, denn sie sah ihre Zeit inzwischen sehr begrenzt, sie glaubte nicht mehr daran, Benjamins Volljährigkeit zu erleben.
Dabei war Peter nie aggressiv, wenn er volltrunken nach Hause kam. Er tastete sich dann an den Wänden entlang und lächelte dümmlich, als amüsiere er sich selbst über seinen schwankenden Schritt, konzentrierte sich auf das Schlafzimmer, fiel ins Bett und sofort in Tiefschlaf. In diesem Zustand redete er nicht, beantwortete keine Fragen und ließ sich nicht provozieren, sondern winkte nur ständig ab. Nichts konnte ihn dann erreichen. Kein noch so großes Problem dieser Welt.
Benjamin lag abends oft lange wach und belauschte die Gespräche seiner Eltern. Sie gaben sich gar keine Mühe, leise zu reden, weil sie davon ausgingen, dass Benjamin fest schlief. Dabei hatte er gehört, wie sein Vater ihn seiner Mutter gegenüber verteidigte. Er meinte, schlechte Zensuren seien nichts Ungewöhnliches bei kleinen Jungen, und meist sei es nur eine faule Phase, die nach ein, zwei Jahren wieder ausgestanden sei. Seine Mutter hatte da ihre Zweifel, und auch er glaubte nicht so recht an das, was sein Vater sagte, denn er machte sich ja selbst Sorgen um sich. Seine Lehrerin hatte gesagt, nur noch ein Wunder könne ihn vor dem Sitzenbleiben retten.
»Wenn du die Rechtschreibung nicht lernst«, sagte Frau Blau, »wirst du auch in allen anderen Fächern einbrechen, weil du automatisch immer eine Zensur tiefer rutschst. Man muss ja raten, was da steht, was du meinst und was das überhaupt heißen soll. Lies Bücher, dann siehst du, wie die Worte geschrieben werden.«
Benjamin verstand die ganze Rechtschreibung nicht. Warum wurde »Bohne« mit »h« geschrieben? »Weil man das ›O‹ lang spricht«, sagte Frau Blau, aber das »o« in »Kanone« wurde auch lang gesprochen, und die Kanone schrieb man ohne »h«. Das konnte ihm Frau Blau auch nicht erklären. Und dann beim Diktat brachte Benjamin alles durcheinander. Schrieb man den »Wal« nun mit »h« oder mit zwei »a« oder einfach mit einem »a«? Und wie war das mit dem »Saal« und dem »Pfahl« und der »Qual«? Benjamin überlegte und überlegte, wurde immer unsicherer, brachte alles durcheinander und machte dadurch noch jede Menge Flüchtigkeitsfehler. Letztendlich bekam er jedes Mal eine Fünf. Er konnte es einfach nicht. Es ging alles nicht in seinen Kopf.
Die Mathearbeit hatte er verhauen, weil er das Einmaleins nicht gelernt hatte. Klar, das war seine Schuld, aber auch diese Zahlen gingen nicht in seinen Kopf. Er konnte sich einfach nicht merken, dass zwei mal siebzehn vierunddreißig war und sieben mal acht sechsundfünfzig. Keine Zahl hatte für ihn eine Bedeutung, nach drei Sekunden hatte er sie wieder vergessen.
Benjamin war fest entschlossen, die missratenen Arbeiten seinem Vater zu zeigen und ihm alles zu erklären. Sicher war er genauso enttäuscht wie seine Mutter, aber er würde ihn sicher verstehen, und er weinte wenigstens nicht. Er würde unendlich traurig gucken, aber die Arbeiten unterschreiben. Und wahrscheinlich diesen fürchterlichen Satz sagen, der Benjamin immer zu Tode erschreckte: »Wir müssen eine Lösung finden, mein Sohn.«
Kurz vor acht hörte er auf, aus dem Fenster zu gucken. Die Hoffnung, dass sein Vater nüchtern nach Hause kam und er noch mit ihm sprechen konnte, wurde immer geringer. Er setzte sich ins Wohnzimmer zu seiner Mutter, um mit ihr gemeinsam die Tagesschau anzusehen. Seine Mutter freute sich, wenn er sich für die Nachrichten interessierte.
Er saß ganz still. Ab und zu sah ihn seine Mutter an und lächelte. Als die Nachrichten zu Ende waren, sagte Benjamin: »Papa kommt sicher gleich. Mach dir keine Sorgen.«
Marianne nickte tapfer und streichelte Benjamins Hand. »Was hältst du von einer Leberwurststulle?«
Benjamin strahlte. »Au ja, ich mach uns welche.« Er rannte in die Küche.
Als er mit zwei Leberwurstbroten und zwei Gläsern Milch zurück ins Wohnzimmer kam, war seine Mutter eingeschlafen. Aber als er versuchte, das kleine Tablett, auf dem eine sonnige Gebirgslandschaft zu sehen war, leise auf dem Couchtisch abzustellen, wachte sie auf und nahm ihn in den Arm.
»Mein großer Junge«, flüsterte sie, »wenn du wüsstest, wie lieb ich dich hab.«
»Ich dich auch, Mama«, flüsterte Benjamin ebenfalls, »ich dich auch.« Er war vollkommen glücklich in diesem Moment und drückte seine Mutter ganz fest. Aber gleichzeitig war ihm zum Heulen zumute. Er hätte ihr so gern sein Herz ausgeschüttet, aber er traute sich nicht.
Um neun Uhr schickte ihn seine Mutter ins Bett. Benjamin verschwand ohne Protest in seinem Zimmer. Aber schlafen konnte er nicht. Immer wieder sprang er aus dem Bett und sah auf die Straße. Immer wieder kamen wildfremde Menschen um die Ecke – sein Vater war nicht dabei. Um elf war er einfach zu müde, um noch länger wach zu bleiben. Er beschloss, am nächsten Tag die Schule zu schwänzen, um ein bisschen Zeit zu gewinnen, denn Frau Blau würde sicher nach den Unterschriften fragen. Kurz darauf schlief er, mit seinem Teddy im Arm, erschöpft ein.
Als Benjamin wie immer um sieben Uhr fünfzehn in die Küche kam, schmierte ihm seine Mutter gerade die Schulbrote zum Mitnehmen. Sie war blass und sah müde aus. Ihre langen Haare hingen ungekämmt über die Schultern, sie hatte sie noch nicht hochgesteckt, aber Benjamin fand sie dennoch wunderschön.
»Ist Papa da?«, fragte Benjamin.
»Ja.«
»Wann ist er denn gekommen?«
»Um drei. Möchtest du Kakao?«
Benjamin nickte. »Und jetzt bist du froh?«, fragte er seine Mutter.
»Ich bin erleichtert. Na klar.«
Benjamin entspannte sich. Dann war ja alles in Ordnung. Heute Nachmittag würde er mit seinem Vater reden.
»Geht er heute zur Arbeit?«
»Nein«, sagte Marianne, »er hat frei und schläft seinen Rausch aus. Und jetzt beeil dich, es ist gleich halb.«
Benjamin hatte es nicht so eilig, weil er wusste, dass er nicht zu spät kommen konnte, wenn er gar nicht in die Schule ging, aber das durfte er sich nicht anmerken lassen. Daher schlang er sein Marmeladenbrot hinunter wie gewöhnlich und kippte den Kakao hinterher. Dann nahm er seine Tasche, in der er sicherheitshalber die Bravo und beide Klassenarbeitshefte verstaut hatte, packte seine Schulbrote ein, hauchte seiner Mutter einen Abschiedskuss auf die Wange, riss im Vorübergehen im Flur seine Jacke vom Haken und raste die Treppe hinunter.
Marianne Wagner hatte sich aus dem Rollstuhl erhoben und stand am Fenster. Ihre Beine erlaubten es ihr, einen Moment zu stehen, und sie genoss diesen Moment. Ich habe einen wunderbaren Sohn, dachte sie, und die Probleme mit der Schule kriegen wir auch noch in den Griff. Gemeinsam schaffen wir das.
Sie sah, wie er aus dem Haus kam und die Straße mehr entlanghüpfte als -lief. Dieses Kind ist ein Geschenk, sagte sie sich, zumal ich nie wieder eins bekommen werde.
Ihr wurde ganz leicht ums Herz, und sie winkte ihm hinterher, obwohl er es nicht sehen konnte. Dann überlegte sie, ob sie alles im Haus hatte, um ihm sein Lieblingsgericht zu kochen. Hackbraten mit viel brauner Soße und gedrehten Nudeln.
Ein kleines Paket Hackfleisch hatte sie noch in dem Gefrierfach über dem Kühlschrank, die Eier reichten ebenfalls, und alte Brötchen und geriebene Semmeln hatte sie immer vorrätig im Küchenschrank. Dass sie ihre Idee auch in die Tat umsetzen konnte, machte sie ganz euphorisch. Zum ersten Mal seit langer Zeit freute sie sich auf das gemeinsame Mittagessen, denn auch Peter würde dabei sein. Langsam begann sie die Küche aufzuräumen, konzentrierte sich auf jeden Schritt und jede Handbewegung. Aber auch das erschien ihr heute leichter als sonst.
Dann goss sie sich eine frische, heiße Tasse Kaffee ein, setzte sich wieder in ihren Rollstuhl und schaltete das Radio an. »Morning has broken«, sang Cat Stevens. Es war ein Lied ihrer Jugend, und sie summte es leise mit. Draußen wurde der Regen stärker.
3
Bis Karstadt war es nicht mehr weit. Benjamin ging schneller. So ein Schultag war verdammt lang, wenn man nichts zu tun hatte und nicht wusste, wohin. Sein Freund Andi hatte wenigstens eine Oma, bei der Andi jederzeit aufkreuzen konnte. Zweimal hatte Andi bei ihr den Vormittag verbracht, als er die Schule schwänzte, um eine Biologie- und eine Englischarbeit nicht mitschreiben zu müssen. Andis Oma hatte immer Kekse im Haus und spielte stundenlang Mau-Mau, Schafskopf oder Mensch-ärgere-dich-nicht. Andi war total begeistert von seiner Oma. Bei ihr hatte er sogar schon einmal eine Zigarette rauchen dürfen, aber vor allem hatte er ihr heiliges Ehrenwort, dass sie Andis Eltern nichts verraten würde. So eine Oma war Gold wert. Vor allem bei diesem Wetter. Benjamin beschloss, Andi zu fragen, ob er das nächste Mal vielleicht auch zu dieser Oma gehen könnte.
Benjamins Opa, der Vater seiner Mutter, war schon seit einigen Jahren tot, und seine Oma lebte nun allein in einem kleinen Haus mit einem Dackel und ein paar Hühnern in Lübars, am Stadtrand von Berlin. Viel zu weit weg, um den Vormittag dort verbringen zu können. Die Eltern seines Vaters wohnten in der Nähe von München. Benjamin hatte schon zweimal die Sommerferien dort verbracht. Vielleicht konnte er Andi einen Tausch vorschlagen. Andi kam in den Sommerferien mit nach Bayern zu seinen Großeltern, dafür lieh Andi ihm die Oma in Berlin. Das war immerhin eine Möglichkeit.
Die warme Kaufhausluft, die ihm durch das starke Gebläse in der Türschleuse entgegenströmte, tat ungeheuer gut. Benjamin blieb im Eingangsbereich stehen, öffnete seinen Anorak und hoffte, die warme Luft würde auch das Hemd auf seinem Rücken trocknen, aber es klappte nicht. Sein nasses T-Shirt blieb kalt und klamm. Also ging er hinein, durchquerte die Kurzwaren- und die Strumpfabteilung, kam an diversen Ständen mit billigem Modeschmuck vorbei und erreichte die Rolltreppe hinter den Drogerieartikeln. Er fuhr in den vierten Stock, weil er wusste, dass dort die Toiletten waren.
Er hatte Glück. Die Männertoilette war leer. Um diese Zeit war noch nicht viel Betrieb im Kaufhaus, es hatte erst vor einer halben Stunde geöffnet. Hastig zog er Anorak, Pullover und T-Shirt aus, zog den Pullover wieder an, weil er sich mit nacktem Oberkörper furchtbar schämte, und hielt sein T-Shirt unter den elektrischen Händetrockner. Er musste das Gebläse zehnmal neu starten, bis das T-Shirt endlich trocken war. Erleichtert zog er sich wieder an und fühlte sich in den warmen, trockenen Sachen richtig wohl.
In diesem Moment kam ein älterer, dicker Mann herein, der seine wenigen Haare vom Hinterkopf nach vorn gekämmt hatte und geblendet blinzelte, obwohl es in der Toilette überhaupt nicht besonders hell war. Er musterte Benjamin argwöhnisch, sagte aber nichts, sondern verschwand in einer der Kabinen. Als Benjamin hörte, dass der Mann die Toilettentür verriegelte, hielt er noch seinen Kopf und seine nassen Haare unters Gebläse, aber er erreichte mit der warmen Luft nur den Hinterkopf. Also ließ er es bleiben, zog den Anorak wieder an, nahm seine Schultasche und machte sich auf den Weg zur Spielwarenabteilung.
»Pass mal uff, junger Mann, du spielst jetzt schon ne janze Stunde. Ick finde, jetzt is langsam jenuch«, sagte ein junger Verkäufer mit Elvis-Tolle. »Wir sind ja hier keen Kinderjarten. Hast du denn keene Schule?«
»Unsre Lehrerin is krank«, stotterte Benjamin und legte nur widerwillig und schweren Herzens die Fernbedienung für die Autorennbahn aus der Hand. »Ich geh ja schon.«
»Na, dann is ja jut«, grummelte der Verkäufer und nahm die Autos von der Bahn.
Benjamin griff seine Sachen. Es war jetzt elf. Er hatte noch über zwei Stunden Zeit und überlegte, was er machen könnte. Von Karstadt hatte er erst mal genug, aber vielleicht regnete es nicht mehr, dann könnte er zum Kanal gehen, Enten füttern. Seine beiden Schulbrote hatte er noch nicht angerührt. Eins für ihn und eins für die Enten. Das war okay. Die armen Viecher fanden ja kaum was zu Fressen bei dem Wetter.
Im vergangenen Frühjahr waren die Bäume gefällt worden, die direkt am Ufer des Kanals standen, weil sie drohten, ins Wasser zu stürzen und die Schifffahrt zu behindern. Das Gartenbauamt hatte die Stämme fein säuberlich zersägt und aufgeschichtet, um sie besser abtransportieren zu können. Dennoch waren einige Holzstücke weggerollt oder liegen geblieben.
Auf einem saß Benjamin, nur zwei Meter vor sich im seichten Uferwasser schwamm eine Schar Enten. Bestimmt zwanzig, dreißig Stück, die blitzschnell und scheinbar aus dem Nichts aufgetaucht waren, als Benjamin einem einzelnen, gemächlich vor sich hin schwimmenden Paar die ersten Brotbrocken zugeworfen hatte.
Als er ein Brot verfüttert hatte, fing es erneut an zu regnen. Er setzte die Kapuze auf, weil er nicht wieder ein nasses Hemd haben wollte, und fing an, auch noch das Schulbrot zu verfüttern, das er eigentlich selber essen wollte. Die Enten wurden immer zutraulicher, immer unverschämter, kamen immer näher an ihn heran. Einige holten sich inzwischen die Krümel direkt bei ihm aus der Hand, da sie dann um die einzelnen Bissen nicht mehr kämpfen mussten.
So lange er denken konnte, hatte sich Benjamin ein eigenes Haustier gewünscht, aber nie eins bekommen. Seine Mutter hatte Angst vor der Arbeit, vor dem Dreck und vor den Krankheiten, die so ein Tier übertragen konnte. Sein Vater hatte ihm allerdings eine kleine Katze versprochen, falls er die fünfte Klasse doch noch schaffen sollte, aber das würde wohl nicht klappen. Die Katze konnte er abschreiben.
Benjamin war so vertieft ins Füttern und so begeistert, weil immer mehr Enten angeschwommen kamen, dass er die zwei Typen nicht bemerkte, die sich ihm langsam und von hinten näherten. Außerdem sah und hörte er unter seiner Kapuze wenig.
Die beiden sahen aus wie Skins, hatten rasierte Schädel und trugen Bomberjacken. Der Kleinere hatte einen Blitz auf den glatten Kopf tätowiert. Auf Grund ihrer Glatzen war ihr Alter schwer zu schätzen. Sie mochten sechzehn, siebzehn, vielleicht auch älter sein. Erst als ihn jemand am Anorak packte und hochriss, merkte Benjamin, was los war. Er starrte in die zwei Gesichter, die ihm wie widerliche Fratzen vorkamen, und schrie. Die Enten stoben davon. Plötzlich gab es ein kurzes, scharfes Geräusch, ein Springmesser klappte aus der Scheide, und der Größere der beiden setzte es ihm an die Kehle.
»Halt die Schnauze«, zischte er.
Benjamin verstummte.
Der mit dem Blitz zog Benjamin den Anorak aus, der Große hielt ihn fest. »Wo hast du deine Knete?«, fragte er.
»Ich hab keine«, jammerte Benjamin, »ehrlich nich. Ich geh immer ohne Geld in die Schule. Damit’s mir nich geklaut wird.«
»Scheiße.«
Der Kleinere nahm Benjamins Schultasche, kippte sie aus und durchwühlte den Inhalt. Ein Portemonnaie war nicht dabei.
»Scheiße.«
Daraufhin boxte der Große ihn in den Magen. »Zeig deine Hosentaschen«, brüllte er. »Du feige Sau wirst doch wohl irgendwo deine Scheißknete haben!«
Benjamin krümmte sich. Ihm blieb die Luft weg, und für einige Sekunden glaubte er zu ersticken. Wie ein Fisch an Land schnappte er nach Luft, aber als er wieder einigermaßen atmen konnte, kehrte er seine Hosentaschen nach außen. Sie waren bis auf siebzig Pfennig und einen Schlumpf aus einem Überraschungsei leer.
»Mehr hab ich wirklich nich«, flüsterte Benjamin.
Vor Wut verpasste der Große Benjamin einen Kinnhaken, sodass Benjamin zwei Meter durch die Gegend flog, im Matsch landete und seine Hand fest auf den Unterkiefer drückte, der höllisch wehtat. Der mit dem Blitz hatte sich inzwischen das Springmesser des Großen geschnappt, hockte auf Benjamin und hielt ihm das Messer an die Kehle.
»Es is verdammt gefährlich, ohne Knete aus dem Haus zu gehen«, tönte der Große. »So was können wir überhaupt nich leiden!«
»Es ist auch verdammt gefährlich, kleine Kinder zu überfallen«, brüllte völlig unvermittelt eine tiefe, wütende Männerstimme und ließ beide Skins vor Schreck zusammenzucken. »So was kann ich nämlich überhaupt nicht leiden!«
Der Kleine sprang sofort auf und versteckte das Messer hinter seinem Rücken.
Vor ihnen stand Alfred und hatte eine Pistole in der Hand, die er auf die beiden Skins richtete.
»Komm her zu mir«, sagte Alfred zu Benjamin. »Und ihr beiden Scheißkerle rührt euch nicht vom Fleck, sonst puste ich euch eure Schwachköpfe weg!«
Benjamin sah sich unsicher um, dann huschte er zu Alfred und stellte sich in dessen Nähe.
»Und jetzt verpisst euch, aber schnell! Und lasst euch hier nie wieder blicken! Ich zähle bis drei, und dann seid ihr verschwunden! Eins – zwei – drei.«
Er schoss ihnen im selben Moment, als er »drei« sagte, mit der Gaspistole direkt in die Gesichter. Der mit dem Blitz heulte laut auf und rannte los, als wäre der Teufel hinter ihm her. Der Größere schnappte nach Luft, versuchte die brennenden Augen aufzubekommen und ballte die Fäuste.
»Halt dir die Augen zu«, sagte Alfred zu Benjamin und schoss erneut.
Der Große schrie und stürzte zu Boden. Er rieb sich die brennenden Augen und rollte sich brüllend im Gras, um den Schmerz zu betäuben.
»Komm«, sagte Alfred. Er steckte die Pistole ein, zog Benjamin, der gerade noch seinen Anorak greifen konnte, mit sich und fing an zu rennen. Benjamin rannte neben ihm her. Nach etwa hundert Metern, hinter einer Kurve, blieb Alfred stehen.
»Zieh deinen Anorak an, du holst dir ja den Tod.«
Benjamin schnatterte vor Kälte. So schnell er konnte zog er seinen Anorak über. »Meine Schultasche …«, stammelte er.
»Die holen wir nachher, wenn diese widerlichen Typen weg sind. Jetzt musst du erst mal in die Wärme, damit du dich nicht erkältest. Und dann brauchst du eine heiße Schokolade mit viel Sahne. Magst du so was?«
Benjamin konnte sich in diesem Moment nichts Besseres vorstellen.
Alfred trabte weiter, Benjamin lief neben ihm her und hielt locker Schritt.
Alfreds Gedanken überschlugen sich, sein Herz klopfte bis zum Hals. Dass er lief, merkte er gar nicht. Er sah nur diesen kleinen Jungen neben sich, spürte seine Anwesenheit direkt körperlich und wusste nicht, ob er vor Glück schreien sollte oder ob gerade ein neuer Albtraum begann. Seit dem letzten Mal im Hahnenmoor in der Nähe von Braunschweig vor dreieinhalb Jahren hatte er sich nie wieder etwas zu Schulden kommen lassen. Den kleinen Daniel hatte er über die Osterfeiertage zwei Tage in einem Bauwagen gefangen gehalten, bevor er ihn tötete. Niemand war ihm auf die Spur gekommen, es blieb ein unaufgeklärter Fall. Er hatte sofort danach alle Kontakte abgebrochen, war nach Berlin gezogen und hatte ein völlig neues Leben angefangen. Jeden Tag arbeitete er an sich und litt wie ein Schwein. Er fühlte sich wie ein Alkoholiker, der rund um die Uhr vor der Whiskyflasche sitzt und darum kämpft, der Versuchung zu widerstehen. Er hatte sich von Schulen, Kindergärten und Spielplätzen fern gehalten, hatte sich im Sommer in seiner Wohnung eingeschlossen, wenn die halbe Welt die Tage und Abende im Park verbrachte und die Kinder auf der Wiese tobten, während die Eltern die Würste grillten. Er hatte die Badeseen gemieden und die Freibäder, er war fast wahnsinnig geworden dabei.
Aber er war verdammt stolz auf sich. Als der Herbst kam und die Tage kühl wurden, war es leichter. Die Kinder spielten nicht mehr auf der Straße, die Parks leerten sich. Er war fest entschlossen, so lange durchzuhalten, bis der Drang vorbei war. Jede Sucht konnte man mit Willenskraft besiegen. Jede. Und er trainierte unaufhörlich. Mal verzichtete er wochenlang auf Bier. Dann auf seinen geliebten Morgenkaffee. Dann zwang er sich eine Zeit lang, Brot ohne Butter zu essen, was ihm sehr schwer fiel. Nachmittags überkam ihn häufig der Heißhunger auf etwas Süßes. Meist genehmigte er sich dann einen Müsliriegel oder ein Stück Kuchen oder eine halbe Tafel Schokolade. Auch das unterließ er eine Weile. Jede Gewohnheit versuchte er zu durchbrechen, indem er auf Liebgewordenes verzichtete.
Als er merkte, dass er sich angewöhnt hatte, jeden Nachmittag eine Stunde zu schlafen, zwang er sich daraufhin, wach zu bleiben. Jede Regelmäßigkeit musste bekämpft werden. Und er schaffte es. Er war ein willensstarker Mensch. Und das bewunderte er an sich. Sein Selbstbewusstsein war stabil, solange er nicht schwach und rückfällig wurde.
Und jetzt lief dieser fremde kleine Junge neben ihm her. Ganz zufällig, ganz freiwillig. Er musste ihn nicht locken, nicht überreden und nicht betäuben, er war einfach da und kam einfach mit. Alfred brach der Schweiß aus. Er war auf dem Weg in die Laubenkolonie. Die Lauben standen im Winter leer. Dort war jetzt kein Mensch.
Seine Beine bewegten sich fast automatisch. Er konnte nichts dagegen tun.
Sie liefen jetzt langsamer. Es gab ja auch keinen Grund mehr, so zu rennen, die Skins waren längst weg. Benjamin sah den Mann neben sich verstohlen an. Er war bestimmt etwas älter als Papa und auch stärker. Und etwas dünner. Durch die monotone und bewegungsarme Arbeit am Band war sein Vater behäbig geworden und hatte einen Bauch angesetzt.
Seine Augen sind so komisch, dachte Benjamin, er guckt so starr geradeaus. Dabei gibt es hier doch gar nichts Besonderes zu sehen. Aber er guckt, als müsste er gleich etwas ganz Kompliziertes machen, ein Flugzeug landen vielleicht, und es ist neblig, und er hat Angst.
Der Mann war irre nett, davon war Benjamin überzeugt. Obwohl er es ein bisschen gruslig fand, dass er eine Pistole dabeihatte. Aber eine Sekunde später dachte er, dass das auch wieder toll war. Wie in Amerika. Wie im Wilden Westen. Keiner konnte einem was tun. Man konnte sich jederzeit verteidigen. Oder einen anderen retten. So wie er ihn gerettet hatte.
»Warum bist du nicht in der Schule?«, fragte Alfred völlig unvermittelt.
»Nur so.« Benjamin schämte sich plötzlich.
»Wie? Nur so? Schwänzt du?«
Benjamin nickte stumm.
»Warum? Drückst du dich vor einer Arbeit?«
Benjamin schüttelte den Kopf und sah zu Boden. »Nee. Ich hab Deutsch und Mathe verhauen.«
»Nun gut. Du hast zwei Arbeiten verhauen. Aber das ist ja schon passiert. Warum bist du dann heute nicht in der Schule?«
»Ich hab die Unterschriften von meinen Eltern nicht.«
»Alles kein Problem. Mach dir keine Sorgen, das kriegen wir hin.«
Benjamin schwieg. Er hatte zwar keine Vorstellung, wie das gehen sollte, aber er wollte nicht zu viele Fragen stellen.
Alfred und Benjamin erreichten die Teupitzer Brücke. Benjamin blieb stehen.
»Ich muss meine Tasche holen. Die Typen sind jetzt bestimmt weg.« Er wollte sich umdrehen und losrennen, aber Alfred hielt ihn mit eisernem Griff fest.
»Mo – ment.« Benjamin zuckte zusammen. »Deine Tasche holen wir später, okay? Die klaut keiner. Außerdem liegt sie im Gebüsch am Ufer, da sieht sie auch keiner, weil kein Mensch bei dem Sauwetter spazieren geht.« Alfred spürte, dass ihm glühend heiß war. Er durfte jetzt keinen Fehler machen. »Sind in deinen Heften schon irgendwelche Unterschriften von deinen Eltern? Unter früheren Arbeiten zum Beispiel?«
Benjamin nickte eingeschüchtert. Der Griff um seinen Oberarm fühlte sich an wie ein Schraubstock.
»Gut. Dann unterschreib ich für deine Eltern. Ich kann das. Ich kann alle Unterschriften nachmachen. Das merken noch nicht mal deine Eltern selbst.«
Benjamin war einen Moment beeindruckt.
»Komm«, sagte Alfred. Er bog nach links ab und zog Benjamin mit sich. Hinter der S-Bahn begannen die Kolonien. Kolonie Rübezahl, Kolonie Stadtbär, Kolonie Kieler Grund, Kolonie Georgina, Kolonie Sorgenfrei und viele andere. Er musste auf Anhieb eine geeignete Laube finden. Nicht zu sehr heruntergekommen, nicht schwer zu knacken, nicht direkt an der Straße. Und er musste schnell und spontan entscheiden. Der Junge durfte auf keinen Fall misstrauisch werden.
»Ich glaub, ich geh jetzt lieber nach Hause«, sagte Benjamin. »Vielen Dank für alles. War echt nett von Ihnen.« Er versuchte sich loszumachen, aber Alfred ließ nicht locker.
»Das ist nicht fair«, sagte er, »ich helfe dir, die großen Jungs loszuwerden, die dir deine Sachen klauen und dich verprügeln wollten …, und du willst nicht mal mit mir einen Kakao trinken. Ich bin immer schrecklich allein. Ich freue mich einfach, wenn ich mal ein bisschen Gesellschaft habe.«
Benjamin bekam augenblicklich ein schlechtes Gewissen. »Wo wohnen Sie denn?«
»Weit weg. Ganz oben im Norden. In Heiligensee. Da habe ich ein schönes großes Haus und zwei Hunde.«
»Was für Hunde?« Benjamins Interesse war sofort geweckt.
»Dalmatiner. Eine Hündin und einen Rüden. Ganz lieb. Ganz süß. Pünktchen und Anton heißen sie.«
»Ist ja irre.« Benjamin lächelte und sah in seiner Vorstellung zwei schwarz-weiß gefleckte Dalmatiner in seinem Bett schlafen.
»Aber meine Tante hat hier eine Laube. Gleich dahinten«, fuhr Alfred fort. »Im Moment muss ich jeden Tag hinfahren und die Meerschweinchen füttern, weil meine Tante im Krankenhaus liegt. Ich dachte, es macht dir vielleicht Spaß, mir kurz dabei zu helfen. Außerdem musst du dich unbedingt aufwärmen. Es ist gar nicht weit von hier.«
Benjamins Verstand arbeitete fieberhaft. Er hatte das Gefühl, dass seine Gedanken kreuz und quer durch seinen Kopf sausten, so schnell, dass er sie nicht fassen und sortieren konnte. Er hörte seine Mutter, die schon zigmal zu ihm gesagt hatte: »Du darfst mit niemandem mitgehen, hörst du? Und wenn der Mann dir sonst was verspricht. Tiere oder Süßigkeiten und Spielzeug oder was weiß ich. Es ist immer eine Lüge. Lass dich auf keine Diskussionen ein, hau einfach ab. Ist das klar?«
Er hatte genickt. Natürlich. Andere Kinder gingen vielleicht mit Fremden mit, er nicht. Niemals! Er war doch nicht doof, er ließ sich nicht locken, da brauchten sich seine Eltern keine Sorgen zu machen.
Und sein Vater hatte immer wieder gesagt: »Zeig niemandem den Weg, wenn dich ein Fremder darum bittet. Und steig niemals in ein fremdes Auto! Geh in keine fremde Wohnung! Du darfst nichts glauben, was man dir erzählt. Vor allem nicht, wenn dir jemand weismachen will, wir hätten dich geschickt. Oder deiner Mutter oder mir sei etwas passiert, und deswegen sollst du schnell ins Auto steigen und mit ins Krankenhaus fahren. Glaub das alles nicht! Du ahnst ja gar nicht, wie viele Tricks diese bösen Männer draufhaben.«
Auch das hatte ihm alles eingeleuchtet. Er war sich völlig sicher, in jeder Situation Bescheid zu wissen. Aber er hatte sich das Abhauen immer ganz einfach vorgestellt, und jetzt war es so verdammt schwer.
Dieser Mann hat mich ja nicht angesprochen, dachte Benjamin, er hat mir geholfen, als ich in einer ganz beschissenen Situation war! Der war ja nicht auf der Suche nach kleinen Kindern, um sie wegzufangen, der war nur zufällig in der Nähe, als ich Hilfe brauchte. Also ist er bestimmt nicht »so einer« von denen, die Mama und Papa meinten.
Benjamin konnte gut verstehen, dass der Mann sich allein fühlte und sich als Gegenleistung für seine Hilfe ein bisschen Gesellschaft und Unterstützung beim Meerschweinchenfüttern wünschte. Wahrscheinlich war das allein auch furchtbar langweilig.
Erst letzte Woche hatte Frau Blau im Religionsunterricht erzählt, dass ganz viele alte Leute schrecklich einsam sind. Die in den Altersheimen hatten es ja noch gut, die konnten mit anderen wenigstens Canasta und Mau-Mau spielen, aber ganz viele lebten irgendwo in ihren Wohnungen und hatten niemanden. Keine Kinder, keine Verwandten und keine Freunde. Niemand wusste, dass sie da wohnten. Gerade in Neukölln gab es eine Menge, die noch nicht mal einen Kanarienvogel hatten, sondern nur einen Fernseher und kaum Geld, um sich genug zu essen zu kaufen.
Benjamin taten alle alten Leute, die so allein waren, furchtbar Leid, obwohl er es immer noch besser fand, einen Fernseher zu haben als einen Kanarienvogel. Aber er hatte immer geglaubt, allein ist man erst, wenn man alt ist. Dieser Mann war ja noch gar nicht so alt, aber trotzdem schon so schrecklich allein. Das fand Benjamin am allerschlimmsten.
Was sollte er denn jetzt tun? Himmel, er hatte doch nicht alle Zeit der Welt, der Mann hielt ihn an der Hand und zog ihn immer weiter in die Kolonie. Sollte er sich losreißen und wegrennen? Und wenn der Mann schneller war? Er sah viel sportlicher aus als sein Vater, und der konnte schneller rennen als er, wenn es darauf ankam. Beim letzten Sommerfest in der Hasenheide hatte er mit seinem Vater Wettrennen gemacht, und sein Vater hatte gewonnen. Deswegen musste seine Mutter eine Runde Zuckerwatte spendieren, denn sie hatte gewettet, dass Benjamin gewinnen würde.
Ja, ich renne weg, sagte sich Benjamin, ich versuch’s, da vorne, an der nächsten Abbiegung renne ich weg. So schnell ich kann. Der Mann wird mir sowieso nicht hinterherrennen. Der wird nur traurig sein oder böse, aber das ist ja egal. Ich werde den sowieso nie wieder treffen, denn der wohnt ja gar nicht hier, der wohnt ja ganz weit weg in Heiligensee. Er kickte einen Kieselstein vor sich her. Der Kieselstein rollte schnell und weit vor. Benjamin hatte Lust hinterherzurennen und weiterzukicken, aber der fremde Mann hielt ihn immer noch an der Hand.
Außerdem ist Papa bestimmt stinksauer, wenn ich mit dem Mann in die Laube gehe, fiel Benjamin noch ein, wahrscheinlich saurer als über die Fünf und die Sechs. Ja, es ist besser. Ich muss abhauen. Zehn Meter noch, dann renne ich nach rechts. Ohne was zu sagen. Ganz plötzlich.
»Du bist ein wirklich netter Junge«, sagte der Mann plötzlich und lächelte. »Ich hab dir geholfen, und jetzt hilfst du mir. Das finde ich prima. Und ich denke, wir sollten Freunde werden. Meinst du nicht auch?«
Benjamins Herz machte einen Sprung. Nein, jetzt konnte er nicht wegrennen. Das wäre einfach gemein. Der Mann war so nett, und er vertraute ihm. Er konnte ihn jetzt nicht enttäuschen. Schnell einen Kakao trinken und dann das bisschen Meerschweinchenfüttern, das ging ja schnell. So viel Zeit hatte er noch, er würde es auf alle Fälle rechtzeitig nach Hause schaffen und seinen Eltern gar nichts davon erzählen, damit sein Vater nicht dachte, er wäre dumm oder ungezogen, weil er nicht auf ihn gehört hatte.
Benjamin schaute auf seine Armbanduhr, die ihm seine Oma aus Bayern zu Weihnachten geschenkt hatte. Sie war sehr schlicht und unauffällig, Benjamin gefiel sie nicht. Das war sicher auch der Grund, warum ihm die Typen vorhin die Uhr nicht geklaut hatten. Es war beinah eine Mädchenuhr, fand Benjamin. Er hatte sich ein richtiges Chronometer gewünscht. Mit Sekundenzeiger, Stoppuhr, Datumsanzeige, Wecker, Weltzeituhr und natürlich wasserfest. So eine Uhr war sein Traum, aber darauf musste er wohl noch eine Weile warten.
Es war jetzt fünf nach zwölf. Normalerweise hatte er heute sechs Stunden, seine Mutter würde erst kurz vor zwei mit ihm rechnen.
Ich hab ja noch Zeit, dachte Benjamin, ich kann dem netten Mann eigentlich den Gefallen tun.
4
»Mein Gott, was hast du dir für eine Mühe gemacht!«, sagte Peter, als er in die Küche kam. »Hackbraten, Soße, Nudeln und Porreegemüse! Wahnsinn! Geht es dir denn heute so gut?« Er küsste seine Frau aufs Haar.
»Es geht mir immer gut, wenn du zu Hause bist.«
Peter hatte die Kritik durchaus verstanden. »Nun mach mir doch kein schlechtes Gewissen! Lass mir doch diesen einen kleinen Freiraum!«
»Manchmal schon. Okay. Aber nicht andauernd. Nicht dreimal in der Woche oder mehr. Hast du dir mal überlegt, was uns deine Sauferei kostet?«
Marianne konnte sehen, dass Peter nachdenklich geworden war. Nach einer Pause sagte er: »Gut. Einmal die Woche. Aber dieses eine Mal lass ich mir nicht nehmen. Einverstanden?«
Marianne schenkte ihrem Mann ihr schönstes Lächeln. »Einverstanden.«
»Warum hast du dir denn heute mit dem Essen solche Mühe gemacht? Haben wir was zu feiern?«
»Nein, aber Benny kam mir heute Morgen so traurig vor. Oder lustlos. Vielleicht war er auch einfach nur müde. Jedenfalls dachte ich, er freut sich sicher über sein Lieblingsgericht. Wir hatten ja ewig keinen Hackbraten mehr!«
»Sag ehrlich! Wie viele Stunden hast du gearbeitet?«
Marianne schob sich eine verschwitzte Haarsträhne aus der Stirn. »Ach was, war gar nicht so schlimm.«