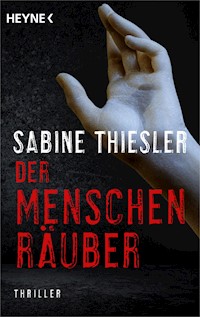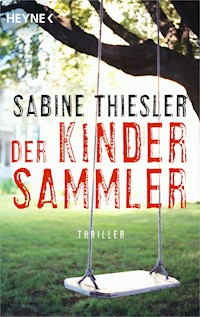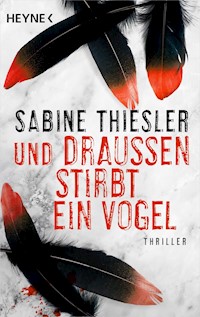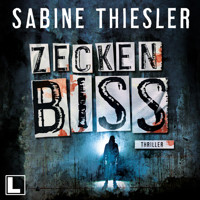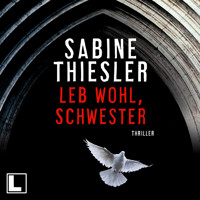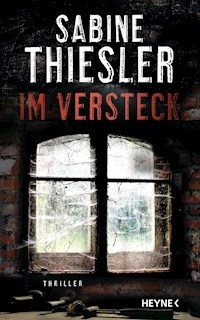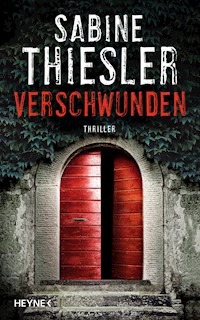Sabine Thiesler
Der Menschenräuber
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2010 by Wilhelm Heyne Verlag,
und Sabine Thiesler
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Herstellung: Helga Schörnig
Covergestaltung: Eisele Grafik Design
ISBN: 978-3-641-05134-1V005
www.heyne.de
Für meine Mutter In Liebe
PROLOG
Schwere Wolken hingen über der Heide, der Wetterbericht hatte Schneeregen und Graupelschauer angesagt.
Er stand am Fenster, blickte auf den trostlosen, grau gepflasterten Hotelparkplatz mit fünf armseligen Parkbuchten, von denen nur zwei besetzt waren, und wusste, dass er nur diese eine Chance hatte.
Heute war der Tag, auf den er Monate gewartet hatte, heute musste es passieren.
Nachdem er vor zehn Minuten das Telefonat beendet hatte, triumphierte er innerlich. Sie war einfach zu gutgläubig und hatte ihm die Adresse verraten. Die erste Hürde war genommen, und es war unproblematischer gewesen, als er gedacht hatte.
Er ging ins Bad, betrachtete ein paar Sekunden sein Gesicht im Spiegel eines altmodischen Allibert und begann sich sorgfältig zurechtzumachen.
Es war jetzt zwanzig vor elf. Zeit der Visite und daher viel zu gefährlich. Er wollte noch zwei Stunden warten, denn es erschien ihm günstiger, wenn auf den Stationen das Mittagessen gerade vorbei war und das Geschirr abgeräumt wurde.
In den letzten zwei Wochen hatte er sich einen Bart wachsen lassen, den er jetzt sorgfältig schnitt, so dass er gepflegt wirkte. Der schlohweiße Bart störte ihn maßlos, er kam sich verwahrlost und unsauber vor, geradezu verwildert. Aber es handelte sich ja nur noch um wenige Stunden. Wenn alles erledigt war, würde er ihn abrasieren.
Die Perücke hatte er schon vor Wochen in Florenz gekauft. Sie war aus Echthaar, handgeknüpft, und hatte über fünfhundert Euro gekostet. Das war es ihm wert. Graue, drei bis vier Zentimeter lange Haare, die sehr natürlich wirkten und gut zu seinem schmalen Gesicht passten. Er streifte sie über seine eigenen millimeterkurzen Haare, und damit die Perücke nicht verrutschte, fixierte er sie an den Schläfen und oberhalb der Stirn am Haaransatz mit Mastix. Ein Spezialklebstoff, der im Theater in der Maske verwendet wurde. Hinterher würde er die Perücke so bald wie möglich verbrennen.
Zum Schluss setzte er eine Brille mit Fensterglas und zartgoldenem Rand auf, die ihm einen intellektuellen, distinguierten Touch gab. Kein Problem, sie danach auf der Autobahn aus dem Fenster zu werfen.
Er wirkte wie ein Professor Anfang sechzig, dem man ohne weiteres Respekt zollte und Vertrauen schenkte. Perfekt. Er war zufrieden.
Das Zimmer hatte er bereits am Abend zuvor bezahlt. Er packte seine Sachen und verließ zwanzig Minuten später das Hotel vollkommen unbemerkt. Die Rezeption war in diesem kleinen Hotel nur selten besetzt.
Ideal für ihn, der ungesehen verschwinden wollte.
Es war jetzt kurz nach elf. Zu früh. In Gedanken ging er noch einmal die Liste durch, ob irgendetwas fehlte. Aber ihm fiel nichts ein. Er hatte an alles gedacht.
Also blieb ihm nur noch ein Waldspaziergang, um zwei weitere Stunden totzuschlagen.
Um dreizehn Uhr fünfundzwanzig hielt er vor der Klinik und parkte am Nebeneingang auf einem für Ärzte reservierten Parkplatz. Weiße Hosen, weißes Hemd und weißen Kittel hatte er bereits im Auto angezogen, Stethoskop und obligatorischer Kugelschreiber steckten in der Brusttasche.
So betrat er das Krankenhaus. Dem Pförtner nickte er kurz zu, und dieser grüßte automatisch zurück.
Als er nur fünfzehn Minuten später die Klinik durch einen Notausgang verließ, trug er ein Neugeborenes hinaus in die Kälte und die wenigen Meter bis zu seinem Auto, legte es in die Tragetasche auf dem Beifahrersitz und fuhr davon.
Die Mutter und die Mitarbeiter der Säuglingsstation würden frühestens in einer halben Stunde merken, dass das kleine Mädchen nicht mehr da war.
Er war so glücklich wie seit Jahren nicht mehr. Hatte keinerlei Schuldbewusstsein. Denn er hatte das Kind nicht entführt, sondern zu sich geholt. Und das war – verdammt nochmal – sein gutes Recht.
GISELLE
EINS
Toskana, 3. November 2001
Er hatte kein Ziel, keinen Plan, kein Dach überm Kopf und noch zweiundsiebzig Mark und dreiundzwanzig Pfennige in der Tasche. In seinem Koffer befanden sich zehn Unterhosen, ebenso viele Sockenpaare, vier T-Shirts, drei Pullover und zwei Jeans. Außerdem zwei Handtücher, sein Filofax und ein Kulturbeutel mit einer Haarbürste, einer Zahnbürste, einer fast leeren Tube Zahnpasta, einer Niveadose, einem Nageletui und einem Briefchen Aspirin. Auch ein Deostift und Creme gegen Herpes-Lippenbläschen. Gut eingebettet zwischen den Handtüchern und Pullovern, lagen sein Laptop, seine Kamera und eine Bilderrolle aus stabiler Pappe. In seiner Jackeninnentasche trug er seine Brieftasche mit der Krankenversicherungskarte, einer Kreditkarte, Ausweis, Führerschein und einem Foto seiner Tochter im Alter von fünf Jahren. Sie saß in einer Sandburg an der Ostsee und hielt triumphierend ihre Schippe in die Höhe. In der Jackenaußentasche steckte noch eine Lesebrille.
Das war alles, was von seinem Leben übrig geblieben war.
Es war jetzt knapp fünf Tage her, seit er nach einem Streit mit Jana das Haus verlassen hatte. Er fühlte sich als Verlierer, weil er gegangen war, aber das war nicht wichtig. Auch wenn sie triumphierte – er hätte es in ihrer Nähe keine fünf Minuten länger ausgehalten.
Dass er vor der großen Anzeigetafel auf dem Flughafen Tegel gestanden hatte, wusste er noch. Paris, Brüssel, Kopenhagen, Athen, Rom, Lissabon. Zehn Minuten, vielleicht auch eine halbe Stunde hatte er auf die rauf- und runterklappernden Buchstaben gestarrt, aber die Orte bedeuteten ihm nichts. Zürich, Budapest, Mailand, Stockholm. Geflogen war er in seinem Leben genug.
Er wandte sich ab und fuhr mit dem nächsten Bus zurück in die Stadt.
Was er in den darauffolgenden drei Tagen und Nächten getan hatte, konnte er jetzt nicht mehr sagen. Er versuchte sich zu erinnern, aber vor seinen Augen tauchten nur vereinzelte Bilder von Wartehallen, U-Bahnhöfen und Kneipen auf. Von einem grellbunten Drogeriemarkt, in dem er Wodka kaufte, und von einem Kanal, an dessen Ufer er sich übergab. Er hatte keine Erinnerung mehr an Wärme oder Kälte und glaubte, weder irgendetwas gegessen noch mit einem Menschen gesprochen zu haben.
Vor zwei Stunden war er in einer Toilette der Charité aufgewacht. Er lag in der engen Kabine auf dem klebrigen Fußboden, gekrümmt wie ein Embryo, den Kopf direkt neben der Toilettenschüssel, und mit seinen Armen umklammerte er den Fuß des Beckens wie ein Schiff brüchiger den rettenden Baumstamm. Mühsam zog er sich hoch und versuchte aufrecht zu stehen. In seinen Haaren klebte Erbrochenes, und erst jetzt bemerkte er, dass er direkt in einer mittlerweile getrockneten Lache gelegen hatte.
Er ekelte sich vor sich selbst, als er sein blasses, müdes Gesicht und seine zerzausten, verdreckten und seit Tagen nicht mehr gekämmten Haare im Spiegel sah. Sein Mund war ausgetrocknet, und sein Speichel schmeckte bitter und säuerlich zugleich. Am meisten wunderte er sich darüber, dass sein Koffer immer noch da war und neben ihm auf dem Fliesenboden stand.
Sein Koffer war das Wichtigste und Einzige, was er besaß. Er erinnerte sich dunkel an eine Situation, die zwei, drei oder auch schon fünf Tage her sein konnte. Er war am Ufer der Spree eingeschlafen. Seinen Koffer hatte er als Kissen benutzt und war davon aufgewacht, dass jemand dabei war, ihn unter seinem Kopf wegzuziehen. Ihm wurde schwindlig, als er hochfuhr und sah, wie ein ausgemergelter Mann Ende sechzig mit langem, verfilztem weißem Haar mit dem Koffer flüchtete.
So schnell war Jonathan schon seit Wochen nicht mehr aufgesprungen.
»Hey«, schrie er, »bleib steh’n, du Arsch, oder ich schlag dir alle Zähne aus!«
Der andere hatte nicht viel Kraft, und der Koffer war schwer. Jonathan holte den Mann schnell ein und riss ihn zu Boden. Im Fallen schleuderte der Alte den Koffer so weit er konnte von sich, und Jonathan sah, dass er die Böschung hinunterrutschte.
Der Alte interessierte ihn nicht mehr. Er hechtete seinem Koffer hinterher und erreichte ihn gerade noch im allerletzten Moment, als er bereits im Wasser schwamm, aber von der Strömung noch nicht abgetrieben war. Er zog ihn heraus, drückte ihn fest an sich und hörte sich schluchzen vor Erleichterung. Sein Leben ging weiter, wenn man das, was ihm geblieben war, noch als Leben bezeichnen konnte.
Jonathan wollte gar nicht wissen, wie er in die Charité gekommen war. Ob er einfach nur eine Toilette gesucht hatte und eingeschlafen war oder ob man ihn mit der Ambulanz gebracht hatte und er den Schwestern und Ärzten entkommen war. Es war müßig und unerfreulich, darüber nachzudenken, wie er die vergangenen zweiundsiebzig Stunden verbracht hatte, wichtig war, dass seine Sachen noch da waren, er keine Kopfschmerzen hatte und einigermaßen aufrecht gehen und stehen konnte.
Er wusch sein Gesicht und seine Haare mit kaltem Wasser, spülte sich den Mund aus, trank gierig, trocknete sich mit mehreren Papierhandtüchern ab und verließ die Toilette. Pfeile zeigten in Richtung Ausgang, demnach befand er sich im Parterre. Ein großes rot-weißes Schild wies nach rechts zur Notaufnahme. Also war er wahrscheinlich doch eingeliefert worden und dann auf eigenen Wunsch gegangen. Aber selbst das wusste er nicht mehr.
Mit dem Koffer in der Hand trat er auf die Straße. Es war dunkel, und er versuchte vergeblich, sich zu erinnern, wann er das letzte Mal Tageslicht gesehen hatte. Ihm war übel vor Hunger, und als er auf die Uhr sehen wollte, war sein Handgelenk leer. Aha. Die Uhr hatten sie ihm also geklaut. Irgendwo beim Schlafen unter einer Brücke oder in einer finsteren Kneipe. Vielleicht hatte er sie auch beim Pokern verloren. Alles war möglich.
Langsam ging er durch die nächtliche Stadt, wusste inzwischen wieder genau, wo er war, und brauchte zwanzig Minuten bis zu seinem Stammitaliener.
Giovanni stand hinterm Tresen, als Jonathan das Restaurant betrat, und winkte ihm kurz zu.
»Was ist los, Dottore?«, fragte er. »Du siehst verdammt schlecht aus!«
»Kriege ich noch was zu essen?«
»O dio, es ist kurz nach Mitternacht! Die Küche ist schon geschlossen, tut mir leid. Pietro räumt gerade auf.«
»Vielleicht hast du doch noch eine winzige Kleinigkeit für mich? Bitte, Giovanni! Mach mir einfach ein paar Nudeln warm, das reicht schon. Und ein Glas Wein.«
Giovanni kannte Jonathan seit einigen Jahren, er kam bestimmt zweimal in der Woche zum Essen, aber in diesem Zustand hatte er ihn noch nie erlebt. Jonathans Gesichtsfarbe war grau, er wirkte hohlwangig, die Augen waren rot und entzündet, wie bei einem Menschen, dem man unter Folter den Schlaf entzieht. Wahrscheinlich hatte er wirklich schon lange nichts mehr gegessen und getrunken, denn seine Lippen war trocken und eingerissen.
»Ich werde Pietro mal fragen«, sagte Giovanni daher milde und verschwand in der Küche.
Jonathan setzte sich. Er hatte den Eindruck, seine Hände festhalten zu müssen, damit sie nicht vom Tisch rutschten, so schlapp fühlte er sich. Er spürte eine Traurigkeit, die ihm jede Kraft nahm, und er hatte keine Idee, was er in dieser Nacht, was er überhaupt in seinem Leben noch machen sollte.
»Pasta kommt gleich«, sagte Giovanni, als er aus der Küche kam, und stellte einen halben Liter Rotwein vor Jonathan auf den Tisch.
»Du siehst aus, als wenn irgendwas passiert wäre.«
»Nein, aber ich fühl mich nicht gut. Ich glaube, ich muss mal raus. Verreisen. Irgendwohin. Aber ich habe noch keine Idee.«
»Fahr nach Italien. Italien ist immer gut für die Seele. Auch im Winter.«
Ja, dachte er. Italien. Warum auch nicht. Vor sechs Jahren war er das letzte Mal dort gewesen. Mit Jana hatte er einen fünftägigen Kurztrip nach Venedig gemacht, und die Eindrücke waren bis heute nicht verblasst. Großbürgerliche Häuser mit heruntergekommenen Fassaden, Türen und Fensterläden geschlossen. Aber wenn sich ein Fenster öffnete, offenbarte sich dahinter die Pracht eines Palazzo mit edlen Deckenintarsien, kostbaren Wandteppichen, prunkvoll vergoldeten Spiegeln und Lüstern aus Muranoglas. Venedig bestand aus unzähligen Palästen, die sich hinter schäbigen Fassaden versteckten. Das hatte Jonathan beeindruckt.
Italien. Er spürte, wie in ihm eine Sehnsucht aufkeimte, in dieses Land zu fahren. Vielleicht war es die Lösung.
»Wann willst du denn fahren?«, fragte Giovanni.
»Am liebsten sofort. Ich weiß es nicht, ich habe mir noch keine Gedanken gemacht. Und ohne dich wäre ich auch nicht auf diese Idee gekommen.«
»Mein Sohn fährt noch heute Nacht nach Bologna. Er will ein paar Tage seine Mutter besuchen. Ich könnte mir vorstellen, dass es ihm gefällt, ein bisschen Gesellschaft zu haben.«
Jonathan wusste, dass Giovanni vor zehn Jahren geschieden worden war. Während er in Berlin geblieben war und das Restaurant weiterführte, war seine Frau zurück nach Bologna gegangen.
Jonathan trank den Wein in großen Schlucken.
»Okay«, sagte er, »ich fahre mit.«
Sechzehn Stunden später hatte ihn Giovannis Sohn Angelo in Bologna am Hauptbahnhof abgesetzt, und Jonathan war um vierzehn Uhr vierundzwanzig in irgendeinen Zug gestiegen, der mit zwölf Minuten Verspätung um fünfzehn Uhr vierunddreißig im Hauptbahnhof von Florenz, Santa Maria Novella, ankam.
Er kaufte sich bei einem Straßenhändler eine billige Digitaluhr für fünftausend Lire,, einen dünnen, lauwarmen Milchkaffee in einem Styroporbecher und ein Brötchen mit Tomate und bereits angetrocknetem Mozzarella. Dazu eine deutsche Zeitung.
Allmählich setzte der Feierabendverkehr ein. Auf dem Bahnhof war es voll, Jonathan stand in der Mitte der Halle, aß heißhungrig sein Brötchen, während die Menschen um ihn herumrannten, Gepäck und kleine Kinder hinter sich herzogen, durcheinanderschrien oder das Rauchverbot ignorierend in Gruppen rauchten und sich unterhielten.
Was mache ich hier?, dachte Jonathan und sah auf die Uhr. Es war jetzt fünfzehn Uhr fünfzig. Direkt vor ihm auf Gleis sieben fuhr um fünfzehn Uhr einundfünfzig ein Zug nach Rom. Jonathan stopfte sich den Rest des Brötchens in den Mund, stürzte den letzten Schluck Kaffee hinunter und warf den Becher im Rennen in den Papierkorb. Als er auf den Bahnsteig kam, hob der Bahnbeamte bereits die rote Kelle. Jonathan schaffte es gerade noch, seinen Koffer in den Zug zu werfen und hinterherzuklettern. Unmittelbar hinter ihm schlossen sich die automatischen Türen.
Der Zug rollte durch das Bahnhofsviertel von Florenz, und Jonathan ging auf der Suche nach einem Platz langsam weiter nach vorn. Im dritten Wagen fand er eine freie Bank, setzte sich ans Fenster und stellte seinen Koffer neben sich.
Es roch nach Diesel und alter Pisse. Ihm gegenüber saß ein junger Italiener mit ungewöhnlich dicken Oberschenkeln, breitbeinig und mit geschlossenen Augen. In seinen Ohren steckten Kopfhörer, und Jonathan hörte gedämpft die plärrende Musik.
In den letzten Tagen hatte er sein Handy nicht angeschaltet, er wollte für Jana nicht erreichbar sein, jetzt zog er es aus derJackentasche und schaltete es ein.
Nur damit du Bescheid weisst, schrieb er an Jana, ich bin in Italien. Auf unbestimmte Zeit. J.
Keine Anrede, kein Gruß, kein nettes Wort.
Dann schickte er die SMS ab.
Die kleinen Orte, die vorüberzogen, registrierte er nicht. Er sah aus dem Fenster, ohne wirklich etwas zu sehen, und dachte an den letzten Streit. Es hatte bereits viele gegeben, aber dieser hatte das Fass zum Überlaufen gebracht.
Jonathan hatte am Küchentisch gesessen und Zeitung gelesen.
»Was ist los?«, fragte Jana.
»Nichts ist los.«
»Du machst ein Gesicht – das ist nicht zum Aushalten.«
»Ich mache gar kein Gesicht.«
»Doch. Du müsstest dich mal sehen, da kann einem schlecht werden!«
»Hör auf, auf mir rumzuhacken, und lass mich in Ruhe.«
Jana schnaufte. »Ich halte das nicht aus, Jon. Nie redest du mit mir. Immer soll ich dich in Ruhe lassen, du hängst hier mit finsterem Gesicht in der Gegend rum und hast nur noch schlechte Laune. Nur noch!«
»Du hast schlechte Laune! Seit Tagen, Wochen, ach was, seit Monaten. Keine Ahnung, was mit dir los ist, aber jetzt komm mir nicht so! Ich hab keine schlechte Laune, aber wenn du so weitermachst, kriege ich gleich welche!«
»Jonathan, du hast dich völlig verändert! Du bist nur noch verbiestert und verbittert, ich habe dich schon ewig nicht mehr lächeln sehen, und wenn du irgendetwas zu mir sagst, dann meckerst du rum, kritisierst mich wegen jedem Scheiß und weißt alles besser. Ich hab das monatelang ertragen und runtergeschluckt, aber irgendwann kann ich auch nicht mehr. Ich bin nicht deine Feindin, Jon, ich sitze im selben Boot, uns beiden ist dasselbe passiert, aber du greifst mich ständig an! Was soll das?«
Jonathan knallte die Zeitung auf den Tisch. »Wer greift denn hier wen an? Ha?«, schrie er. »Ich weiß nicht, was das soll, Jana? Ich hatte keine schlechte Laune und wollte nur in Ruhe meine Zeitung lesen, aber jetzt bin ich sauer. Durch dein ewiges Gehetze und Rumgemäkle, durch dein ständiges Stänkern …«
»Ach so, jetzt bin ich es also? Natürlich. Wie wunderbar du wieder den Spieß umdrehst!«
»Wenn du schlechte Laune hast, dann projizierst du es immer auf andere und machst mir Vorwürfe, dass ich schlechte Laune hätte. Fass dir mal an die eigene Nase!«
Jede Weichheit war aus Janas Gesicht verschwunden. Ihre Züge waren hart und kalt. »Du kotzt mich an, Jon, weißt du das?«
»Du kotzt mich genauso an, meine Liebe.«
»Na, das ist ja toll.«
»Das ist richtig toll.«
Jana schnappte nach Luft. Jonathan dachte, dass sie jetzt genug hätte, und wollte gerade die Zeitung in die Hand nehmen, als sie wieder anfing. Allerdings wesentlich leiser.
»Es ist ja nicht erst seit ein paar Tagen, es geht seit Wochen so, ach was, seit Monaten, eigentlich seit …, du weißt seit wann. Die ganze Welt ist dir egal, ich bin dir egal. Du siehst mich nicht mehr, du hast mich seit Ewigkeiten nicht mehr berührt.«
»Ich kann nicht, Himmelherrgott!«, schrie Jonathan.
»Du lebst nicht mehr mit mir!«
»Nein! Weil ich nicht nur nicht mehr mit dir, sondern weil ich überhaupt nicht mehr leben will! Kapierst du das nicht?«
Jonathan schwieg, aber seine zitternden Hände trommelten ein Tremolo auf die Tischplatte, und er stierte zu Boden.
»Irgendwann muss doch mal Schluss sein!« Jana wischte energisch über die Arbeitsplatte. »Irgendwann müssen wir beide doch mal wieder von vorn anfangen, Jon, einen Schlussstrich ziehen, in die Zukunft schauen!«
»Nein!« Jonathan schrie wie einer, der von der Klippe stürzt und begreift, dass er diesen Sturz niemals überleben wird. »Nein, nein, nein!«
»Du hast sie immer nur vergöttert. Mit deiner Affenliebe hast du alles kaputtgemacht«, murmelte Jana bitter. »Zwanzig Jahre hat sie unser Leben bestimmt, und selbst jetzt dreht sich immer noch alles nur um sie! Um sie, um sie, um sie, um sie!« Dann schwieg sie und flüsterte: »Immer nur um sie.«
Jonathan zitterte. Seine Gesichtshaut war knallrot, er stand kurz vor der Explosion.
Jana sah ihn an und hatte Lust, ihn zu verletzen.
»Du hast sie immer mehr geliebt als mich. Und du hast es mich verdammt spüren lassen. Und jetzt sitzt du hier rum und schikanierst mich mit deiner Trauer, deiner Einsamkeit, deinem Frust, was weiß ich. Und wirst mich noch Jahre dafür strafen, dass ich alles geopfert habe: für dich, für sie, für euch, für uns. Aber davon willst du nichts wissen, du willst nur, dass alle dein Leid sehen, der Herr und Meister geht kaputt, schaut her und bemitleidet ihn, Völker der Welt, schaut auf diesen Mann!«
Ihre Stimme war schrill, hoch und spöttisch zugleich.
Jonathan sprang auf und schlug ihr ins Gesicht.
Sie schleuderte zurück, sank zusammen und hockte auf dem Küchenfußboden.
Ohne jedes Mitleid sah er auf sie hinab und hätte ihr am liebsten noch ins Gesicht gespuckt.
»Alle Reichtümer der Welt würde ich dafür geben, dich nicht mehr sehen und ertragen zu müssen«, sagte er leise, »meine Wut ist zu schade für dich.«
Damit drehte er sich um, verließ die Küche und ging nach oben, um zu packen.
ZWEI
Als der Zug minutenlang durch die Dunkelheit eines Tunnels donnerte, wurde Jonathan bewusst, dass er keine Fahrkarte gekauft hatte.
Er saß jetzt auf dem Sprung. Beobachtete den Gang vor sich, horchte nach hinten, ob er den Kontrolleur hörte, der sich meist lautstark Gehör verschaffte, und kam sich vor wie mit fünfzehn, als er zum Handballtraining schwarzgefahren und jedes Mal tausend Tode gestorben war. Genauso fühlte er sich jetzt.
Eine halbe Stunde ging alles gut. Doch dann, unmittelbar nach San Giovanni Valdarno, kam der Schaffner von vorn in den Wagen und verlangte die Fahrkarten. Jonathan stand auf, verließ den Wagen gegen die Fahrtrichtung und stellte sich zum Ausstieg an die letzte Tür. So weit würde es der Schaffner bis zur nächsten Station nicht schaffen.
Noch nie waren Jonathan fünf Minuten so lang vorgekommen. Aber schließlich stand er doch unbehelligt und sehr erleichtert auf dem Bahnsteig von Montevarchi / Terranuova und wusste überhaupt nicht, wo er war. Er kannte die Stadt nicht, und es war mittlerweile kurz vor fünf, dämmerte bereits und fing an zu regnen.
Als er um das Bahnhofsgebäude herumging, jagte ihm der kalte Wind eine Gänsehaut über den Rücken. Er fror und zog sich die Jacke enger um den Körper.
Auf der kleinen Piazza vor dem Bahnhof standen nur wenige Autos. Ein paar alte Männer saßen trotz des Regens rauchend auf einigen Bänken vor einem Brunnen, in dem Plastiktüten, aufgeweichte Papiertaschentücher und Laubreste schwammen. Dieser Anblick war so trostlos, dass er ihn kaum ertragen konnte. Er wandte sich nach rechts, ging die Straße entlang bis zu einer unübersichtlichen Baustelle, die er nur mit Mühe überquerte, da die Autos aus mehreren Richtungen scheinbar aus dem Nichts auftauchten.
Ein paar Meter weiter begann die Fußgängerzone. Via Roma las er an einer Hauswand.
Langsam schlenderte er die Straße entlang und blieb vor fast jedem Schaufenster stehen. Bekleidungsgeschäfte, Optiker, eine Apotheke, ein Gemischtwarenhändler, ein exquisites Einrichtungshaus und zwei Zeitungsläden. Er kaufte ein deutsch-italienisches Wörterbuch und eine Landkarte von der Toskana.
Die Kirche wäre ihm beinah nicht aufgefallen, so unauffällig lag sie eingebettet zwischen Wohn- und Amtshäusern. Erst als eine alte Frau heraustrat und langsam Stufe für Stufe die Treppe herunterstieg, weil sie Angst hatte zu fallen, bemerkte er das von außen völlig unscheinbare Gotteshaus. Er ging hinein und war überwältigt von der unfassbaren Größe, die er zwischen den Häusern nicht vermutet hätte.
Außer einem alten Mann, der mit rundem Rücken und gesenktem Kopf in der ersten Reihe saß, war niemand in der Kirche. Jonathan setzte sich ganz nach hinten, direkt neben den Opferstock. Er schloss die Augen und roch kaltes Holz, lange verwehten Weihrauch und verbranntes Wachs.
Er fror. Seine Füße waren eiskalt, aber er blieb dennoch eine Viertelstunde sitzen. O Herr, sprach er in Gedanken, obwohl er sich nicht erinnerte, nach seinem zwölften Geburtstag jemals wieder gebetet zu haben, wo soll ich hin? Was soll ich tun? Was hast du mit mir vor? Er wartete auf eine Antwort, aber die Kirche blieb still und unverändert wie zuvor.
Nach weiteren drei Minuten stand er mit klammen Gliedern auf, entzündete eine Kerze am Opferstock und machte sich dann auf den Weg, die Stadt zu verlassen, die ihm an diesem Novembernachmittag zu laut und zu grau war und ihn noch depressiver machte, als er ohnehin schon war.
Er ließ sich treiben, wollte dem Schicksal die Entscheidung überlassen und stieg am Ende der Fußgängerzone in den ersten Bus, der kam. Siena stand auf der digitalen Anzeige. Auf keinen Fall wollte er bis Siena fahren, nicht schon wieder in eine Stadt, sondern irgendwo aussteigen, in einem kleinen Ort, irgendwo.
Das leichte Schaukeln des Busses machte ihn müde, aber er kämpfte gegen den Schlaf, um nicht erst an der Endstation wieder aufzuwachen. Die langgestreckten, kalten und funktionalen Industriebauten zwischen Montevarchi und Bucine waren abstoßend, und Jonathan bedauerte, dass der Schaffner im Zug so früh gekommen war. Vielleicht wäre es besser gewesen, bis ins Latium zu fahren.
Hinter Bucine wurde die Landschaft lieblicher. Als er vor sich auf einer Anhöhe Ambras mittelalterlichen Stadtkern liegen sah, stieg er kurzerhand aus und ging in die Altstadt.
Jede kleine Gasse, jede Treppe, jeden dunklen Gang erkundete er und grüßte jeden, der ihm entgegenkam.
Allmählich wurde es dunkel. Das gelbe Licht der Straßenbeleuchtung beruhigte ihn und weckte in ihm fast so etwas wie ein heimatliches Gefühl.
In einem kleinen Alimentariladen kaufte er sich warme Lasagne in einer Pappschachtel, die er auf der Straße im Gehen aß, und betrat anschließend die Bar. Er bestellte sich ein Mineralwasser und einen halben Liter Wein und setzte sich an den Tisch unter dem Fernseher.
In der Bar war es laut und voll. Eine blonde und eine dunkelhaarige Frau hinter dem Tresen bedienten mit stoischer Ruhe. Er wusste, dass jetzt die Entscheidung fallen musste, wie es an diesem Abend und in dieser Nacht mit ihm weitergehen sollte. Wenn er es nicht schaffte, nach diesem halben Liter sofort zu gehen, dann würde er hier versacken und keine Unterkunft mehr finden. Nervös starrte er auf die Straße. Sie glänzte im Licht der Laternen, es regnete jetzt stärker.
In seinem Wörterbuch suchte er sich schließlich die nötigen Vokabeln heraus, um nach einem Zimmer für eine oder mehrere Nächte zu fragen, aber zuerst wollte er in Ruhe zu Ende trinken und jeden Schluck genießen, wenn er sich mehr nicht genehmigen durfte.
Als sich der Wein warm in seinem Magen ausgebreitet hatte und ihm leicht zu Kopf gestiegen war, ging er zum Tresen.
»Scusi«, sagte er zu der Blonden, die kleine Espressounterteller aus der Spülmaschine nahm und mit einem entsetzlich lauten Scheppern aufeinanderknallte, »cerco camera. Zimmer. Room. Per la notte, oder for a week. Oder länger. Don’t know.«
Offensichtlich hatte sie den wüsten Sprachenmix verstanden, denn sie grinste, aber verzog auch gleichzeitig den Mund, als wolle sie damit ausdrücken: Oh, das wird schwierig.
Jonathan bekam einen Schreck.
»Hotel?«, fragte er erneut. »Pensione?«
Jetzt zog die Blonde die Augenbrauen hoch. »Abbiamo novembre!«, sagte sie beinah vorwurfsvoll, »tutto è chiuso!« Dann wandte sie sich an zwei Bauern, die am Tresen standen, Grappa tranken und den Fremden aufmerksam musterten. »Der Mann hier sucht ein Zimmer zum Übernachten. Wisst ihr was?« Und ohne die Antwort abzuwarten, fragte sie Jonathan: »Tedesco?«
Jonathan nickte.
Riccardo hatte den Deutschen schon länger beobachtet. Er schätzte ihn auf Ende vierzig, Anfang fünfzig, obwohl seine Haare schlohweiß waren und ihm bis auf die Schultern fielen. Sein Fünftagebart war grau, und seine Augen wirkten müde.
Komischer Vogel, dachte Riccardo, wie ein normaler Tourist sieht er nicht aus, aber auch nicht wie ein Penner. Wahrscheinlich ist er ein Intellektueller oder ein Künstler, bei denen es zurzeit Mode war, sich die Haare wachsen zu lassen und zu einem Zopf im Nacken zusammenzufassen. Riccardo fand das ziemlich albern und unpraktisch, aber irgendetwas an diesem Fremden gefiel ihm. Vielleicht die Art, wie er genussvoll seinen Wein getrunken hatte, oder aber schlicht die Frage, was er an einem verregneten Novemberabend in Ambra zu suchen hatte.
Fast beiläufig hob Riccardo die Hand und nickte dazu. »Er kann mitkommen«, sagte er zu der Blonden. »Im Moment hab ich keine Gäste, meine Ferienwohnung steht leer.«
Jonathan hatte zumindest verstanden, dass Riccardo etwas Positives gesagt hatte.
»Camera libera«, meinte die Blonde grinsend. »Da lui!« Dabei tippte sie mit dem Finger in Riccardos Richtung.
Jonathan nickte erleichtert. »Grappa!«, sagte er. »Per us.« Dabei zeigte er auf Riccardo und Ugo, der bisher noch gar nichts gesagt hatte, die Blonde und sich selbst.
Die Blonde nahm wortlos drei Grappagläser aus dem Schrank und schenkte ein. Als Jonathan sie fragend ansah, deutete sie auf ihren Bauch, wischte mit ihrem sich hin und her bewegenden Zeigefinger ein entschiedenes »Nein« in die Luft und flüsterte strahlend: »Bimbo. Tra cinque mesi!«
Dass sie schwanger war, hatte Jonathan noch gar nicht bemerkt. Und in diesem Moment wurde ihm bewusst, dass es jetzt schon über zwei Jahre her war, dass er einen erotischen Gedanken gehabt, Lust verspürt, geschweige denn eine Frau berührt hatte.
Riccardo und Ugo tranken ihren Grappa in einem Zug, Jonathan brauchte etwas länger. Schließlich stand Riccardo auf, schob sich die Mütze tiefer in die Stirn, grüßte sowohl die Blonde als auch die Dunkle mit einem knappen »Ciao«, drückte Ugo kurz zum Abschied die Schulter und ging, während er Jonathan aufforderte mitzukommen, zur Tür. Jonathan legte einen Zwanzigeuroschein auf den Tresen und folgte ihm. Da ihn die Blonde nicht erbost zurückrief, wusste er, dass er zu viel bezahlt hatte.
Riccardo hatte einen verbeulten weißen Pick-up, auf dessen Ladefläche leere Olivenkästen und zusammengerollte Netze lagen. Außerdem zwei Leitern und eine Kiste mit allerlei Werkzeug und undefinierbarem Krempel.
Bevor er einstieg, streckte Riccardo Jonathan die Hand hin. »Sono Riccardo«, sagte er grinsend. »Riccardo Valentini.«
»Jonathan Jessen«, antwortete er und schlug ein. Anschließend kletterte er auf den Beifahrersitz, Riccardo startete den Motor, der Geräusche machte, als müsse er abhusten, und fuhr los.
Während der Fahrt schwiegen sie, was Jonathan aber nicht als unangenehm empfand. Sie ließen Ambra hinter sich, bogen nach einigen Kilometern rechts ab und fuhren in die Hügel des Chianti hinein. Trotz der Dunkelheit spürte Jonathan die Schönheit und Weite der Landschaft. Er wurde ruhig und sah der Nacht zuversichtlich entgegen. Es war ihm egal, wohin Riccardo ihn brachte, ihm war jedes Zimmer recht, auch wenn es noch so einfach oder unbequem sein sollte.
Nach einer Viertelstunde erreichten sie Monte Benichi und fuhren zwischen der Ruine eines Palazzo und der alten Stadtmauer direkt auf die kleine Osteria zu, in der noch Licht brannte, aber durch die geschlossene Gardine konnte Jonathan nicht erkennen, ob Gäste da waren oder nicht.
Unmittelbar nach Monte Benichi bogen sie auf eine Schotterstraße ab. Riccardo fuhr wie ein Verrückter. Der Wagen sprang über die Schlaglöcher und rutschte auf dem feuchten, schlammigen Boden. Nur einen knappen Meter neben ihnen ging es steil bergab, selbst in der Dunkelheit konnte Jonathan die Tiefe der gewaltigen Schlucht erahnen, aber er sagte nichts.
Nach dreihundert Metern begann der Wald.
Nebelfelder zogen durch die Nacht. Die Bäume erschienen im Scheinwerferlicht riesengroß. Jonathan nahm nur winzige Ausschnitte der Umgebung war, die Luft war feucht, Regentropfen fielen von den Blättern auf die Windschutzscheibe.
Riccardo raste jetzt, als wolle er seinen Wagen auf diese Weise verschrotten. Jonathan hielt sich am Griff über dem Seitenfenster fest und versuchte sich zu merken, wo Riccardo langfuhr, aber nach der dritten oder vierten Abzweigung gab er es auf. Alle Wege sahen gleich aus, der Wagen rumpelte bergauf und bergab, Äste hingen über der Straße, es war unmöglich, die Orientierung zu behalten.
Jonathan sah auf die Uhr. Seit Monte Benichi waren sie jetzt zwölf Minuten unterwegs und keinem einzigen Haus begegnet, Riccardo schien in der absoluten Einsamkeit zu wohnen.
Wunderbar, dachte Jonathan, genauso habe ich es mir vorgestellt.
Auf den letzten zweihundert Metern musste selbst Riccardo langsam fahren, so steinig und holprig war der Weg, aber dann tauchte der Schein einer Laterne auf, und kurz darauf sah er das Haus. Aus den Fenstern des oberen Stockwerks drang warmes Licht, in einem kleinen Fenster neben dem Portico leuchtete eine Kerze neben einer Madonnenfigur.
»Un attimo«, sagte Riccardo und stieg aus. »Chiamo mia figlia. Può parlare tedesco.« – Einen Moment, ich rufe meine Tochter. Sie spricht Deutsch.
Jonathan sah sich um. Das Haus war groß. Sehr groß. Wahrscheinlich ein ehemaliger Hof, in dem früher mehrere Generationen samt der Tiere unter einem Dach gewohnt hatten. Er konnte sich gut vorstellen, dass in diesem typisch toskanischen Bauernhaus eine oder mehrere Ferienwohnungen ausgebaut worden waren.
Jonathan sah still in die dunkle Nacht. Das ist hier sicher einer der höchsten Punkte dieser Gegend, überlegte er, am Tag muss der Panoramablick einmalig sein. Jetzt konnte er nur vereinzelte Lichtpunkte in der dunklen Weite ausmachen, wo einsame Podere oder winzige Dörfer auf den Hügeln lagen, in der Ferne blinkten die Lichter einer größeren Stadt. Vielleicht Siena, dachte Jonathan, nein, da möchte ich jetzt nicht sein.
In diesem Moment öffnete sich oben die Tür, und eine junge Frau betrat den unbeleuchteten Portico, den überdachten Eingangsbereich im ersten Stock am Ende der toskanischen Treppe. Im Dunkeln kam sie die Treppe herunter. Auch auf der Terrasse brannte kein Licht.
Langsam ging sie auf Jonathan zu, und er konnte in der Dunkelheit ihre Gestalt nur schemenhaft erkennen.
Sie kam näher und ging fast an ihm vorbei.
»Buonasera«, sagte er leise. Sie zuckte zusammen und wandte sich ihm zu.
»Buonasera. Ich bin Sofia«, antwortete sie und streckte ihm zögernd ihre Hand entgegen.
»Ich bin Jonathan«, sagte er, ergriff ihre Hand und wunderte sich, wie warm sie war. »Sie sprechen Deutsch?«
»Ja«, antwortete sie, »ein wenig.«
Oben auf dem Portico öffnete sich erneut die Tür, und Riccardo kam heraus. Er schaltete die Außenbeleuchtung des Hauses an.
Jetzt sah Jonathan Sofia etwas deutlicher und hielt den Atem an. In seinem Kopf drehte sich alles. Sie war schön.
»In diesem Jahr ist der November sehr kalt«, sagte sie.
Jonathan blieb stumm und konnte nicht aufhören, sie anzusehen, obwohl der dem Haus abgewandte Teil ihres Gesichtes im Schatten und im Dunkeln blieb. Er fixierte ihre hohe Stirn, die langen dunklen und glatten Haare, die schmalen Augen und den sanft geschwungenen Mund.
»Mein Vater sagte, Sie suchen ein Zimmer?«
»Ja.«
»Für wie lange?«
»Ich weiß es nicht. Ein paar Tage? Ein paar Wochen oder Monate? Ich habe wirklich keine Ahnung.«
»Gut«, meinte sie und lächelte. »Kommen Sie. Ich zeige Ihnen die beiden Wohnungen, die wir haben. Dann können Sie sich eine aussuchen.«
Sofia konnte es gar nicht glauben. Im Winter einen Gast zu haben war ein Geschenk des Himmels. Finanziell ein völlig unerwarteter warmer Regen. Außerdem würde das Haus beheizt, und es würde vielleicht nicht ganz so still werden über Weihnachten und Neujahr oder im Februar, wenn häufig Schnee fiel und sie manchmal tage- oder wochenlang nicht vom Berg hinunterkamen. Eine Abwechslung wäre es auf alle Fälle, und ein bisschen Arbeit konnte auch nicht schaden.
Jonathan folgte Sofia, die langsam den Garten durchquerte und unterhalb des Portico die Tür hinter einem gemauerten Torbogen öffnete.
Als er an ihr vorbeiging, kräuselte sie leicht die Nase.
»Pia macht die beste Lasagne in ganz Ambra«, sagte Sofia, während sie die Wohnung betrat. »Hat sie Ihnen geschmeckt?«
»Ja«, erwiderte Jonathan irritiert, »wie …, ich meine, woher wissen Sie das?«
Sofia drehte sich lächelnd zu ihm um. »Sie haben den köstlichen Geruch der Lasagne immer noch an sich.«
Offensichtlich wollte sie die Diskussion nicht weiter fortführen, denn jetzt machte sie eine große Geste, um den Raum zu präsentieren, in dem sie standen.
»Dies ist die größere der beiden Wohnungen. Wohnzimmer mit Kamin, Küche, Bad und ein kleines Schlafzimmer. Hier haben Sie Morgensonne und einen schönen Blick. Zwar nicht ins Tal, aber über den Olivenhain. Den Torbogen können Sie nutzen wie eine kleine überdachte Terrasse, aber natürlich auch den Garten. Sie können sich aufhalten, wo Sie wollen, gar kein Problem.« Sie stand steif im Zimmer, ohne sich zu drehen oder sich in die Richtung zu wenden, von der sie sprach.
Jonathan trat in das Zimmer. Feuchte, abgestandene Luft schlug ihm entgegen, mit einem modrig süßlichen Geruch wie in einem dunklen Wald, in dem unter fauligen Baumstümpfen Moos und Pilze wucherten.
Sofia betätigte den Lichtschalter, aber es blieb dunkel.
Sie ging tiefer in den Raum hinein. »Es könnte sein, dass die Gasflasche leer ist, das müssen wir ausprobieren«, sagte sie.
»Entschuldigen Sie, aber ich sehe überhaupt nichts. Es ist stockdunkel.«
»Oh!« Sofia lachte fast. »Dann werden die Sicherungen wohl noch nicht drin sein. Kleinen Moment.«
Mein Gott, dachte er, sie sieht nichts. Für sie macht es keinen Unterschied, ob das Licht an oder aus ist, sie ist blind.
Zwischen Torbogen und Tür gab es eine Nische, in der der Sicherungskasten hing. Sofia ertastete und öffnete ihn. Jonathan hörte es ein paarmal knipsen, und dann ging zumindest eine Glühbirne im Küchenbereich an.
»Besser?«, fragte Sofia.
»Ja. Danke.«
Im schummrigen Licht starrte er sie an, was sie jedoch nicht bemerkte. Ihre Augen wanderten ziellos hin und her, und dann wartete sie darauf, dass er etwas sagte.
Die Tür zum Schlafzimmer stand offen. Er fand den Lichtschalter, und auch hier brannte nur eine schwache Glühbirne an der Decke. Auf den ersten Blick sah er die feuchte Wand in der Nische hinter dem Bett, an der sich schon an einigen Stellen der Putz löste. Über dem Bett lag eine großgeblümte, verblichene Tagesdecke, die bestimmt schon fünfzehn Jahre oder mehr in diesem Zimmer, zumindest aber in diesem Haus überdauert hatte.
Im Wohnzimmer lagen zwei Teppiche: einer unter dem winzigen Couchtisch und einer vor dem Kamin. Sie waren nicht verblichen, sondern einfach derartig abgetreten, dass sie ihre Farbe fast völlig verloren hatten. Couch, Sessel und Couchtisch waren ein Relikt aus den sechziger Jahren, ein Fernseher fehlte ganz.
Die Kochnische bestand aus einer schlichten verchromten Spüle, der man deutlich ansah, dass sie jahrelang mit scharfen Reinigern und harten Scheuerschwämmen malträtiert worden war, daneben eine zweiflammige Kochplatte. Zwei einfache Hängeschränke hingen über der Kunststoff-Arbeitsplatte, über der die nackte Glühbirne pendelte, weil Sofia sie angestoßen hatte, als sie den Lichtschalter neben dem Fenster betätigt hatte.
Neben der Tür stand ein schmaler Kleiderschrank und davor ein Schirmständer, den sicher noch nie jemand benutzt hatte, da außer ihm wohl kaum jemand auf die Idee gekommen war, im November in einer solchen Wohnung zu wohnen.
Jonathan fand es unerträglich dunkel im Raum, und er entdeckte als weitere Lichtquelle nur noch eine vergilbte Stehlampe mit gefaltetem Schirm neben der grün-gelb gemusterten Gardine dem Couchtisch gegenüber.
»Prima«, sagte er zu Sofia und öffnete die Tür zum Bad. Rechts neben der Tür war der Lichtschalter, und als er ihn betätigte, gab die Neonröhre über einem Spiegelschränkchen hinter bräunlichem Plexiglas klägliches, düsteres Licht, das unentwegt flackerte und zuckte. Jonathan registrierte, dass es im Bad eine Toilette, ein Bidet und ein winziges Waschbecken gab, und schließlich entdeckte er links hinter der Tür auch noch einen Duschkopf an der Decke, ohne Duschkabine, aber mit einem Abfluss im Fußboden.
Wenigstens etwas, dachte er erleichtert, auf einen klebrigen Duschvorhang kann ich verzichten, Hauptsache, ich bekomme heute Abend noch eine heiße Dusche.
»Ich zeige Ihnen jetzt noch die andere Wohnung. Sie ist etwas kleiner, aber dafür auch billiger«, meinte Sofia, zog die Tür hinter sich zu und ging wieder voran bis hinters Haus. Eine steinerne Treppe führte direkt in das obere Stockwerk, aber der winzige Portico bot nicht genug Platz für Tisch und Stuhl. Von hier hatte man wahrscheinlich einen Blick ins Tal bis nach Ambra und über die dahinter liegenden Bergketten bis hin zum Prato Magno.
Die zweite Wohnung war ähnlich erbärmlich ausgestattet, Küche und Bad waren fast identisch, aber sie hatte nur ein Zimmer, und ein Kamin fehlte ganz.
»Wunderbar«, meinte er, nachdem er sich umgesehen hatte, »ich glaube, ich nehme die größere Wohnung unten, die wir zuerst gesehen haben. Sie gefällt mir besser.«
Er war irritiert über seinen eigenen Optimismus, denn bis vor zwei Tagen hatte er noch in einem Haus gewohnt, das einen großen Garten, eine Terrasse, acht Zimmer und zwei Bäder hatte, eine überdimensionale offene Küche mit einem zentralen Kochblock, den er über alles liebte, außerdem ein integriertes Ballettstudio, zwei Umkleideräume und vier Duschen. Und jetzt glaubte er, sich in dieser Absteige wohlfühlen zu können.
»Gut«, meinte Sofia, »das freut mich. Dann hole ich Ihnen jetzt noch ein paar Handtücher und Bettwäsche. Wir waren ja nicht auf Gäste eingerichtet.«
»Nein, natürlich nicht. Machen Sie sich bloß keine Umstände.«
Jonathan spürte, dass er unkontrolliert anfing zu zittern. Und daher fiel ihm auch jetzt erst auf, dass es in der Wohnung nur unwesentlich wärmer war als draußen.
»Entschuldigen Sie, eine Frage habe ich noch«, sagte er, als Sofia bereits dabei war, die Wohnung zu verlassen. »Gibt es in der großen Wohnung eine Heizung?«
Sofia blieb stehen. »Nein. Tut mir leid. Nur den Kamin. Aber wenn Sie ihn gut anheizen, ist es warm genug. Die Winter in der Toskana sind nicht so streng, und Schnee haben wir meist nur wenige Tage im Jahr. Wenn Sie wollen, kommen Sie mit zum Schuppen. Dann gebe ich Ihnen einen Korb voll Holz.«
Zwanzig Minuten später kam er mit leicht muffiger Bettwäsche, zwei klammen und steinharten Handtüchern, dem Wohnungsschlüssel und einem Korb voller Holz und getrockneter Erika zum Anzünden zurück in die Wohnung. Er verschloss die Tür, stellte den Korb ab und öffnete das Fenster. Aber als er die kalte Nachtluft spürte, die hereinzog, schloss er es sofort wieder.
Unter dem Fenster stand eine kleine Kommode. Die Schubladen klemmten derart, dass er sie nur mit Gewalt aufreißen konnte, wobei die Kommode durch die Gegend rutschte. Er durchsuchte sie, fand aber nur eine Plastiktischdecke mit Zitronenmuster und zwei kleine Kerzenstummel. Jonathan überlegte, ob er Feuer machen sollte, aber die Vorstellung, jetzt noch ein oder zwei Stunden untätig am Kamin zu sitzen, bis es im Zimmer vielleicht um zwei oder drei Grad wärmer geworden war, reizte ihn nicht. Lieber wollte er gleich ins Bett gehen und schlafen, um dieses Zimmer und die Kälte zu vergessen.
Im Badezimmer betätigte er zuerst den Heißwasserhahn. Braune Soße floss ins Waschbecken, und das Wasser blieb kalt. Das geht nicht, dachte er, das geht alles gar nicht, das halte ich nicht aus. Morgen früh fahre ich weiter. Sehr viel südlicher, vielleicht bis nach Sizilien. Ein Zimmer wie dieses finde ich überall, aber vielleicht ist es dort ein bisschen wärmer.
Jonathan ließ das Wasser einige Minuten laufen, versuchte seinen Ekel zu überwinden und trank schließlich mehrere Schluck Wasser aus der hohlen Hand. Dann begann er das Bett zu beziehen. Und es war, wie er befürchtet hatte: Das Bettzeug war feucht und ebenso die Bezüge.
Er löschte das Licht, zog nur die Jeans aus, behielt den Pullover an und kroch in das kalte, beinah nasse Bett.
Stunden vergingen, und Jonathan lag wach. Die Kälte saß ihm in den Knochen und hinderte ihn daran, einzuschlafen.
Jana hatte auf seine SMS nicht geantwortet. Also war es ihr wirklich egal. Sie vertraute darauf, dass er irgendwann reumütig zu ihr zurückkehren würde.
In diesem Moment gab es ein fürchterliches Poltern und Krachen. Jonathan schreckte hoch, starrte in die Dunkelheit und versuchte sich daran zu erinnern, wo der Lichtschalter war. Aber die kalte Zimmerluft zog wie ein eisiger Wind um seine Schultern, und er legte sich wieder hin und versuchte, die Bettdecke unter seinem Körper festzustecken, damit kein Luftzug mehr hindurchkriechen konnte. Warum sollte er auch Licht machen? In seinem Zimmer war alles in Ordnung. Wahrscheinlich war direkt über ihm ein Möbelstück umgekippt oder irgendjemand aus dem Bett gefallen.
Auf seiner Armbanduhr sah er, dass es jetzt halb drei war. Normalerweise fielen um diese Zeit nicht ohne Grund Möbel um, das Geräusch beunruhigte ihn, weil es so unerklärlich und absurd war, aber dann zwang er sich, nicht länger darüber nachzudenken.
Nur noch ein paar Stunden, dann würde er Riccardo zwanzig Euro in die Hand drücken und diese Räuberhöhle ein für alle Mal verlassen. Das Ende dieses Alptraums war absehbar.
Wehmütig dachte er an sein warmes, luxuriöses Haus, sein großes bequemes Bett und das fantastische Badezimmer, das sie erst vor anderthalb Jahren eingebaut hatten. Um sich abzulenken und sich etwas Gutes zu tun. Sie wollten sich gegenseitig beschenken, wollten einen Raum völlig neu gestalten, in dem es ihnen vielleicht gelang, die Seele baumeln zu lassen.
Jana konnte es, er nicht. Stundenlang lag sie mit geschlossenen Augen im warmen schaumigen Wasser und ließ den Whirlpool sprudeln. Und Jonathan machte sich Sorgen, dass sie einschlafen und in der Wanne ertrinken könnte.
Die Situation war grotesk. Er fror in einem feuchten Bett in der winterlichen Toskana und wünschte sich nichts sehnlicher, als die Zeit noch einmal zurückdrehen und alles ungeschehen machen zu können, was vor vierundzwanzig Jahren in Berlin begonnen hatte.
DREI
Berlin 1977
Jonathan stand bescheiden neben dem Tisch mit den Getränken und fragte sich, ob er einen roten Kopf hatte, denn er hatte Schwierigkeiten, auf das Lob und die Gratulationen zu reagieren, die seit ungefähr einer halben Stunde auf ihn einprasselten. Nur eins war ihm klar: Er hatte es geschafft! Seine erste Vernissage als Fotograf war ein voller Erfolg.
Ungefähr sechzig Leute drängten sich in der kleinen Galerie in der Grolmanstraße, drehten Sektgläser in ihren Händen und legten den Kopf schief, als könnten sie die Bilder so besser betrachten, nickten, murmelten leise Kommentare, lächelten und gingen ein paar Schritte weiter zum nächsten Foto.
Vor einem knappen Jahr hatte Jonathan neben seiner Arbeit als Theaterfotograf damit begonnen, eine Fotoreihe zum Thema »Leben im Sturm« zu entwickeln. Menschen im Wind, zerzauste Landschaften, Wellenberge, Dinge, die durch die Luft flogen – alles in Bewegung oder außer Kontrolle. Die Fotos hatte er als »Ausgangspunkt« ins Zentrum seiner Bilder gestellt und sie dann mit realistischer Malerei weitergeführt, verfremdet, vervollkommnet oder entstellt. Dadurch waren faszinierende Werke entstanden, die die Sicht auf die Dinge veränderten und eine völlig neue Betrachtung ermöglichten.
Und inmitten seiner Foto-Malerei-Collagen immer wieder Jana. Sie war sein Thema, seine Muse, verkörperte die perfekte Leichtigkeit in der Bewegung. Er zeigte, wie sie sprang, sich in der Luft drehte oder am Ende eines wilden Tanzes in sich zusammenfiel, als würde sie auf dem Bühnenboden zerfließen. Jana war stürmisch und kraftvoll, ihr Tanz war wie eine Explosion, seine mutigen Zeichnungen unterstrichen dies und gaben der Momentaufnahme ihres Tanzes eine Dimension weit über den Bildrand hinaus.
Während sich die Galerie immer mehr füllte, wurde Jonathan immer nervöser. Sie war noch nicht da, obwohl sie fest versprochen hatte, spätestens um neun hier zu sein. Nach der Probe wollte sie nur kurz nach Hause, duschen, sich umziehen und dann so schnell wie möglich kommen. Sie wusste, wie wichtig ihm der Abend und seine erste Ausstellung war, und sie wusste auch, dass ihm das alles nichts bedeutete, wenn sie nicht dabei war.
Jetzt war es halb zehn, und sie war immer noch nicht da.
Gerade als er unzählige Male »bitte entschuldigen Sie mich einen Moment« gesagt hatte und murmelnd versuchte, sich bis ins Büro durchzukämpfen, um sie anzurufen, sah er sie kommen.
Sie sah fantastisch aus, trug ein fließendes champagnerfarbenes Kleid, das, obwohl es nicht eng anlag, ihren schmalen Körper perfekt betonte. Aber sie wirkte ungewohnt ernst, und das Lächeln fiel ihr schwer, als sie Jonathan und die ersten Gäste begrüßte.
»Ist irgendetwas?«, fragte er sie flüsternd.
An der Art, wie sie den Kopf schüttelte, sah er deutlich, dass doch etwas war, aber er fragte nicht weiter. Hier zwischen all den Menschen würde sie ihm ohnehin nichts erzählen.
»Sehr verehrte Frau Jessen«, sagte ein grauhaariger, übergewichtiger Mann zu Jana, den Jonathan schon ein paarmal gesehen hatte, aber dessen Namen er nicht wusste, »ich habe Sie als ›Giselle‹ gesehen, bei Ihrer letzten Premiere, Sie waren einfach göttlich! So eine hervorragende Primaballerina hatte die Deutsche Oper noch nie! Entschuldigen Sie, dass ich das so sage, aber ich verehre Sie und werde von nun an keine Ihrer Premieren verpassen. Und dass Ihr Mann Sie fotografiert und in den Themenkreis ›Sturm‹ eingearbeitet hat, ist einfach großartig! Mein Kompliment!« Er verneigte sich, und obwohl Jonathan direkt daneben stand, hatte er nur zu Jana gesprochen.
Normalerweise war Jana an solche Komplimente gewöhnt und konnte sie genießen, an diesem Abend wirkte sie jedoch, als sei sie nicht ganz bei der Sache. Sie bedankte sich knapp, aber nicht unhöflich, und wollte sich abwenden, als ihr Bewunderer sagte:
»Ach … eine Bitte habe ich noch.« Hektisch riss er das Packpapier von einem Bild, das er die ganze Zeit unter dem Arm gehalten hatte. »Würden Sie eventuell so freundlich sein und mir hier auf dieses Foto ein Autogramm geben? Ich habe es gerade erworben.«
Jana sah Jonathan an. Das Foto zeigte sie während eines Sprunges mit Drehung, und Jonathan hatte ihm mit wenigen, aber gekonnten zeichnerischen Veränderungen einen Schwung und eine Dynamik gegeben, die ihren Sprung noch außergewöhnlicher erscheinen ließ. Sie wusste, dass dies eines seiner Lieblingswerke war, und ein Autogramm darauf würde es in seinen Augen zweifellos verändern, wenn nicht zerstören, aber Jonathan verzog keine Miene. Er stand da und machte ein unbeteiligtes Gesicht, als würde ihn das alles nicht interessieren.
Jana lächelte, nahm dem Mann den dicken Filzstift aus der Hand, den er bereithielt und unterschrieb. Sie war sensibel genug, zu spüren, wie verletzt Jonathan war. Es war sein Abend, seine Vernissage, sein Erfolg, aber sie stahl ihm die Schau, alles drehte sich nur noch um die Ballerina der Deutschen Oper, die Muse des Künstlers, und nicht mehr um ihn. Und jetzt hatte sie durch ihre Unterschrift auch noch sein Bild zerstört.
Der Mann bedankte sich für das Autogramm mit einer tiefen Verbeugung und ging.
In den kommenden anderthalb Stunden kam sich Jonathan in der Galerie vor wie reine Staffage. Er wurde begrüßt, höflich für seine Arbeit gelobt und dazu beglückwünscht, doch die wahre Aufmerksamkeit der Besucher galt Jana. Sie war der Star des Abends, die Inspiration des Künstlers, die Attraktion Berlins. Jonathan war nur ein Statist, der auf seine erfolgreiche Frau stolz sein durfte, der, der ihr Talent benutzte, um auf anderem Gebiet ebenfalls Karriere zu machen. Zeitweilig stand er einfach nur dumm herum, drehte sein Sektglas in den Händen und sah zu, wie seine Frau von Fans und Bewunderern umringt wurde.
Um halb eins lehnte Jonathan gelangweilt, ein bisschen verloren und vollkommen nüchtern neben einem seiner größten Fotos, das einen grauschwarzen Tornado zeigte, der über einem kleinen amerikanischen Ort tobte und sich ein knallorangefarbenes Haus als Ziel seiner Zerstörungswut ausgesucht hatte. Die Spitze der Windhose zielte genau auf den Schornstein.
Jonathan war zu dieser Zeit in Arkansas gewesen und hatte das sensationelle Foto geschossen. Einen Tag später hatte er auch die Trümmer des orangefarbenen Hauses aufgenommen, aber dieses Foto interessierte niemanden. Einzig und allein der Moment der Gefahr war ausschlaggebend und prickelnd.
Adam Genzke, der Galerist, kam auf ihn zu.
»Nun?«, fragte er grinsend, »was sagst du? Ich glaube, die Vernissage war ein Riesenerfolg. Hättest du das gedacht?«
»Ich hab es gehofft«, antwortete Jonathan geistesabwesend.
»Bis auf drei Bilder sind alle verkauft, die kriegen wir auch noch weg, ich kann es gar nicht fassen. Du bist ein Star, Jonathan!«
»Schön«, sagte er und zwang sich zu einem Lächeln. »Dank dir, Adam. Für alles.«
Damit drehte er sich um und machte sich auf die Suche nach Jana.
Sie war im Gespräch mit dem Regierenden Bürgermeister und dessen Frau. Jonathan begrüßte die beiden, aber als sie ihre Begeisterung zum Ausdruck brachten und sich dabei ständig gegenseitig ins Wort fielen, hörte er gar nicht mehr zu.
»Ich kann nicht mehr«, flüsterte er anschließend Jana ins Ohr. »Kommst du mit nach Hause?«
Sie nickte und lächelte. »Gleich.«
Er wandte sich ab und ging ins Büro, um auf sie zu warten.
Sieben Minuten später kam sie und zupfte ihn am Ärmel.
»Na, dann komm«, sagte sie nur.
Vor der Galerie stiegen sie in ihr Auto und fuhren davon.
Bis zu ihrer gemeinsamen Wohnung waren es fünfzehn Minuten. In dieser Nacht brauchte Jonathan nur zwölf. Er sehnte sich jetzt nach einem kühlen Glas Wein oder einem kalten Bier. Den ganzen Abend hatte er nur am lauwarmen Sekt genippt, und davon war ihm ganz übel.
»Möchtest du auch noch einen Schluck trinken?«, fragte er Jana, als er in die Küche ging, aber sie antwortete nicht, sondern war schon auf dem Weg nach oben.
Jonathan machte sich eine Flasche Bier auf und wartete. Jana trank nur ganz selten etwas, wenn sie am nächsten Tag Probe oder Vorstellung hatte, und er kannte ihren Spielplan nicht. Aber auch wenn sie nur Wasser trank und dazu ein paar Karotten aus der Salatschüssel fischte – nach Premieren oder Abenden wie diesem saßen sie immer eine halbe Stunde zusammen, ließen alles Geschehene noch einmal Revue passieren und erzählten sich gegenseitig, was bemerkenswert gewesen war.
Nach zehn Minuten hatte er das Bier schon fast ausgetrunken. Jana kam nicht. Dass sie einfach so ohne ein Wort ins Bett gegangen war, konnte er sich nicht vorstellen. Das tat sie nur nach einem Streit, aber doch nicht heute, nach seiner ersten Vernissage.
Er ging nach oben und rief schon auf der Treppe: »Jana, wo bleibst du denn? Kommst du nicht in die Küche?«
Sie antwortete nicht.
Er öffnete die Tür zum Schlafzimmer – aber das Zimmer war dunkel und das Bett unberührt.
Plötzlich hörte er ein leises Schluchzen und riss die Badezimmertür auf.
Sie saß auf dem geschlossenen Toilettendeckel und weinte.
»Was ist los?« Er stürzte auf sie zu und nahm sie in den Arm. »Was hast du? Was ist passiert? Bist du krank?«
Sie schüttelte den Kopf. Dann riss sie sich mehrere Lagen Toilettenpapier ab und putzte sich die Nase.
»Scheiße, Jon«, schluchzte sie. »Verdammte Scheiße, ich bin schwanger.«
Einen Moment verschlug es ihm die Sprache. Dann murmelte er: »Wie konnte denn das passieren? Wir haben doch immer aufgepasst!«
»Keine Ahnung. Ist ja jetzt auch egal.«
»Komm.« Er zog sie hoch, legte den Arm um sie und führte sie hinunter in die Küche. Jana setzte sich.
»Was möchtest du trinken?«
»Wasser mit ein bisschen Zitrone.«
Jonathan nahm die Wasserflasche aus dem Kühlschrank. Während er die Zitrone ins Wasser spritzte, sagte Jana: »Das ist eine Katastrophe, Jon. Wenn ich das Kind kriege, kann ich die Giselle hier in Berlin und meinen Gastvertrag in Wien in den Wind schreiben. Vielleicht meine letzte große Chance. Ich bin ja keine zwanzig mehr.«
»Ich weiß.«
»Jetzt läuft es gerade rund. So wie ich es mir immer erträumt hatte. Plötzlich gehen alle Türen auf, und ich hätte noch fünf bis sieben Jahre als Primaballerina. Aber nicht, wenn ich jetzt unterbreche, dick und fett und unbeweglich werde. Dann bin ich raus.«
»Ich weiß.« Jonathan war plötzlich sehr müde.
»Nein, ich glaube nicht, dass du weißt, wie ich mich fühle.«
Jonathan schwieg. Er hatte keine Lust, sich zu rechtfertigen, ihr zu erklären, dass er sehr wohl wusste, wie sie sich fühlte, welche Ängste um ihre Karriere sie ausstand und wie durcheinander sie war. Er wollte nicht mit ihr streiten, und es kam ihm zu banal vor, ihr zu erklären, dass er sich kein größeres Glück vorstellen konnte als ein Kind. Er war wütend, dass sie ihm die Freude nicht ließ, dass sie zweifelte und ihm Angst machte.
Aber er wusste, dass er in dieser Situation nichts sagen konnte und nichts sagen durfte. Er musste ihr Zeit lassen. Morgen würde er mit ihr reden. Wenn sie den ersten Schock überwunden hatte.
»Du sagst ja gar nichts mehr«, bemerkte sie nach einer Weile und fuhr nachdenklich mit dem Zeigefinger um den Rand einer Tasse, die noch vom Frühstück auf dem Tisch stand, als wolle sie sie zum Klingen bringen.
»Ich bin genauso überrascht wie du«, flüsterte er, »aber das ist eine wundervolle Nachricht. Eine schönere gibt es nicht.«
Jana starrte ihn an, und ihre dunklen Augen wirkten fast schwarz. Dann sprang sie auf.
»Ich wusste es«, schrie sie, »du begreifst nichts! Gar nichts!«
Sie rannte aus der Küche und warf die Tür hinter sich zu.
Jonathan legte den Kopf auf seinen Arm und fürchtete sich davor, ins Bett zu gehen.
Zwei Tage später tanzte sie wieder die »Giselle«, und Jonathan saß in der Dienstloge und sah ihr zu. Sie war eine Schönheit. Gertenschlank und so beweglich, dass es ihm immer wieder den Atem nahm. Er spürte bis in die Loge, dass der Tanz ihr Leben war, und als sie die unglücklich Liebende tänzerisch ausdrückte, wusste er, dass sie noch nie so deutlich gefühlt hatte, was sie auf der Bühne darstellte.
»Du warst wunderbar«, sagte er nach der Vorstellung zu ihr. »So gut wie heute hast du noch nie getanzt.«
Sie gingen nicht mehr in die Kantine, Jana wollte sofort nach Hause.
»Wir müssen reden, Jon«, sagte sie im Auto, »ich habe jetzt zwei Tage und zwei Nächte vor mich hin gebrütet, aber ich komme allein nicht weiter. Ich weiß einfach nicht, was ich will oder was ich nicht will, ich weiß auch nicht, was richtig oder falsch ist, ich weiß gar nichts mehr. Und wenn ich denke, einen Weg gefunden zu haben, schmeiße ich eine halbe Stunde später alles wieder über den Haufen. Du kennst mich. Ich kann mich ja noch nicht mal bei alltäglichen, unwichtigen Dingen entscheiden, bei so einer schwierigen existenziellen Frage bin ich völlig aufgeschmissen. Hilf mir, Jon. Sonst werde ich verrückt.«
Jonathan fuhr langsamer als gewöhnlich. »Es gibt im Grunde nur zwei Möglichkeiten«, meinte er vorsichtig, »du bekommst es, oder du lässt es wegmachen. Dazwischen gibt es nichts. Ein Kompromiss ist unmöglich.«
»Großartig«, spottete sie, »du wirst es nicht glauben, aber so weit war ich auch schon.«
Jonathan fürchtete, sie noch mehr zu verärgern, und sagte nichts mehr, bis sie in die Garage ihres Hauses fuhren.
Im Wohnzimmer machte er ihr ein warmes Fußbad.
Sie saß mit geschlossenen Augen im Sessel und genoss diesen Moment der totalen Entspannung.
»Rede mit mir«, meinte sie schleppend, »sag mir alles, was dir durch den Kopf geht. Auch wenn du dich wiederholst. Egal. Mein Kopf ist so leer, dass ich das Gefühl habe, überhaupt nicht mehr denken zu können.«
Jonathan konnte sich nicht erinnern, schon jemals in einer so komplizierten Situation gewesen zu sein.
»Jana«, begann er leise, »du weißt, dass ich ein hoffnungsloser Fatalist bin. Und so sehe ich auch das, was hier gerade mit uns passiert. Wir haben das Kind nicht gewollt«, er stockte, weil er die Formulierung äußerst unglücklich fand, aber Jana schien sich daran nicht zu stören. Also sprach er weiter: »Ich meine, wir haben es nicht darauf angelegt, eins zu bekommen, weil wir noch warten wollten.«
»Darüber haben wir nie gesprochen.«
»Nein. Weil es irgendwie klar war. Auch ohne dass wir es so deutlich aussprechen mussten. Weil deine als auch meine Karriere gerade dabei ist, loszugaloppieren.«
Jana seufzte.
»Aber es ist nun mal passiert. Und darum denke ich, es soll so sein. Wir sollen dieses Kind bekommen, wir sollen mit ihm leben! Keine Ahnung warum, aber das können wir uns vielleicht in fünf oder zehn, vielleicht auch erst in zwanzig oder dreißig Jahren beantworten. Dann wissen wir, warum es gut und richtig war, jetzt dieses Kind zu bekommen. Wahrscheinlich soll es uns verändern, unser Leben in eine andere Richtung lenken.«
»Ich will in keine andere Richtung gelenkt werden, Jon! Ich will tanzen! Die paar Jahre, die ich noch habe. Kinder kann ich auch mit fünfunddreißig noch bekommen.«
»Es passt nie, Jana. Es ist immer der falsche Zeitpunkt.«
»Für dich nicht. Dich tangiert es überhaupt nicht. Aber mich. Ich bin raus. Ich habe mich all die Jahre umsonst abgestrampelt und bis zum Umfallen trainiert. Ich habe geprobt und getanzt wie eine Verrückte und hinter der Bühne gekotzt, weil ich einfach nicht mehr konnte. Und niemals eine Tafel Schokolade, kein Gänsebraten zu Weihnachten, keine Bratwurst auf dem Markt und keine Tagliatelle beim Italiener. Immer nur Nein sagen, verzichten und tanzen. Um neun Uhr früh Probe im Ballettsaal, und wehe, wenn du am Abend vorher ein Glas Wein getrunken hast!«
»Ich weiß, Jana, ich weiß …«
»Und dann hast du es geschafft. In Berlin! Ich bin die Primaballerina an der Deutschen Oper und zu dämlich zum Verhüten, verdammte Scheiße! Ich bin so bekloppt, mir alles selbst zu vermasseln, jetzt, wo ich auf dem absoluten Höhepunkt bin und alles erreicht habe, was ich niemals zu träumen gewagt habe!«
Jana schossen die Tränen in die Augen, aber sie weinte nicht, sondern wischte sich mit dem Ärmel über die Nase und schniefte nur.
»Alles, was du sagst, ist richtig«, flüsterte Jonathan, »deine Situation kenne ich wahrscheinlich besser als jeder andere auf der Welt, und bitte: Glaube mir, dass ich mir gut vorstellen kann, wie du dich fühlst. Aber trotzdem …«
»Was trotzdem?«
»Trotzdem bitte ich dich, Jana, bekomm dieses Kind! Es ist doch schon da! Wir können nicht einfach so tun, als wäre da nichts! Bitte, bitte, bitte! Ich werde mich drum kümmern, damit du hinterher vielleicht doch wieder einsteigen kannst. Es müsste eigentlich das Normalste von der Welt sein, dass auch eine Primaballerina schwanger wird! Ich werde alles tun, um dir den Rücken freizuhalten, das verspreche ich dir! Bitte, Jana!«
Er ging zu ihr, kniete sich vor sie und vergrub seinen Kopf in ihrem Schoß.
Jana strich ihm sanft übers Haar. Dann drückte sie seinen Kopf zur Seite, trocknete ihre Füße ab und ging zur Tür.
»Ich bin müde«, sagte sie.
Grand jeté. Als sie absprang, spürte sie schon, dass sie weniger Kraft hatte als üblich und sicher nicht so hoch kommen würde wie gewöhnlich. Hinterher fand sie es unfassbar und faszinierend zugleich, wie viele Gedanken ihr im Bruchteil einer Sekunde durch den Kopf geschossen waren. In der Luft riss sie die Beine zum Spagat auseinander und wusste doch, dass die Zeit nicht reichen würde, um zu landen wie gewohnt, so, wie sie es schon hundert-, wenn nicht tausendmal geprobt und perfekt geschafft hatte.