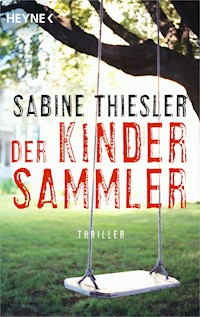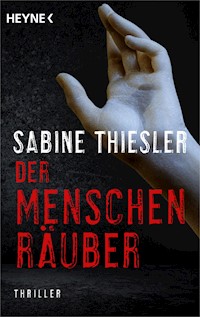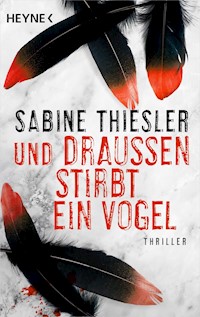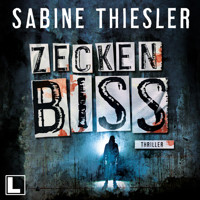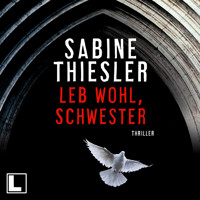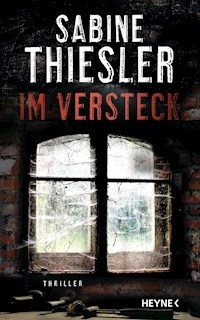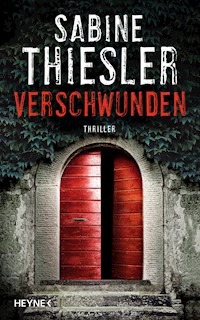2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Das Todesurteil heißt: Ich liebe dich
Eine Mordserie versetzt Berlin in Angst und Schrecken. Ein perfider Mörder, der sich selbst als »Prinzessin« bezeichnet, sucht sich seine Opfer auf den nächtlichen Straßen und erdrosselt sie beim Liebesspiel.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 700
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
NACHTPRINZESSIN
Titel
SABINE THIESLER
NACHTPRINZESSIN
Roman
Impressum
Copyright © 2011 by Sabine Thieslerund Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbHSatz: C. Schaber Datentechnik, WelsISBN: 978-3-641-06383-2www.heyne.de
Widmung
Ich umarme dich, mein Sohn
Motto
So möchte ich sterben, selig vor Lust.
Petronius, Satyricon
Prolog
PROLOG
Die Nacht war sternenklar. Als er das Achterdeck betrat, ertappte er sich dabei, dass seine Hand automatisch in die Brusttasche seines Jacketts fuhr, wo normalerweise seine Sonnenbrille steckte, und er musste über sich selbst lächeln.
Noch vierundzwanzig Stunden, dann war Vollmond, und an Deck war es beinah taghell.
Weit und breit kein einziger Passagier und auch niemand von der Besatzung. Er warf einen kurzen Blick auf die Uhr. Fünf Minuten vor halb drei. Wunderbar. Das war die Zeit, die er liebte, seine ganz eigene blaue Stunde, Erholung nach der Last des Tages. Und wenn es irgendwie ging, dachte er nicht daran, diese köstlich stille Stunde zu verschlafen.
Einen Moment stand er an der Reling und sah auf das vom fahlen Mondlicht beleuchtete, nachtschwarze Meer. Der Ozean zeigte eine schwere Dünung, und die Schaumkronen der Wellen, die vom Licht des Schiffes angestrahlt wurden, leuchteten weiß und beinah grell.
Er konnte sich nicht sattsehen daran.
Die Schiffsmotoren arbeiteten ruhig und gleichmäßig, das Kreuzfahrtschiff stampfte durchs Wasser, ein beruhigendes Geräusch, das fast so etwas wie Geborgenheit signalisierte.
Aus den Deckskisten an der Seite, unmittelbar neben den Rettungsbooten, nahm er eine blaue Schaumstoffauflage und legte sie auf einen Liegestuhl, den er nah an die Reling rückte. Hier wehte ein frischer Wind, den er im Schutz der Brücke nicht gespürt hatte, aber er störte ihn nicht. Im Gegenteil. In seinem Alltag in der Stadt kam Wind so gut wie gar nicht vor.
Er legte sich auf den Liegestuhl und sah in den Himmel. Noch nie war ihm so bewusst geworden, wie unendlich viele Sterne es gab, allein in seinem kleinen beschränkten Blickfeld auf diesem Punkt der Erde.
Einen Stern musste er finden, seinen eigenen. Einen, der nur für ihn leuchtete, der ihn begleitete, egal, wo er sich aufhielt. Den er immer wiedererkannte, wenn er die Zeit und Muße finden sollte, in Deutschland in den Himmel zu schauen.
Er war nicht religiös, aber in dieser Nacht war er dankbar für sein wunderbares, erfülltes Leben, für den Frieden, den er gerade jetzt, in diesem Moment empfand.
Natürlich war er einsam, aber das war gut so. Ein Genie musste einsam sein. Warum nur konnte nicht jeder seiner Gedanken der Nachwelt überliefert und erhalten werden? Sein Leben und seine Leidenschaft waren einzigartig. Ein treffenderes Wort gab es dafür nicht.
Er atmete tief durch und streckte sich wohlig aus. Ein warmer Schauer absoluter Zufriedenheit durchzog ihn. Vielleicht würde er jede Nacht an Deck verbringen.
Eine Melodie klang in seinem Kopf, und er überlegte, um welches Lied es sich handelte, als er die schwere Eisentür zum Promenadendeck klappen hörte.
Unwillkürlich zuckte er zusammen und wurde augenblicklich wütend über die Störung.
Es war der gut aussehende Mann, der Arzt, der zum Frühstück nur Obst aß und seine schwangere Frau umsorgte, als wäre sie sterbenskrank.
Und jetzt kam er mitten in der Nacht an Deck. Allein. Ohne seine Frau.
Er nickte ihm kurz zu und stellte sich an die Reling.
Hoffentlich spricht er mich nicht an, dachte er. Das ist das Letzte, was ich will und was ich jetzt gebrauchen kann. Außerdem zerstörte er das Bild. Die kostbare Einsamkeit an Bord.
Es regte ihn auf, dass der Mann es wagte, dort zu stehen. Es war ein ästhetisches Problem.
Der Arzt hielt sich merkwürdig unsicher an der Reling fest, schwankte leicht, und dann erbrach er sich ins Meer.
Das ist ja ekelhaft.
Mehr dachte er nicht.
Er stand aus seinem Liegestuhl auf, ging zu dem jungen Arzt, dem immer noch übel war, und ohne ein Wort zu ihm zu sagen, packte er ihn an den Beinen, hob ihn hoch und warf ihn wie ein Paket über die Reling ins Meer.
Nach ein oder zwei Sekunden hörte er, wie der Körper auf dem Wasser aufschlug.
Es interessierte ihn nicht. Er sah ihm noch nicht einmal hinterher, sondern drehte sich mit einem eleganten Hüftschwung um und legte sich zurück auf seinen Liegestuhl.
Allmählich kehrte wieder Frieden ein. Er schloss die Augen und genoss diese wundervolle Nacht.
Erster Teil
ERSTER TEIL
JUGENDSÜNDEN
1
1
Berlin, Juni 2009
Es gab viele Dinge, die Matthias auf den Tod nicht ausstehen konnte, und eines davon war frühes Aufstehen. Dazu war er einfach nicht geboren. Basta. Ende der Diskussion.
Schon als kleiner Junge hatte er liebend gern geschlafen und war auch am Sonntagmorgen nicht aus dem Bett zu kriegen. Zum Entzücken seiner Mutter, die ebenfalls gern ausschlief, erschien er statt zum Frühstück immer erst zum Mittagessen. Die Schule hasste er vor allem, weil sie um acht Uhr anfing und er dreizehn Jahre lang um halb sieben aufstehen musste. Vielleicht wäre er gern zur Schule gegangen, wenn sie mittags begonnen hätte, vielleicht wäre er dann ein besserer Schüler gewesen und hätte nicht die meiste Unterrichtszeit verträumt und verdöst, vielleicht hätte er sogar Freunde gehabt und eine fröhlichere Kindheit. Tausendmal vielleicht. Aber so war eben alles anders gekommen.
Mit Pauken und Trompeten fiel er durchs Abitur, denn Klausuren und mündliche Prüfungen begannen nun mal um acht Uhr morgens, und um diese Zeit war Matthias einfach noch nicht wach. Auch nicht, wenn es darauf ankam.
Nur um dem ewigen Gezeter seiner Mutter ein Ende zu machen und seine Ruhe zu haben, versuchte er es noch einmal, allerdings wieder ohne Erfolg. Dann hatte er es endgültig satt und ging von der Schule ab.
Er war eben ein Nachtmensch. Anders als alle anderen. Und darauf war er sogar stolz.
Im Urlaub ließ er die Jalousien herunter, verschlief den Tag und ging erst bei Dunkelheit auf die Straße. So ein Leben war für ihn perfekt. Erholung pur.
An diesem Vormittag erwachte er für seine Verhältnisse relativ früh, es war erst kurz nach elf, und er fühlte sich alles andere als ausgeruht. Aber er wusste, dass es jetzt keinen Zweck hatte, noch zwei Stunden zu schlafen, denn er hatte bereits um fünfzehn Uhr einen wichtigen Termin mit einem gewissen Dr. Hersfeld, Manager eines Elektrokonzerns, der für sich, seine Frau, Sohn und Tochter ein neues Domizil in Berlin suchte. Geld spielte bei der Suche die geringste Rolle, problematisch war allerdings, dass sich die Familie nicht einig war, ob sie lieber eine Villa mit Garten oder eine repräsentative Stadtwohnung mit Dachterrasse bevorzugte. Matthias machte sich auf ein langwieriges Hin und Her gefasst, und das war auch etwas, was er hasste: Leute, die sich nicht entscheiden konnten.
Mit der Fernbedienung am Bett fuhr er das Rückenteil seiner Matratze hoch, um erst einmal zu sich zu kommen. Fast jeden Morgen hatte er im Liegen leichte Kopfschmerzen, die aber verschwanden, wenn er zehn Minuten aufrecht saß. Mit einer zweiten Fernbedienung öffnete er nun die doppelseitig genähten, schweren Seidenvorhänge. Er mochte das Geräusch, wenn sie über den Parkettfußboden schwungvoll zur Seite rauschten, aber als Tageslicht das Zimmer durchflutete, schloss er leicht angewidert die Augen.
In Gedanken ging er alles durch, was an diesem Tag zu erledigen war. Er musste zur Bank, seine Mutter beim Friseur absetzen, kurz im Büro nach dem Rechten sehen und dann zum Termin mit Hersfeld. Zwei exklusive Objekte hatte er anzubieten, das konnte drei oder mehr Stunden in Anspruch nehmen. Je nachdem ob die Kunden zügig die Wohnung durchschritten, in jeden Raum nur einen flüchtigen Blick warfen und sich ein rein gefühlsmäßiges Urteil bildeten, oder ob sie sich in jedem Zimmer eine halbe Stunde aufhielten, alles misstrauisch begutachteten, befühlten und selbst zur Fliege an der Wand noch fünfundzwanzig Fragen hatten.
Matthias streckte sich, spreizte die Finger und ballte sie anschließend zur Faust. Das tat er zehnmal, dann zog er die Beine an und drehte sich aus dem Bett. Die Kopfschmerzen waren fast weg, der letzte Rest würde unter der Dusche verschwinden.
Auf dem Läufer vor dem Bett machte er zehn Kniebeugen, drehte anschließend erst den Kopf, dann die Schulter, dann den Oberkörper, beugte sich mit gestreckten Beinen, so tief es ging, zu Boden, schwang die Hüften zehnmal nach links und zehnmal nach rechts und tänzelte ins Bad.
Dort schaltete er die Musikanlage an und beschallte mit Verdi die gesamte Wohnung. Seine Mutter, die unter ihm wohnte, störte es nicht, sie war leicht taub und ohnehin seit sechs wach. Preußisch stand sie seit einigen Jahren jeden Morgen pünktlich um sieben auf.
Seine Prozedur im Badezimmer dauerte fünfundvierzig Minuten. Duschen, abtrocknen, sorgfältig eincremen, Haare föhnen und leicht gelen, aber nur so, dass es nicht fettig wirkte, was bei blonden Haaren leicht passieren konnte. Zum Abschluss trug er noch ein transparentes Make-up auf, das bisher noch nie jemandem aufgefallen war, aber einen frischen, ebenmäßigen Teint erzeugte, und zog vorsichtig mit einem Kajalstift die Augenbrauen nach, die ihm immer zu blond und unmännlich erschienen waren.
Frische Unterwäsche, ein gebügeltes Hemd, saubere Socken, Hose und Jackett oder sportliches Blouson legte er sich immer schon abends bereit, ganz egal, wie spät es war, denn nachts konnte er besser denken und die schwierige Kleiderfrage eher lösen. Im Haus bewegte er sich in seidenen Pantoffeln, die er sich aus Marokko mitgebracht hatte, seine Schuhe warteten unten im Flur, wo sie von seiner Mutter jeden Tag geputzt und auf Hochglanz poliert wurden. So wie sie auch seine Oberhemden mit Hingabe und absolut faltenfrei bügelte.
In seiner hypermodernen und matt glänzenden Luxusküche, die in der Mitte einen Granitblock als Arbeits- und Kochbereich hatte, was im Moment der letzte Schrei war, hatte er noch nie etwas gekocht. Noch nicht einmal ein Spiegelei gebraten. Er wusste gar nicht, wie er das anstellen sollte. Küchen bedeuteten ihm nichts, und dennoch hatte er diese für ein Vermögen einbauen lassen. Da sie nicht benutzt wurde, war sie immer tadellos sauber, und das erfüllte ihn mit tiefer Befriedigung.
Morgens, oder besser gesagt mittags, schaltete er jedoch die Espressomaschine ein, die so überdimensioniert war, dass sie jedem Café und jedem italienischen Restaurant zur Zierde gereicht hätte, und kochte sich zwei Espressi, die er zusammen mit zwei Gläsern Pineo Luna Llena trank. Er bestellte dieses spezielle, teure Mineralwasser alle Vierteljahre direkt aus Spanien. Es kam aus den katalanischen Pyrenäen, stammte aus unterirdischen Wasservorkommen inmitten von Kalk- und Granitgestein und wurde nachts und nur bei Vollmond abgefüllt. Matthias war davon überzeugt, dass es einen positiven Einfluss auf sein physisches und psychisches Wohlbefinden ausübte, und wurde richtig nervös, wenn ihm sein morgendliches Wasser fehlte.
Irgendetwas Essbares konnte er um diese für ihn eigentlich noch nachtschlafende Zeit nicht zu sich nehmen.
Die Natur war in den letzten zwei Wochen regelrecht explodiert. Wo man hinsah, blühte es, die Rasenflächen waren saftig grün und mussten zweimal in der Woche gemäht werden. Diese lästigen Gartenarbeiten erledigte ein pensionierter Gärtner, der mittwochs drei und samstags sechs Stunden arbeitete.
Aber Matthias hatte für den herrlichen Frühsommertag keinen Blick, als er aus dem Haus trat. Wetter interessierte ihn überhaupt nicht. Er fand es ausgesprochen ärgerlich, dass man es nicht ändern konnte, daher hatte er beschlossen, es zu ignorieren.
Gerade drehte er sich um und wollte seiner Mutter – wie jeden Tag – zum Abschied zuwinken, als er sah, dass ihr Platz am Küchenfenster, wo sie mittags Kreuzworträtsel löste und ihre heiße Brühe schlürfte, leer war.
Das war in den letzten zehn Jahren noch nie vorgekommen, und Matthias erschrak so, dass er unwillkürlich einen Schritt zurücktrat und beinah über die Begrenzung des Blumenbeetes gestolpert wäre.
Er rannte zurück zum Haus, nahm die fünf Stufen vor ihrer separaten Eingangstür in einem Schritt und klingelte. Wartete. Klingelte wieder. Sie öffnete nicht.
Mühsam und mit zitternden Fingern suchte er ihren Wohnungsschlüssel an seinem Schlüsselbund und schloss die Tür auf.
Sie lag im Wohnzimmer auf dem Teppich.
Er fiel vor ihr auf die Knie.
»Mama«, hauchte er und küsste sie auf den Mund. »Mama, was ist passiert?«
Da er sich einbildete, einen ganz schwachen Atemhauch zu spüren, drückte er sein Ohr an ihre Brust.
Leise und wie in weiter Ferne klopfte ihr Herz.
Er stürzte zum Telefon, wählte eins-eins-zwei und schrie, sobald er eine Stimme hörte, in den Apparat.
»Kommen Sie schnell, meine Mutter stirbt, sie ist ohnmächtig, Hirschhornweg achtundzwanzig, mein Name ist Steinfeld, von Steinfeld!«
»Hatte sie einen Unfall?«, fragte die gleichgültige, unaufgeregte, tiefe Stimme am anderen Ende der Leitung.
»Das weiß ich doch nicht!«, kiekste Matthias. »Ich bin kein Arzt und kein Hellseher und will jetzt auch nicht mit Ihnen diskutieren, kommen Sie, und zwar schnell!«
»Wagen ist unterwegs«, sagte der Beamte gelassen, und Matthias legte auf.
Bis der Rettungswagen eintraf, ging Matthias im Wohnzimmer auf und ab und konnte kaum der Versuchung widerstehen, an den Fingernägeln zu knabbern. Er schlug sich selber mit der Hand auf die Finger, denn angenagte Nägel machten bei zahlungskräftigen Kunden der oberen Zehntausend keinen guten Eindruck.
Schließlich kam er auf die Idee, die Lippen seiner Mutter mit Wasser zu benetzen.
Immer wieder sah er auf die Uhr. »Was machen diese Idioten?«, brüllte er und raufte sich die frisch gegelten Haare. »Wo bleiben die? Warum kommen die nicht? Sind die zu blöde, die Adresse zu finden?«
Er rannte vor die Tür, aber noch war kein Rettungswagen in Sicht.
Fuchsteufelswild kam er ins Wohnzimmer zurück. »Da muss so eine arme Frau krepieren, nur weil der Rettungsdienst in diesem tollen, hochgelobten Land eine halbe Stunde braucht, um zu Hilfe zu kommen. Das darf ja wohl nicht wahr sein! Ich werde diese Ignoranten anzeigen! Zur Rechenschaft ziehen. Die werden sich noch umgucken!«
In diesem Moment klingelte es. Matthias stürzte zur Tür, nahm Haltung an, fuhr sich noch einmal korrigierend durch die Haare und öffnete.
»Haben Sie angerufen?«, fragte der Notarzt, und Matthias nickte. »Wo ist Ihre Mutter?«
»Im Wohnzimmer. Kommen Sie.« Matthias lief voran, der Arzt und zwei Sanitäter folgten, und Matthias stolperte vor Aufregung über ein Paar Stiefel, deren Spitzen hinter dem Schuhschrank im Flur hervorstanden.
Dann ging alles sehr schnell. Der Arzt schien sofort zu wissen, was mit Frau von Steinfeld los war, er legte eine Infusion, und dann wurde sie in Windeseile auf eine Trage gelegt, zum Notarztwagen gefahren und hineingeschoben.
»Ich nehme an, ein Schlaganfall. Fahren Sie bei uns mit?«
Matthias nickte.
Als er im Wagen neben seiner Mutter saß, ihre faltige, schmale Hand in seiner hielt und sie unaufhörlich streichelte, flüsterte er ihr tröstende Worte zu, ohne zu wissen, was er sagte, und fühlte sich so hilflos wie noch nie in seinem Leben.
2
2
Erst auf dem Krankenhausflur wurde ihm bewusst, dass seine Mutter sterben könnte. An diese Möglichkeit hatte er all die Jahre nicht, wirklich noch nie gedacht. Und das gab es auch nicht, das war einfach unmöglich.
Mama. Sie war immer da, immer zur Verfügung. Eine Welt ohne sie war für ihn undenkbar.
Jeden Wunsch, den Matthias so ganz nebenbei mal irgendwann erwähnte, merkte sie sich, ohne jemals davon zu sprechen, und erfüllte ihn irgendwann. Vielleicht zwei Jahre später, wenn Matthias schon lange nicht mehr daran dachte.
Sie war einfach wunderbar. Eine perfekte Dame. Zärtlich, schön und elegant. Aber sie konnte auch Bilder aufhängen, Lampen anschließen, Gardinen nähen, Rumtopf ansetzen und Schwarzwälder Kirschtorte backen. Sie dübelte Regale an die Wände, baute ganz allein und fröhlich pfeifend Schrankwände auf und verlegte Teppichböden und Parkett. Sie konnte einfach alles.
Auf jede Frage wusste sie einen Rat, immer hatte sie Zeit, nichts ließ sie bis morgen warten, sondern erledigte alles sofort.
Und so wurde sie zu Matthias’ Königin, seiner Heiligen, und gab seinem Leben einen Sinn.
Aber jetzt lag die Unsterbliche mit einem Schlaganfall auf der Intensivstation, und die Ärzte versuchten zu retten, was noch zu retten war.
Er weigerte sich zu begreifen, dass auch seine Mutter nur einen Körper hatte, der vergänglich war und genauso schnell verwesen würde wie jeder andere. Er hatte sie oft und gern umarmt, obwohl sie in den letzten Jahren immer weniger geworden war, aber er war sich bewusst, dass er niemals in der Lage sein würde, sie zu füttern, zu waschen oder ihr gar eine Windel anzulegen.
Niemals. Unsummen würde er demjenigen zahlen, der das für ihn übernahm. Er würde nicht erlauben, dass diese profanen Dinge seinen Glauben an ihre Einzigartig- und Unvergänglichkeit zerstörten.
Wie ein Tiger im Käfig ging er auf dem Krankenhausflur auf und ab und war dankbar, dass er nicht sehen konnte, was sie hinter den Milchglasscheiben mit ihr taten, schon ein Schlauch in der Nase war für ihn unerträglich, und eine gelegte Infusion auf ihrem Handrücken jagte ihm allein bei der Vorstellung einen wilden Schmerz durch den Körper, der ihn zusammenkrümmte.
Mama.
Mach die Tür auf, komm heraus, lächle und sage: »Es ist alles gut, komm, mein Junge, mach dir keine Sorgen, wir gehen nach Hause.«
Wenn dieses Wunder irgendein Mensch vollbringen konnte, dann sie.
So wartete er vier Stunden, aber sie kam nicht.
Der Termin mit Dr. Hersfeld war vorbei, aber es war ihm nicht bewusst, er hatte ihn vergessen. Nicht eine Sekunde hatte er an seinen Kunden gedacht, der vielleicht eine Drei-Millionen-Villa bei ihm kaufen würde. Er hatte noch nicht einmal mit seinem Büro telefoniert und um eine Verschiebung des Termins gebeten. Er hatte gar nichts getan.
Die Welt hatte aufgehört, sich zu drehen, die Zeit verging, und er merkte es nicht.
Mama, bitte, verlass mich nicht.
Um kurz vor neunzehn Uhr kam der Arzt und reichte ihm die Hand. Matthias dachte an die Millionen und Milliarden von Bakterien, die vielleicht jetzt gerade auf ihn übergegangen waren, aber dann schob er den Gedanken beiseite und konzentrierte sich auf das Gesicht des Arztes, das freundlich und ernst zugleich aussah.
»Der Zustand Ihrer Mutter ist jetzt stabil«, meinte er. »Sie hatte einen schweren Schlaganfall und lag wahrscheinlich schon mehrere Stunden auf dem Boden, bevor Sie sie fanden. Diese lange Zeit ist das Problem. Darum sind die Schäden, die wahrscheinlich bleibende sind, so schwerwiegend. Ich kann Ihnen jetzt noch nichts Hundertprozentiges sagen, aber ich denke, Ihre Mutter wird sich aufgrund ihrer Lähmungen nicht mehr allein fortbewegen können. Das wird sicher durch Übung noch geringfügig zu verbessern, aber wohl nicht mehr vollständig reparabel sein.«
»Das heißt, sie wird im Rollstuhl sitzen müssen?«
Der Arzt nickte.
»Und sie wird sich schwer artikulieren können. Es kann sein, dass sie vieles versteht, aber Sie werden sich höchstwahrscheinlich nie wieder mit ihr unterhalten können. Das ist schwer, ich weiß. Ihre Mutter ist von nun an ein Pflegefall, aber sie lebt, und sie wird bald wieder bei Ihnen sein und nach Hause zurückkehren. Ich hoffe, das tröstet Sie ein wenig.«
Matthias war wie vor den Kopf geschlagen. Wie ein Schwachsinniger stand er vor dem Arzt und starrte ihn an.
Es gelang ihm noch nicht einmal, sich innerlich zu empören und dagegen zu rebellieren.
»Herr von Steinfeld?«
Matthias sah zu Boden und reagierte nicht.
Der Arzt fasste ihn am Arm. »Sie müssen jetzt stark sein! Für sich und Ihre Mutter! Lassen Sie sie in den kommenden Tagen Ihre Verzweiflung nicht spüren. Hoffnung ist das, was Ihre Mutter am meisten braucht.«
Matthias nickte schwach und murmelte leise: »Ja. – Danke, Doktor.«
Der Arzt sah ihn nachdenklich an, und eine Spur von Mitleid zog über sein Gesicht.
»Sie können mich jederzeit anrufen, wenn Sie noch Fragen haben. Aber lassen Sie erst einmal zwei Wochen ins Land gehen, so lange bleibt Ihre Mutter ja mindestens noch hier, und dann sehen wir weiter. Vielleicht gibt es dann schon eine viel genauere und eventuell auch positivere Prognose.«
Als Matthias den Kopf hob, sah der Arzt, dass Tränen in seinen Augen schwammen.
»Gehen Sie nach Hause, lenken Sie sich ab, reden Sie mit Freunden oder ruhen Sie sich aus. Ihre Mutter schläft jetzt. Heute Abend können Sie nichts mehr für sie tun.«
Er drückte noch einmal Matthias’ Arm und entfernte sich. Sein offener Kittel wehte wie ein Königsmantel, als er eilig den Flur entlangschritt.
Matthias blieb stehen und starrte minutenlang auf die Milchglasscheibe der Tür zur Intensivstation, als überlegte er, ob er einfach hineinstürmen oder die Tür zerschlagen solle.
Aber dann drehte er sich still um und verließ das Krankenhaus. Wohl wissend, dass er in dieser Nacht weder nach Hause gehen noch eine Minute schlafen würde.
Ihr Zusammenbruch hatte alles verändert. Nichts würde mehr so sein wie früher.
3
3
Er dachte an sie, als wäre sie schon tot. Seine Gedanken rasten, dabei waren es nur wenige Sätze, die sich wie ein immer schneller werdendes Karussell in seinem Kopf drehten. Was soll ich bloß machen ohne sie? Um Himmels willen, was soll ich bloß tun?
Ihm wurde klar, dass er ohne sie vollkommen hilflos war. Würde er es schaffen, in dem Haus wohnen zu bleiben, in dem er sein gesamtes Leben verbracht hatte und in dem alles, aber auch wirklich alles an sie erinnerte? Vielleicht sollte er lieber verkaufen und sich statt der Villa eine Penthouse-Wohnung anschaffen, mit einem weiten Blick über die Stadt und mit Restaurants, Bars und Geschäften direkt vor der Tür. Dort müsste er nicht immer ins Auto steigen, um zum Theater oder ins Konzert zu fahren, und umgeben von den Lichtern der Stadt würde er sich weniger einsam fühlen.
Ihm wurde angst und bange, wenn er daran dachte, dass er sich jetzt mit der Pflegeversicherung (hatte sie so etwas überhaupt?) und Pflegekräften herumärgern musste, die sich um seine Mutter kümmern und im Haus ein und aus gehen würden. Eine scheußliche Vorstellung.
Ludmilla, die russische Putzfrau, die einmal in der Woche für acht Stunden kam, das gesamte Haus putzte und ununterbrochen vor sich hin summte, ging ihm schon genug auf die Nerven.
Wenn seine Mutter starb, trat die größte Katastrophe ein, die er sich vorstellen konnte, aber wenn sie ein Pflegefall wurde, war es keinen Deut besser. Es gab nicht den geringsten Lichtschein am Horizont, er war in einer Sackgasse gelandet.
Seine Mutter hatte ihm stets viel leidigen Schriftkram abgenommen, und dies zu delegieren war ihm auch im Beruf meisterhaft gelungen. Er war ein überaus erfolgreicher Makler, konnte Klienten wie kein anderer Häuser aufschwatzen, die sie eigentlich gar nicht wollten, und wenn er sich richtig ins Zeug legte, schaffte er es, auch eine durchschnittliche Immobilie in ein Objekt der Begierde zu verwandeln.
Viola, seine Sekretärin, erledigte anschließend, nachdem der Kaufvertrag per Handschlag zustande gekommen war, alles Schriftliche, sein Kollege Gernot ging mit den Klienten zum Notar und erklärte mit unendlicher Ruhe alles, was einem Nichtjuristen am Kaufvertrag unverständlich und suspekt erschien.
Matthias’ größtes Kapital waren seine attraktive Erscheinung, seine geschliffenen Umgangsformen, sein rhetorisches Talent und sein umwerfender Charme.
Und jetzt sollte er niemanden mehr haben, der seine Hemden bügelte und ihn beim Kauf von eleganten Kombinationen beriet? Undenkbar.
Vor dem Krankenhaus gab es kein einziges Taxi, worüber er sich schon wieder aufregte. Aber noch mehr ärgerte er sich darüber, dass er dem Krankenwagen nicht mit dem eigenen Auto hinterhergefahren war. Und nun stand er hier wie bestellt und nicht abgeholt auf der Straße.
Es war heute einfach nicht sein Tag. Im Krankenhaus hatte er sein Handy ausgeschaltet, jetzt sah er, dass er mehrere Nachrichten hatte.
»Was ist los mit dir?«, meldete sich Viola mit dünner Stimme. »Wo bleibst du? Dr. Hersfeld wartet und ist überhaupt nicht amused. Bitte ruf mich unbedingt zurück!«
Beim letzten Anruf war sie sehr nervös. »Wir machen uns riesige Sorgen. Ist dir was passiert? Bitte melde dich!«
Einen Moment überlegte er, ob er Gernot und Viola anrufen sollte, aber dann entschied er sich dagegen. Es war nicht verkehrt und fast ein angenehmes Gefühl, wenn sie sich mal vierundzwanzig Stunden Sorgen um ihn machten. Hauptsache, sie hetzten ihm nicht die Polizei auf den Hals. Aber das würden sie wohl nicht wagen, schließlich war er ein erwachsener Mann und konnte ja wohl mal einen Tag unentschuldigt dem Büro fernbleiben. Jede Panikmache wäre lächerlich.
Er ging bis zur nächsten Hauptstraße und wartete keine fünf Minuten, bis ein Taxi vorbeifuhr, das er heranwinkte und in das er einstieg.
»Fahren Sie mich zum Rautmann’s«, sagte er dem Taxifahrer. Ihm war bewusst geworden, dass er heute bis auf Kaffee und Wasser noch nichts zu sich genommen hatte.
Er fühlte sich nicht in der Lage, Alexander anzurufen, um ihm zu erzählen, dass seine Oma zwar noch nicht tot, aber doch schon in irgendeiner Weise gestorben war.
4
4
Es war kurz nach dreiundzwanzig Uhr, als er das Rautmann’s verließ. Über die viel zu kleine, lieblos angerichtete, nicht besonders gut schmeckende und überteuerte Spargelportion hatte er sich maßlos geärgert. Schließlich war er Stammgast, kam bestimmt dreimal in der Woche zum Essen und ließ nicht wenig Geld in dem Laden. Daher hatte er es weiß Gott nicht verdient, so abgefrühstückt und über den Tisch gezogen zu werden.
Carlo, dem Kellner, hatte er dennoch elf Euro Trinkgeld gegeben. »Sie können ja nichts dafür, dass irgendjemand hier seinen Job nicht anständig macht«, hatte er gönnerhaft gesagt und den Schein über den Tisch geschoben. »Es soll Ihr Schaden nicht sein.«
Er wollte Carlo nicht verärgern und ihn sich gewogen halten, denn Carlo besorgte ihm auch noch nachts um zwei ein Päckchen Zigaretten und eine Flasche Champagner. Eines Nachts hatte Carlo Matthias sogar in dessen Porsche nach Hause gefahren, weil er zu viel getrunken hatte. Das hatte er ihm hoch angerechnet, zumal er am nächsten Tag problemlos in den Wagen steigen und zum ersten Termin fahren konnte, ohne den Porsche erst mithilfe eines Taxis holen zu müssen.
Carlo war eine hilfsbereite Seele, und er schien Matthias zu bewundern. Das war nicht das Schlechteste und pinselte seine Seele, und so war Carlo jedes Scheinchen wert, das Matthias springen ließ.
Matthias spürte, dass er kribblig war, nervös, unruhig. Und das lag nicht nur an seiner Mutter. Er konnte jetzt noch nicht nach Hause, außerdem fing die Nacht gerade erst an.
Etwas unschlüssig überlegte er, wohin er noch gehen konnte. Die laue Nachtluft elektrisierte ihn und machte ihn atemlos. Er sah auf die Uhr. Um diese Zeit waren die meisten Theater aus, das war günstig. Und wenn er sich beeilte, erreichte er die Staatsoper Unter den Linden noch bevor Fidelio zu Ende war.
Allmählich beruhigte er sich. Es war nicht wichtig, dass er das Ende der Oper erwischte, in warmen Sommernächten gab es viele Möglichkeiten. Auf Plätzen, Einkaufsstraßen oder in Bars, die ihre Tische und Stühle auf der Straße stehen hatten. Nicht einen Moment zweifelte er daran, dass er finden würde, was er suchte.
Sein Gang war flott und lässig zugleich. Er genoss das Klappern seiner nagelneuen Schuhe aus Krokoleder auf dem Asphalt. Für ihn war es ein vornehmes Geräusch, und bei dem Gedanken daran musste er lächeln.
Als er die Oper erreichte, war der Vorplatz voller Menschen, Taxis starteten im Sekundentakt. Mit Händen in den Hosentaschen mischte er sich unauffällig unter die Wartenden und unter die, die in Grüppchen herumstanden, diskutierten, sich verabschiedeten oder sich noch einmal die Fotos im Schaukasten der Oper ansahen.
Matthias hatte einen geschulten Blick, die Suche gehörte zu seinem Alltag, und daher sah er sehr schnell, dass niemand dabei war, mit dem er Kontakt aufnehmen konnte. Er überlegte kurz, ob er zum Bühneneingang gehen und warten sollte, bis der Opernchor abgeschminkt war und herauskam, aber dann ließ er es bleiben. Er wollte nicht wie jemand dastehen, der fest verabredet war, um dann am Ende vielleicht noch gefragt zu werden, auf wen er warte.
So schlenderte er langsam weiter in Richtung Gendarmenmarkt.
Um diese Zeit war noch erstaunlich viel Betrieb in der Stadt. Vor ihm ging ein älteres Paar, die Frau mit winzigen weißen Löckchen und ungefähr anderthalb Köpfe kleiner als ihr Mann, der seinen breiten Arm um ihre Schultern gelegt hatte. So als bugsierte er sie vorsichtig durch die Stadt. Die Frau erinnerte ihn an seine Mutter, deren Haare auch von Jahr zu Jahr weißer geworden waren, obwohl sie sie hin und wieder blond tönte. Von hinten sah seine Mutter mit ihrer zarten Figur immer noch aus wie ein junges Mädchen. »Von hinten Lyzeum, von vorne Museum«, hatte sie immer wieder gesagt und dabei gelacht, und obwohl ihm der Satz schon zum Hals heraushing, hatte er es nie gewagt, sie zu bitten, damit aufzuhören.
Egal, was sie tat, er liebte sie.
Keine Ahnung, warum ihm das gerade jetzt einfiel, aber er erinnerte sich plötzlich an eine Situation, als er in die zweite Klasse ging. Es war eine katholische, von Patres geführte Schule. Jeden Morgen stand Pater Dominikus an der Pforte zum Schulhof, begrüßte die Kinder und wechselte auch hin und wieder ein paar Sätze mit Eltern, die ihre Kinder zur Schule brachten.
Pater Dominikus hatte Matthias’ Mutter angerufen und sich darüber beschwert, dass ihr Sohn morgens an der Pforte gar nicht oder nicht höflich genug grüße.
»Matthias«, begann seine Mutter am Nachmittag mit einem scharfen Unterton in der Stimme, »warum sagst du Pater Dominikus nicht Guten Tag?«
»Ich sag ihm Guten Tag!«
»Aber anscheinend nicht anständig.«
»Doch.«
»Er hat sich aber über dich beschwert.«
Matthias schwieg verstockt.
»Offensichtlich ist dir nicht klar, wie man anständig grüßt. Und darum werden wir das jetzt üben!« Henriette setzte sich in den Sessel am Fenster. »Du kommst bitte herein, gehst auf mich zu, sagst laut und deutlich ›Guten Morgen, Pater Dominikus‹ und gehst wieder. Ich will das mal sehen.«
Matthias schämte sich entsetzlich.
»Das mach ich nicht!«
»Sehr wohl machst du das, mein Sohn, und zwar so lange, bis du es kannst.«
Mein Sohn sagte sie nur, wenn sie wütend war und keinen Widerspruch duldete.
Matthias nahm all seinen Mut zusammen, marschierte durchs Zimmer, stieß wütend ›Guten Morgen, Pater Dominikus‹ heraus und verließ das Zimmer.
»Komm mal bitte her!«, rief Henriette laut und entsetzlich hoch.
Matthias kam herein, baute sich vor ihr auf und musste sich zusammenreißen, um nicht zu weinen, so erniedrigend fand er die Situation.
»Das war gar nichts! Kein Wunder, dass sich Pater Dominikus beschwert hat. Also noch mal von vorne: Du kommst herein, bleibst vor mir stehen, sagst: ›Guten Morgen, Pater Dominikus.‹ Und zwar freundlich! Du brauchst den Pater nicht anzublöken, er hat dir nichts getan. Während du ihn grüßt, nimmst du die Hände auf dem Rücken zusammen und machst einen Diener. Ist das klar?«
Matthias reagierte nicht, er wünschte sich ganz weit weg, am liebsten auf den Mond.
»Also dann probieren wir das jetzt noch mal.«
Sie sagte wir, dabei saß sie im Sessel und ließ ihn tanzen wie eine Puppe.
Er stürmte ins Zimmer, schrie: »Guten Morgen, Pater Dominikus!«, machte eine wüste Verbeugung und wollte aus dem Zimmer rennen, als sie ihn bremste.
»Noch einmal, bitte.«
Matthias rannte zurück und wiederholte das Ganze. Kein bisschen anders, kein bisschen besser. Henriette brüllte jedes Mal: »Noch einmal, und streng dich endlich an, verdammt noch mal!«
Es war ein Spießrutenlaufen. Immer und immer wieder von vorn. Henriette schrie und Matthias lief, brüllte, verbeugte sich, flüchtete.
»Wir können das auch hundertmal so weitermachen – bis heute Abend!«, sagte Henriette schließlich. »Ich habe Zeit.«
Sie sah unerbittlich aus und saß in ihrem Sessel, als könnte sie nicht nur bis heute Abend, sondern noch hundert Jahre dort sitzen bleiben. Matthias wusste, dass er auf jeden Fall verlieren und dieser Hölle nur entkommen würde, wenn er sich wirklich anstrengte und die Schmach hinunterschluckte.
Beim fünfundzwanzigsten Mal kam er zum ersten Mal langsam in den Raum, blieb vor Henriette stehen, sagte leise, schluchzend und unter Tränen »Guten Morgen, Pater Dominikus«, während er die Hände auf dem Rücken zur Faust ballte und sich artig, beinahe zu tief, verbeugte. Dann drehte er sich langsam auf den Zehenspitzen weg und verließ das Zimmer.
»Sehr schön«, sagte seine Mutter. »Sehr, sehr schön. Ich erspare es dir, dies jetzt noch hundertmal zu wiederholen, aber du weißt ja, worum es geht. Und ich wünsche, dass du Pater Dominikus jetzt jeden Morgen in dieser Form begrüßt! Hast du das verstanden?«
Matthias nickte und hoffte, dass die Tränen, die in seinen Augen schwammen, nicht die Wangen herunterlaufen würden. Er wollte nicht, dass seine Mutter sah, wie sehr sie ihn gedemütigt und dass sie ihn letztlich kleingekriegt hatte.
»Geh auf dein Zimmer«, meinte sie abschließend und erhob sich aus dem pompösen Ohrensessel, »vielleicht wird ja doch noch mal etwas aus dir.«
In diesem Moment hatte er sie gehasst und geglaubt, in ihrer Nähe nie wieder befreit atmen zu können, sondern ersticken zu müssen.
Aber jetzt, fast fünfunddreißig Jahre später, war er ihr fast dankbar für die Lektion, die sie ihm erteilt hatte. Aus ihm war ein höflicher Mensch geworden, der sich zu benehmen wusste, sich auf dem gesellschaftlichen Parkett sicher bewegte und sich in Adelskreisen zu Hause fühlte, denen er eigentlich nur noch dem Namen nach angehörte.
Obwohl er seine Mutter verstand und die Episode seiner Liebe keinen Abbruch getan hatte, saß diese Schmach doch immer noch als nie verheilende Wunde wie ein spitzer Pfeil in seiner Seele.
Ganz in Gedanken hatte er das ältere Paar aus den Augen verloren.
Sekunden später sah er dem Deutschen Dom gegenüber einen jungen Mann aus der Brasserie kommen. Er war nicht besonders groß, leicht dicklich, hatte etwas zu langes, brünettes Haar, und Matthias schätzte ihn auf Anfang zwanzig. Vielleicht war er auch erst neunzehn.
Es war dieses unglaubliche Phänomen des instinktiven Erkennens, das kein Außenstehender nachvollziehen konnte und niemals begreifen würde. Matthias wusste sofort, dass er der Richtige war und ging auf ihn zu.
Der andere lehnte lässig neben dem Hauseingang und rauchte eine Zigarette. Erst jetzt sah Matthias den angewinkelten Arm und die nach hinten abgeknickte »gebrochene« Hand, die die Zigarette hielt, als wollte er sich auf die Schulter aschen. Das war eindeutig. Vielleicht hatte er dieses Zeichen gewählt, weil er seinerseits auch Matthias längst entdeckt hatte.
Einige Meter vor ihm blieb Matthias stehen und sah ihn an. Ihre Blicke trafen sich. Zu lange für einen unabsichtlichen, flüchtigen Moment und zu kurz für eine wirkliche Kontaktaufnahme. Matthias wusste nicht genau, wer als Erster weggesehen hatte, aber das war jetzt nicht wichtig. Er ging scheinbar achtlos und uninteressiert an ihm vorbei, streckte dabei jedoch das Kreuz und hob den Kopf ein wenig an, als wollte er Teller auf seinem Scheitel balancieren.
Und er hatte sich nicht getäuscht. Der junge Kerl folgte ihm.
Matthias ging schneller, und auch der andere beschleunigte seinen Schritt.
Dann blieb Matthias stehen und tat, als suchte er etwas in seinem Jackett – der junge Mann überholte ihn zwangsläufig. Und nun wiederholte sich das Spiel, jetzt folgte ihm Matthias.
Es war wie ein dreiminütiger Balztanz.
Auf einmal standen sie sich wie auf Kommando gegenüber und sahen sich tief in die Augen. Aber gönnten sich kein Lächeln.
»Hier?«, sagte der andere knapp. »Ich kenne ein paar stille Ecken auf einigen Hinterhöfen.«
Matthias schüttelte den Kopf.
»Dann im Tiergarten.«
Matthias schüttelte wieder den Kopf.
»Wie heißt du?«
»Jochen. Und du?«
»Gerd«, log Matthias. »Hör zu, ich will Zeit haben. Können wir zu dir?«
Jochen nickte und setzte sich in Bewegung.
Während des zehnminütigen Weges durch die Stadt beobachtete Matthias Jochens Gang und seine Bewegungen. Er hielt sich leicht hinter ihm, so als gehörten sie nicht zusammen. Die Jeans, die Jochen trug, war für Matthias’ Geschmack viel zu weit, aber das war jetzt egal. Matthias gab sich ganz seinen Fantasien hin, stellte sich vor, wie es sein würde, wenn der wesentlich Jüngere nackt vor ihm stand, und überlegte, ob dieser Junge, der noch einen ziemlich unbedarften Eindruck machte, auch all das tun würde, was Matthias von ihm verlangen wollte.
Bis zu Jochens Wohnung sprachen sie kein Wort.
5
5
Jochen wohnte in einem sanierten Altbau im Hinterhof, zwei Treppen links. Er klickte die Tür, die noch nicht einmal ein Sicherheitsschloss hatte, mit einem riesigen Schlüssel auf, was auch mit einem simplen Schraubenzieher oder einem Grillspieß möglich gewesen wäre. Eine Campingseele, dachte Matthias. Wahrscheinlich besitzt er so gut wie nichts, ist arm wie eine Kirchenmaus und hat darum auch nicht die Sorge, dass jemand bei ihm einbrechen könnte.
Der Flur war wahrhaftig so karg, wie Matthias es erwartet hatte. Anstelle einer Garderobe ein paar flüchtig und ungleichmäßig in den Putz gehauene Nägel, ein Schuhschrank, der vermutlich für allen möglichen Krempel, bloß nicht für Schuhe benutzt wurde, und ein Fahrrad. Schon ziemlich in die Jahre gekommen und flüchtig mit weißer Lackfarbe angestrichen.
Nicht einmal einen Spiegel gab es im Flur.
»Ich wohne hier noch nicht lange«, sagte Jochen mit leiser Stimme, »drei Wochen vielleicht.«
Alle drei Türen der winzigen Wohnung standen offen. Matthias warf einen Blick in die enge, schmale Küche. Schmutziges Geschirr stapelte sich in der Spüle, auf dem Herd eine benutzte Pfanne und darin zwei kleinere Töpfe. Matthias fand es ekelhaft.
Über dem Kühlschrank tickte eine alte Bahnhofsuhr. Mit großer Wahrscheinlichkeit Jochens einziger und ganzer Stolz.
Matthias hatte genug gesehen und folgte Jochen ins Wohn- und Schlafzimmer. Der Raum hatte den Charme einer Ausnüchterungszelle. Keine Bilder an den Wänden, nirgends ein bisschen Farbe oder eine Pflanze. Ein grauer Teppichboden ohne den kleinsten Fleck, ein schlichtes, eisernes Bettgestell mit einer schwarzen, breiten Matratze und ein überdimensionaler Tisch mit drei Computern und einem Laptop. Außerdem wüste Papier- und Bücherberge.
»Was machst du so?«, fragte Matthias.
»Ich studiere Informatik.«
Also ein Kopfmensch. Diese Sorte schätzte Matthias gar nicht. Sie hatte Probleme, sich gehen zu lassen und für eine Weile Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auszuknipsen. Aber er musste jetzt seine Neugier unterdrücken, denn wenn er noch mehr über seine Zufallsbekanntschaft erfuhr, verging ihm die Lust. Vielleicht war es schon zu viel gewesen, ihn nach seinem Namen zu fragen. Warum er das heute getan hatte, war ihm nicht klar. Er war einfach nicht ganz bei der Sache, aber das war ja an einem Tag wie diesem auch kein Wunder.
Jochen holte zwei Bierflaschen aus der Küche und öffnete sie mit seinem Feuerzeug. Beide tranken schweigend.
Entscheidend war, wer jetzt den Anfang machte, denn derjenige signalisierte, dass er bereit war, sich dem anderen zu unterwerfen und die Spielregeln zu akzeptieren. Matthias wartete.
Jochen ging zum Fenster und schloss die anthrazitfarbenen Vorhänge. Dann setzte er sich aufs Bett.
Bei jedem Schluck Bier taxierte Jochen seinen fremden Gast, als versuchte er herauszufinden, wer er war. Der Mann war älter, und er hatte Geld. So viel war klar. Und er hatte einen spöttischen Zug um den Mund, den Jochen interessant fand.
Es war alles in Ordnung, und Jochen begann sich auszuziehen.
6
6
Loni Maier fummelte kopfschüttelnd die Post aus dem engen Schlitz und verletzte sich dabei den Mittelfinger, sodass er blutete. Seit Tagen war der Briefkasten nicht mehr geleert worden, und sie hatte keinen Schlüssel. Das meiste war Reklame, dieser junge Student hatte noch nicht einmal einen Bitte-keine-Werbung-einwerfen-Aufkleber. Sie nahm sich vor, unbedingt mit ihm zu sprechen.
Seit dreißig Jahren kümmerte sich Loni darum, was in diesem Hause geschah, und schrieb es sich als Verdienst auf ihre eigenen Fahnen, dass bisher noch nie eingebrochen worden war. Wenn Mieter in Urlaub waren, goss sie die Blumen, fütterte die Katze und leerte eben auch den Briefkasten. Sie führte Hunde spazieren, wenn Herrchen oder Frauchen zehn Stunden zur Arbeit waren, und wartete auf den Kundendienst zum Reparieren der Waschmaschine.
Loni tat alles Notwendige aus reiner Lust und Liebe. Freute sich natürlich, wenn sie dafür hin und wieder eine Schachtel Pralinen bekam oder auf eine Tasse Kaffee eingeladen wurde. Dann fühlte sie sich geliebt, gebraucht und ungeheuer wichtig. Diese Bestätigung konnte ihr ihr Mann Heinz schon lange nicht mehr geben, der den ganzen Tag vor dem Fernseher saß und kaum drei Worte mit ihr wechselte. Loni war sich darüber im Klaren, dass sie erst dann wieder in sein Bewusstsein vordringen würde, wenn sein Mittagessen nicht auf dem Tisch stand, weil sie krank oder tot war.
Sie sah auf die Uhr. Es war jetzt halb elf, eine zivile Zeit, um einen verpennten Studenten aus dem Bett zu werfen, also stieg sie die Treppe hinauf bis zum zweiten Stock, wo Jochen Umlauf wohnte.
Loni klingelte. Zuerst zaghaft, dann stürmischer und anhaltender. Niemand öffnete. Sie legte das Ohr an die Tür, hörte aber nicht das leiseste Geräusch.
Sie wollte sich gerade abwenden und zurück in ihre Wohnung gehen, als ihr ein säuerlich beißender Geruch in die Nase stieg. Zwar nicht stark, aber unangenehm und ekelhaft.
Was war das denn? Hortete der Student etwa Müll in seiner Wohnung? Merkwürdig. Das konnte sie sich eigentlich nicht vorstellen, denn Jochen Umlauf war ihr in der kurzen Zeit, seit sie ihn kannte, als sehr ordentlich und zuverlässig vorgekommen. Ein bisschen kontaktscheu vielleicht, aber das war in den heutigen Zeiten ja eher von Vorteil. Und wenn sie auf etwas stolz war, dann auf ihre Menschenkenntnis. Sie hatte sich in ihrer Einschätzung von einem Menschen nur selten getäuscht.
Loni drückte erneut auf die Klingel. – Nichts.
Sie beschloss, vorerst keine Pferde scheu zu machen, noch nichts zu unternehmen und das Ganze erst mal zu beobachten. Wahrscheinlich war der junge Mann einfach nur ein paar Tage verreist und hatte vergessen, ihr den Schlüssel zu geben, so wie sie es ihm grundsätzlich angeboten hatte. Falls es mal einen Rohrbruch geben sollte und die Feuerwehr die Tür öffnen musste.
Sie ging hinunter ins Parterre in ihre Wohnung, um Eimer und Schrubber zu holen. Das Treppenhaus musste dringend gewischt werden. Es bezahlte sie zwar niemand dafür, aber wenn sie es nicht tat, machte es keiner.
Auch in den folgenden drei Tagen zog Loni mit spitzen Fingern die Post aus Jochens Briefkasten und klingelte an seiner Tür. In der Wohnung rührte sich nichts. Kein Laut. Aber der unangenehme Geruch wurde stärker.
»Ich weiß nicht, Heinz«, sagte sie am Nachmittag zu ihrem Mann und versuchte die Seifenoper mit ihrer Stimme zu übertönen, denn Heinz dachte nicht daran, den Fernseher leiser zu stellen, »aber was diesen neuen Mieter betrifft, weißt du, diesen Studenten aus dem zweiten Stock …«
»Weiß ich nicht und kenn ich nicht. Interessiert mich auch nicht.«
»Heinz, da stimmt was nicht. Er ist wie vom Erdboden verschluckt, und in der Wohnung stinkt’s wie damals bei uns, als wir die beiden toten Mäuse im Schrank unter der Spüle hatten. Erinnerst du dich?«
»Ungern.«
»Aber du erinnerst dich.«
»Ja.«
»Siehst du. Und genauso stinkt’s bei dem durch die Tür. Was soll ich denn machen?«
»Ruf die Polizei und lass mich in Ruhe. Ich hab durch dein Gerede jetzt schon völlig den Faden verloren …«
Bei jedem Problem, das auftauchte, sagte Heinz: »Ruf die Polizei.« Etwas anderes fiel ihm nicht ein. Ob sich vor dem Haus Kinder prügelten, die Müllabfuhr zu viel Krach machte, sich die Müllers aus dem ersten Stock stritten oder irgendjemand laut Musik hörte – immer sagte er: »Hol doch die Polizei.«
Loni hatte es nie getan, sondern sich immer selbst eingemischt, bis das Problem vom Tisch war, aber diesmal waren ihr die Hände gebunden. Schließlich konnte sie nicht die Tür aufbrechen.
Ein bisschen unwohl war ihr schon dabei, aber nachdem sie noch eine Nacht darüber geschlafen hatte, wählte sie am Sonntagmorgen nach dem Frühstück, als sich Heinz ins Wohnzimmer zurückgezogen hatte und den Fernseher einschaltete, die Eins-Eins-Null.
Innerhalb von zehn Minuten war der Streifenwagen da.
7
7
Erst nach dem fünften Läuten begriff Susanne Knauer, dass das Telefon klingelte. Der Apparat stand neben ihrem Bett auf dem Boden, und noch im Liegen riss sie den Hörer von der Gabel. Dabei fiel ihr Blick auf den Radiowecker. Zwanzig nach zehn. Eigentlich eine zivile Zeit, aber es war Sonntag, der einzige Tag in der Woche, an dem sie wirklich ausschlafen konnte, und es kam ihr vor, als wäre es gerade mitten in der Nacht.
»Ja?«, stöhnte sie.
»Ich bin’s, Ben. Tut mir leid, dass ich dich wecke, aber es gibt Arbeit. Mord in Mitte. Ich hol dich ab. In zehn Minuten unten vor der Tür?«
»Nein«, knurrte sie. »Lass mich in Ruhe!«
»Okay. Dann bis gleich.« Er legte auf.
Susanne jaulte wie ein verwundeter Hund, sprang auf und rannte ins Bad.
Neun Minuten später kritzelte sie ihrer Tochter eine kurze Nachricht auf einen Zettel: Sorry, musste los wegen Mord, im Kühlschrank ist noch Suppe, hoffentlich bis bald. S., ließ ihn auf dem Küchentisch liegen und stürzte los. Sie hatte sich schon seit Jahren abgewöhnt, mit »Mama« zu unterschreiben, denn sie konnte sich nicht erinnern, wann ihre Tochter sie das letzte Mal so angesprochen hatte. Meistens war sie »Ej« oder »Hallo« oder »Du da«, nur wenn Melanie ausgesprochen gut gelaunt war, und das kam äußerst selten vor, wurde sie von ihr »Suse« genannt. Susanne bildete sich ein, dass es liebevoll klang, und darum war sie immer glücklich, wenn Melanie die Kurzform ihres Namens in den Mund nahm.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!