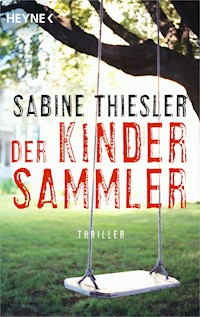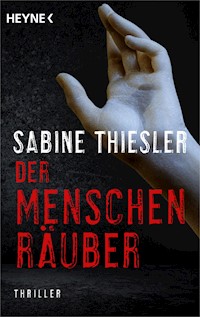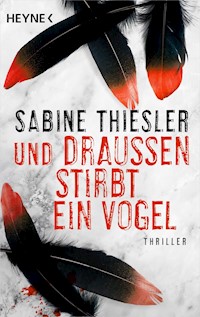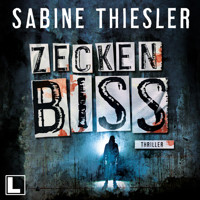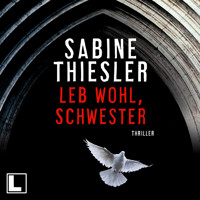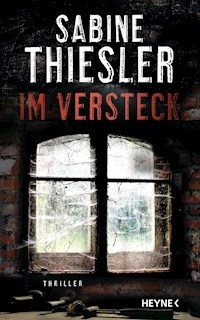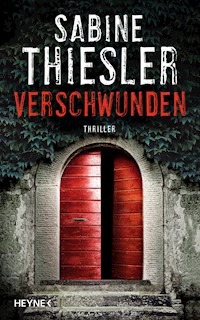SONDERANGEBOT
SONDERANGEBOT
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
»Mein Liebster, schlaf gut. Schlaf für immer.«
Wenn einer den anderen betrügt, ist das Leben zu Ende. Das hat sie schon als Kind gelernt. Und deshalb steht ihr Entschluss fest: Sie kann ohne ihn nicht leben, aber sie kann vor allem mit ihm nicht mehr leben. Es ist ein warmer Sommermorgen in der Toskana. Heute soll er sterben. Sie hat alles vorbereitet, er wird nichts spüren. Jedenfalls nicht in den ersten Minuten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 537
Veröffentlichungsjahr: 2010
3,8 (98 Bewertungen)
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
DAS BUCH
Magda und Johannes haben sich mit ihrem Haus in der Toskana einen Traum erfüllt. Sie verbringen dort jedes Jahr mehrere Wochen und sind im Dorf bei den Einheimischen bereits gut integriert. – Doch in diesem Sommer ist alles anders: Magda fährt allein voraus und wartet auf ihren Mann, der ein paar Tage später aus Berlin nachkommen will. Sie weiß, dass er die Zeit bei Carolina, seiner Geliebten, verbringt. Magda ist nicht mehr bereit, dies länger zu ertragen. Johannes hat ihre Liebe zerstört, und jetzt ist die Zeit ihrer Rache gekommen. Sie geht ihren mörderischen Plan immer wieder in allen Einzelheiten durch und empfindet dabei unglaubliche Ruhe und tiefe Zufriedenheit.
An einem warmen Sommermorgen tötet sie ihren Mann, vergräbt ihn und meldet ihn als vermisst. Als ihr Schwager Lukas zu Besuch kommt, eskaliert die Situation. Er liebt Magda und erkennt erst viel zu spät, in welch tödlicher Gefahr er sich befindet …
DIE AUTORIN
Sabine Thiesler, geboren und aufgewachsen in Berlin, studierte Germanistik und Theaterwissenschaften. Sie arbeitete einige Jahre als Schauspielerin im Fernsehen und auf der Bühne und schrieb außerdem erfolgreich Theaterstücke und zahlreiche Drehbücher fürs Fernsehen (u. a. Das Haus am Watt, Der Mörder und sein Kind, Stich ins Herz und mehrere Folgen für die Reihen Tatort und Polizeiruf 110). Bereits mit ihrem ersten Roman Der Kindersammler stand sie monatelang auf der Bestsellerliste. Ebenso mit den beiden folgenden Büchern Hexenkind und Die Totengräberin.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2009 by Sabine ThieslerCopyright © 2009 by Wilhelm Heyne Verlag, Münchenin der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: Eisele Grafik Design
ISBN 978-3-641-05135-8V007
www.heyne.dewww.penguinrandomhouse.de
LIEFERBARE TITEL
Der Kindersammler – Hexenkind
Für Nani und Egon.
BACI
Voll Furcht ist allezeit die Frau, sie scheut den Kampf und bebt, wenn sie ein Schwert erblickt; doch wenn man sie gekränkt in ihrer Liebe Recht, ist in der Gier nach Blut kein Herz dem ihren gleich.
EURIPIDES, »MEDEA«
ERSTER TEIL
1
Sie hatte die ganze Nacht geweint. Um zehn nach drei sah sie das letzte Mal auf die Uhr, und unmittelbar danach schlief sie vollkommen erschöpft ein. Gegen halb sechs war sie wieder wach. Ihr Kopf dröhnte, und sie spürte, dass ihre Augen zugeschwollen waren. Sie rollte sich von der Bauchlage auf den Rücken und versuchte, sich zu entspannen. Aber ihre Ängste verschlimmerten sich. Sie hatte keinen Strohhalm mehr, an dem sie sich festhalten konnte.
Johannes hatte von alldem nichts mitbekommen. Sein Atem ging gleichmäßig, er schlief tief und fest. Sie überlegte, wie es sein würde, wenn er nicht mehr da wäre, wenn sie seinen Atem nie wieder hören würde, und bei diesem Gedanken verspürte sie Panik. Sie konnte ohne ihn nicht leben, aber sie konnte auch mit ihm nicht mehr leben.
Um halb sieben ging die Sonne auf und warf einen rötlich goldenen Lichtstreifen auf den antiken Brotschrank dem Bett gegenüber, in dem Magda ihre Bettwäsche aufbewahrte. Johannes schnaufte leise und drehte sich auf die Seite. Gestern Abend waren ihr seine Bartstoppeln gar nicht aufgefallen, er hatte sich seit mindestens drei Tagen nicht rasiert. Sie hasste das. Wenn sie ihm über die Wange strich, sollte seine Haut weich sein. Ohne jede Unebenheit, ohne jeden Makel.
Magda stand leise auf, zog sich ihren Bademantel über und ihre Hausschuhe an. Obwohl es Juli war, war es durch die vierzig bis achtzig Zentimeter dicken Mauern morgens im Haus regelrecht kühl. Vor zehn Jahren hatten sie das ehemalige Landgut La Roccia, das stark renovierungsbedürftig war, gekauft. Es hatte einen hufeisenförmigen Grundriss, war für Magdas Geschmack viel zu groß und noch dazu in einem erbärmlichen Zustand. Das Dach drohte einzustürzen, von den Innenwänden fiel der Putz, und der Fußboden hing beängstigend durch. Das Grundstück war verwildert und mit Brombeeren, Heckenrosen, Weißdorn und Erika zugewuchert.
Zum Verzweifeln, fand Magda. Aber Johannes war von dem Panoramablick fasziniert. Nach Norden sah man von Montevarchi bis hin zum Prato Magno, dem Gebirge, das das Arno-Tal vom Casentino trennt. Nach Westen blickte man auf ein kleines Bergdorf, nach Osten auf einen kahlen Hügel mit einem einzelnen Haus, und nach Süden auf den dichten Wald und den Weg, der nach Solata führte. Johannes hatte sich sofort in diesen Platz verliebt und war in jeder freien Minute nach Italien gefahren, hatte Handwerker und Freunde mobilisiert, sich selbst mit unermüdlicher Energie in die Arbeit gestürzt und das Landgut allmählich im Lauf der Jahre in ein Schmuckstück verwandelt.
Er hatte fünf Zimmer, zwei Bäder und die Küche ausgebaut, aber im westlichen Seitentrakt die teilweise eingestürzte Mauer im alten Zustand gelassen und die eingebrochenen Stellen durch Glas ersetzt. Eine ungewöhnliche Konstruktion, die dem Haus einen eigenwilligen Charakter gab und jede Menge Licht in Johannes’ Arbeitszimmer brachte. Der Innenhof war mit alten Straßensteinen gepflastert, und eine metallene Lampe pendelte über dem schweren Holztisch. Magda hatte zahlreiche unterschiedlich große Terrakottatöpfe aufgestellt, in denen Hortensien, Hängegeranien, Rosmarin, Basilikum und Salbei regelrecht wucherten. Der Innenhof war archaisch und gemütlich zugleich, und sie liebte es, die Sommernächte hier zu verbringen, windgeschützt durch die Mauern des Hauses, die noch Stunden die Wärme des Tages abstrahlten.
Allerdings hatte sie immer das ungute Gefühl, nie wirklich unbeobachtet zu sein. Denn vom Weg aus, der nach Solata führte, konnte man an einigen Stellen den Innenhof gut einsehen. Das war der Punkt, der sie an dem Haus störte.
Magda verließ leise das Schlafzimmer und ging in das gegenüberliegende Bad. Ihre vom Weinen dick verschwollenen Augen sahen fürchterlich aus, die Wimpern waren hinter den dicken Lidern fast völlig verschwunden.
Sie beschloss, dies zu ignorieren, und putzte sich die Zähne. Als sie unter der Dusche stand und das warme Wasser auf ihrem Körper spürte, kreiste wie schon seit Wochen nur der eine Gedanke in ihrem Kopf: Er hat alles kaputt gemacht.
Sie zog sich eine leichte Sommerhose und ein T-Shirt an und ging in die Küche. In einer Viertelstunde würde sich der Radiowecker im Schlafzimmer einschalten. Johannes stand dann meist sofort auf. Er wollte nichts vom Tag verlieren. Jeden Morgen hatte er den Kopf voller Pläne, was er in Haus und Garten reparieren oder verändern konnte, und verzweifelte fast daran, dass sein Urlaub nie reichte, um all das zu erledigen, was er sich vorgenommen hatte.
Genug Zeit, denn es würde noch mindestens eine halbe Stunde dauern, bis er zum Frühstück herunterkam.
Sie öffnete die Terrassentür und trat hinaus. Die Luft war klar und trocken, es würde wieder ein heißer Tag werden. Magda streckte sich und atmete tief durch. Es war vollkommen still, die Schotterstraße nach Solata lag verlassen da. Kein Auto fuhr, keine Stimmen waren zu hören. Noch nicht einmal eine Katze schlich durchs hohe Gras oder rekelte sich auf den durch die frühe Morgensonne schon aufgewärmten Steinen.
Einige Minuten stand sie beinah reglos. Ein leichter Wind wehte durch den Hof, der jetzt noch im Schatten lag. In ihrem dünnen T-Shirt fröstelte sie, aber sie war dennoch ganz ruhig und spürte, dass ihr Herz langsam und gleichmäßig schlug. Keine Spur von Nervosität mehr. Dann war es also richtig. Es gab keinen Zweifel, Überlegungen waren nicht mehr notwendig. Sie hatte sich entschieden.
Sie ging zurück in die Küche und setzte Teewasser auf. Seit Johannes an permanent erhöhtem Blutdruck litt, hatten sie sich beide angewöhnt, morgens keinen Kaffee mehr zu trinken. Es war ihnen außerordentlich schwergefallen. Jetzt stand die Espressomaschine schon seit zwei Jahren unbenutzt auf einer kleinen Kommode unter dem Fenster, und Magda glaubte nicht, dass sie überhaupt noch funktionierte.
Johannes hatte Kaffee immer mit sehr viel heißer Milch getrunken, geschäumt oder nicht geschäumt, das war ihm egal. Er trank Milchkaffee in Berlin, Caffè Latte in Italien und Café au Lait in Frankreich. Seit er das alles nicht mehr durfte, fehlte ihm die Kalziumbombe mehr als der Kaffee. Manchmal kam er nachmittags in die Küche, verschwitzt und kaputt von der Gartenarbeit, nahm die Milchtüte aus dem Kühlschrank und stürzte mindestens einen halben Liter in einem Zug hinunter. Außerdem hatte er sich angewöhnt, zum Frühstück Müsli mit Obst zu essen, das in Milch schwamm.
Magda bemerkte ihr Gesicht, das sich in der gläsernen Tür des Geschirrschrankes spiegelte, und strich sich mit der linken Hand die viel zu langen Ponyfransen aus der Stirn.
Alles, was sie dann tat, war morgendliche Routine und geschah schon fast automatisch. Sie ging hinaus und wischte den schweren Holztisch im Hof mit einem Schwammtuch feucht ab. Dann holte sie zwei leuchtend blaue Sets, Besteck, Teller und Tassen, aus dem Kühlschrank die toskanische Salami, ein Stück Pecorino und eine Gurke. Im Gegensatz zu Johannes startete Magda deftig in den Tag. Wenn sie Müsli oder Obst und Quark aß, wurde ihr spätestens nach einer Stunde übel.
Das Wasser kochte, und sie goss den Tee auf. In diesem Moment schaltete sich der Radiowecker im Schlafzimmer ein. Nur wenn sie ganz still stand, sich nicht bewegte und sehr konzentrierte, konnte sie die Musik sehr leise mehr erahnen als hören. Noch fünf Minuten. Höchstens. Dann würde Johannes aufstehen.
Sie schnitt das Obst in kleine Würfel. Einen Apfel, eine halbe Banane, eine halbe Orange. Darüber drei Esslöffel Müsli. Die Badezimmertür klappte, und wenig später rauschte die Spülung. Wahrscheinlich noch zehn Minuten, bis er kam. Mit der Milch musste sie noch warten, das Müsli sollte nicht aufweichen.
Neben dem Haus war eine kleine Wiese, auf der die unterschiedlichsten Blumen wuchsen, die Magda alle nicht kannte. Undefinierbare Wildblumen, wahrscheinlich Unkraut. Johannes mähte die Wiese nur, wenn es gar nicht mehr anders ging und die Gräser schon von allein umknickten. Er liebte sein »geordnetes Gartenchaos«, wie er es nannte, und holte den Rasenmäher erst aus dem Magazin, wenn er der Meinung war, dass es »asozial« aussah.
Magda pflückte einige Blumen, dazu gelb blühenden Dill, und stellte den Wiesenblumenstrauß in einer kleinen bauchigen Vase, die sie bei einem Trödler in der Nähe von Arezzo für zwei Euro erstanden hatte, auf den Tisch.
Jetzt war es Zeit für die Milch. Gleich würde Johannes da sein.
Das Gift hatte sie in ihrer Hosentasche. Sie wusste, dass die Tropfen vollkommen geschmacksneutral waren. Er würde nichts merken. Jedenfalls nicht in den ersten Minuten.
2
Als die Musik des Radioweckers einsetzte, brauchte Johannes fünf Sekunden, um sich daran zu erinnern, dass er gerade dabei war, in der Toskana aufzuwachen. Die Morgensonne war wärmer als in Deutschland und das Zimmer enger. Die Deckenmattoni und die schmalen dunkelbraunen Holzbalken strahlten von der Decke einen erdigen rötlichen Ton auf das Bettzeug zurück, in der Fensternische hing ein schwarzer Skorpion bewegungslos an der Wand.
Er war zu Hause. War zurückgekommen und wollte alles hinter sich lassen, was geschehen war, einen Neuanfang wagen. Vier Wochen Urlaub lagen vor ihm, in denen er sich vor allem um Magda kümmern und langsam wieder zu ihr zurückfinden wollte. Zweite Flitterwochen. Daran zweifelte er keine Sekunde.
Johannes schlug die leichte Bettdecke zurück, schwang die Beine gestreckt in die Höhe und ließ sie dann langsam absinken. Fünf Zentimeter über der Matratze hielt er die Beine gestreckt, bis seine Bauchdecke zitterte. Zwanzigmal. Es fiel ihm leicht, das regelmäßige Krafttraining im Fitnessstudio hatte sich ausgezahlt, er war gut durchtrainiert und sah jünger aus, als er war.
Carolina hatte sich oft einen Spaß daraus gemacht, auf irgendeinen Muskel seines Körpers zu tippen, den er dann anspannen musste, damit sie sah, wie er auf- und abtauchte oder kontrolliert zuckte. Es faszinierte sie jedes Mal.
Carolina. Er musste aufhören, an sie zu denken. Es war vorbei. Er würde sie nie wiedersehen. Basta.
Johannes stand auf und trat ans offene Fenster. Trotz wolkenlosen Himmels war die Sonne noch milchig hell und diesig. Es würde ein schöner, heißer Tag werden.
Ein weißer Fiat kroch ungewöhnlich langsam die kurvige Straße nach Solata hinauf. Gianni wahrscheinlich. Er war sechsundsiebzig und arbeitete gelegentlich in den Oliven. Wenn er sich kräftiger fühlte und der Magenkrebs Ruhe gab.
Ich werde gleich nach dem Frühstück die Wiese mähen, dachte Johannes. Und die Klärgrube eingraben. Er hatte sie im letzten Herbst anschließen lassen, weil die Kommune neue Richtlinien über die erforderliche Größe von Klärgruben erlassen hatte. Für Johannes war das eine reine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Baustoffhändler und Klempner. Da La Roccia ein großes Anwesen war und rein theoretisch zwölf Personen Platz bieten könnte, hatte man ihn aufgefordert, eine größere Klärgrube anzuschaffen. Johannes war wütend und hatte immer wieder versichert, dass sie La Roccia nur zu zweit bewohnten, aber die Kommune blieb stur. Und schließlich hatte sich Johannes gefügt und eine völlig überdimensionierte Klärgrube kommen lassen.
Johannes wusste, wie sehr Magda es hasste, wenn es irgendwo auf dem Grundstück nach »Baustelle« aussah, und die noch nicht fertig zugeschüttete Klärgrube sah äußerst hässlich aus. Darum würde er sich schnellstens kümmern, dann könnte Magda die Stelle begrünen oder auf die drei Deckel der einzelnen Kammern Terrakottatöpfe mit Geranien oder Hibiskus stellen, Magdas Lieblingspflanzen.
Und dann musste er unbedingt die Rosen neben der Küche hochbinden. Der gewaltige Busch saß voller Blüten und konnte die Last nicht mehr tragen. Eine Arbeit, die Magda nicht gern tat. Sie zerkratzte sich die Arme und fürchtete sich vor Schlangen, die sich häufig in die Rosen zurückzogen.
Alles Menschenmögliche würde er für sie tun, sie auf Händen tragen, ihr jeden Wunsch von den Augen ablesen.
Und Magda würde ihm verzeihen. Davon war er überzeugt.
3
Allmählich wurde Magda nervös und sah bereits zum vierten Mal auf die Uhr. Johannes ließ sich heute Morgen ungewöhnlich viel Zeit mit seiner Morgentoilette. Wahrscheinlich rasierte er sich gründlich. Sie musste lächeln und freute sich auf seine makellos glatten und weichen Wangen, wenn sie ihn zum letzten Mal küssen würde.
Als sie ihren Blick über den Frühstückstisch wandern ließ, um zu überprüfen, ob sie vielleicht doch noch irgendetwas vergessen hatte, durchfuhr es sie plötzlich eiskalt. Sie hatte einen gravierenden Fehler gemacht. Wie jeden Morgen im Sommer, wenn es nicht regnete, hatte sie im Hof gedeckt, aber für ihr Vorhaben war das denkbar ungünstig. Johannes würde dort zusammenbrechen, und sie müsste ihn ins Haus schleifen. Das waren weitere sieben unnötige Meter. Vom Weg hatte man an manchen Stellen Einblick in den Hof. Es kam zwar nur selten vor, dass im Sommer ein Olivenbauer oder im Winter ein Jäger dort entlangfuhr, aber trotzdem. Durch ihre Unüberlegtheit setzte sie sich einem Risiko aus, das leicht zu vermeiden gewesen wäre.
Sie rannte in die Küche, horchte kurz, hörte ihn aber noch nicht die Treppe herunterkommen, nahm ein Tablett, rannte zurück nach draußen, raffte Sets und Bestecke zusammen, stellte Teller, Tassen, Wurst, Käse, Obst, Milch, Butter, Salz und all die anderen Kleinigkeiten, die immer auf ihrem Frühstückstisch standen, zusammen und schleppte das überladene Tablett zurück in die Küche. Die Zeit wurde langsam knapp, denn sie musste das Betäubungsmittel auf alle Fälle in die Milch träufeln, bevor Johannes in der Küche auftauchte.
Auf dem großen Holztisch der Terrassentür gegenüber deckte sie den Tisch erneut und benötigte dazu nur wenige Sekunden.
Dann öffnete sie die Tür zu einer kleinen Diele, von der aus eine Treppe hinauf in den ersten Stock und zum Schlafzimmer führte.
»Johannes«, rief sie, »Frühstück ist fertig! Kommst du?«
»Gleich«, antwortete er. »Fünf Minuten noch.«
Fünf Minuten konnten bei Johannes auch zehn Minuten bedeuten. Was machte er nur so lange? Sie wollte die Anspannung jetzt loswerden, wollte es endlich hinter sich bringen.
Unschlüssig lehnte sie an der Terrassentür und betrachtete ihren Kochbereich, als sähe sie ihn zum ersten Mal. Sie liebte diese Küche, obwohl sie alles andere als praktisch war. Sie mochte sie viel mehr als ihre elegante, moderne und zweckmäßige Küche in Berlin, in der einem die Schubladen nach bloßem Antippen entgegenglitten, die Vorräte in Schiebeschränken auf Augenhöhe untergebracht waren und die Ecken unter der Arbeitsplatte durch ein cleveres System mithilfe von Drehschränken perfekt genutzt werden konnten. Die chromglänzenden Armaturen waren leichtgängig und makellos, und die Halogenstrahler waren so angebracht, dass sie die Küche perfekt, aber nicht zu grell ausleuchteten.
Und hier war die Arbeitsplatte aus schwerem, dunklem Kastanienholz und faulte dort, wo sie die nassen Töpfe abstellte. Alte raue Mattoni an der Wand wurden von Jahr zu Jahr dunkler. Die gemauerte Abzugshaube, eingefasst mit alten, wurmstichigen Balken, gab dem Raum eine heimelige, gemütliche Atmosphäre, über dem Herd hingen schmiedeeiserne Pfannen. Man glaubte, sich in einer wirklich alten, typisch toskanischen Küche zu befinden, und mit einem warmen Licht über dem Tisch und ein paar Kerzen im Fenster fühlte man sich sofort zu Hause.
Magda spürte in diesem Moment, dass sie sich bisher noch nirgends so wohlgefühlt hatte wie in dieser Küche.
Neben dem Herd lag noch das Messer, mit dem sie die Salami abgepellt hatte. Sie öffnete die Spülmaschine, um es in den Besteckkasten zu stecken, und merkte erst in diesem Moment, dass in der Maschine noch sauberes Geschirr war. Sie begann sie auszuräumen, lief mindestens zehnmal von der Maschine zum großen Küchenschrank, in dem sie Teller, Schüsseln und Kaffeebecher stapelte und die Bestecke in einer Schublade einsortierte.
Als sie damit fertig war, sah sie auf die Uhr. Sechs Minuten waren vergangen. Gleich würde Johannes da sein.
Sie zog das Fläschchen aus der Hosentasche, schraubte es auf und ließ zwanzig Tropfen in die Milch fallen.
Jetzt gab es keinen Weg mehr zurück.
4
Johannes war sich ganz sicher, die kleine Schachtel mit den Ohrringen in die Seitentasche des Koffers gesteckt zu haben, und jetzt war sie wie vom Erdboden verschwunden.
Was Geschenke betraf, hatte er noch nie viel Fantasie entwickelt, er schenkte Magda entweder Blumen oder Schmuck, je nachdem, ob der Anlass größer oder kleiner war. Am Samstag war er in Friedenau in einer unscheinbaren Seitenstraße an einem Juweliergeschäft vorbeigekommen und eigentlich nur stehen geblieben, weil es ihn wunderte, dass man in dieser abgelegenen kleinen Straße überhaupt etwas verkaufen konnte. Aber das Schaufenster war äußerst geschmackvoll dekoriert, und ein paar Ohrringe fielen ihm sofort ins Auge. Weißgoldene Kreolen mit einem winzigen Brillanten. Sie strahlten eine herbe, kühle Schönheit aus, die ihn faszinierte.
Nie wäre er auf die Idee gekommen, Carolina Schmuck zu schenken – ihr Geschmack war einfach zu ausgefallen. Aber bei Magda war das anders. Er hatte oft den Eindruck, ihr gefiel, was ihm gefiel. Sie war so leicht zu beeinflussen und freute sich wie ein Kind, wenn er etwas schön fand. Bei Magda lag man immer richtig, sie war so wunderbar unkompliziert.
Kurzerhand hatte er die Ohrringe gekauft. Er meinte es wirklich ernst mit Neuanfang und Versöhnung. Vielleicht ließ sich sein guter Wille durch dieses Geschenk ja noch unterstreichen.
In den letzten Tagen war im Geschäft die Hölle los gewesen. Anscheinend hatten sich alle Umzugswilligen in diesem Land verabredet, ihren Plan in dieser Woche in die Tat umzusetzen. Magda war bereits nach Italien gefahren, Johannes arbeitete noch eine Woche, gab schließlich letzte Instruktionen, hinterließ seine Handynummer und fuhr am Freitag früh auf dem direkten Weg und mit nur einem kurzen Tankstopp in die Toskana.
Magda hatte nicht auf ihn gewartet und lag schon im Bett. Sie wachte kurz auf, als er ins Schlafzimmer kam.
»Ach, schön, dass du da bist«, sagte sie verschlafen, »gute Nacht, bis morgen früh.«
Damit drehte sie sich auf die Seite und schlief weiter.
Er hätte ihr gern erzählt, dass er Carolina nie mehr wiedersehen würde, aber das musste wohl bis zum Frühstück warten.
Auf der Terrasse schenkte er sich ein Glas Rotwein ein und sah den Mond am sternenklaren Himmel. Noch eine Nacht, dann war Vollmond.
Es war vorbei. Er hatte sich für Magda entschieden und fühlte sich auf einmal ganz leicht und frei.
Johannes fand endlich die Ohrringe in der Seitentasche seines Kulturbeutels. Ihm war gar nicht bewusst, dass er das kleine samtene Täschchen dort hineingeschoben hatte.
Jetzt steckte er es in seine Hosentasche, öffnete das Schlafzimmerfenster weit, machte noch schnell die Betten und ging hinunter in die Küche.
Alles wird gut, dachte er, alles wird gut.
5
Magda lächelte, als Johannes in die Küche kam und ihr einen Kuss auf die Wange hauchte.
»Hast du gut geschlafen?«, fragte er und setzte sich an den Küchentisch.
»Ja, doch. Einigermaßen. Ich hab ein bisschen schlecht geträumt.«
»Wovon?«
»Das kann ich dir nicht erzählen, sonst gehen die Albträume in Erfüllung.«
Sie stellte ihm die Müslischale auf den Tisch und goss ihm Tee ein. »Lass es dir schmecken.«
Johannes begann das Müsli zu essen. »Ich habe übrigens mit Carolina Schluss gemacht. Die Sache ist beendet, und ich werde sie nie wiedersehen.«
»So«, meinte Magda ungerührt und beobachtete, wie er aß.
»Es tut mir leid, Magda. Ich habe noch nie so deutlich gespürt, wie wichtig du mir bist. Ich liebe dich, Magda. Lass uns vergessen, was gewesen ist. Lass uns noch einmal neu anfangen.«
Er stand auf und umarmte sie.
Sie war seltsam steif. »Setz dich und iss dein Müsli«, sagte sie, »lass uns nachher weiterreden.«
Er setzte sich und aß wieder einige Löffel voll. Magda bestrich sich ein Stück Weißbrot mit Butter und Käse. Als Johannes erneut den Löffel zur Seite legte, wurde sie nervös.
»Was hast du?«, fragte sie. »Ist der Löffel schmutzig? Möchtest du einen anderen?«
»Nein«, meinte er und lächelte. »Ich hab dir eine Kleinigkeit mitgebracht.« Er stand auf und holte aus seiner Hosentasche das kleine Samtsäckchen hervor.
»Für dich. Bitte, Magda, verzeih mir.«
Er gab es ihr, aber Magda reagierte nicht.
»Mach doch mal auf. Ich hoffe, es gefällt dir.«
Magda öffnete das Samtsäckchen.
»Oh, wie schön«, flüsterte sie, »wie wunderschön! Kreolen. Und dann noch mit Brillanten. Meinen Lieblingssteinen.«
Sie küsste ihn, um sich bei ihm zu bedanken. Er zog sie auf seinen Schoß und umarmte sie.
»Ich war so dumm, Magda. Ich habe vergessen, dass wir zusammengehören.«
»Schon gut.« Sie stand auf und setzte sich wieder ihm gegenüber.
»Möchtest du noch etwas Tee?«
Er nickte, und sie schenkte ihm nach.
»Warum essen wir heute eigentlich nicht auf der Terrasse?«, fragte Johannes.
»Mir war kalt heute Morgen, und es ging so ein kühler Wind. Da dachte ich, drinnen ist es vielleicht gemütlicher.«
»Stimmt.« Johannes lächelte ihr zu. »Es wird noch so viele warme Tage geben, da kommt es auf einen mehr oder weniger nicht an.«
Magda stand auf und ging hinaus. »Ich bin gleich wieder da«, sagte sie, »ich muss nur mal auf die Toilette.«
Johannes schaltete das Radio an. »Senza una donna« sang Zucchero. Während er langsam sein Müsli zu Ende aß, klang dieses Lied tief in seiner Seele und machte ihn glücklich. Das Leben ist wundervoll, dachte er, und wir haben fantastische Urlaubswochen vor uns. Magda und ich.
»Ich war übrigens gestern Abend noch kurz bei Massimo und Monica und hab eine Fünf-Liter-Flasche Öl und eine Kiste Wein gekauft. Ist alles noch im Auto«, sagte er, als Magda wieder in die Küche kam.
Magda zuckte zusammen. »Oh, wie schön«, meinte sie.
Dann wussten Massimo und Monica jetzt also, dass Johannes hier war. Und was die beiden wussten, erfuhr das ganze Dorf. Sie war wütend. Musste er das verdammte Öl und den Wein unbedingt gleich am ersten Abend kaufen? Sie hatte eigentlich vorgehabt, im Dorf zu erzählen, dass sie in diesem Sommer allein Urlaub machte.
»Die beiden lassen schön grüßen«, unterbrach Johannes Magdas Gedanken, »und wir haben vereinbart, uns wie immer bei uns zum Abendessen zu treffen. Vielleicht am Wochenende. Oder nächste Woche. Wie du willst.«
Magda antwortete ihm nicht mehr, denn in diesem Moment wurde ihm übel. Es war kein Schmerz, sondern eine unkontrollierbare Schwäche. Die Welt begann sich in seinem Kopf zu drehen, und er spürte, wie ihm die Augen wegkippten.
»Magda«, röchelte er, »hilf mir, mir ist so schlecht, ich kann mich nicht mehr halten. Was ist los mit mir? Hilf mir, oh mein Gott …«
Um ihn herum wurde es schwarz, er versuchte seinen Arm zu heben, aber es gelang ihm nicht, der Arm rutschte nach unten, neben den Tisch ins Leere, und Johannes’ Gesicht schlug schwer und hart auf die Holzplatte des Tisches.
6
Magda hatte in der Apotheke lange auf die Gelegenheit gewartet. Henriette, ihre Chefin, war beim Zahnarzt und würde nicht vor fünf wiederkommen. Außer ihr war nur Daniela, die Apothekenhelferin, eine ziemlich langsame, dralle Blondine mit fünf Dioptrien auf dem einen und sieben Dioptrien auf dem anderen Auge, im Geschäft. Sie bediente gerade eine Kundin, die alles über Mittel gegen Erkältungskrankheiten bei Kindern wissen wollte, was Magda für überkandidelt hielt. Heutzutage gab es bei Medikamenten gegen Erkältungskrankheiten keine Überraschungen und keine Geheimnisse mehr, und Magda beobachtete angewidert, wie Daniela den Beipackzettel trotz dicker Brille bis direkt vor ihre Augen hielt.
In diesem Moment betrat der Pharmalieferant die Apotheke und wurde von Magda direkt nach hinten in den Lagerraum gebeten, wo er die Kiste mit Succinylcholin absetzte. Einem Mittel, das vor allem Lungenärzte für ihre Belegkliniken bestellten, da sie Intubationen mit dieser Narkose durchführten.
»Wie lange haben Sie heute noch zu tun?«, fragte sie freundlich und desinteressiert.
»Sie sind meine vorletzte Kundin«, antwortete der Lieferant, trat von einem Bein auf das andere und grinste.
Magda lächelte ebenfalls und unterzeichnete den Lieferschein. Der Lieferant fasste sich grüßend an die Mütze und verschwand so schnell und unauffällig, wie er gekommen war.
In Windeseile begann sie die Kiste auszupacken und ließ fünf Ampullen in ihrer Kitteltasche verschwinden. Die übrigen stapelte sie sorgfältig in den Giftschrank, zu dem nur sie und Henriette einen Schlüssel besaßen.
»Frau Kremer braucht eine Packung Zocor«, platzte Daniela herein. »Sie hat kein Rezept, aber sie meint, sie habe Zocor hier immer ohne Rezept bekommen. Ohne Probleme.«
»Pack die Ampullen zu Ende aus«, meinte Magda zu Daniela, »ich kümmere mich um Frau Kremer.«
Frau Kremer hatte der Himmel geschickt. So konnte sie immer sagen, Daniela habe die Ampullen einsortiert, und wenn es Henriette auffallen sollte, dass einige fehlten, würde sie Daniela rausschmeißen. Unzuverlässige Apothekenhelferinnen konnten sie nicht gebrauchen.
Magda war überaus freundlich zu Frau Kremer. Sie kannte die Kundin seit Jahren, und selbstverständlich bekam sie ihr Mittel gegen erhöhtes Cholesterin ohne Rezept.
Daniela hatte den Giftschrank fertig eingeräumt. Magda bedankte sich bei ihr und schloss den Schrank ab.
Es war noch eine halbe Stunde bis Feierabend. Magda trank einen Kaffee mit Daniela, und da kaum noch Kunden in die Apotheke kamen, schickte sie sie nach Hause.
Daniela drückte sich ihre dicke Brille fester auf die Nase und fuhr – blind wie eine Henne – in ihrem kleinen Polo davon.
Magda nutzte die Gelegenheit, auch noch schnell wirkende Barbiturate einzustecken.
Um neunzehn Uhr schloss Magda die Apotheke sorgfältig ab und fuhr nach Hause. Eigentlich hatte Henriette ja vor Feierabend noch vorbeikommen wollen, aber vielleicht hatte der Zahnarzt geschnitten, und es ging ihr nicht gut.
Am nächsten Vormittag hatte Magda frei. Um Viertel nach elf rief Henriette an.
»Gestern ist Succinylcholin angeliefert worden?«, fragte sie.
»Ja, warum?«
»Es fehlen fünf Ampullen. Ich habe den Bestand und den Eingang überprüft.«
»Das kann ja gar nicht sein.« Magda wunderte sich insgeheim, dass Henriette das bemerkt hatte. Sie hatte es ihr wirklich nicht zugetraut.
»Kannst du dir das erklären?«
»Nein. Hast du wirklich genau gezählt?«
»Ja.« Henriette schnaufte genervt. »Hast du die Ampullen eingeräumt?«
»Zuerst ja, aber dann hat Daniela weitergemacht, weil eine schwierige Kundin in den Laden kam.«
Henriette schwieg.
»Kann das nicht einfach ein Lieferfehler sein? Denn was soll Daniela mit einigen Ampullen Succinylcholin? Henriette, ich bitte dich! Damit kann doch kein Mensch etwas anfangen! Und Daniela schon gar nicht!«
Henriette wusste, dass Magda einer Beate-Uhse-Puppe mehr Intelligenz zutraute als Daniela. Sie war immer gegen deren Einstellung gewesen.
»Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, auf alle Fälle fehlen die Ampullen. Und das ist eine Katastrophe, Magda.«
»Ich weiß.«
»Was soll ich machen? Daniela rausschmeißen? Ohne Beweise?«
»Du hast keine andere Chance. Dann bist du die Sache los. Schließlich kannst du nicht ihre Wohnung durchsuchen lassen.«
Henriette seufzte hörbar ins Telefon. »Ich war noch nie in einer so blöden Situation, Magda.«
»Das kann ich mir denken.« Magda legte so viel Wärme in ihre Stimme, wie sie konnte.
»Gut. Ich werde mit ihr reden.«
Henriette entschuldigte sich für die Störung, verabschiedete sich und legte auf.
Magda atmete tief durch und fühlte sich irgendwie erleichtert. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass Henriette sie noch mal auf das fehlende Succinylcholin oder auch auf die Barbiturate ansprechen würde. Dies alles würde jetzt auf Danielas Konto gehen.
Als Magda am Nachmittag wieder in die Apotheke kam, gab es bereits eine neue Apothekenhelferin: Ingrid.
7
»Mein armer Hase«, flüsterte Magda, »jetzt hast du es bald geschafft. Das Schlimmste hast du hinter dir.«
Sie zog seine Lider hoch. Er war nicht mehr bei Bewusstsein und würde nicht spüren, was sie auch noch mit ihm tun musste.
Er lag jetzt im Koma. Im Urin wären diese Tropfen zwölf Stunden nachweisbar, im Blut lediglich sechs. Aber eigentlich war es egal. Sie würde dafür sorgen, dass niemand seine Leiche fand.
Doch noch war er nicht tot. Die Mixtur aus Barbituraten, die sie selbst hergestellt hatte, würde ihn nicht umbringen, sondern lediglich dafür sorgen, dass er nicht mitbekam, wie sie ihn tötete.
Sie wollte ihm nicht wehtun. Und sie wollte ihm keine Angst machen.
Wenn einer den andern betrügt, ist das Leben zu Ende.
Schatz, du hast es gewusst. Du kennst mich doch. Du hättest es nicht tun dürfen.
Sie holte die Spritze aus der Küchenschublade, schob ihm die kurze Hose hoch und injizierte ihm das Succinylcholin in den Oberschenkel. Das Mittel wurde bei Operationen häufig als Anästhetikum benutzt und löste eine totale Muskellähmung im ganzen Körper aus. Also würde auch die Atmung bald nicht mehr funktionieren, und das Herz würde aufhören zu schlagen.
Intravenös gespritzt hätte das Mittel zwar bereits nach wenigen Sekunden gewirkt, aber das traute sie sich nicht zu. Sie hatte Angst, die Vene nicht zu finden. Intramuskulär war sie da auf der sicheren Seite, auch wenn das Sterben ein klein wenig länger dauerte. Wie auch immer. Es gab keinen Weg zurück.
Magda nahm Johannes’ Hand und streichelte sie.
»Mach’s gut«, flüsterte sie, »wo immer du jetzt auch hingehst. Wir hatten eine schöne Zeit, und ich werde dich nie vergessen. Schade um dich, schade um uns, Johannes. Schade, dass du Carolina kennengelernt hast, wir hätten sonst bestimmt noch viele gute Jahre gehabt. Mein Freund, mein Liebster, schlaf gut. Schlaf für immer.« Sie küsste ihn aufs Haar und fühlte seinen Puls. Noch schlug sein Herz.
»Nur noch einen Moment, nicht mehr lange, dann fliegt deine Seele davon, Hannes. Nimm mir nicht übel, was ich getan habe, aber es ging nicht anders. Ich hätte dir nie wieder vertrauen können. Und ich wollte dich auch keiner anderen überlassen. Es gab nur diesen einen Weg. Verzeih mir.«
Johannes’ Kopf kippte plötzlich zur Seite, sie sah, wie seine Halsschlagader noch einmal heftig pulsierte, und dann setzte sein Atem aus.
Magda spürte keinen Puls mehr. Johannes war tot.
8
Magda verriegelte die Terrassentür und zog die schwere Übergardine vor, die nicht nur vor neugierigen Blicken, sondern auch vor der Sonne schützte und die Küche im Sommer angenehm kühl hielt. Anschließend schloss sie am gesamten Haus die Fensterläden, aber nicht die Fenster.
Dann ließ sie Johannes vorsichtig vom Stuhl rutschen und legte ihn auf die Erde.
Sie hatte Zeit, denn nach der Gabe von Succinylcholin gab es keine Totenstarre. Aber sie hatte auch noch verdammt viel Arbeit vor sich.
Ihr fiel ein, dass sie ihre Tabletten nicht genommen hatte. Daher setzte sie sich, öffnete eine Flasche Mineralwasser und durchsuchte eine alte Teekiste, in der sie die Tabletten aufbewahrte, die sie regelmäßig nehmen musste. Ein bisschen Kalium fürs Herz, Kalk für die Knochen, Aspirin fürs Blut und ein Briefchen leichtes Abführmittel für die Verdauung. Das Pulver musste in Wasser aufgelöst und getrunken werden, zum Glück schmeckte es einigermaßen erträglich und erinnerte entfernt an Orangengeschmack.
Sie hatte gerade den Kopf im Nacken, um die Kalktabletten zu schlucken, die groß und trocken waren und sich nur sehr schwer hinunterspülen ließen, als das Telefon klingelte. Magda hielt den Atem an und zählte leise mit. Fünfmal, sechsmal. Dann stand sie auf. Das Klingeln zerrte an ihren Nerven, ihr brach der Schweiß aus.
Hör auf!, schrie sie innerlich, hör endlich auf! Ich bin nicht zu Hause. Wann kapierst du das? Herrgott noch mal!
Nach dem siebzehnten Mal schwieg das Telefon. Sie ging zur Terrassentür und sah hinaus. Der Hof, der Weg und der Wald lagen vollkommen verlassen da. Die Grillen zirpten, die Luft flimmerte vor Hitze.
Sie legte eine CD von Adriano Celentano auf. Zum Abschied. Johannes hatte seine Lieder immer gern gehört. Celentano war für ihn der kernige, männliche Italiener schlechthin. »Azzurro« war das einzige Lied, von dem er alle Strophen auf Italienisch singen konnte, und er brüllte es auf jedem Dorffest begeistert mit. Falls er es im Jenseits noch hören konnte, würde es ihn freuen.
»Sento fischiare sopra i tetti, un aeroplano che se ne va«, sang Adriano. »Ich höre über den Dächern ein Flugzeug davonfliegen …« Plötzlich überkam sie eine unerträgliche Wehmut. Sie sehnte sich danach, auch einfach in ein Flugzeug zu steigen und abzuhauen. Dies hier alles zurücklassen und nie wiederkommen. Irgendwo ganz von vorn anfangen. Ohne Johannes und ohne Schuld.
Plötzlich fiel ihr ein leicht beißender Geruch auf, der immer stärker wurde, je mehr sie sich dem Kühlschrank näherte. Sie schnüffelte die ganze Gegend ab und fand schließlich in einem Netz unter den Zwiebeln eine verschimmelte Zitrone.
Sie warf die Zitrone weg und merkte, dass sie Hunger hatte. Sie war ja noch gar nicht dazu gekommen, etwas zu essen.
Die Reste des Frühstücks standen noch auf dem Tisch. Zuerst nahm sie die leere Müslischale, spülte sie sorgfältig aus und stellte sie zurück in den Schrank.
Anschließend schnitt sie sich eine Scheibe Brot ab und aß sie mit Parmaschinken. Dazu trank sie fast eine halbe Flasche Wasser.
»Es hat wirklich Spaß gemacht, für dich zu kochen, Johannes«, sagte sie lächelnd, lehnte sich entspannt zurück und sah in die toten Augen ihres Mannes, die sie kalt und vorwurfsvoll anstarrten. »Und ich glaube, unsere gemeinsamen Mahlzeiten werden mir fehlen, Liebster.«
In diesem Moment vernahm sie ein Motorengeräusch und hörte unwillkürlich auf zu atmen. Das Geräusch wurde lauter. Sie öffnete die Gardine vor der Terrassentür einen Spaltbreit und sah hinaus. Ein grüner Suzuki kam gerade den Weg herauf.
Magda erstarrte vor Schreck und schlich zum Fenster über der Spüle. Durch die Lamellen des Fensterladens konnte sie beobachten, was draußen geschah, und war sich sicher, nicht gesehen zu werden. Sie wartete und verharrte bewegungslos.
Der Wagen hielt direkt vor dem Haus.
Magdas Herz klopfte, der Schweiß stand ihr auf der Stirn.
Zwei Männer stiegen aus dem Auto, auf dem »Assistenza – Servizio – Manutenzione« und dann in riesigen Buchstaben »LIQUIGAS« geschrieben stand.
Wir haben noch genug Gas, dachte sie automatisch, und: Ich hab sie nicht angerufen. Was zum Teufel wollen die?
Der ältere der beiden klopfte energisch gegen die Terrassentür.
Magda rührte sich nicht. Sie hielt sogar den Atem an, als könnte sie sich damit unsichtbar machen.
»Accidenti, non c’è nessuno«, brummte sein Kollege, was so viel hieß wie: Verflucht noch mal, keiner da.
Warum ruft ihr auch nicht vorher an, ihr Vollidioten, dachte Magda, so wie es sich gehört. So wie es alle machen.
Der Ältere klopfte erneut. Länger, anhaltender, heftiger.
Magda rührte sich nicht, aber ihr war übel vor Angst.
Dann flüsterten die beiden. Magda konnte nicht genau verstehen, was sie sagten, sie hörte nur das Wort »macchina«, und siedend heiß fiel ihr ein, dass ihr Auto vor der Tür stand. Für Italiener ein untrügliches Zeichen, dass jemand zu Hause war.
Ich könnte ja spazieren gegangen sein, dachte Magda, oder schlafen. Oder krank sein. Jetzt nur die Nerven behalten. Schließlich können sie nicht einbrechen, nur weil ihnen niemand öffnet.
Aber all diese Gedanken beruhigten nicht ihren Herzschlag.
Die beiden Techniker der Gasfirma klopften erneut, riefen laut »Signore Tillmann« und »Liquigas, Buongiorno!«, aber als sich daraufhin immer noch niemand rührte, zuckten sie mit den Achseln und fuhren davon.
Magda atmete tief durch.
»Das war knapp«, sagte sie zu Johannes. »Hoffentlich kriegen wir heute nicht noch mehr Besuch.«
Sie räumte das Frühstücksgeschirr ab und stellte alles in die Spülmaschine.
Sanft strich sie Johannes über die Wange, band sich die Haare hinten im Nacken zusammen und ging hinaus, um sich an die Arbeit zu machen.
In den letzten Tagen, als Johannes noch in Berlin war, hatte sie sich schon den richtigen Platz ausgesucht. Es war nicht einfach, denn wie der Name schon sagte, war La Roccia sehr steinig. Im Grunde ein gewaltiger Felsen, von Erde bedeckt. Wenn man grub, war meist nach dreißig bis fünfzig Zentimetern Schluss, dann stieß man auf Stein. Die einzige Chance, und vielleicht auch die unauffälligste, war der Gemüsegarten. Johannes hatte ihn geliebt und fast täglich stundenlang dort gearbeitet. So war es wahrscheinlich nur richtig und gut, dass dieser Ort seine letzte Ruhestätte wurde.
Positiv war auch, dass Johannes in dem Gärtchen die Steine abgesammelt und vor zwei Jahren sogar vier Lastwagen mit Muttererde hatte kommen lassen. Am vergangenen Mittwoch hatte Magda ein Olivenbäumchen gekauft und schon mal ein Loch gebuddelt, um zu sehen, wie tief sie kam. Sie arbeitete anderthalb Stunden, und dann war das Loch achtzig Zentimeter tief. Genug, um einen Menschen zu vergraben. Das gesamte Grab konnte sie nicht vorbereiten. Das wäre zu auffällig gewesen.
Falls Johannes früher gekommen wäre und das Loch gesehen hätte, wollte sie sagen, sie hätte vorgehabt, das Olivenbäumchen zu pflanzen.
Aber Johannes war erst gestern Abend nach Einbruch der Dunkelheit gekommen. So konnte sie sich diese Lüge ersparen.
Sie hatte noch den ganzen Tag Zeit.
Um neun Uhr begann sie zu graben, um halb zehn taten ihr alle Knochen weh, und sie hatte kaum etwas geschafft. Die Haut an ihren Händen warf bereits Blasen. Nicht mehr lange, dann würde sie zwischen Daumen und Zeigefinger offene Wunden haben. Sie trank Mineralwasser und setzte sich einen Moment ins Unkraut, das in den letzten Wochen den ganzen Gemüsegarten überzogen hatte. Johannes hätte ein paar Tage gebraucht, um den Garten wieder so aussehen zu lassen, als ob da nie auch nur ein Halm Unkraut gestanden hätte. Normalerweise setzte er dann Tomaten, Salat, Gurken, Melonen und Kartoffelpflanzen, schob alle möglichen Zwiebeln in die Erde, steckte Petersilien- und Basilikumpflänzchen und säte, was man im Juni noch säen konnte. Und war glücklich. Auch wenn er die Früchte seiner Arbeit meist Massimo überlassen musste, der auf das Haus aufpasste, wenn sie nicht da waren, das ganze Jahr über den Rasen mähte, die Bäume beschnitt, Unkraut jätete und bei dieser Gelegenheit die Tomaten und das übrige Gemüse erntete.
Das musste sie diesmal unterbinden. Sie wollte nicht, dass Massimo hier im Garten herumkroch. Und vielleicht auch noch umgrub, um ihr eine Freude zu machen.
In der hinteren Ecke des Gartens wucherte das Unkraut auffällig stark, und das dort gepflanzte Gemüse wurde doppelt so groß. Denn an dieser Stelle war Bingo vergraben, ein weißer Terrier, den sie auf der Landstraße gefunden hatten. Fast verdurstet, verängstigt, verstört und an ein Vorfahrtsschild gebunden.
»Bingo«, sagte Johannes, als sie anhielten und aus dem Auto stiegen, »du hast gewonnen, Sportsfreund. Sei froh, dass wir dich gefunden haben, das ist für dich wie ein Sechser im Lotto.«
Sie packten Bingo auf den Rücksitz, päppelten ihn in den kommenden Wochen auf und versuchten ihm klarzumachen, dass ein braver Hund, der in Berlin und ab und zu auch in der Toskana lebt, keine Teppiche, Möbel und Schuhe frisst. Dass er nicht ins Bett springt und sich nicht die Reste vom Tisch holt.
Bingo hörte gut zu, legte den Kopf schief, machte sein Häufchen unter dem Schreibtisch und kapierte erst nach einem halben Jahr, was seine Lebensretter von ihm wollten. Gerade noch rechtzeitig, denn Magda hatte – völlig entnervt – schon mit dem Tierheim Kontakt aufgenommen.
Sieben Jahre später starb Bingo an einem heißen Tag auf La Roccia an einem Bandscheibenvorfall und einer Herzschwäche. Wahrscheinlich in hohem Alter, das man nur schätzen konnte. Johannes grub ein Grab am Rande des Gemüsegartens, wickelte den Hund in seine Schmusedecke und beerdigte ihn. Ohne Stein, aber mit Tränen in den Augen.
Und Bingos verwesende Leiche machte die Erde fruchtbar.
Genauso wollte sie nun auch mit Johannes verfahren.
Sie grub und grub. Unterirdische Wurzeln machten ihr das Leben schwer. Sie zerschlug sie mühsam mit einer Machete, um weitergraben zu können. Laut fluchend über jede Schaufel Erde, die am Rand in die Grube zurückrutschte. Schweißgebadet und völlig verdreckt war sie den Tränen nahe. Ständig hielt sie den Zollstock in die Grube, um die Tiefe zu messen. Vergrößerte sie das Loch in der Breite oder Länge, schien die Grube auf wundersame Weise und ganz von selbst wieder flacher zu werden.
Magda kämpfte und grub. Sie dachte mit Entsetzen an ihren toten Mann in der Küche und hatte gar keine andere Wahl.
Um zwei Uhr konnte sie einfach nicht mehr. Sie schwor sich, nie wieder in ihrem Leben eine Schaufel, einen Spaten, eine Spitzhacke oder eine Machete in die Hand zu nehmen, und ging unter die Dusche.
Johannes wirkte vollkommen friedlich, als sie zurück in die Küche kam. Sie war wütend auf ihn. Er war an allem schuld. Normalerweise rief man den Bestattungsunternehmer und hatte mit der ganzen Angelegenheit nichts mehr zu tun. Höfliche Menschen kamen ins Haus, legten den Toten in einen grauen Sarg und trugen ihn hinaus. Schoben ihn in ein Auto, schlossen die Türen mit den verdunkelten Scheiben, und er war für immer verschwunden. Vom Erdboden verschluckt. Die Vorstellung bei der Beerdigung, dass er in dieser Grube versenkt wurde, war nur noch ein Gedanke. Kein sichtbarer Beweis, kaum zu verstehen und eine saubere, keineswegs anstrengende Sache.
Nur sie musste ganz allein das Grab ausheben. Auf diesem fürchterlichen Stück Land mit diesem harten, steinigen Boden. Hätte Johannes das nicht gemacht, was er getan hatte, hätte er eines natürlichen Todes sterben können, und sie müsste diesen schrecklichen Tag nicht hinter sich bringen.
Sie machte sich eine Dose Thunfisch auf, aß ihn direkt aus der Büchse, trank einen halben Liter Milch und versuchte, Johannes dabei nicht anzusehen. Er machte sie nervös und erinnerte sie daran, was sie noch vor sich hatte.
Beim Graben war ihr auch bewusst geworden, dass sie das Unkraut des gesamten Gemüsegartens jäten musste. Eine entsetzliche Vorstellung. Aber in dieser Unkrautwüste fiel auch dem blindesten und fantasielosesten Menschen oder gar Polizisten auf, dass hier ein Grab ausgehoben worden war.
Magda beschloss, einen ausgiebigen Mittagsschlaf zu machen, um Kraft zu tanken. Bei hellem Tageslicht wollte sie die Leiche sowieso nicht durch die Gegend zerren.
Sie legte sich in den Sessel vor dem Fernseher und schlief augenblicklich ein.
Um siebzehn Uhr wurde sie wach. Der Abend kam näher. Sie spürte, wie ihr Pulsschlag sich erhöhte.
Im Haus war es still.
Noch vier Stunden bis zum Dunkelwerden. Sie hätte nie gedacht, dass ein Tag mit einem Toten in der Küche so verdammt lang sein konnte.
Wieder legte sie Celentano auf und beschloss, schon jetzt damit anzufangen, die Leiche einzupacken.
Aus dem Gläserschrank holte sie aus der untersten Schublade zwei große grüne Müllsäcke mit hundertzehn Litern Fassungsvermögen. Sie steckte Johannes’ Füße und Beine in den Sack, der ihm bis zur Taille reichte. Perfekt, dachte sie, nahm den Gürtel aus Johannes’ heller Leinenhose, die noch über der Stuhllehne hing, und verschnürte damit den Müllsack um Johannes’ Bauch, indem sie den Gürtel zwei Löcher enger zuzog als gewöhnlich.
Sie küsste ihn. Seine Lippen waren kalt und trocken. »Tschüss, mein Lieber«, flüsterte sie.
Dann stülpte sie ihm den zweiten Müllsack über Kopf, Arme und Brust, holte aus dem Magazin gleich hinter der Küche breites Klebeband und eine Schere und verschnürte und verklebte Johannes wie ein Paket. Er lag wie eine grüne Mumie auf dem Steinfußboden, und Magda musste sich setzen. Sie war schon wieder erschöpft, der Schweiß lief ihr in dünnen Bächen den Rücken hinunter und stand ihr auf der Stirn.
Noch zwei weitere Stunden grub sie, bis sie mit der Tiefe des Grabes einigermaßen zufrieden war. Siebzig Zentimeter. Mehr schaffte sie einfach nicht, denn im unteren Teil des Grabes stieß sie auf Fels. Und das Schlimmste hatte sie noch vor sich. Vielleicht hatte sie sich einfach zu viel zugemutet. Hatte sich überschätzt und das Grabschaufeln unterschätzt. Aber jetzt musste sie weitermachen, auch wenn ihre Muskeln zitterten.
Als die Sonne hinter den Bergen versank, war sie so weit, dass sie beginnen konnte.
Von der Terrassentür bis zum Haupteingang mit der toskanischen Treppe und dem kleinen Portiko waren es über den Hof ungefähr sieben Meter. Daneben war der Durchgang zur Ostterrasse, auf der im Halbschatten einer stämmigen Eiche drei Hortensien in Terrakottatöpfen prächtig gediehen. Das ganze Jahr über standen dort zwei schmiedeeiserne Stühle und ein kleiner Tisch, aber Magda und Johannes saßen nur selten dort. Magda grauste vor Insekten, die aus dem Baum in ihr Haar oder ins Glas fallen könnten.
Direkt neben der Ostterrasse lag der Gemüsegarten. Bis dahin waren es ungefähr noch einmal zwölf Meter. Die längste und gefährlichste Strecke, da man den Platz vom Haus gegenüber auf dem nächsten Hügel einsehen konnte.
Seit Tagen hatte Magda das gegenüberliegende Nachbargrundstück beobachtet, aber es wirkte wie ausgestorben. Magda vermutete, dass die Nachbarn bei ihrer Tochter und ihren Enkeln in Grosseto waren, die dort ein Haus hatten. Insofern war die Gelegenheit günstig.
Jetzt, nach Sonnenuntergang, wurde es schnell dunkel. Es war schon lange niemand mehr unterwegs. Das Abendessen war in den Familien um diese Zeit bereits vorbei, man traf sich mit Freunden beim Wein, entweder zu Hause oder in einer Bar. Man saß auf der Piazza, ging ins Kino, ins Theater oder in eine Discothek. Es gab tausend Möglichkeiten, den Abend zu verbringen. Aber keine davon war ein Spaziergang in der Natur. Nur Wilderer wagten sich nachts in den Wald.
Aus dem Gästezimmer holte Magda eine Wolldecke, die sie neben Johannes legte, und sie rollte die Leiche darauf. Dann begann sie ihn durch die Küche zu ziehen.
Die kurze Strecke auf dem glatten Steinfußboden ging leicht, aber im Hof wurde es mühsam. Magda kam nur zentimeterweise voran und verzweifelte fast. Nach drei Metern musste sie verschnaufen. Sie ließ ihn liegen, setzte sich fünf Minuten hin und zog dann das schwere Paket weiter Richtung Durchgang. Johannes’ Hinterkopf schlug hart auf die Steine, es tat ihr beinah weh, und sie musste sich immer wieder klarmachen, dass es ihm nichts mehr anhaben konnte.
Im Durchgang machte sie eine lange Pause. Jetzt noch zwölf Meter.
Mittlerweile war es stockdunkel. Eine Außenlaterne, die über dem Durchgang hing, beleuchtete den Weg bis zur Zisterne notdürftig. Aber das genügte.
Ein leichter Abendwind wehte ums Haus. Normalerweise würden wir jetzt im Hof sitzen und Abendbrot essen, dachte sie. Einen frischen Mozzarella mit Tomaten, Basilikum und Öl-Knoblauchsoße, ein bisschen Schinken, ein paar Oliven. Dazu knuspriges Ciabatta. Johannes würde eine Flasche Wein öffnen, und vielleicht würden sie darüber diskutieren, ob es nicht doch schön wäre, einen Pool zu bauen. Auch wenn der Sommer kurz war und sie ihn nur wenige Wochen nutzen konnten.
All das ging ihr durch den Kopf, als sie den leblosen Körper ihres Mannes zu dem frisch ausgehobenen Grab in ihrem Gemüsegarten zog.
Nie wieder würden hier Kartoffeln wachsen, denn der Garten hatte eine neue Aufgabe bekommen: Johannes’ Leiche zu schlucken und nie wieder herzugeben.
9
Es war ein Uhr dreißig, als sie es geschafft hatte, die Leiche in die Kuhle zu rollen. Sie setzte das Olivenbäumchen auf Johannes’ Brust, drückte es mit Erde fest, schaufelte das Grab vollständig zu und harkte es glatt. Anschließend war sie fix und fertig.
Aber jetzt hatte sie das Schlimmste hinter sich. Bisher hatte sich noch nie jemand für den Gemüsegarten interessiert, das würde auch in Zukunft niemand tun. Und bis sie Johannes als vermisst melden würde, war das Unkraut gejätet und alles in Ordnung. Sie konnte sich entspannen.
Magda setzte sich an den großen Holztisch auf dem Hof und trank ein Glas Wein. Sie hatte die Lampe über dem Tisch nicht eingeschaltet, sondern lediglich ein Windlicht angezündet. Der Wald lag vor ihr wie eine schwarze Wand, noch nicht einmal den Weg konnte sie in der Dunkelheit ausmachen. Nur der zarte Duft eines Jasminbusches, der neben der Küchentür eingepflanzt war und gerade erst zu blühen begann, wehte durch die kühle Nachtluft.
Es wurde ihr bewusst, dass sie von nun an allein sein würde. Allein an diesem Tisch, wenn sie etwas aß oder trank, allein in ihrem Bett. Es gab niemanden mehr, der die Verstopfung in den Rohrleitungen zum Wassertank reparierte, wenn das Haus kein Wasser hatte, niemanden, der ein defektes Türschloss abschraubte oder eine klemmende Schublade wieder gängig machte. Sie würde einen Mechaniker rufen müssen, um bei einer Panne das schwere Rad ihres Wagens zu wechseln, würde die Einkäufe allein bewältigen und als Letzte abends die Lichter löschen müssen. Sie würde allein auf Dorffesten auftauchen und allein nach einem Abendessen bei Freunden nach Hause kommen. Es würde einsam sein. Niemand mehr, der ihr beim Zähneputzen im Spiegel zulächelte oder sie in den Arm nahm, wenn unten am Bach die Jagdhunde bellten. Im Haus würde es still werden. Wahrscheinlich würde sie sogar den Klang seiner Stimme allmählich vergessen.
All das stand ihr deutlich vor Augen, und dennoch fühlte sie eine tiefe Zufriedenheit. Sie hatte das, was sie sich vorgenommen hatte, geschafft. Sie hatte es wahrhaftig getan. Und anschließend hatte sie schier Unglaubliches geleistet. Denn als sie die Leiche bis in den Garten gezerrt hatte, war sie mit ihren Kräften vollkommen am Ende. Sie saß neben dem neunzig Kilo schweren Sack und brach vor lauter Hilflosigkeit in Tränen aus.
Nach zehn Minuten hatte sie sich wieder unter Kontrolle. Sie stand mühsam auf, hievte den Leichnam bis zur Grube, schickte im Stillen ein Dankgebet zum Himmel und wuchtete das Paket hinein.
In der dunklen Erde lag ein Müllsack, der einmal ihr Mann gewesen war. Der sie geküsst und geliebt, in den Arm genommen und getröstet hatte. Den sie besser gekannt hatte als sich selbst und der ihr alles bedeutet hatte. Der ihr Leben gewesen war.
Sie hob das Olivenbäumchen in die Grube, stellte es direkt auf die Stelle, wo sie sein Herz vermutete, schaufelte die dunkle Erde über ihn, und dann war Johannes verschwunden. Für immer.
Sie saß noch lange auf der Terrasse im Hof, genoss diesen Moment der Stille. Irgendwann begann sie vor sich hin zu summen, und dann sang sie leise:
»WHEN THE NIGHT HAS COME, AND THE LAND IS DARK, AND THE MOON IS THE ONLY LIGHT WE’LL SEE, NO I WON’T BE AFRAID, OH, I WON’T BE AFRAID, JUST AS LONG AS YOU STAND, STAND BY ME. SO DARLIN’, DARLIN’, STAND BY ME, OH, STAND BY ME. OH, STAND, STAND BY ME. STAND BY ME.«
Ihre klare, helle Stimme klang durch die Nacht wie ein einsames Requiem.
Als das Käuzchen schrie, blies sie die Kerze aus, ging ins Haus, verschloss sorgfältig die Haustür und legte sich, vollkommen mit sich im Reinen, ins Bett.
Sie schlief sofort ein.
10
Magda erwachte am nächsten Morgen um Viertel nach acht und fühlte sich frisch und voller Energie. Sie stand sofort auf, duschte und wusch sich die Haare, wozu sie sonst oftmals keine Lust hatte. Hunger verspürte sie keinen, obwohl sie gestern fast den ganzen Tag nichts gegessen hatte, aber sie hatte Appetit auf Kaffee. Einen Cappuccino mit viel heißer, geschäumter Milch.
Also versuchte sie, die Espressomaschine wieder in Gang zu setzen. Sie säuberte die Siebe, ließ ein paarmal Essigwasser durchlaufen, um die Maschine zu entkalken, und versuchte schließlich, einen Espresso zu brühen. Der erste war dünn und labbrig, und sie kostete ihn noch nicht einmal. Für den zweiten nahm sie mehr Kaffee, drückte das Pulver fester in die Form, und beim dritten pumpte sie mit dem chromfarbenen Hebel auf und ab, bis der Espresso eine cremige Oberfläche hatte. Magda jubilierte innerlich, erwärmte Milch auf dem Herd, schäumte sie mit einem elektrischen Quirl auf und goss sie über den Kaffee.
Sie konnte sich gar nicht mehr erinnern, wann sie sich das letzte Mal zu Hause zum Frühstück einen Kaffee gemacht hatte, und genoss jeden Schluck. Es war wie ein Fest, und sie wurde fast euphorisch. Schluss mit der elenden Teetrinkerei am Morgen, jetzt würde sie bereits beim Anziehen das Gurgeln der Espressomaschine hören und riechen, wie der Kaffeeduft durchs Haus zog.
Und zum ersten Mal durchfuhr sie der Gedanke, vielleicht nie wieder nach Deutschland zurückzukehren.
Nachdem sie den Kaffee getrunken hatte, fuhr sie nach Montevarchi.
Vor dem Bahnhof fand sie auf Anhieb einen Parkplatz, was an einem Sonntagmorgen nicht ungewöhnlich war. Im winzigen Bahnhofsgebäude waren keine Kunden am Ticketschalter, die Angestellte der Bahn kam erst, als sie Magda vor dem Schalter warten sah. Magda sagte freundlich »Guten Morgen« und kaufte ein Biglietto nach Rom. Als die Signora es ihr unter der Glasabtrennung durchschob, fragte Magda nach dem nächsten Zug.
»Der fährt um elf Uhr fünfzehn«, sagte die Dame.
»Was?« Magda verschluckte sich fast. Ihre gespielte Erregung wirkte echt. »Ich dachte, es fährt jede Stunde ein Zug nach Rom! Um acht Uhr fünfzehn, um neun Uhr fünfzehn, um zehn Uhr fünfzehn …«
»Um zehn Uhr fünfzehn nicht. Erst wieder um elf Uhr fünfzehn.«
»Was ist denn das für ein Blödsinn?«
Die Frau zuckte nur die Achseln. Niemals würde sie als Bahnangestellte zugeben, dass der Fahrplan der Bahn unlogisch war.
»Hören Sie«, fuhr Magda fort, »das Ticket ist nicht für mich, sondern für meinen Mann. Er ist draußen und parkt den Wagen. Es ist furchtbar wichtig, dass er pünktlich nach Rom kommt, weil er Termine hat. Deswegen ist er ja auch nicht mit dem Wagen gefahren.«
»Ich kann es nicht ändern«, meinte die Frau hinter dem Schalter und seufzte vernehmlich, was signalisierte, dass ihr die Kundin langsam auf die Nerven ging.
»Gibt es eine andere Möglichkeit?« Magda trat von einem Bein auf das andere und rang die Hände, was die Bahnangestellte als Gezappel interpretieren musste.
»Vielleicht einen anderen Zug, der früher in Rom ankommt, aber bei dem man umsteigen muss? Irgendetwas muss doch möglich sein!«
»Mi scusi, Signora, aber es gibt keine andere Möglichkeit. Um elf Uhr fünfzehn. Früher nicht. Vielleicht versuchen Sie es ja mit dem Auto.« Damit wandte sie sich ab und signalisierte, dass die Unterhaltung für sie beendet war.
»In Italien funktioniert nichts. Aber auch gar nichts«, keifte Magda noch im Hinausgehen und war sich ziemlich sicher, dass die Ticketverkäuferin sie in Erinnerung behalten würde. Denn auch wenn sie derselben Meinung war, von einer Ausländerin – Magda sprach mit deutlich deutschem Akzent – ließ sie sich nicht das eigene Nest beschmutzen.
Magda war mit ihrem Auftritt äußerst zufrieden, setzte sich ins Auto und fuhr nach Hause.
11
Wie immer waren dienstags auf dem Markt in Ambra fünfzehn unterschiedliche Stände aufgebaut: mit Obst und Gemüse, Fisch, gebratenen Hähnchen, Porchetta und Wurstwaren, mit Süßigkeiten, Schuhen, Damenoberbekleidung, Tischdecken und Bettwäsche, mit Hosen, Westen, Strümpfen, Pullovern und mit Unterwäsche, Nachthemden, Kitteln.
Magda wollte unbedingt etwas kaufen. Am Obststand erstand sie einen Salatkopf, zwei Knollen Knoblauch, ein Kilo Karotten und eine Ananas. Am Schuhstand kaufte sie ein paar windige Sandalen für fünfzehn Euro, denen deutlich anzusehen war, dass die zarten Riemen nach fünfmaligem Tragen reißen würden. Und schließlich fragte sie am Unterwäschestand nach einem leichten, sommerlichen Schlafanzug für ihren Mann.
»Welche Größe hat denn Ihr Mann?«, fragte die Verkäuferin.
»Keine Ahnung. Er ist ungefähr zwanzig Zentimeter größer als ich und schlank.«
Die Verkäuferin hörte schon gar nicht mehr hin, kramte in ihren Kisten, zog von ganz unten einen in Zellophan verpackten Schlafanzug hervor und hielt ihn Magda unter die Nase.
»Zehn Euro«, sagte sie. »Wenn er nicht passt, können Sie ihn nächste Woche umtauschen.«
Der Schlafanzug war kreuzhässlich. Grün-gelb kariert mit blauen Streifen. Eine unmögliche Kombination.
Magda zögerte.
»Mag Ihr Mann Frottee?«, fragte die Verkäuferin. »In Frottee haben wir größere Auswahl. Für acht Euro.«
Magda kaufte zwei Frotteeschlafanzüge: einen blauen mit dunkelrotem Absatz am Hals und an den Schultern und einen olivgrünen mit braunen Taschen. Beide zusammen für fünfzehn Euro.
Anschließend setzte sie sich in die Bar und bestellte einen Cappuccino und ein Acqua minerale gassata. Das Schälchen mit den Erdnüssen, das auf dem Tresen stand, nahm sie mit hinaus an einen Tisch unter einen weißen Sonnenschirm auf der Piazza.
Während sie langsam und genüsslich ihren Cappuccino nicht trank, sondern löffelte, grüßte sie die vorbeikommende Zeitungsverkäuferin, den Friseur und den alten Lehrer, der schon lange pensioniert war und den alle mit »Maestro« anredeten.
»Buongiorno, Maddalena«, sagte plötzlich eine Stimme hinter ihr. Magda drehte sich um, und vor ihr stand Katharina Tassi, eine gute Bekannte, mit der sie immer gern ein paar Worte wechselte.
»Buongiorno, Katharina! Setz dich doch einen Moment!«
Katharina zog einen Stuhl heran. »Monica hat mir erzählt, dass ihr wieder im Lande seid. Und ich dachte, mal sehn, ob ich dich auf dem Markt treffe. Wie geht’s dir?«
»Gut. Sehr gut. Und dir?«
»Alles bestens.«
Es war also so, wie sie vermutet hatte. In Ambra wusste man, dass die Tillmanns wieder auf La Roccia waren. Okay, dachte Magda, dann spielen wir das Spiel. Geht ja nicht anders. Und Katharina wird mir dabei helfen.
»Was macht Johannes?«
»Ihm geht’s sehr gut. Er ist am Sonntag für einige Tage zu einem Freund nach Rom gefahren. Aber am Wochenende ist er wieder hier.«
»Wann seid ihr denn angekommen?«
»Vor drei Tagen. Unser Urlaub fängt also gerade erst an.«
»Wie schön. Dann können wir uns ja irgendwann mal treffen?«
»Na klar«, antwortete Magda freundlich.
Katharina war fünfundsechzig, lebte seit dem Tod ihres Mannes vor zwanzig Jahren völlig allein in einem riesigen Haus mit einer ebenso riesigen, aber lammfrommen Dogge. Jeden Nachmittag machte sie mit »Attila« einen zweistündigen Spaziergang, ganz egal, ob die Fliegen wegen der Hitze von der Wand fielen oder ob es Stein und Bein fror. Katharina lebte ihren eigenen geregelten Tagesablauf, ließ sich in ihren Ritualen von niemandem stören, tat nur das, was sie wollte, und war glücklich dabei. Die Witwenrente ihres Mannes genügte ihr und ihrem Hund zum Leben, ansonsten malte sie Aquarelle und verkaufte hin und wieder ein Bild an Gäste, die sich in ihrer kleinen Ferienwohnung im Parterre ihres Hauses eingemietet hatten.
Es war leicht, sich mit Katharina zu unterhalten, sie sprach ebenso gut Deutsch wie Italienisch. Magda hatte sie nie gefragt, ob sie eigentlich Deutsche oder Italienerin war.
Katharina ging in die Bar und holte sich einen Espresso. Als sie wiederkam, fragte Magda: »Hast du inzwischen eigentlich ein Auto?«
Katharina schüttelte den Kopf. »Nein. Der Fiat, den mir Luigi angeboten hat, war mir dann doch zu teuer. Und ich glaube auch nicht, dass ich mir jetzt noch eins anschaffen werde. Es geht ja auch ohne. Ich komme jedenfalls gut zurecht.«
»Am Freitagnachmittag fahre ich nach Montevarchi und hole Johannes vom Bahnhof ab. Willst du mitkommen? Dann können wir vorher noch kurz zu Ipercoop.«
Katharina überlegte nicht lange. Sie war darauf angewiesen, dass sie jemand im Auto mitnahm, wenn sie größere Besorgungen zu erledigen hatte. »Natürlich! Gerne! Das ist lieb von dir.« Sie stand auf. »Wann holst du mich dann am Freitag ab?«
»Warte mal … Johannes kommt um achtzehn Uhr fünfundzwanzig in Montevarchi an. Wenn ich dich um vier abhole, haben wir genügend Zeit zum Einkaufen und können auch noch gemütlich einen Kaffee trinken gehen.«
»Va bene. Mi piace. Danke, Magda. Na, dann bis Freitag.«
Während Katharina auf ihre kleine Vespa stieg und ihren Helm aufsetzte, überlegte sie, dass Magda wirklich ausgesprochen nett war. Das war ihr bisher noch nicht aufgefallen. Sonst war sie ihr immer eher kühl und zurückhaltend erschienen, wie jemand, der seine Ruhe haben will. Magda hatte ihr auch in der Vergangenheit noch nie angeboten, sie mit dem Auto irgendwohin mitzunehmen.
So kann man sich irren, dachte Katharina, winkte noch einmal kurz und fuhr knatternd davon.
Magda trank drei Cappuccino, bis ihr Puls zu rasen begann. Dann fuhr sie nach Pietraviva zum Casa Domenica, wo Monica und Massimo wohnten.