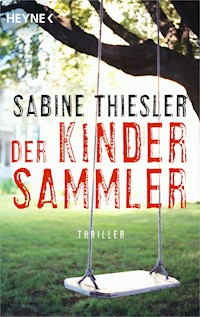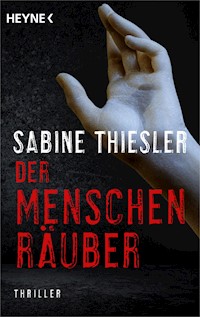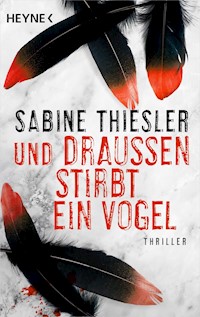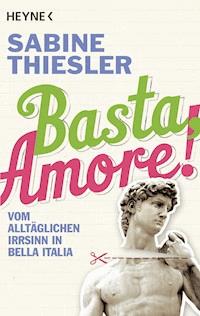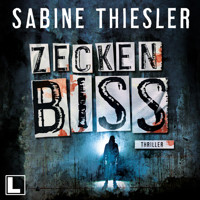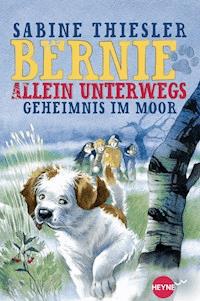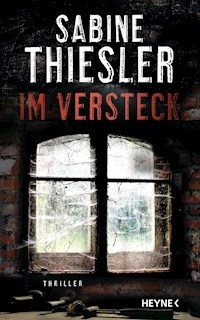9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Mord und Intrige in der Toskana
Tom ist ein anerkannter Kunstmaler, dazu reich und glücklich verheiratet. Alles läuft perfekt für ihn. Bis eines Nachts in seinem Haus etwas Schreckliches passiert. Unter Schock flieht er in ein toskanisches Bergdorf. Doch was ihm zunächst wie das Paradies erscheint, entpuppt sich schnell als Hölle. Tom hält das Alleinsein nicht aus, fühlt sich eingesperrt und verfolgt. Als er begreift, dass er niemandem mehr vertrauen kann, auch seinen Freunden nicht, ist es zu spät: Er trifft eine verhängnisvolle Entscheidung . . .
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 579
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Das Buch
Norddeutschland. Ein einsames Anwesen. Eine stürmische Gewitternacht. Ein Mann und eine Frau beim Liebesspiel. Plötzlich Geräusche: Es ist jemand im Haus.
Und dann geschieht Schreckliches. Tom, der Bewohner des Hauses, der wohlhabend, erfolgreich und glücklich verheiratet ist, wird durch das, was in der Nacht geschieht, vollkommen aus der Bahn geworfen. Von einer Sekunde zur anderen ändert sich sein ganzes Leben. Er flieht in ein kleines Bergdorf in der Toskana, taucht unter, aber wird zum Gejagten. Fassungslos muss er mit ansehen, dass er dabei ist, alles zu verlieren, was er besessen und was ihm jemals etwas bedeutet hat. Die Idylle wird zu seiner privaten Hölle. Er begreift, dass er niemandem mehr trauen kann. Selbst sein bester Freund wird zu seinem schlimmsten Feind, und Tom wird klar, dass er ihn mehr fürchten muss als die Polizei.
Umgeben von Verrat und Intrige wird er in seiner Verzweiflung selbst zum Mörder. Aber es ist bereits zu spät: Der Sturz in den Abgrund ist nicht mehr aufzuhalten.
Die Autorin
Sabine Thiesler, geboren und aufgewachsen in Berlin, studierte Germanistik und Theaterwissenschaften. Sie arbeitete einige Jahre als Schauspielerin im Fernsehen und auf der Bühne und schrieb außerdem erfolgreich Theaterstücke und zahlreiche Drehbücher fürs Fernsehen (u. a. Das Haus am Watt, Der Mörder und sein Kind, Stich ins Herz und mehrere Folgen für die Reihen Tatort und Polizeiruf 110). Ihr Debütroman Der Kindersammler war ein sensationeller Erfolg, und auch all ihre weiteren Thriller standen wochenlang auf der Bestsellerliste: Hexenkind, Die Totengräberin, Der Menschenräuber, Nachtprinzessin, Bewusstlos, Versunken, Und draußen stirbt ein Vogel, Nachts in meinem Haus, Zeckenbiss, Der Keller, Im Versteck, Verschwunden und Romeos Tod.
SABINE THIESLER
NACHTS INMEINEM HAUS
ROMAN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
© 2017 by Sabine Thiesler
© 2017 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: Eisele Grafik·Design, München, unter Verwendung eines Fotos von Lauren Bates / Gettyimages
Satz: Schaber Datentechnik, Austria
ISBN 978-3-641-20232-3 V004
www.heyne-verlag.de
www.sabinethiesler.de
Für Dich, Julia.
Alles Liebe.
ERSTER TEIL
DIE NACHT
1
Bönningstedt, Juni 2015
Seit zwei Tagen lag ein Tief über Norddeutschland, der Himmel war grau und wolkenverhangen, und kräftige Schauer peitschten über das Land. Jetzt gegen Abend wurde der Wind noch stärker, Tom erkannte dies immer daran, dass die uralte, nutzlose Katzenklappe neben der Eingangstür bei jeder Böe gegen den Rahmen schlug.
Charlotte schien sich nicht im Geringsten für das Wetter zu interessieren. Tom beobachtete sie durch die weit offen stehende Schlafzimmertür, wie sie mit bewundernswerter Sicherheit ihre Kleidung für eine Woche zusammensuchte und Schuhe, Unterwäsche, Blusen, Hosen, Röcke und Pullover in ihren Koffer legte. Sie zögerte nicht eine Sekunde, als wüsste sie ganz genau, was sie zu welcher Gelegenheit tragen würde. Und dabei summte sie noch leise vor sich hin.
In anderthalb Stunden ging ihr Flug, spätestens in zehn Minuten müssten sie das Haus verlassen.
Tom wurde schon nervös, wenn er Charlotte nur zusah. Sie strahlte eine Ruhe aus, als hätte sie noch lässig zwei Stunden Zeit. Wenn Tom zu einer Vernissage nach London, Wien oder New York fliegen musste, was er verabscheute, brauchte er mindestens einen ganzen Tag, um zu packen. Albträume von fürchterlichen Flugzeugkatastrophen wanderten schon tagelang vorher durch seine Gedanken, und er war ständig drauf und dran, alle Termine abzusagen und den Flug zu canceln.
Charlotte brauchte zum Packen höchstens zehn Minuten und schien sich darüber nicht die geringsten Gedanken zu machen.
»Es wird stürmisch!«, rief er in Richtung Schlafzimmer.
»Ja, ja …«, rief sie zurück. »Wir hatten schon schlimmeres Wetter. Weißt du noch, als ich von Sydney zurückgekommen bin?«
Das war vor zwei Jahren gewesen. Tom erinnerte sich noch gut daran. Über Hamburg tobte ein Sturm mit Orkanböen, der Flieger, in dem Charlotte saß, brauchte drei halsbrecherische Landeversuche, beim ersten kippte das Flugzeug beinah auf die Seite und schrammte mit den Tragflächen fast die Startbahn, bevor es wieder durchstartete. Sämtliche deutschen Nachrichtensendungen hatten die beängstigenden Bilder von den Landungsversuchen ausgestrahlt.
Tom hatte in der Ankunftshalle auf Charlotte gewartet und war fast verrückt geworden vor Angst.
Charlotte dagegen hatte während der hochgefährlichen Landeversuche ungerührt Manuskripte gelesen und sich überhaupt nicht dafür interessiert, wie die Maschine gegen den Sturm ankämpfte.
Als sie ihm dann endlich um den Hals fiel und ihn umarmte, war er grün im Gesicht, sie nicht.
»Ich bin fertig!«, verkündete Charlotte in diesem Moment. »Wir können los. Oder soll ich mir doch ein Taxi nehmen?«
»Nein!«, sagte Tom. »Warum denn? Ich fahr dich.«
Charlotte trug enge, verwaschene Jeans, eine lässige Bluse, darüber eine derbe Lederjacke und Wildlederstiefel, die sie sowohl im Sommer als auch im Winter anzog.
Tom fand seine Frau wundervoll. Charlotte, eine erfolgreiche Produzentin, die aussah wie eine Mischung aus Countrygirl und Rockerbraut.
Er nahm ihr den Koffer ab, und sie verließen das Haus.
Auf dem Weg zum Auto mussten sie sich mit aller Kraft gegen den Wind stemmen, der Himmel wurde immer schwärzer.
»Es gibt heute noch was«, sagte Tom, als er den Motor anließ.
Charlotte strich sich gelassen durch die kurzen blonden Haare. »Mach dir keine Sorgen. Niemand will sterben. Auch nicht die Piloten. Sie werden schon wissen, was sie tun. Ich hab übrigens vorhin im Internet nachgeguckt. Alle Flieger in Hamburg starten planmäßig.«
Trotz des schlechten Wetters kamen sie zügig voran.
»Was hast du heute Abend noch vor?«, fragte Charlotte.
Tom zuckte die Achseln. »Gar nichts. Wahrscheinlich seh ich mir in Ruhe den Tatort an. Bei dem Sauwetter jagt man ja keinen Hund vor die Tür. Aber irgendwann diese Woche geh ich vielleicht mit René in den Cotton-Club, da spielt ’ne Jazz-Band aus England, die ich ganz interessant finde.«
Charlotte lächelte. »Schade. Da wär ich auch gern mit dir hingegangen.«
»Ein andermal. Läuft uns ja nicht weg.« Er legte seine Hand auf Charlottes Knie und streichelte sie kurz.
»Stimmt«, sagte sie leise.
»Wann kommst du genau zurück?«
»Samstagabend, achtzehn Uhr fünfzehn. Holst du mich ab?«
»Na klar. Dann können wir gleich was essen gehen.«
»Wunderbar.« Charlotte atmete tief ein. Immer wieder wurde ihr bewusst, was sie für ein großartiges Leben führten. Sie konnten tun und lassen, was sie wollten, jeder lebte seine Träume, beide hatten einen Beruf, den sie liebten, sie besaßen ein herrliches, relativ einsam gelegenes Haus im Norden von Hamburg, unweit des kleinen Ortes Bönningstedt, außerdem ein fantastisches Ferienhaus auf Sylt, direkt in den Dünen mit Blick aufs Meer, eine Segelyacht im Hafen Wedel und mehr Geld auf dem Konto, als sie wahrscheinlich in ihrem ganzen Leben ausgeben konnten. Sie waren gesund, hatten keine Sorgen und führten eine gute Ehe. Da blieben keine Wünsche offen.
Charlotte wusste, dass dies alles keineswegs selbstverständlich war. Es hatte ganz andere Zeiten gegeben, aber sie hatten beide einfach unverschämtes Glück gehabt.
Tom fuhr am Flughafen Fuhlsbüttel auf den Parkplatz drei, den er wie seine Westentasche kannte, parkte auf dem zweiten Parkdeck, hob Charlottes Koffer aus dem Kofferraum, drückte ihr einen Kuss aufs Haar, und gemeinsam gingen sie in die Abfertigungshalle.
»Du musst nicht warten«, sagte Charlotte, als sie vor dem Schalter standen. »Ich checke jetzt sofort ein und setze mich dann gleich vor den Abflugschalter, denn ich muss für die Besprechung morgen noch ’ne Menge lesen und durcharbeiten.«
»Okay.« Tom nahm Charlotte in den Arm. »Pass auf dich auf, ja? Und viel Erfolg!«
Sie lächelte. »Ich werd mir Mühe geben.«
»Ich freu mich schon auf Samstag, wenn du wieder da bist.«
»Ich mich auch.«
Er zog sie an sich und küsste sie.
»Ich liebe dich«, flüsterte sie.
»Ich liebe dich auch.«
Er wandte sich ab. »Mach’s gut!«
Sie nickte und reihte sich in die Schlange zum Einchecken ein.
Im Davongehen drehte er sich noch einmal kurz um und winkte ihr zu.
Sie winkte zurück.
2
Es war keine Freude, mit dem breiten Audi-SUV auf dem engen Parkdeck zu manövrieren, aber Tom war jetzt die Ruhe selbst. Auf der Landstraße würde er irgendwo halten und telefonieren.
Es regnete ohne Unterbrechung, auf den Straßen schwamm das Wasser, der Scheibenwischer arbeitete auf höchster Stufe. Dicke schwarz-violette Wolken lagen über der Stadt, aber noch war kein Donnergrollen zu hören, auch Blitze durchzuckten noch nicht den düsteren Himmel.
Er fuhr langsam. Sechs Tage, bis Charlotte wiederkam, fast eine ganze Woche. Unter anderem würde er viel Zeit zum Malen finden.
Tom war ein renommierter Kunstmaler, der in den letzten zehn Jahren in der Kunstszene sehr bekannt geworden war, seine Bilder erzielten mittlerweile fünfstellige Preise. Aber das interessierte ihn weniger, Geld war nicht sein Problem, er arbeitete einfach leidenschaftlich gerne, weil er das Malen brauchte wie die Luft zum Atmen. Mit seinen Gefühlen konnte er schon immer schlecht umgehen, er hatte nicht sie, sondern sie hatten ihn im Griff. So war er seinen Stimmungsschwankungen und Ängsten, seinen Sehnsüchten und Verzweiflungen hilflos ausgeliefert, es sei denn, er malte und brachte das, was ihn erregte und bewegte, auf die Leinwand.
Charlotte hingegen war eine erfolgreiche Film- und Fernsehproduzentin, eine kühle Geschäftsfrau, die eiskalt verhandeln und den Sendern die Gelder aus den Rippen leiern konnte. Bei Filmstoffen und Drehbüchern verlor sie nie den dramaturgischen Durchblick, merkte sich Details wie ein Hochleistungscomputer, erklärte Redakteuren die Logik und schenkte Autoren so manch eine kreative Idee.
Während sich der sensible Tom seinen Träumen und Fantasien hingab, behielt sie immer die Realität im Blick und verlor nie die Kontrolle.
Die beiden ergänzten sich hervorragend, und das Duo Tom-Charlotte war einfach unschlagbar.
Tom hatte jetzt die Stadtgrenze erreicht und fuhr auf einer schnurgeraden Allee. Er schaltete das Radio ein und gleich wieder aus, Stimmen konnte er im Moment nicht ertragen, und er fand keinen Sender, der Musik spielte, die ihn entspannte.
In einer Ausweichbucht hielt Tom an, schaltete den Motor aus und wählte eine Nummer auf seinem Smartphone.
Sie meldete sich sofort.
»Hallo, Leslie«, sagte Tom, und seine Stimme klang weich und warm. »Wie sieht’s aus? Bleibt es dabei? Heute Abend bei mir?«
»Ist sie weg?«
»Ja. Ich hab sie gerade zum Flugplatz gebracht. Jetzt müsste sie bereits eingecheckt haben.«
»Ist gut. Ich komme.«
»Wann bist du da?«
»Keine Ahnung. Aber ich beeil mich. René ist heute Abend bei seinem geliebten Juristenstammtisch, der nur alle zwei Monate stattfindet. Das geht meist sehr lange, die lassen es immer richtig krachen, vor eins oder zwei ist er sicher nicht zu Hause.«
»Oh wie schön, Leslie, ich freu mich.«
»Bis dann.« Sie legte auf.
Tom startete den Motor und fuhr weiter. Diesmal trotz des Regens wesentlich schneller.
Leslie kam um kurz vor acht. Sie stand in ihren knallbunten Gummistiefeln und einem Regenschirm mit blauem Himmel und Schäfchenwolken, der so riesig war, dass fünf Personen darunter Platz gehabt hätten, vor der Tür, grinste breit, und Tom fand sie unwiderstehlich.
Sie kam herein, zog die Stiefel aus, hängte den tropfenden Monsterschirm an die Garderobe und ließ sich in Toms Arme fallen.
Er küsste sie wild und leidenschaftlich und fuhr ihr dabei sofort mit der Hand unter den Pullover, aber sie drehte sich aus seinem Arm.
»Nun mal langsam, junger Mann. Wir haben schließlich vier Stunden Zeit. Und ich kann mir ja ’ne Menge vorstellen, aber nicht hier im Flur zwischen den nassen Sachen!«
Tom lachte leise und zog sie ins Wohnzimmer.
Als Charlotte vor ungefähr einem halben Jahr in Berlin war und dort eine Krimiserie drehte, kam Leslie eines Abends bei Tom vorbei und hatte eine Quiche Lorraine dabei.
»Du armer Strohwitwer«, sagte sie lächelnd, »wahrscheinlich bist du ohne Charlotte schon fast verhungert. René ist auf einem Kongress. Was hältst du davon, wenn wir zusammen essen?«
»Das ist eine fantastische Idee. Komm rein.« Tom war in der Tat schon fast verhungert, ernährte sich nur von Keksen und Tee und malte den ganzen Tag.
Leslie schob die Quiche kurz in die Mikrowelle, und Tom öffnete eine Flasche Weißwein.
Als sie sich gegenübersaßen und sich zuprosteten, lag eine merkwürdige Fremdheit zwischen den alten Freunden in der Luft. So als träfen sie sich zum ersten Date. Dabei kannten sie sich jetzt seit über zehn Jahren. Leslie spürte, dass sie nervös und verunsichert war, denn sie wollte unbedingt, dass er sie in den Arm nehmen und küssen würde. Aber nicht als Freundin, sondern als Frau.
Und Tom dachte, verflucht noch mal, warum ist mir bisher nie aufgefallen, wie schön sie ist?
Sie aßen fast schweigend. Wussten nicht so recht, was sie sagen sollten.
In ihrer Not fragte Leslie: »Wie geht es Charlotte?«
»Gut. Sie ruft jeden zweiten Tag an.«
»Und? Wie laufen die Dreharbeiten?«
»Prima. Sie sind im Zeitplan, die Kosten bleiben anscheinend im Rahmen, der Regisseur hat die Sache im Griff, und die Schauspieler sind entspannt. Besser geht’s nicht.«
»Ach, das freut mich aber.«
Und schon brach die Unterhaltung wieder zusammen.
Aber ihre Blicke wurden tiefer. Und länger.
Bis Tom sein Besteck aus der Hand legte und fragte: »Sag mal, Leslie, würdest du mir Modell sitzen?«
Leslie wurde flammend rot.
»Ja … ja, warum nicht, aber … – nun ja – komisch ist das schon – wie kommst du denn jetzt darauf?«
»Ich stelle mir gerade vor, wie du aussiehst, wenn du nichts anhast.« Er lächelte. »Und ich glaube, du bist so schön, dass ich dich malen möchte.«
»Oh!« Leslie war völlig verwirrt. Wenn sie jetzt beide aufgestanden wären, sich ausgezogen hätten und im Schlafzimmer verschwunden wären – hätte sie kein Problem damit gehabt. Im Gegenteil. Denn eigentlich war sie nur deswegen gekommen. Sie wollte Tom. Sie wollte ihre Attraktivität testen. Sie wollte wissen, ob sexuelle Lust auch zwischen so alten, vertrauten Freunden möglich war.
Aber jetzt wollte er, dass sie nackt vor ihm posierte, und plötzlich schämte sie sich wie eine Sechzehnjährige, der ein junger Mann zum ersten Mal in ihrem Leben die Bluse aufknöpft.
Schließlich sagte sie einfach die Wahrheit: »Ich glaube, ich geniere mich vor dir, Tom.«
Er stand auf und nahm ihre Hand. »Komm.«
Tom bat sie, sich auszuziehen und auf eine lindgrüne Couch zu legen, die in seinem Atelier stand.
Zögernd und langsam zog sie sich aus und legte sich hin. Mit dem Rücken zu ihm.
»Nein«, sagte er, »bitte dreh dich um.«
Sie tat es, vorsichtig, und wurde sich in diesem Moment ihres Körpers vollkommen bewusst. Ihre Brüste waren fest und voll, ihre Taille schmal, aber ein kleiner Bauch hing nun ein wenig schlapp herab, und sie versuchte ihn einzuziehen, war sich aber bewusst, dass sie das nicht lange durchhalten würde. Ihre Scham war rasiert, und sie fragte sich, was Tom darüber denken würde. Ihre Oberschenkel waren ein klein wenig zu dick, dafür waren ihre Knie schmal und ihre Waden wunderschön geformt. Sie konnte es nicht ändern, jetzt wusste er, wie sie aussah, und sie schämte sich entsetzlich.
»Bleib so«, sagte er, »aber stütze den Kopf auf den rechten Arm.«
Sie tat es und entspannte sich ein klein wenig. Es ist doch wirklich nichts dabei, versuchte sie sich immer wieder einzureden, wir sind doch dicke Freunde, und in einer Berghütte würden wir bestimmt auch in einem Zimmer übernachten.
Was für eine prachtvolle Frau, dachte Tom, eigentlich das komplette Gegenteil von Charlotte. Die üppige, große und brünette Leslie konnte man mit der schmalen, zierlichen, blonden Charlotte überhaupt nicht vergleichen.
Ganze drei Minuten zeichnete er, dann hielt er es nicht mehr aus. Das ist unprofessionell, aber richtig gut, dachte er, während auch er sich auszog und sich zu ihr auf die breite Couch legte.
Und sie reagierte, als hätte sie die ganze Zeit nur darauf gewartet, und küsste ihn.
In den kommenden Wochen und Monaten trafen sie sich immer, wenn es nur irgendwie möglich war. Es war ein Spiel. Ein Spiel mit der Lust und der Ahnungslosigkeit der Ehepartner. Denn eines war beiden klar: Leslie liebte René, und Tom liebte Charlotte. Ihre Ehen waren ihnen heilig, sie wollten sie nicht gefährden, aber wenn sie sich sahen und miteinander ins Bett gingen, hatten sie das Gefühl, ein großes, lustvolles Abenteuer zu erleben, das sie nicht mehr missen wollten.
Tom stand in der Küche, schwenkte Garnelen in der Pfanne, gab Knoblauch und Paprika dazu, löschte das Ganze mit einem Schluck Weißwein ab und füllte es auf zwei Teller. Dazu gab es Baguette, einen kleinen grünen Salat und Champagner.
Zum Essen setzten sie sich ins Wohnzimmer, auf dem Tisch brannten mehrere Kerzen.
Sie aßen lange Zeit schweigend und sahen sich an.
»Es schmeckt fantastisch«, meinte Leslie schließlich.
»Das freut mich. Und? Was gibt’s Neues?«
»Nicht viel. Eigentlich gar nichts. Und bei dir?«
»Auch nichts. Nur Charlotte arbeitet ziemlich viel. Tag und Nacht eigentlich. Sie schwimmt auf einer regelrechten Erfolgswelle, alles, was sie anschiebt, klappt, und ich hab manchmal Angst, dass sie sich übernimmt.«
»Wann hab ich sie das letzte Mal gesehen?«, überlegte Leslie. »Vor drei Wochen ungefähr. Da erschien sie mir sehr entspannt und äußerst zufrieden.« Sie lächelte. »Überarbeitet kam sie mir jedenfalls nicht vor.«
»Hoffentlich hast du recht, denn jetzt plant sie auch noch, das Leben von Liz Taylor zu verfilmen, und da freut sie sich drauf.«
»Echt? Ich bin ein großer Fan von Liz Taylor. Hast du Wer hat Angst vor Virginia Woolf gesehen?«
»Sicher. War sensationell …« Er brach mitten im Satz ab, denn er wollte jetzt weder über das Theaterstück noch über den Film noch über Charlotte diskutieren. »Hast du Lust auf ein Bad, oder gehen wir gleich ins Bett?«
»Ich hab Lust auf beides«, meinte Leslie und grinste.
Sie stand auf und löschte die Kerzen. Tom griff nach Flasche und Gläsern, und sie gingen nach oben.
Während sie sich später liebten, grummelte in der Ferne der Donner. Regen prasselte gegen die Fenster.
Plötzlich gab es einen Knall, einen gleißend hellen Blitz und einen einzigen, ohrenbetäubenden Donnerschlag.
Und augenblicklich war es stockdunkel.
3
Leslie kicherte und seufzte leise.
»Psst!«, zischte Tom.
Sie kicherte immer noch. »Du kitzelst mich!«
»Sei mal still!« Tom drückte ihr die Hand auf den Mund.
»Warum machst du denn nicht weiter?«, fragte sie und biss ihm ins Ohrläppchen.
»Nein. Ruhig! Da war was. Ein merkwürdiges Geräusch. Ich glaub, ich hab ein Poltern gehört.«
»Du spinnst! Das ist das Gewitter!«, flüsterte Leslie gereizt, die sich Toms Berührungen gerade vollkommen lustvoll hingegeben hatte, in ihren sexuellen Fantasien davongeflogen war und nun hart in der Realität landete.
»Psst!«
Er wusste nicht, ob es wirklich im Haus gewesen war. Unten in der Küche? Oder im Wohnzimmer?
Momentan schwieg das Gewitter, auch der Regen hatte nachgelassen.
Tom spürte, dass er den Atem anhielt, wagte es nicht, sich zu bewegen.
Vorsichtig richtete er sich ein wenig auf. Sein Halswirbel knackte, und dieses Geräusch hallte schreiend laut in seinem Kopf. Als hackte jemand Holz.
Die Kerze auf dem Nachttisch flackerte, er sah Leslies ungläubigen Gesichtsausdruck und legte den Finger auf seine Lippen.
Vor den Fenstern waren keine Gardinen, das fahle Mondlicht warf einen leichten Schimmer aufs Bett.
Vollkommen unbeweglich lauschte er weiter in die Stille. Leslie beobachtete ihn und bewegte sich nicht.
Eine knappe Minute wartete er und horchte. Holte nicht ein einziges Mal Luft und registrierte zunehmend erleichtert, dass die Stille blieb. Wahrscheinlich hatte er sich getäuscht.
Seit vier Jahren lebte er nun mit Charlotte in diesem komplett abgelegenen friesischen Haus. Sie liebten es beide, aus jedem Fenster über die weiten Felder gucken zu können, aber waren in dieser Einsamkeit auch auf sich gestellt. Das nächste Nachbarhaus lag zwar in Sichtweite, aber dennoch drei Kilometer entfernt. Einen Einbruch oder Überfall bekam niemand mit, und das war für sie, seit sie hier wohnten, die absolut schlimmste Vorstellung.
Immer noch vollkommene Ruhe.
Er hörte nichts. Gar nichts.
Langsam ließ er sich zurück ins Kissen sinken. Wahrscheinlich hatte er sich alles nur eingebildet. Er atmete tief durch und entspannte sich.
Die Digitalanzeige des Radioweckers war wegen des Stromausfalls schwarz, er hatte keine Ahnung, wie spät es genau war, aber uns bleiben bestimmt noch zwei Stunden, sagte er sich, mach dich nicht verrückt.
Da.
Da war es wieder. Verdammt. Diesmal hatte er es ganz deutlich gehört, es hatte geklungen, als wäre jemand gegen einen Stuhl gestoßen und hätte ihn über die Fliesen geschoben. Ein schabendes Geräusch. Ganz genau konnte er es nicht deuten. Aber er war sicher, dass es nicht der Wind war, der das Kabel der Außenlaterne gegen die Wand schlug. Und es war auch kein Tier, das draußen die Gießkanne oder einen Klappstuhl auf der Terrasse umgeworfen hatte. Es kam nicht von draußen. Es kam von drinnen.
Jemand war im Haus.
Nein, bitte nicht!, flehte er innerlich. Das darf nicht wahr sein, nein, das kann einfach nicht sein!
Der Sturm heulte und machte ihn ganz verrückt, weil er die Geräusche nicht eindeutig orten konnte. War es vielleicht doch die Loo-Tür, die am Haken eingehängt im Wind hin und her schlug?
Nein, es kam aus einer anderen Richtung.
Und wieder hörte er etwas. Leiser zwar, aber eindeutig. Von innen. Nicht von draußen.
Jetzt kam es darauf an, keinen, nicht den geringsten Laut von sich zu geben. Bloß nicht den Einbrecher auf sich aufmerksam machen, der vielleicht davon ausging, dass niemand im Haus war.
Tom war klar, dass das Überraschungsmoment bei ihm bleiben musste, sonst hatte er verloren.
Er legte Leslie die Hand auf den Arm. »Ganz still«, flüsterte er. »Rühr dich nicht. Keinen Laut jetzt!«
Das Herz schlug ihm vor Aufregung bis zum Hals, als er langsam mit seiner Hand unter dem Bett nach seiner Harpune tastete. Vor einem knappen halben Jahr hatte er sie im Internet bestellt, weil man diese Waffe ohne Waffenschein kaufen konnte. Auslöser war ein Überfall im Nachbarort gewesen. Drei junge Männer waren in das Haus eines Ehepaares eingedrungen und hatten die beiden alten Leute zusammengeschlagen, gefesselt und gefoltert. Sie wären an ihren Verletzungen fast gestorben. Erbeutet hatten die Räuber das gesamte Ersparte der beiden Alten und den Familienschmuck.
Bereits eine Woche nach der Bestellung lag das Paket auf dem Küchentisch. Tom setzte die Harpune zusammen und probierte sie im Garten aus, als Charlotte nicht zu Hause war, weil er wusste, dass sie eine Aversion gegen Waffen aller Art hatte.
Sie funktionierte hervorragend, und nach einigen Schüssen gingen ihm das Spannen der Feder und das Einlegen des Pfeils schon leichter und schneller von der Hand.
Dann hatte er sie – für alle Fälle – unters Bett gelegt und seitdem nicht mehr hervorgeholt.
Seine Finger tasteten weiter den Fußboden ab. Verflucht! Er kam nicht dran! Sie lag zu weit entfernt. Wahrscheinlich hatte die Putzfrau sie mit jedem Wischen immer mehr in die Mitte geschoben.
Instinktiv legte er beruhigend die Hand auf Leslies Oberschenkel, die wie erstarrt neben ihm lag.
Dann drehte er sich vorsichtig und so leise wie möglich auf die Seite, um noch tiefer unter das Bett fassen zu können.
Da! Endlich! Er bekam die Harpune, den Ladestab, einen Pfeil und eine Pfeilspitze zu fassen und zog alles vorsichtig unter dem Bett hervor, damit nichts davon über die Dielen schrammte.
In der Stille der Nacht erschien jedes leichte Kratzen so laut wie die Arbeitsgeräusche einer Horde Handwerker im Haus.
Langsam hob er die Harpune im Dunkeln hoch und ärgerte sich, dass er sie so lange nicht mehr in der Hand gehabt hatte.
»Was machst du denn da?«, hauchte Leslie.
»Sei ganz still, ja?« Noch einmal legte er den Finger auf die Lippen.
Lautlos glitt er aus dem Bett und stand auf. Er nahm den Ladestab, schob ihn von oben mit aller Kraft in den Lauf der Harpune und presste die Feder bis zum Anschlag. Als sie endlich einrastete, klang es in seinen Ohren wie ein Peitschenknall.
Er hielt inne. Wartete einen Moment – aber nichts geschah.
Dann setzte er den Pfeil ein, nahm die Pfeilspitze, schraubte sie mit zitternden Händen langsam und vorsichtig auf den Pfeil und zwang sich zur Ruhe, um sie nicht zu verkanten.
Die Zeit, sich eine Hose oder Hausschuhe anzuziehen, nahm er sich nicht.
»Was soll das? Was hast du vor?« Leslie saß im Bett und starrte ihn mit großen, ängstlichen Augen an.
In diesem Moment wurde ihm klar, dass es eine Katastrophe wäre, wenn sie ihm nach unten folgen würde. Das musste er unbedingt verhindern.
»Leslie«, flüsterte er so leise, aber auch so eindringlich wie möglich. »Bleib hier und verhalte dich ganz ruhig, bitte. Ich glaube wirklich, da unten ist jemand. Ich seh jetzt mal nach.«
»Soll ich die Polizei rufen?«, fragte sie.
»Nein. Warte hier auf mich. Sei leise. Ich sag dir Bescheid. Vielleicht hab ich mich ja auch getäuscht.«
Er versuchte, ihr beruhigend zuzulächeln, aber es gelang ihm nicht.
Seinem ärgsten Feind wünschte er nicht, jemals in solch eine Situation zu kommen.
Die Harpune in der linken Hand, drückte er vorsichtig mit der Schulter gegen die Schlafzimmertür, damit sie nicht knarrte, und öffnete sie lautlos mit der rechten.
Er war darauf gefasst, eventuell gleich einer dunklen Gestalt im Flur gegenüberzustehen.
Aber dies geschah nicht. Der kurze Flur war leer.
Ihm brach der Schweiß aus. Seine Finger fühlten sich glitschig an, er hatte das Gefühl, die Waffe nicht sicher halten zu können, versuchte aber, den Gedanken zu verdrängen.
Ich muss da durch, dachte er, ich muss das jetzt aushalten. Ganz egal, was geschieht. Oh mein Gott!
Noch nie in seinem Leben hatte er solch eine Scheißangst gehabt. Ihm wurde klar, dass er nur einen, nur einen einzigen verdammten Schuss hatte. Wenn der danebenging, war er geliefert, dann würde der Einbrecher ihn und Leslie fertigmachen, denn der Typ war sicher nicht unbewaffnet. Und was war, wenn es zwei waren? Oder eine ganze Bande? Dann konnte er mit einem Schuss herzlich wenig ausrichten, es sei denn, er traf und schlug dadurch die anderen in die Flucht.
Langsam näherte er sich im Dunkeln der Treppe. Durch ein winziges quadratisches Fenster in der Decke drang kaum Mondlicht. Aber in diesem Haus kannte er jeden Zentimeter und fand sich wie ein Schlafwandler zurecht. Zumindest darin war er den Einbrechern überlegen.
Jetzt musste er die Treppe ein Stück hinuntergehen, um zu sehen, was los war.
Er setzte seine Füße so vorsichtig, als liefe er über schlafende Welpen.
Die dritte und die fünfte Stufe von oben knarrten, das wusste er, daher mied er die beiden und machte jeweils behutsam einen großen Schritt.
Tom war noch sieben Stufen vom Ende der Treppe entfernt und blieb im Dunkeln stehen.
Von hier aus konnte er übers Geländer nach unten in die Küche sehen.
Sie war leer, aber die Tür zum Wohnzimmer stand offen.
Nur mit Mühe konnte er eine Gestalt wahrnehmen, die sich im Dunkeln durchs Wohnzimmer bewegte und nun zur Küche hereinkam.
Sein Herz stolperte, ihm wurde übel, und seine Hand krampfte sich um die Harpune. Hundertmal hatte er in Gedanken schon so eine Angstsituation durchgespielt, er konnte kaum glauben, dass sie jetzt Realität war.
Tom konnte die Person nur schattenhaft wahrnehmen, die jetzt die Hand auf die Klinke legte, um die geschlossene Tür zum Flur hin zu öffnen. Vom Flur aus kam man ebenfalls durch eine schmale Treppe in den ersten Stock – und ins Schlafzimmer, wo Leslie sich wahrscheinlich gerade zu Tode fürchtete.
Tom geriet in Panik. Er überlegte nicht mehr, in seiner Angst reagierte er nur noch. Beinah lautlos ging er die wenigen noch fehlenden Stufen hinunter und hob die Harpune. Jetzt kam es darauf an. Jetzt musste er treffen. Nur dieses eine Mal.
Oh Gott!
Einen Moment überlegte er zu fliehen, nach oben zu rennen, sich im Schlafzimmer zu verbarrikadieren und die Polizei zu rufen, aber dann fiel ihm ein, dass die Tür keinen Schlüssel hatte, und so blieb er innerlich zitternd und bebend stehen.
»Stopp!«, rief er laut, aber fühlte sich gleichzeitig unendlich schwach.
Wie elektrisiert fuhr die Gestalt herum, und Tom schoss im selben Moment. Ohne nachzudenken. Der Abzug an der Harpune hatte so gut wie überhaupt keinen Druckpunkt.
Die gewaltige Wucht des Pfeils traf den menschlichen Schatten direkt von vorn, durchbohrte seinen Hals knapp unterhalb des Kehlkopfes und nagelte ihn an die schwere Vollholztür.
Als Tom merkte, dass der Eindringling augenscheinlich getroffen und handlungsunfähig war, tastete er sich die Treppe zur Küche hinunter und weiter zur Gläservitrine, denn er wusste, dass im untersten Fach links eine Stabtaschenlampe stand, die immer zum Einsatz kam, wenn der Strom ausfiel.
Er fand sie sofort, schaltete das starke grelle Licht der Lampe an und leuchtete in das Gesicht des Einbrechers.
In Charlottes Gesicht.
Sie starrte Tom mit riesigen, angsterfüllten Augen an und konnte offensichtlich nicht fassen, dass sie gerade dabei war zu sterben, dass ihr eigener Mann zu ihrem Mörder geworden war.
Unablässig blubberte das Blut aus ihrem Hals. Sie versuchte die Arme zu heben, aber schaffte es nicht mehr, ihre Beine gaben nach, doch sie konnte nicht zu Boden sinken, da der Pfeil mit Widerhaken fest im Holz steckte. Sie bekam keinen Ton mehr heraus.
Toms Entsetzen war übermächtig. Er stieß einen schrillen, lang anhaltenden Schrei aus, als würde er am Rande einer Schlucht den Halt verlieren und in schier unendliche Tiefen stürzen.
Beinah ohnmächtig vor Schreck fiel er vor der Sterbenden auf die Knie. »Charlie, Liebes«, schluchzte er, »das habe ich nicht gewollt, oh mein Gott, was habe ich getan? Charlie, bleib bei mir, bitte, das konnte ich doch nicht ahnen, ich dachte …« Dann versagte ihm die Stimme, er umklammerte ihre Beine und weinte hemmungslos.
Als er den Kopf hob und wieder die Taschenlampe auf sie richtete, sah er, dass Charlotte noch einmal die Augen weit aufriss wie ein harpunierter Thunfisch, der sich im Todeskampf drehte und durchs Wasser trudelte.
Sie gab ein grauenhaftes Röcheln von sich und schloss für immer die Augen. Ihr Kopf fiel nach vorn wie der des Gekreuzigten.
Da verließ Tom die Kraft. Er konnte nicht mehr knien, konnte sich nicht mehr halten und sank zu Boden. Lehnte an der Wand. Vollkommen fertig. Leer und voller Entsetzen.
Langsam kam Leslie in Unterhose und Pullover die Treppe herunter.
»Tom«, hauchte sie kaum hörbar.
Er antwortete nicht.
In seinem Inneren tobte ein Chaos wie noch niemals zuvor.
»Tom«, wiederholte sie. »Was ist los?«
Er sagte nichts, richtete nur den Schein der Taschenlampe auf Charlotte.
»Oh mein Gott!«, stöhnte Leslie. »Was zum Teufel hast du getan?«
4
Tom weinte haltlos.
»Reiß dich zusammen!«, schrie Leslie. »Und versuch, das verdammte Licht wieder anzuschalten! Schnell! Dreh die Sicherungen rein, oder was weiß ich. Wir müssen sehen, ob noch irgendwas zu machen ist, aber in dieser Finsternis ist das unmöglich!«
Tom schluchzte und rührte sich nicht.
»Nun mach schon!«, brüllte sie. »Verdammt noch mal, hilf mir!«
Jetzt erst reagierte er. Langsam wie in Trance erhob er sich und lief mit der Taschenlampe hinaus zum Sicherungskasten.
Nur Sekunden später ging das Licht an, und Tom kam wieder herein.
Der Anblick der toten, von der Harpune durchbohrten Charlotte war im hellen Licht noch viel grausamer als das, was sie im Schein der Taschenlampe gesehen hatten.
Leslie behielt einen kühlen Kopf, tastete nach Charlottes Puls und untersuchte, ob noch irgendeine Spur von Leben in ihr war. Dabei bemühte sie sich, nicht in die riesige Blutlache auf den hölzernen Dielen zu treten.
Tom stand stumm daneben. Sein Herz raste.
»Es ist zu spät«, sagte Leslie schließlich. »Tom, bist du eigentlich vollkommen verrückt geworden? Wie konntest du denn bloß gleich losschießen? Und hast du nicht gesehen, dass es Charlotte war?«
Tom schüttelte den Kopf. »Es war stockdunkel.«
»Aber auch wenn ich jemanden nur schemenhaft wahrnehme, weiß ich doch, ob es ein Mann oder eine Frau ist!«
»Jeans und Lederjacke und kurze Haare. Ich hab’s wirklich nicht gesehen.«
»Das glaubt dir kein Mensch!«
»Denkst du, ich hab Charlotte mit Absicht umgebracht?« Tom war, als würde sein Schädel platzen.
»Ich weiß nicht, was ich denken soll, Tom, aber ich weiß, dass du jetzt wirklich bis über beide Ohren in der Scheiße steckst.«
»Was machen wir denn jetzt? Was mach ich bloß? Was soll ich denn tun, Leslie?«, schrie er hilflos, als könnte Leslie alle Probleme dieser Welt lösen und vom Tisch wischen.
»Das weiß ich doch auch nicht! Du musst die Polizei rufen.«
Tom zitterte am ganzen Körper. Er überlegte, ob es nicht das Beste wäre, einfach ins Bett zu gehen und zu schlafen. Morgen früh würde er aufwachen, der Spuk wäre vorbei und alles in bester Ordnung. Es war grauenvoll, dass man manchmal aus den schlimmsten Albträumen einfach nicht erwachte.
Wie ein Tiger im Käfig lief er im Kreis immer wieder um den Küchentisch herum. Dass er die ganze Zeit völlig nackt war, schien er gar nicht zu bemerken.
»Warum hast du denn sofort geschossen, du Vollidiot?«, schrie sie ihn an. »Ohne zu fragen, wer da ist? Charlotte hätte bestimmt gesagt: ›Hallo, ich bin’s‹, und dann wäre alles klar gewesen, aber nein, du denkst, das muss ein Einbrecher sein, und ballerst einfach drauflos!«
»Aber ich konnte doch nicht ahnen, dass es Charlotte ist! Ich hab sie doch vorhin erst zum Flugplatz gebracht!« Er kam vor Leslie zum Stehen und rang die Hände.
Noch nie hatte sie so einen verzweifelten Menschen gesehen. »Wahrscheinlich ist der Flug bei diesem Sauwetter gecancelt worden. Himmel, Tom! Wie kann man nur solch eine Scheiße bauen!«
Er weinte wieder und jammerte dabei wie ein junger Hund.
»Setz dich«, befahl Leslie knapp. »Wir müssen überlegen.«
Tom setzte sich zu ihr an den Küchentisch.
Eine Weile schwiegen beide. Dann sagte Tom: »Ich rufe René an. Er weiß bestimmt, was man in dieser Situation am besten tut.«
Er griff das Telefon.
»Nein, mein Lieber, damit wartest du schön, bis ich verschwunden bin«, meinte Leslie scharf und nahm ihm das Telefon aus der Hand. »Auf eine halbe Stunde kommt’s jetzt auch nicht mehr an. Niemand weiß, dass hier ein Mord geschehen ist. Du hast Zeit, und ich werde wegen dieses Wahnsinns nicht meine Ehe aufs Spiel setzen.«
»Mord?«, schrie Tom entgeistert. »Hast du Mord gesagt?«
»Na, was denn sonst? Was glaubst du, was das für die Polizei ist, wenn du in deinem Haus deine Ehefrau mit einer Harpune durchbohrst? Ich zieh mich jetzt schnell an und haue ab. Und dann mach, was du willst. Ruf meinetwegen René an, aber kein Wort, dass ich heute Abend hier war, ist das klar? Lass mich aus dem Spiel!«
Tom nickte schwach. Leslie stand auf und lief die Treppe hinauf.
Mühsam wie ein alter Mann zog er sich vom Stuhl hoch, schleppte sich in die Gästetoilette und erbrach sich.
Nur zwei Minuten später kam Leslie fertig angezogen wieder herunter, ging in den Flur, nahm ihre Handtasche, zog ihre Gummistiefel an und griff ihren Schirm.
»René wird dir bestimmt helfen«, sagte sie zu Tom, der ihr nachgekommen war. »Am besten, du lässt Charlotte da, wo sie ist. Fass nichts an. Ich drück dir die Daumen, dass ihr beide eine Lösung findet.« Sie sah sich um. »Hoffentlich hab ich nichts vergessen. Wir telefonieren, ja? Sag mir, was René dir geraten hat, aber vielleicht erzählt er es mir ja auch von allein. Tschüss, Tom.« Sie drückte ihm einen Kuss auf den Mund. »Irgendwie kriegen wir das alles hin, da bin ich ganz sicher, verlier jetzt nicht die Nerven.«
Sie drehte sich um und lief hinaus in die Nacht.
Tom stand da und wusste nicht, wie ihm geschah. Noch nie in seinem Leben hatte er sich so hilflos, so allein, so ohnmächtig und im selben Moment so voller Angst und verzweifelt gefühlt. Alle Emotionen stürmten gleichzeitig auf ihn ein und machten ihn völlig handlungsunfähig.
Wie in Trance schloss er die Haustür ab, obwohl es eigentlich idiotisch war. Wenn René kam, musste er sie ja wieder aufschließen.
Er hatte keine Ahnung, was er jetzt tun sollte.
Er wusste nur eins: Nach dieser Nacht würde er niemals wieder der sein, der er mal gewesen war.
Ungefähr eine Viertelstunde später hatte er sich vollständig angezogen und wählte Renés Handynummer.
Beim zehnten Klingeln nahm René ab.
»Ich bin’s, Tom.«
»Ach, Tom! Du, ich kann grade nicht, ich bin mit ein paar Freunden unterwegs, ich ruf dich morgen an, ja?«
»Bitte, René, ich brauche deine Hilfe! Komm her, es ist wichtig!«
»Hat es nicht bis morgen Zeit?«
»Nein. Verflucht noch mal, René, es geht um Leben und Tod, also bitte, beweg deinen Arsch und komm her!«, brüllte Tom.
»Gib mir ein Stichwort, sonst lege ich auf und saufe weiter.«
»Ich hab Charlotte mit einer Harpune erschossen. Weil ich dachte, sie ist ein Einbrecher.«
Eine Weile hörte es sich an, als wäre die Leitung tot. Dann sagte René: »Oh mein Gott …«
»Ja.« Tom schluchzte.
»Wo ist sie? Ich meine, wo ist es passiert?«
»Sie hängt an der Küchentür. Der Harpunenpfeil hat sie ans Holz genagelt.«
»Du spinnst doch. Du willst mich auf den Arm nehmen!«
»Nein, René. Bitte komm!«, kreischte Tom hysterisch. »Verstehst du nicht? Ich habe Charlotte umgebracht!«
»Und du bist sicher, dass du nicht komplett besoffen bist?«
»Bitte, René! Hilf mir! Und sag mir, was ich tun soll!«
»Gar nichts. Fass nichts an! Verändere nichts! Und ruf noch nicht die Polizei. Warte auf mich, ich bin schon unterwegs.«
5
Dreißig Minuten später hörte Tom ein Auto auf dem Kies, und nur Sekunden später kam René durch die Terrassentür.
Obwohl er darauf vorbereitet war, stand er völlig konsterniert vor Charlottes Leiche. Ein Schatten zog über sein Gesicht, und er sagte leise: »Oh Mann, und ich hatte bis zuletzt gehofft, du machst bloß Sprüche.« Eine Weile schwieg er. Dann drehte er sich zu Tom um. »Sag mal, spinnst du? Hast du sie nicht alle? Bist du völlig durchgedreht?«
Tom zuckte kraftlos die Achseln und sah aus, als würde er jeden Moment zusammenklappen. Er begann wieder zu schluchzen.
»Erzähl!«, sagte René. »Ganz genau. Ich muss jede Einzelheit wissen. Was ist passiert? Versuch dich zu erinnern. An jede Sekunde!«
»Willst du ’n Whisky?«, fragte Tom.
»Nein. Wir sollten jetzt nicht trinken. Keiner weiß, was heute Nacht noch alles geschieht.«
Sie setzten sich an den Küchentisch. Tom hatte seine tote Frau im Blick.
»Können wir sie nicht abhängen, auf die Erde legen und zudecken? Ich kann das nicht ertragen, dass sie da so hängt.«
»Nein. Das überlassen wir der Spurensicherung. Aber komm, wir gehen ins Wohnzimmer.«
Sie gingen rüber und setzten sich in zwei Sessel.
Tom fühlte sich besser.
»Wo war denn Charlotte heute Abend?«
»Ich hab sie am späten Nachmittag zum Flughafen gebracht. Sie wollte nach München fliegen und Samstagabend wieder zurück sein.«
»Ah ja. Und was ist dann passiert?«
»Ich war oben im Schlafzimmer und hab ein Geräusch gehört.«
»Wann war das?«
»So um zehn, halb elf.«
»Und da hast du schon im Bett gelegen und geschlafen?« René verdrehte ungläubig die Augen.
»Ja, sicher. Erst tobte dieses fürchterliche Gewitter, und dann hab ich ein Geräusch gehört.«
»Seit wann gehst du um zehn ins Bett, Tom? Das war doch zum letzten Mal, als du dreizehn warst und am nächsten Tag ’ne Mathearbeit schreiben musstest?«
»Ich fühlte mich nicht wohl.«
»Erzähl mir keine Opern. Das letzte Mal, als du dich nicht wohlgefühlt hast, war bei deiner Geburt.«
»Kann man nicht auch mal müde sein?«
»Man kann. Aber du nicht. Du stehst jede Nacht bis morgens um fünf im Atelier und malst. Und pennst dann bis mittags um eins. Für dich bricht doch abends um zehn erst der Nachmittag an. Und da liegst du oben im Bett? Bitte!«
Tom zögerte einen Augenblick, dann sagte er: »Ich war nicht allein.«
»Aha. Das versteh ich. Oh, wie unangenehm! Du liegst mit einer Geliebten im Bett, und deine Frau kommt nach Hause. Dumm gelaufen.«
»Ich dachte, sie ist ’ne Woche weg!«
»Tja, Pech.«
»René, bitte, glaub mir: Ich hab wirklich gedacht, da ist ein Einbrecher im Haus! Es war Notwehr, reine Notwehr!«
»Das einem Richter klarzumachen, mein Lieber, ist eine oscarverdächtige Meisterleistung.«
»Oh Mann!« Tom stützte seinen Kopf in die Hand und brach wieder in Tränen aus.
»Jetzt reiß dich zusammen und sag mir, wer bei dir war. Sie könnte eine wichtige Zeugin sein, die dich entlastet! Du glaubtest an einen Einbruch, du hattest Angst um sie, wolltest sie beschützen et cetera et cetera, da kann man eine schöne emotionale Geschichte bauen. Aber ich brauche ihren Namen.«
»René, hör auf. Bitte!«
»Tom! Ich glaube, du kapierst nicht, in welcher Situation du steckst! Es geht um deinen Kopf, beziehungsweise um eine erhebliche Anzahl von Jahren im Knast! Außerdem kann Charlotte ihren Namen nicht mehr erfahren. Also bitte, es tut niemandem weh, wenn du mir sagst, wer sie ist, es hilft dir nur.«
»Es war ein Quickie, verstehst du? Ein One-Night-Stand. Nichts von Bedeutung und absolut nicht wiederholungsbedürftig. Aber ich darf dir nicht sagen, wie sie heißt, weil sie tierisch prominent ist. Die Geschichte geht sofort die Yellow Press rauf und runter, und zwar nicht nur zwei Tage, sondern monatelang. Aber dann ist diese Frau fertig. Und ihre Ehe auch.«
»Woher kennst du sie?«
Tom stotterte. »Wir … wir haben uns auf Sylt ein paarmal getroffen, und jetzt kam sie her, um mich zu besuchen, die Gelegenheit war günstig, und da hat es geknallt. Lass sie aus dem Spiel, René, bitte!«
René seufzte. »Okay, wenn du meinst, aber es erschwert unsere Situation.«
»Was soll ich tun, René?«
René stand auf und ging im Zimmer umher. Vom Tisch zum Fenster und wieder zurück. Immer und immer wieder. Dann sagte er: »Wenn du wirklich nur einen Einbrecher erschossen hättest, sähe es gar nicht so schlecht aus. Notwehr. Vielleicht hatte der Typ auch noch ’ne Waffe dabei, und dann ist alles klar. Aber hier sieht es ganz übel aus, mein Freund, weil du deine eigene wehrlose Frau erschossen hast, und dass du eine Geliebte hattest, wird auch nicht ganz unentdeckt bleiben und dir sicher nicht zum Vorteil ausgelegt werden. Die Spurensicherung nimmt die DNA von jedem Zentimeter deiner Bettwäsche und von jedem Härchen im Bad. Wie auch immer. Du hast verdammt schlechte Karten. Ich würde dich verteidigen, klar, würde alles versuchen, aber ich kann im Bestfall nur ein oder zwei Jährchen weniger raushauen. In den Knast wanderst du in jedem Fall.«
»Nein!«, schrie Tom. »Alles – aber nicht in den Knast! Das schaffe ich nicht, René. Da gehe ich kaputt. Da sterbe ich! Ich brauche jeden Tag meine Medikamente, meine Malerei, meine Bücher, anständiges Essen … Ich kann nicht abends um neun das Licht ausmachen, da fange ich doch erst an zu leben! Das hast du doch selbst gerade gesagt! Und dann brauche ich Kontakte, Alkohol, Inspiration … Das ist mein Leben, René, und nicht ein halbes Toastbrot morgens um fünf, dann den ganzen Tag stumpfsinnige Arbeit, nur Stress mit den Halbaffen und Kriminellen, und wenn du duschen gehst, kriegst du einen Besenstiel in den Arsch. René, bitte!« Er fiel vor ihm auf die Knie. »Alles, aber nicht das. Da wäre ein Schuss in den Kopf gnädiger.«
René schwieg und rieb sich die Stirn. »Das verstehe ich. Aber wenn du das nicht willst, musst du abhauen. Raus aus Deutschland, irgendwohin.«
Tom reagierte nicht, nickte aber kaum merklich.
»Es sei denn«, fuhr René fort, »wir schaffen es, das Ding so zu drehen, dass es wirklich nach einem Einbruch aussieht. Dann hast du eine echte Chance.«
»Wie denn?« Tom war völlig kraftlos, und man sah ihm an, dass er im Moment nicht in der Lage war, kreativ zu denken.
»Lass mich mal einen Moment überlegen.« René ging zum Schrank, goss sich einen Whisky ein und nahm einen großen Schluck. »Jetzt brauch ich doch einen.«
»Ich auch.«
»Du musst heute Nacht noch fahren.«
»Nur einen kleinen. Mir ist schlecht.« Tom erhob sich schwankend.
René gab ihm den Whisky. »Verflucht«, überlegte er, »niemand sollte wissen, dass ich heute Nacht hier war, aber egal, ich wasch das Glas nachher ab.« Dann setzte er sich wieder. »Okay. Mach als Erstes diese verdammte Harpune sauber, klar? Penibelst. Dass da auch nicht mehr der Hauch eines Fingerabdrucks von dir drauf ist.«
»Okay.« Wie ein Schlafwandler holte Tom die Harpune und begann sie zu putzen.
Währenddessen redete René weiter: »Pass auf, Tom. Ich hau dich raus. Ganz klar. Ehrensache. Aber mit Notwehr könnte es knapp werden, weil es eben deine Frau war, die du erschossen hast. Du darfst einfach nicht da gewesen sein, verstehst du? Du haust ab, und zwar noch heute Nacht. Gleich. Wenn wir alles besprochen haben.«
»Wohin?«
»Das erklär ich dir später.«
Tom schwieg.
»Wenn du weg bist, breche ich die Terrassentür aus den Angeln, schlage ein Fenster ein, wie auch immer. Dann durchwühle ich deinen Kram und verwandle dein ganzes Haus in einen chaotischen Müllhaufen, so wie es eben nach einem Einbruch aussieht. Und ich finde natürlich die Harpune – wo war die überhaupt?«
»Unterm Bett.«
»Sag mal, seit wann hast du eine Harpune unterm Bett?«
Tom zuckte die Achseln. »Schon ’ne ganze Weile.«
»Seit unserem Gespräch vor ein paar Monaten, dem Abend mit Britta und Stefan, Wolfgang und Marlene hier bei euch?«
»Ja. Stefan hatte mich überzeugt, dass eine Harpune eine gute, funktionstüchtige und legale Waffe ist. Da hab ich mir eine besorgt.«
Tom fing schon wieder an zu weinen, wischte sich mit einem Taschentuch die Tränen aus den Augen und schnaubte sich die Nase.
»Okay.« René setzte sich und redete eindringlich auf Tom ein. »Also, es muss alles so aussehen, als hätten der oder die Einbrecher dein Haus nach Wertsachen durchwühlt, die Harpune unterm Bett gefunden und Charlotte, die zufällig und unerwartet nach Hause kam, damit erschossen, da sie den Einbrecher auf frischer Tat ertappte. Du bist zurzeit verreist. Wenn ich nach Hause komme, stelle ich einfach das Datum meines Festnetztelefons zwei Tage zurück. Wenn du mich morgen Nachmittag so zwischen drei und vier mit deinem ganz normalen Handy anrufst und mir irgendwelchen Schwachsinn von Wien oder Prag oder Amsterdam, oder wo auch immer du dich gerade aufhältst, draufsprichst, dann hast du ein hervorragendes Alibi für die Zeit, als in dein Haus eingebrochen wurde. Dann bist du aus dem Schneider, und ich stelle nach deinem Anruf mein Telefon wieder auf die Normalzeit.«
Tom nickte, obwohl er nicht aussah, als ob er alles verstanden hätte. »Das hört sich gut an.«
»Das hört sich nicht nur gut an, das ist perfekt!« René sprang auf und redete im Gehen weiter, so begeistert war er von seinem Plan.
»Wichtig ist, dass du abhaust. Und zwar nicht nächste Woche oder irgendwann, wenn du deine Sachen geordnet hast, sondern innerhalb der nächsten Stunde. Pack deinen Kram, nimm alles Geld, was du im Haus hast, und ab durch die Mitte.«
»Das kann ich nicht.« Tom war fassungslos.
»Doch! Das kannst du. Ich hab dir doch eben lang und breit erklärt, warum du verschwinden musst. Soll ich den ganzen Blues etwa noch mal erzählen?«
»Nein, nein, schon gut. Du hast ja recht.«
»Kommt hier irgendwann ’ne Putzfrau?«, fragte René.
»Ja. Morgen.«
»Wann?«
»Um neun. Aber meistens verspätet sie sich.«
»Hat sie ’nen Schlüssel?«
Tom nickte.
»Okay. Dann wird die Leiche also morgen früh gefunden. Bis dahin musst du über alle Berge sein.«
Tom atmete schwer.
»Du hast einige Fehler gemacht, mein Freund. Schwerwiegende Fehler.«
Tom sah ihn fragend an.
»Du hättest den vermeintlichen Einbrecher ansprechen sollen. ›Was wollen Sie hier? Verschwinden Sie, oder ich schieße!‹ Da hätte Charlotte sicher gesagt: ›Hey, Tom, lass den Quatsch, ich bin’s!‹ Und dann wär das alles nicht passiert.«
»Es war Stromausfall, es war stockdunkel im Haus! Kannst du dir das nicht vorstellen? Ich hab die Hand nicht vor Augen gesehen, nur einen vagen Schatten in meiner Küche. Ich dachte, Charlotte wäre schon in München, das konnte nur ein Einbrecher sein!«
»Okay. Und warum hast du nichts gesagt?«
Tom zuckte die Achseln.
»Also gut. Und wenn es wirklich ein Einbrecher gewesen wäre, hättest du dich mit deiner Prominentengattin im Schlafzimmer verbarrikadieren und die Polizei rufen sollen. Aber einfach mit der Harpune losballern – Tom, das geht gar nicht!«
»Die Polizei rufen!«, erregte sich Tom mit jeder Menge Spott in der Stimme. »Du weißt ganz genau, dass es eine halbe Stunde dauert, bis die Polizei kommt. Wenn sie überhaupt kommt. Die haben hier doch einfach keine Leute mehr! In manchen Orten haben sie schon Bürgerwehren gegründet, weil sich niemand mehr auf die Polizei verlassen kann.«
»Ich weiß, aber das bringt uns jetzt nicht weiter.«
»Was denn? Ich hab dich nicht gerufen, dass du mir Moralpredigten hältst, sondern dass du mir hilfst, verdammt! Also bitte, was soll ich tun?«
»Wie ich schon sagte, du packst jetzt in Windeseile ein paar Klamotten zusammen. Wie viel Geld hast du im Haus?«
»Keine Ahnung. Zweitausend? So in dem Dreh. Genau weiß ich das nicht.«
»Gut. Die nimmst du mit, das heißt, du beklaust dich selbst, räumst den Tresor total leer und lässt die Tür offen. Als hätte der Einbrecher abgeräumt. Klar?«
»Ja.«
»Gut. Handy nimmst du mit, um mich noch ein einziges Mal aus alibitechnischen Gründen anzurufen, aber deine Kreditkarte darfst du nicht mehr benutzen, wenn du untertauchen willst, sonst finden sie dich sofort. Bist du fit? Kannst du fahren?«
Tom nickte. »Ich denke schon.«
»Super. Dann donnerst du am besten in einem Rutsch durch bis nach Italien. Ich hab schon eine Idee, wohin. Möglichst keine langen Aufenthalte auf deutschen Raststätten, die werden als Erstes überprüft.«
»Aber wieso sollen die mich denn suchen? Charlotte wurde doch von einem Einbrecher erschossen!«
»Schon. Aber sie suchen dich trotzdem. Um mit dir zu reden. Um dein Alibi zu überprüfen. Ich muss das hier erst einmal alles mit der Polizei klären, verstehst du? Dazu brauche ich Zeit. Sicher bist du erst, wenn die Einbrechernummer funktioniert hat und von der Polizei geschluckt wurde. Wenn dabei irgendetwas nicht klappt, dann bist du dran. Dann suchen sie dich mit Hochdruck, und dann ist es auch gut, wenn du verschwunden bist. Verstehst du? Verschwinden musst du in jedem Fall.«
»Aber die Einbrecherversion ist doch glaubhaft, oder?«
»Natürlich. Ich krieg das schon hin. Aber man muss immer auf Nummer sicher gehen.«
»Wieso suchen sie mich mit Hochdruck, wenn sie nicht an den Einbrecher glauben?«
René tippte sich an die Stirn. »Tom, ich bitte dich! Was ist denn los mit dir? Du begreifst ja gar nichts mehr. Meinst du wirklich, dass du noch fahren kannst?«
Tom nickte.
»Also noch mal: Deine Frau wird in eurem gemeinsamen Haus erschossen, und du bist weg. Ausgeflogen. Abgehauen. Und nirgends zu erreichen. Natürlich suchen sie dann dich! Wen denn sonst? Den großen Unbekannten, der in deinem Haus auf der Treppe gesessen und gewartet hat, bis Charlotte nach Hause kommt, um sie zu erschießen? Nein – natürlich suchen sie dich. Europaweit wahrscheinlich. Das musst du wissen. Aber keine Sorge, ich präpariere alles, dass es wie ein Einbruch aussieht. Ich werde auch in der Küche abwaschen und dein Bett machen. Ich richte alles so her, wie man ein Haus hinterlässt, wenn man verreist. Und dann durchwühle ich die Schränke. Okay?«
»Okay.«
»Aber vorher brauche ich jetzt von dir eine Vollmacht, dass ich dich als Anwalt in allen Belangen vertreten kann. Sonst sind mir die Hände gebunden. Schmeiß mal ganz kurz deinen Computer an, dann druck ich mir das Formblatt aus, datiere es vor, und du unterschreibst. Alles kein Problem. Geht das?«
Tom nickte. »Komm mit ins Büro.«
Es war eine Angelegenheit von wenigen Minuten, und Tom unterschrieb die anwaltliche Vollmacht.
»Wunderbar«, sagte René. »Dann ist dies schon mal geklärt. Ein weiteres Problem ist allerdings, wie ich an dein Konto komme, damit ich dich mit Geld versorgen kann.«
Tom sah ihn fassungslos an. »René, bitte! Du hast selbst gesagt, dass ich wahrscheinlich in einer Woche wieder nach Hause kommen kann, da wird das Geld aus dem Tresor ja wohl reichen.«
»Stimmt. Du hast völlig recht. Alles gut.«
Tom stützte den Kopf in beide Hände. »Das darf einfach nicht wahr sein, das ist ein Albtraum, René, weißt du das?«
»Ja, das weiß ich. Ich kann mir blendend vorstellen, wie du dich fühlst. Aber jetzt pass auf. Ich hab ein Haus in Italien, da kannst du hin und fürs Erste wohnen. Niemand wird sich wundern, denn es haben schon ein paarmal Freunde von mir Ferien dort gemacht. Verhalte dich unauffällig wie ein normaler Tourist, und alles ist gut.«
»Seit wann hast du ein Haus in Italien?«
»Seit meine Schwester letztes Jahr gestorben ist. Sie hatte eine kleine Hütte am Ortsrand von Cimessa in der Toskana, und die hat sie mir vermacht. Aber ich bin selten da, keine Ahnung, wie es da im Moment aussieht.« René grinste. »Hast du noch mal was zu schreiben?«
Tom holte einen kleinen Block, und René kritzelte etwas auf einen Zettel. »Hier. Das ist die Adresse. Via Dante numero 15 in Cimessa. Das ist ein kleiner Ort in den Bergen oberhalb von Ambra. Wenn du in den Ort hineinfährst, ist gleich links eine kleine Trattoria, die einige Tische direkt auf der Straße stehen hat.«
Toms Kopf sank auf seinen Arm.
»Hör mir zu, verdammt noch mal! Wenn viel los ist, kommt man manchmal kaum vorbei. Das ist jetzt kein Lokal, um wundervoll essen zu gehen, aber für ein paar Crostini und ein Glas Wein reicht es. Wenige Meter weiter bist du auf einer kleinen Piazza mit der Kirche, und die Straße teilt sich. Du musst dich rechts halten. Nach wenigen Häusern ist der Ort zu Ende, fahr einfach weiter den Berg hinauf, und nach ungefähr hundertfünfzig Metern steht links ein kleines Haus. Ziemlich unscheinbar. Die Terrasse hinter dem Haus ist von der Straße aus uneinsehbar, und du hast einen herrlichen Blick ins Tal. Richte dich dort ein, so gut es geht, damit du dich wenigstens ein klein wenig wohlfühlst. Es wird dem Haus auch guttun, wenn du mal anständig sauber machst.«
Er zog sein Schlüsselbund aus der Jackentasche, fummelte umständlich einen kleinen, unscheinbaren Schlüssel vom Schlüsselring und gab ihn Tom. »Das ist der Hausschlüssel. Sieht komisch und überhaupt nicht wie ein Hausschlüssel aus, ich weiß, aber so ist das. Verlier ihn nicht, ich hab zu Hause nur noch einen. Einmal im Monat kommt die Putzfrau, um den gröbsten Dreck zu beseitigen, die hat auch einen. Das heißt, ich hoffe, dass sie kommt. Überprüfen lässt sich das ja leider nicht.«
»Das finde ich großartig von dir, dass ich da wohnen darf. Danke.«
»Schon gut. Unter Freunden ist das eigentlich selbstverständlich. Ach ja, noch was: Dein Auto musst du natürlich so schnell wie möglich loswerden, denn wenn sie nach dir fahnden, suchen sie nach dem Wagen unter Garantie sofort. Ich würde das tun. Nur sicherheitshalber. Falls was schiefläuft. Und den Carabinieri kann man ja ’ne Menge Blödheit nachsagen, aber die gesuchten Autos haben sie garantiert im Computer. Wegen der Mafia gibt es in Italien Straßenkontrollen ohne Ende. Und dann bist du dran.«
»Mir ist übel.«
»Reiß dich zusammen, das alles ist jetzt sehr wichtig.«
»René, ich schaff das nicht. Ich gehe zur Polizei und stelle mich, vielleicht komme ich ja mit ’nem blauen Auge davon.«
»Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vor Gericht und auf hoher See sind wir alle in Gottes Hand. Du weißt nicht, was passiert und wie der Fall hingebogen wird. Läuft alles gut, sage ich dir in den nächsten Tagen, alles klar, die Luft ist rein. Dann kommst du nach Hause und bist bass erstaunt, dass in dein Haus eingebrochen worden ist. Oder es geht alles schief, und die Anklage lautet auf Totschlag oder Mord. Bei Mord bist du eh lebenslänglich dran, bei Totschlag ist alles möglich. In einem minder schweren Fall wäre die allergeringste Strafe ein Jahr Knast, die schwerste lebenslänglich. Dazwischen ist alles vorstellbar, zwischen fünf und zehn Jahren ist das Geläufigste. Das hängt auch ein bisschen von der öffentlichen Meinung und der Stimmung in der Gesellschaft ab. Damit musst du rechnen, mein Lieber, denn Notwehr kriege ich bei der eigenen Ehefrau nicht durch. Auch nicht, wenn es dunkel war. Das kannst du vergessen. Also entweder du stellst dich und wanderst – sagen wir mal – sieben, acht Jahre in den Knast, oder du verschwindest, bis Gras über die Sache gewachsen ist und nicht mehr jeder Polizist in Deutschland dein Bild und dein Auto auf dem Schirm hat. Wenn du Pech hast, kommt der Fall auch noch in XY … ungelöst, und dann hast du ganz schlechte Karten. Dann ist die ganze Nation elektrisiert. Aber an solche fürchterlichen Dinge wollen wir gar nicht denken, ich glaube, die Nummer mit dem Einbruch ist wasserdicht. Das kriegen wir hin. Aber du solltest mir wirklich den Namen von deiner Geliebten nennen. Das würde dir in deiner Situation ungeheuer helfen.«
Tom reagierte gar nicht darauf, sondern sagte nur: »Zweitausend aus dem Tresor reichen nicht ewig.«
»Ich weiß. Ich bring dir mehr, wenn es nötig sein sollte. Aber vielleicht ist der ganze Spuk ja auch wirklich schon in einer Woche vorbei, und du kannst fröhlich und unwissend nach Hause kommen. Ich versuche unterdessen alles zu regeln, was ich für dich regeln kann. Mach dir keine Gedanken, und wirklich: Es gibt schlimmere Schicksale, als eine Weile in einem italienischen Haus ausharren zu müssen. Und jetzt sieh zu, dass du loskommst!«
Tom stand auf und ging zur Treppe. Zu dieser verfluchten Treppe, von der aus er sein Leben zerschossen und seine Frau getötet hatte. Seine Knochen waren schwer wie Blei, er fühlte sich unbeweglich wie ein uralter Mann.
»Ach, Tom«, rief ihm René hinterher, »eins hab ich noch vergessen, was ganz wichtig ist: keinen Kontakt zu niemandem, nur zu mir, okay? Wolfgang, Marlene, Stefan, Britta … Ich werde auch Leslie nichts erzählen, niemand von denen und auch niemand anders darf wissen, wo du bist. Es wird so viel gequatscht auf der Welt, und es ist zu gefährlich. Sicher bist du nur, wenn außer uns beiden niemand deinen Aufenthaltsort weiß. Niemand! Hörst du! Das ist das Allerwichtigste überhaupt!«
Tom nickte stumm.
»Wenn du jetzt fährst, schaltest du dein Handy aus und nimmst den Akku raus. Damit du nicht geortet wirst. Damit man deine Fahrtroute nicht nachvollziehen kann. Dann kaufst du dir als Erstes in Italien ein Prepaid-Handy. Die Nummer dieses Handys kennt niemand. Keine Polizei, keine Behörde – niemand weiß, dass du es bist. Schick mir eine SMS. Dann hab ich deine Nummer, lösche die SMS und kaufe mir ebenfalls ein Prepaid-Handy. So können wir Kontakt halten, ohne dass es jemand mitbekommt. Und dein altes Handy vernichtest du dann. Kapiert?«
»Ja, klar, aber vorher muss ich dich doch noch aus alibitechnischen Gründen anrufen, oder?«
»Sicher. Aber danach vernichtest du es.«
Tom nickte erneut und lief die Treppe hinauf.
Zehn Minuten später kam er mit einem Koffer, seiner Staffelei und einer Kiste, in der er seine Malutensilien aufbewahrte, nach unten.
»Ich bin fertig und fahr jetzt los. Bitte behalte den Schlüssel vom Haus, wenn irgendwas ist. Spätestens in zwei Tagen telefonieren wir. Sag’s mir noch mal: Was meinst du? Wie lange muss ich wegbleiben?«
»Tom, ehrlich, ich weiß es nicht. Hoffentlich nicht lange. Ich werde für dich tun, was ich kann.«
»Danke, René. Danke, danke, danke.« Er umarmte seinen Freund, und beide gingen nach draußen.
Tom verstaute seine Sachen im Kofferraum und sah René an, während er den Zündschlüssel in den Fingern drehte.
»Tja. Das war’s dann. Ich habe keine Frau und keine Heimat mehr«, sagte er. »Eigentlich habe ich nichts mehr.«
»Vertrau mir.«
Tom senkte den Kopf und nickte. »Danke, René.« Er umarmte ihn noch einmal und klopfte ihm auf den Rücken.
»Schon gut. Pass auf dich auf und fahr vorsichtig, auch wenn du es verdammt eilig hast.«
Tom nickte erneut.
Er stieg ein und fuhr los, ohne sich noch einmal umzusehen.
Als die Rücklichter von Toms Wagen in der Dunkelheit verschwunden waren, ging René ins Haus zurück.
6
Ganz langsam ging René durchs Haus, versuchte sich jede Einzelheit einzuprägen und machte unzählige Detailfotos mit seinem Handy. Er wusste jetzt zwar noch nicht, warum, aber vielleicht würde es irgendwann einmal wichtig werden.
Er fotografierte die fettige Pfanne, das Besteck und die schmutzigen Teller in der Spüle, die Salatschälchen mit winzigen Resten von grünen Blättern, den Topflappen neben dem Herd, das zerknüllte Geschirrhandtuch auf der Arbeitsplatte. Die Sauerei würde er noch in Ordnung bringen müssen.
Die Gardinen vor den Fenstern waren nicht zugezogen.
Ansonsten war die Küche unauffällig, es lag nichts herum, was auf die Prominentengattin hinweisen konnte. Denn nur darum ging es René. Er wollte unbedingt herausfinden, wer in dieser Nacht bei Tom gewesen war.