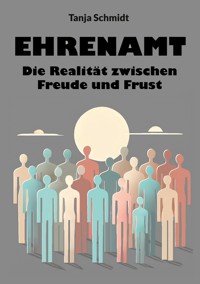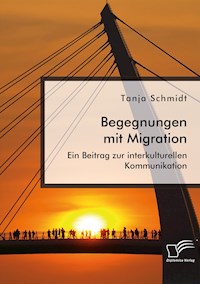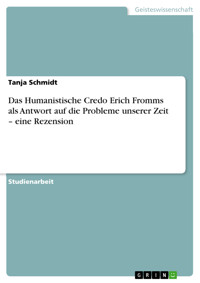Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Die empirische Studie beleuchtet den Prozess beruflicher Entscheidungsfindung von Hauptschulabsolventinnen der SchuB-Maßnahme. Bei der Berufswahl wirken neben dem niedrigen Bildungszertifikat die Aspekte von Gender und Ethnizität kumulativ. Trotz dieser schlechterer Perspektiven widerlegen die jungen Frauen Zerrbilder von trägen Hauptschülern oder der von der Familie bevormundeten Migrantin mit Kopftuch. Mit der Analyse der Fallbeispiele werden die Lernausgangslagen der Schülerinnen und die daraus resultierenden Herausforderungen für die Pädagogen deutlich. Die Forderung aus der Studie ist ein Stipendium für Hauptschülerinnen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 365
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Berufliche Perspektiven von Hauptschülerinnen und –schülern im Wandel: Befunde und Analysen
2.1 Vom Humboldt’schen Bildungsideal zum Bildungsprojekt der Moderne
2.2 Ausgangspositionen von Absolventinnen und Absolventen der Hauptschule
2.3 Diskriminierung von Absolventinnen und Absolventen der Hauptschule beim Übergang in Ausbildung und Arbeit
3. Theoretische Zugänge: Gender und Migration
3.1 Die Wirkung des Genderaspekts in Schule und Beruf
3.2 Vom Anders-Sein und gleichen Wünschen: Über die Spielräume der Geschlechter
3.3 Der Migrationshintergrund als Risikofaktor im deutschen (Aus-)Bildungssystem?
4. Forschungszugänge: Das Feld der Schülerinnen der Maßnahme Schule und Betrieb (SchuB)
4.1 Zugänge zum Feld - methodische und methodologische Aspekte
4.1.1 Die Maßnahme Schule und Betrieb (SchuB)
4.2 Beschreibung des empirischen Feldes
4.2.1 Die Akquise
4.2.2 Die SchuB-Schulen
4.2.3 Schulporträts in der Großstadt
4.2.4 Schulporträts in einer mittelgroßen Stadt
4.2.5 Schulporträts in einer ländlichen Region
4.3 Anmerkungen zur Wahl qualitativer Forschungsmethoden
4.3.1 Fragebogenerhebungen
4.3.2 Interviews
4.3.3 Die qualitative Inhaltsanalyse
5. Zur schulischen, beruflichen und sozialen Situation der Mädchen in SchuB
5.1 Demographische Daten
5.2. Nationalität
5.2.1 Die Herkunft der Eltern
5.3 Sprachen und MINT-Fächer
5.3.1 Deutschkenntnisse
5.3.2 Englischkenntnisse
5.3.3 Mehrsprachenkenntnisse
5.3.4 MINT-Fächer
5.3.6 Mein Lieblingsfach
5.5 Der Lernort Betrieb
5.5.1 Traumberufe
5.5.2 Das Praktikum
5.6 Verbleib nach SchuB
5.6.1 Vorzeitiges Verlassen der SchuB-Maßnahme
6. Fallbeispiele
6.1 Wer sind die SchuB-Schülerinnen?
6.2 Der Zugang zur SchuB-Maßnahme
6.3 Der Lernort Schule vor und in SchuB
6.4 Der Lernort Betrieb
6.6 Reflexion über das Lernen in SchuB
6.7 Besondere Lernausgangslagen in SchuB
7. Zusammenfassung und Ausblick: Neue Handlungsansätze aus SchuB
8. Quellen
1. Einleitung
„Ihr chillt doch lieber am Bahnhof!“ Dieses Zitat eines Lehrers an einer Hauptschule zeigt eine defizitorientierte Wahrnehmung von Schülerinnen und Schülern als freizeitorientiert und wenig leistungsbereit. Eine solche Haltung ist belastend, weil Bildungsprozesse in der Hauptschule häufig unter erschwerten Bedingungen stattfinden. Die Jugendlichen aus dieser Schulform sind beim Übergang in den Arbeitsmarkt von Ausgrenzung betroffen, weil die Berufsaussichten mit dem niedrigsten Bildungszertifikat in Deutschland in den letzten Jahrzehnten gesunken sind. Die jungen Menschen bewegen sich dabei in einem Spannungsfeld zwischen den Anforderungen des Arbeitsmarktes und den Besonderheiten ihrer persönlichen Lebenslagen.
Zudem sind die Bemühungen dieser Schülerinnen und Schüler vor dem Hintergrund benachteiligender wie auch fördernder Strukturen im Bildungssystem zu betrachten. Ein Beispiel für die Evaluation von Schulsystemen auf internationaler Ebene ist die PISA-Studie. Seither werden im Nationalen Bildungsbericht zentrale Ergebnisse zum deutschen Bildungssystem benannt. Als Folge von PISA nimmt Deutschland wieder an internationalen Studien teil. Die Ergebnisse der PISA-Untersuchungen von 2015/16 belegen, dass die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die in ihren Leistungen nicht das erste Kompetenzniveau erreichen, weiterhin stagniert.
Im Fokus der vorliegenden Studie steht daher die Beschreibung und Analyse der Phase der Berufswahl für junge Frauen mit und ohne Migrationshintergrund, die als Teilnehmerinnen der Maßnahme Schule und Betrieb (SchuB) den Hauptschulabschluss anstreben. Die Studie beleuchtet die Lebenswelten von etwa 50 Hauptschülerinnen aus drei Landkreisen im Rhein-Main-Gebiet und zeigt ein differenziertes Bild von Hauptschülerinnen als soziale Akteurinnen, die ihre persönlichen Ziele in Angriff nehmen und am Wirtschaftsleben teilhaben wollen. Die Schülerinnen wurden über den Zeitraum von zwei Jahren zu drei Erhebungszeitpunkten befragt, um den Prozess der Berufsfindung nachzuzeichnen: zu Anfang der Maßnahme, in der Mitte und am Schluss. In qualitativen Interviews kommen die Mädchen selbst zu Wort. Durch die qualitative Anlage des Untersuchungsdesigns war es möglich, gerade bei dieser zahlenmäßig kleinen Gruppe die unterschiedlichen Bildungsvoraussetzungen aufzuzeigen. Die jungen Frauen widerlegen Zerrbilder von trägen Hauptschülern oder der von der Familie bevormundeten Migrantin mit Kopftuch. Gleichwohl gelingt es ihnen nicht immer, die Maßnahme erfolgreich zu beenden oder einen Ausbildungsplatz zu erhalten.
Die Ziele der Studie
Die vorliegende Untersuchung zur Maßnahme „Schule und Betrieb“ zeigt nicht nur das Ergebnis des Verbleibs von Absolventinnen der Hauptschule auf, sondern aufgrund einer breiteren qualitativen Datenbasis den Prozess beruflicher und persönlicher Entscheidungsfindung. Die Studie beschreibt Bildungsverläufe der Teilnehmerinnen am zweijährigen SchuB-Bildungsgang mit anschließender Verbleibs- und Ergebniskontrolle über die Einmündung in Schule, Beruf oder sonstige Bildungsmaßnahmen. Damit liefert sie Ergebnisse zu den
Motiven, Plänen und Erwartungen weiblicher Hauptschulabsolventinnen
Effekten des SchuB-Konzeptes in Bezug auf ihren Beitrag zum gender mainstreaming
und inwieweit der Migrationshintergrund als Ressource dient.
Zudem wurde geprüft, ob das SchuB-Programm einen innovativen Baustein darstellte, der diesen Prozess angemessen unterstützte. Um die Zahl der Schulabgängerinnen und – abgänger ohne Abschluss zu verringern wurde die Maßnahme Schule und Betrieb (SchuB) 2004 ins Leben gerufen. Sie endete 2015 mit dem Auslaufen der Fördermittel durch den Europäischen Sozialfonds (ESF). Die Nachfolgemaßnahme bis 2020 ist die ebenfalls vom ESF geförderte Maßnahme Praxis und Schule (Pusch).
Weil solche Fördermaßnahmen wie SchuB zeitlich begrenzt sind, ist es das Ziel der Studie auf die Notwendigkeit nachhaltiger Bildungsplanung aufmerksam zu machen. Die Studie bietet Ansätze zur Reflektion für Pädagoginnen und Pädagogen. Zudem zeigt sie die Bedeutung der Jugendberufshilfe auf. Statt die Selektion an Bildungsschwellen voranzutreiben können diese Erkenntnisse vom Rand des Bildungssystems dazu beitragen, die Integrationschancen von jungen Menschen in Schule und Beruf zu erhöhen. Die Ergebnisse der Studie können auf berufsvorbereitende Maßnahmen übertragen werden, da die Voraussetzungen vergleichbar sind: Auch hier existieren mehrere Lernorte, der Unterricht erfolgt modularisiert, ist häufig projektbezogen und an den Kompetenzen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer orientiert. Zudem können diese Erkenntnisse auch auf Bildungsprozesse, die in weniger prekären Lebenslagen stattfinden, übertragen werden.
Der Aufbau der Arbeit
Das 2. Kapitel beginnt mit einer historischen Reflektion über den pädagogischen Auftrag des Bildungssystems. Bildung bedeutet die Entfaltung von Möglichkeiten, doch findet sie immer in einem einmaligen historischen, kulturellen und gesellschaftlichem Rahmen statt. Die bildungstheoretische Auseinandersetzung des Erziehungswissenschaftlers Hans-Christoph Koller über den Humboldtschen Bildungsbegriff bietet Anhaltspunkte, wie Bildungsprozesse in einer postmodernen Gesellschaft aussehen können. In seiner Habilitationsschrift „Bildung und Widerstreit: Zur Struktur biographischer Bildungsprozesse in der (Post-)Moderne“ (1999) hebt Koller die Bedeutung von Freiheit und Offenheit in Bildungsprozessen hervor. In postmodernen pluralistischen Gesellschaften wird eine Vielfalt von Bildungswegen als Antwort auf eine ebenso vielfältige und sich verändernde Umwelt notwendig. Kollers Überlegungen, dass es keine vorgefertigten Schemata mehr geben kann, werden in dem Buch zu „Kultur und Geschlecht in der Interkulturellen Pädagogik“ von Patricia Baquero Torres (2009) reflektiert. Zum Umgang mit Gender- und Kulturaspekten sind in Bildungsprozessen neue Wege zu finden.
Der Erziehungswissenschaftler Joachim Schroeder fordert in seiner Publikation „Schule in schwierigen Lebenslagen“ (2012), die Lebenslagen von Schülerinnen und Schüler stärker zu berücksichtigen. Wenn Bildung die Auseinandersetzung eines Individuums mit seiner Welt darstellt, so ist das Lernumfeld stärker zu berücksichtigen. Schroeder verweist auf die besonderen Lernausgangslagen von Hauptschülerinnen und –schülern, die nicht nur unter erschwerten Bedingungen lernen müssen, sondern auch auf dem Ausbildungsmarkt strukturellen und rechtlichen Barrieren gegenüberstehen. Nicht nach dem Ergebnis eines Bildungsprozesses ist zu fragen, sondern nach dem Weg, der dorthin führt. Eine Ausrichtung der Schulplanung an besondere Lebenslagen und die Evaluation der pädagogischen Arbeit sind daher Voraussetzung für die Qualitätssicherung.
In ihrer Analyse der IAB-Studie „Arbeiten und Lernen im Wandel“ (2012) zeigen Corinna Kleinert und Marita Jacob auf, dass sich die Erwerbschancen von geringqualifizierten Personen in den letzten Jahrzehnten durch die Bildungsexpansion verschlechtert haben. Die Ursachen für Jugendarbeitslosigkeit sieht der Wirtschaftswissenschaftler Karl Brenke in einer fehlenden Berufsausbildung, erschwerten Zugänge zum Berufsausbildungssystem und großen regionalen Unterschieden. Die Psychologin Nora Gaupp (2011) kommt zu dem Ergebnis, dass immer weniger Jugendliche direkt in eine Ausbildung einmünden, sondern stattdessen weiterhin zur Schule bzw. einer berufsvorbereitenden Maßnahme gehen. Damit ist auch der Wunsch nach dem Erwerb eines höheren Bildungszertifikats verknüpft. Die Übergangswege von Schule in den Beruf sind vielfältiger und risikoreicher geworden. Als Ursache zur Manifestierung prekärer Erwerbsverläufe erkennt die Soziologin Heike Solga (2005) die veränderte Wertigkeit der Bildungszertifikate an sowie den Zusammenhang von erreichten Bildungsleistungen und der erwarteten Leistungsfähigkeit durch Personalentscheider. Hauptschulabsolventinnen und -absolventinnen erleben hierbei häufig Verdrängung die Diskreditierung ihrer Leistungen.
Im 3. Kapitel wird beschrieben, wie das Geschlecht immer noch als ein Faktor sozialer Ungleichheit bei der Berufswahl und der Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt wirksam wird. Während Mädchen ihre Positionen im Bildungssystem in den letzten Jahrzehnten verbessern konnten, sind die beruflichen Aussichten gerade für geringqualifizierte junge Frauen unverändert schlecht. Der Fokus von Untersuchungen in Hauptschulen und berufsvorbereitenden Maßnahmen konzentriert sich häufig auf männliche Teilnehmer. Eine weitere Dimension des Geschlechtsfaktors ist die Zeit, die spätestens mit dem Eintritt einer Mutterschaft zu einer wertvollen und meist zu knappen Ressource wird. Die SchuB-Schülerinnen müssen eine positive individuelle weibliche Erwerbsbiographie entwickeln auch vor dem Hintergrund, dass ihre Geschlechtsgenossinnen häufig bessere Qualifikationen vorweisen können.
Die Folgen einer am Arbeitsmarkt existierenden Geschlechtssegmentation stellt Anja Hall in ihrer Studie „Lohnen sich schulische und duale Ausbildungsgänge gleichermaßen?“ (2012) dar: Bildungserträge in dualen und schulischen Ausbildungen sind für Frauen und Männer unterschiedlich. Für Frauen lohnen sich schulische Ausbildungen mehr, da die Einkommen in typischen Frauenberufen des dualen Systems häufig nicht existenzsichernd sind. Als Ergebnis der DJI-Studie „Sind MINT-Berufe zukunftsträchtig auch für Hauptschülerinnen?“ von Irene Hofmann-Lun und Jessica Rother (2012) ist festzuhalten, dass der Zugang zu vielen naturwissenschaftlichen und technischen Berufsbildern mit dem Hauptschulabschluss verschlossen bleibt und vor allem weibliche Vorbilder und Mentorinnen fehlen. Dabei sollten aber atypische Geschlechterwahlen bei der Berufsfindung möglich sein, für Hauptschülerinnen sind sie aber alles andere normal wie auch die Studie „Passagen und Passantinnen – Biographisches Lernen junger Frauen“ (2007) von Doris Lemmermöhle und der Beitrag „Mädchen und junge Frauen im Übergang von der Schule in die Arbeitswelt“ von Michael Matzner zeigen. Mit Gender Mainstreaming wird ein Ansatz vorgestellt, strukturelle Hindernisse am Arbeitsmarkt zu beseitigen, um die Erwerbstätigkeit und damit eigenständige Existenzsicherung zu fördern und gleichzeitig Raum zu lassen für persönliche Beziehungen. Die Analyse des Migrationshintergrunds der Schülerinnen bietet einen weiteren Zugang über die Perspektiven von Absolventinnen und Absolventen der Hauptschule. Hierzu werden die Ergebnisse verschiedener Schulleistungsstudien wie IGLU/PIRLS, PISA, das DJI-Übergangspanel und die BA-BIBB-Bewerberbefragung vorgestellt. Die Studie des Deutschen Jugendinstituts (2004–2006) zu Übergangswegen von Hauptschulabsolventen identifiziert Jugendliche mit Migrationshintergrund und Mädchen als Risikogruppen. Die Soziologin Ulrike Hormel (2007) erkennt besonders an den Schwellen im Bildungssystem diskriminierende Mechanismen und kommt zum Schluss, dass ein Migrationshintergrund gegenwärtig im Bildungssystem ein Risikofaktor darstellt. Wie Olaf Groh-Samberg, Ariane Jossin, Carsten Keller und Ingrid Tucci in ihrer Untersuchung der Bildungsverläufe von Jugendlichen mit Migrationshintergrund (2001) feststellten ist die klassische Assimilationstheorie überholt. Vielmehr sind vielfältige Integrationswege zu erkennen, jedoch stoßen Jugendliche mit Migrationshintergrund noch auf viele Hindernisse und Barrieren, weil sie nach bestimmten „turning points“ in ihrer Bildungsbiographie Nachteile nicht mehr ausgleichen können.
Die Soziologin Janina Söhn (2011) thematisiert den Zusammenhang von Bildungsleistungen und rechtlichem Status, da dieser bereits bei der Einreise und der Gewährung von sozio-ökonomischen und bildungspolitischen Hilfen bis hin zu einer symbolischen Akzeptanz wirksam wird. Diskriminierende Mechanismen können über den Rechtsstatus vermittelt werden, aber ein hoher Bildungsstand der Eltern kann ausgleichend wirken. Zusätzlich ist eine unterschiedliche Wertigkeit von Sprachen feststellbar wie die Germanistin Katharina Brizić (2007) nachweist, die ebenfalls zu Diskriminierung im Bildungssystem führen kann, weil manche Herkunftssprachen gefördert werden, andere dagegen ein Schattendasein haben. Ob ein Migrationshintergrund bei der Berufswahl eine Bereicherung oder eine Barriere darstellt, ist abhängig vom Prestige der Herkunftssprachen, der beruflichen Netzwerke und der Bildungsressourcen der unterschiedlichen Migrantengruppen.
Zu den Bildungschancen von Mädchen mit Migrationshintergrund existieren zwei gegensätzliche Positionen: Die Mädchen werden als benachteiligt angesehen oder gerade wegen ihrer Ethnizität im Vorteil, weil durch die stärkere soziale Kontrolle in einigen ethnischen Gruppen Bildungserfolge begünstige. Hier besteht noch erheblicher Forschungsbedarf (vgl. Bergann/Stanat 2010).
Im 4. Kapitel wird das methodische Vorgehen beschrieben und begründet. Die Ergebnisse der empirischen Studie werden in den beiden folgenden Kapiteln dargestellt: Das 5. Kapitel beinhaltet die Analyseergebnisse aus den Fragebögen, das 6. Kapitel die Fallstudien. Der Beitrag endet im 7. Kapitel mit einem Fazit auf die beruflichen Chancen und Perspektiven, ihrer Hindernisse und Barrieren der Schülerinnen als exemplarisches Beispiel für die Maßnahmenpolitik in der Jugendberufshilfe, zeigt weiteren Forschungsbedarf auf und gibt ausgehend vom Rand des Bildungssystems einen Ausblick auf eine nachhaltige Bildungspolitik der Zukunft.
2. Berufliche Perspektiven von Hauptschülerinnen und –schülern im Wandel: Befunde und Analysen
In meiner Arbeit befasse ich mich mit den beruflichen Perspektiven von Hauptschülerinnen. Dabei setze ich mich insbesondere mit der Frage auseinander, was in der heutigen Wissensgesellschaft der Erwerb des Hauptschulabschlusses für die Absolventinnen der SchuB-Maßnahme beim Einstieg in Ausbildung und Arbeit bedeutet. Welches Wissen wird heute benötigt, um ein selbstbestimmtes Leben in modernen Bildungsökonomien zu führen? Daher ist es notwendig, sich zunächst mit dem Begriff Bildung auseinanderzusetzen. Dies werde ich über drei verschiedene Zugänge tun: Zuerst stelle ich in einem knappen historischen Abriss die für Deutschland sehr markante bildungstheoretische Kontroverse dar, die sich als Streit um einen allgemeinen Bildungsbegriff zeigt, der für alle Menschen Gültigkeit beansprucht und somit ein universelles Bildungsverständnis postuliert und Bildung als allgemeines Menschenrecht versteht – diese Position werde ich mit Bezugnahme auf Humboldt und Koller skizzieren.
In einem empirischen Zugang fasse ich zweitens aktuelle Ergebnisse von Schulleistungsstudien zusammen. Denn die Ergebnisse der älteren PISA1-Studien haben zu einer Reflexion über die Leistungsfähigkeit des deutschen Bildungssystems geführt: Ist es in der Lage, soziale Mobilität zu ermöglichen? In diesem Abschnitt werde ich die empirischen Zusammenhänge von Bildung, Schule, Beruf und Benachteiligung erörtern, um daraus Risiken für junge Menschen zu identifizieren, in Erwerbsarbeit einzumünden. Wichtig ist auch zu erläutern, dass sich die beruflichen Chancen für Personen mit Hauptschulabschluss in den vergangenen Jahrzehnten verändert haben, und so ist der Status der Hauptschülerin häufig von Benachteiligung und Exklusion vom Arbeitsmarkt gekennzeichnet. Zudem sind durch die Bildungsexpansion die Anforderungen an die Lernleistungen der Individuen gestiegen. Die beruflichen Chancen und Perspektiven von Hauptschülerinnen sind geringer, weil das Bildungszertifikat des Hauptschulabschlusses durch die Bildungsexpansion seine Wertigkeit verloren hat.
Mein dritter Zugang, ebenfalls ein empirischer, diskutiert die Mechanismen der Reproduktion sozialer Ungleichheit auf dem Arbeitsmarkt mit der Frage, was dies für die Berufsbildung junger Menschen bedeutet. Der Zugang zu beruflichen Positionen wird über Bildungszertifikate vermittelt, die im Schulsystem erworben werden. Ein fehlender Schulabschluss steigert das Risiko prekärer Erwerbs- und Lebensverläufe. Für die meisten Berufsbilder im dualen System wird der Hauptschulabschluss als Mindestanforderung vorausgesetzt, im System der schulischen Ausbildungsgänge ist diese Qualifikation oftmals zu gering. Was ist also mit dem Hauptschulabschluss möglich?
Das Lernen gerade unter prekären Bedingungen zu ermöglichen erkennt der Erziehungswissenschaftler Joachim Schroeder als eine wichtige Aufgabe von Bildung an. Vor dem Hintergrund einer Gesellschaft, die sich durch Vielfalt auszeichnet, sind die Bedingungen zu analysieren, unter denen Bildungsprozesse stattfinden. Bildung heute hat daher nicht nur die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler zu fördern, sondern ebenso deren unterschiedliche Ausgangspositionen zu berücksichtigen. Noch erscheint das Bildungssystem für besondere Lebenslagen allerdings nicht ausreichend gerüstet. In der vorliegenden Studie wird daher das Lebensumfeld von Hauptschülerinnen beleuchtet.
2.1 Vom Humboldt’schen Bildungsideal zum Bildungsprojekt der Moderne
Einen Konsens herzustellen über das, was in den Schulen gelehrt werden soll und im späteren Leben benötigt wird, stellt für Pädagogen eine Herausforderung dar. Sie befinden sich in einem ständigen Diskurs über Bildungsziele und der Reflexion eigener pädagogischer Tätigkeit. Welche Kompetenzen kann Schule überhaupt vermitteln? Ob schulisches Wissen eher theoretisch fundiert oder anwendungsorientiert sein soll, dazu gibt es unterschiedliche Auffassungen. Seit der Antike existieren normative Vorstellungen darüber, was Menschen als Bildungsideale anstreben sollten.
„Allgemeine und zeitlose Gehalte eines Verständnisses von Bildung lassen sich seit Platons Höhlengleichnis2 […] als Zugang zu Erkenntnis und Teilhabe an Wahrheit bestimmen.“ (Schwarz 2004: 81).
Der Erziehungswissenschaftler Bernd Schwarz verweist darauf, dass Bildungsprozesse immer in einem einmaligen historischen, kulturellen und gesellschaftlichem Rahmen stattfinden, und die pädagogische Leistung gerade in der Vermittlung von Bildungsidealen in einer einmaligen historischen Situation besteht (ebd.). Bildung ist der „[…] Versuch einer allgemeinen und zeitlos gültigen Bestimmung des Seins des Menschen.“ (Schwarz 2004: 81). Der Bildungsauftrag befindet sich somit in einem Spannungsfeld idealtypischer Konstruktionen, wie und was gelehrt werden soll, und muss an eine dynamische Welt angepasst werden, die einem ständigen Wandel der Lebensformen und –orientierungen ihrer Mitglieder unterliegt. In der Vergangenheit war Bildung allerdings den oberen sozialen Schichten vorbehalten (vgl. Schwarz 2004: 81).
Dass Bildung für alle selbstverständlich sein soll, ist immer noch ein revolutionärer Gedanke wie der Literaturwissenschaftler Gerhard Lauer in seinem Beitrag zur Geschichte des Bildungsbegriffes nachweist:
„[…] weil ein Programm, das eine Grundbildung für alle Menschen reklamiert, alles andere denn eine Selbstverständlichkeit ist.“ (Lauer 2007: 59).
Was in den Bildungskanon aufgenommen werden sollte, wurde über Jahrhunderte von der katholischen Kirche bestimmt. Als Vertreterin des Christentums wählte sie die Inhalte aus dem antiken Erbe des römischen Reiches aus, die mit ihrer Lehre zu verbinden waren. Obwohl es eigentlich „sich ausschließende Kulturen“ (Lauer 2007: 61) waren, wurden sie in einem jahrhundertelangen Prozess miteinander verknüpft, durch den eine europäische Bildungstradition mit einem dualistischen Wissenschaftsverständnis von Theorie und Praxis entstand. Vermittelt wurde dieses Wissen in Lateinschulen und Universitäten (vgl. Lauer 2007: 62). Zu einer Wissensvermittlung für breite Volksschichten kam es durch die Reformation (vgl. Lauer 2007: 63).
Auch der Neuhumanist Wilhelm von Humboldt (1767–1835) unternahm den Versuch einer Definition des Bildungsbegriffes. Der Erziehungswissenschaftler Hans-Christoph Koller hat eine kritische Reflexion dieses Begriffes vorgenommen, ob er den gesellschaftlichen Anforderungen heute noch genügen kann. In seiner Schrift „Ideen von einem Versuch, die Gränzen [sic.] des der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen“ von 1792 definierte der Neuhumanist Wilhelm von Humboldt (1767–1835):
„Der wahre Zwek [sic.] des Menschen […] ist die höchste und proportionierlichste Bildung seiner Kräfte zu einem Ganzen.“ (I, 64)3.
Nicht die Verwertbarkeit des Wissens in Form von Zeugnissen oder Zertifikaten meinte Humboldt, sondern Ziel der Bildung war für ihn die Beschäftigung mit Lerninhalten und der Lernprozess selbst. Bildung erhält somit einen eigenen Wert. Dieses Bildungsideal von persönlicher Freiheit kann auch heute als Richtlinie für die pädagogische Praxis dienen. Mit der Aufklärung trat das Leitbild der Vernunft damit an die Stelle der Religion. Die praktische Verwertbarkeit von Wissen hatte Vorrang. Einer solchen zweckorientierten Auffassung stellten die Neuhumanisten, zu denen auch Humboldt zählt, ihr Bildungsideal mit der Forderung „Bildung um der Bildung willen“ gegenüber:
„Was zunächst wie eine Tautologie scheint, ist bei näherem Hinsehen ein ästhetisch verstandenes erhabenes Ideal.“ (Lauer 2007: 66).
Lauer verweist auf die Bedeutung von Zweckfreiheit gerade in der Grundlagenforschung auf damit verbundene Entdeckungen wie die Quantenmechanik oder das Internet:
„Modern ist ein Wissen dann, wenn es als Selbstwert in einer Gesellschaft hergestellt wird, die selbst noch nicht weiß, was dieses Wissen für sie bedeutet. Es ist zweckfrei ganz einfach deshalb, weil es nur dann modern ist, wenn es um seiner selbst willen entwickelt, entdeckt und hergestellt wird.“ (Lauer 2007: 75).
Auch Koller interpretiert Humboldts Verständnis von Bildung als ein umfassendes Ziel von Menschenbildung:
„[…] und nicht um die Ausbildung oder Zurichtung des Einzelnen für spezifische gesellschaftliche Erfordernisse.“ (Koller 1999: 51).
Die Ausbildung der persönlichen Talente ist eben nicht „Selbstzweck“, sondern verdeutlicht „was den Menschen als solchen ausmacht“ (Koller 1999: 52). Zur Aneignung von Bildung ist die Auseinandersetzung des Menschen mit seiner Umwelt notwendig. Bildung ist „[…] das Sammeln und Verarbeiten von ‚Stoff‘, den die Welt dem Menschen liefert.“ (Koller 1999: 54). Bildungsprozesse sind als Diskurse zwischen Mensch und Umwelt zu verstehen (vgl. Koller 1999: 57). Bildung bedeutet die Entfaltung von Möglichkeiten durch die konstruktive Auseinandersetzung des Menschen mit seiner Umwelt. Humboldt beschreibt keine einseitige Welt, sondern eine Wirklichkeit der Vielfalt von Menschen, ihren Lebenssituationen und Meinungen (vgl. Koller 1999: 54). Er erkennt ausdrücklich an, „daß die Menschen verschieden sind und letztlich jeder eine ganz besondere, singuläre Persönlichkeit darstellt.“ (Koller 1999: 56; Hervorhebung i.O.). Humboldts „Bild der Menschheit als ganzer“ (Koller 1999: 57, Hervorhebung i.O.) bezieht alle Gesellschaftsmitglieder ein (vgl. Koller 1999: 59). Damit begründet Humboldt eine Auffassung von Bildung, in der Vielfalt anerkannt ist. Dies beinhaltet die Einbindung von unterschiedlichen Menschen hinsichtlich ihrer sozialen und ethnischen sozialen Herkunft, ihres Geschlechts oder ihrer Religion in Bildungsprozesse. Sprache ist dabei die Methode zum Erkenntnisgewinn: Durch sie gewinnt der Mensch Informationen über sich in dieser Welt; ihre Struktur prägt sein Denken:
„Da das gesamte Denken, Empfinden und Handeln des Menschen durch die Weltansicht der Sprache geprägt ist, in die er hineingeboren wurde, ist seine Auseinandersetzung mit der Welt immer schon sprachlich vermittelt.“ (Koller 1999: 92).
Eine persönliche Weltsicht ist daher durch die Struktur der eigenen Muttersprache bereits vorgegeben, aber durch die Konfrontation mit anderen Sprachen können neue Denkanstöße gegeben werden. Mit Bildung verknüpft Koller in einem ganz elementaren Sinn „[…] zunächst einmal nichts anderes als einen sprachlichen Vorgang, bei dem neue Sätze und Satzverkettungen hervorgebracht werden […]“ (Koller 1999: 151). Koller definiert Bildungsprozesse als Sprachdiskurse. Er bezieht sich dabei auf den Begriff des Widerstreits in Lyotards Sprachphilosophie. Lyotard sieht in der „Verkettung von Sätzen“ (Koller 1999: 148) eine federführende Kraft zur Gestaltung von Bildungsprozessen. Mit dem Begriff des Widerstreits zeigt Lyotard auf, dass die verschiedenen Diskursarten blind für die anderen seien. Eine Lösung ist nur im Hervorbringen neuer „Diskursarten, die das bisher Nicht-Sagbare zum Ausdruck bringen“ (Koller 1999: 150) möglich und in der Offenhaltung des Widerstreits. Koller definiert Bildung daher als „(Er-)Finden neuer Diskursarten“ (Koller 1999: 146).
Die Erziehungswissenschaftlerin Patricia Baquero Torres zieht aus Kollers Ausführungen die Schlussfolgerung, dass es in der pluralistischen Gesellschaft nicht die eine Bildung, sondern nur verschiedene Bildungen geben kann (vgl. Baquero Torres 2009: 214). Trotzdem können Bildungsziele definiert werden; zwar müssen sie sich an der demokratischen Grundordnung orientieren, können aber trotzdem unterschiedlich ausfallen. Ein moderner Bildungsbegriff im Sinne Kollers muss gesellschaftliche Vielfalt abbilden können, aber ebenso präzise sein, um wissenschaftlichen Ansprüchen zu genügen (Baquero Torres 2009: 206). Werden Gruppen von Menschen beim Bildungserwerb benachteiligt, so sind offensichtlich noch keine geeigneten Lösungen gefunden worden. Diese müssen im Diskurs erst erarbeitet werden, und zwar unter Berücksichtigung anderer ethnischer und sozialer Milieus (Baquero Torres 2009: 218). Dies setzt die Berücksichtigung von den Bedingungen voraus, unter denen Lernprozesse stattfinden.
Für die Pädagogik bedeutet dies in der praktischen Umsetzung die Abkehr von geschlechtsspezifischen Bildungszielen. Da es nach Koller keine festgefügten Definitionen darüber geben kann, was weiblich oder männlich sei und verschiedene Rollenkonzepte für beide Geschlechter denkbar sind, müssen die Individuen eine eigene Geschlechtsidentität entwickeln. Dies bedeutet einen Zuwachs an persönlicher Freiheit für junge Menschen, aber auch die Auseinandersetzung mit den bisherigen Rollenerwartungen und unterschiedlichen Bildungsbedingungen für die Geschlechter (vgl. Baquero Torres 2009: 215). Ebenso bedeutet die Definition von Bildung als „(Er-)Finden neuer Diskursarten“ einen anderen Umgang mit Menschen mit Migrationshintergrund. Wenn Migrantinnen und Migranten Bildungsprobleme haben, können diese nicht länger als Kulturkonflikt eingeordnet werden. Kulturelle Andersartigkeit als Ursache schwieriger Bildungsverläufe anzusehen ist nur eine Auslegung unter vielen möglichen Diskursarten (Baquero Torres 2009: 217). Dies bedeutet, dass es auch andere Lesarten für die Bildungsprobleme gibt.
2.2 Ausgangspositionen von Absolventinnen und Absolventen der Hauptschule
Durch die PISA-Studien wurde der Öffentlichkeit bewusst, dass der Bildungserfolg von der sozio-ökonomischen Herkunft eines Kindes abhängig ist und Migrantenkinder allgemein schlechtere Bildungsleistungen haben. Zu ähnlichen Ergebnissen kamen auch die AWO-Studie4 und die LAU-Studie5. Hierdurch setzte eine öffentliche Diskussion über die Leistungsfähigkeit des deutschen Bildungssystems ein, die Reformen zur Folge hatte (vgl. De Olano et. al. 2010: 10). Für die Bildungsforscher Timo Ehmke und Nina Jude zählt die Herstellung sozialer Chancengleichheit „[z]u den größten Herausforderungen von Bildungssystemen“ (Ehmke/Jude 2009: 241). Dies bedeutet, dass der Einfluss der sozialen Herkunft beim Erwerb von Bildungszielen gering ist und somit sichergestellt wird, dass eine genügend große Anzahl von Menschen über in dieser Gesellschaft nachgefragten Basiskompetenzen verfügen (ebd.). PISA hat eine Entwicklung angeregt, die noch nicht abgeschlossen ist: Bildungsleistungen zu evaluieren und eine Entkopplung von der sozialen Herkunft zu erreichen.
Weltweit wurden seit den 1960er Jahren in vielen Staaten Untersuchungen zu Schülerkompetenzen durchgeführt. Vergleiche zwischen Bildungssystemen durchzuführen war das Ziel der 1958 in Hamburg gegründeten International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) (vgl. Jude/Klieme 2009: 11). Allerdings nahm Deutschland bis Ende der 1990er Jahre bis auf Stichproben in wenigen Studien an keinen regelmäßigen Prüfungen teil (Jude/Klieme 2009: 11). Mitte der 1990er Jahre wurden durch die TIMS-Studie6mathematisch-naturwissenschaftliche Kompetenzen am Ende der Pflichtschulzeit und am Ende der gymnasialen Oberstufe erhoben (vgl. Jude/Klieme 2009: 12). Die Ergebnisse dieser Studien belegen in Mathematik und Naturwissenschaften für deutsche Schüler der 1990er Jahre nur durchschnittliche Leistungen (ebd.). Auf TIMSS folgte im Jahr 2000 die PISA-Studie, die mit der Überprüfung von Bildungssystemen aus 32 Staaten begann (De Olano et. al. 2010: 13). Die Beteiligung stieg im Jahr 2003 auf 41 Länder; 2009 und 2012 waren es bereits 67 Länder. Im ersten PISA-Zyklus der Jahre 2000, 2003 und 2006 wurden Lesekompetenz, mathematisches Wissen und naturwissenschaftliches Verständnis untersucht (ebd.). Außerdem ist die PISA-Studie ein Beispiel für die Internationalisierung von Bildungspolitik, die nicht mehr allein von nationalen Interessen bestimmt wird (De Olano et. al. 2010: 11). Zu den Ergebnissen bieten die Untersuchungen des Bildungsforschers Falk Radisch (2008) eine gute Übersicht ebenso wie die Forschungen von Isabell van Ackeren und Klaus Klemm (2015).
Nach den Erfahrungen aus der Reading Literacy Studie7 und TIMSS beschloss die Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK)8 die Teilnahme an nationalen und internationalen Vergleichsstudien (vgl. Jude/Klieme 2009: 12). Weitere Punkte in der 2006 von der KMK veröffentlichten Gesamtstrategie zum Bildungsmonitoring waren eine stärkere Vernetzung zwischen den Bundesländern und die Festlegung von Bildungsstandards durch landesweite Vergleichsarbeiten (vgl. Jude/Klieme 2009: 13). Die Daten gehen seither in den Nationalen Bildungsbericht der Autorengruppe Bildungsberichterstattung ein, der seit 2006 mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen Auskunft über das deutsche Bildungssystem gibt.
Vor allem die Art der Fragestellung von PISA war neu: Die Soziologin Janna Teltemann stellt dar, dass das literacy-Konzept der PISA-Studie nicht nur die reine Beherrschung von Lese-und Schreibtechnik beinhaltete, sondern ebenso die Fähigkeiten, Textverständnis und Problemlösekompetenz zu zeigen (vgl. Teltemann 2010: 28). Gerade diese Kompetenzen werden als Schlüsselkompetenzen in modernen Wissensökonomien benötigt. Als Testpopulation wurden alle 15-jährigen eines Jahrgangs gewählt, weil in diesem Alter in den meisten Teilnehmerländern die Pflichtschulzeit endete (vgl. Teltemann 2010: 30). Durch diese Zielsetzung, anwendungsbezogenes Wissen unabhängig von nationalen Lehrplänen zu rekonstruieren, zeigten sich aber bereits bei der praktischen Durchführung länderspezifische Unterschiede, etwa beim Einschulungsalter oder der Praxis der Nicht-Versetzung. Dies hatte zur Folge, dass sich in Deutschland und in einigen anderen Ländern die Population der 15-jährigen auf drei Klassenstufen verteilte, in manchen Ländern dagegen nur auf zwei Klassenstufen oder sogar nur eine. Bei der Darstellung der Ergebnisse ergaben sich dadurch unterschiedliche Rangfolgen der Länder, wenn nur diejenigen Schüler miteinander verglichen wurden, die die landesübliche Klassenstufe besuchten (vgl. Teltemann 2010: 32). Daher gibt Teltemann zu bedenken, dass es sich um Querschnittsdaten handelte, wohl aber konnten Trends aufgezeigt werden (vgl. Teltemann 2010: 35). Zudem wurden in den PISA-Studien unterschiedliche Kompetenzniveaus definiert. Schüler der untersten Kompetenzstufen verfügten nicht über elementare Lesefähigkeiten. Der Einfluss des sozio-ökonomischen Hintergrundes auf die Lesefähigkeit zeigte besonders für Deutschland die hohe Abhängigkeit der erreichten Kompetenz vom Elternhaus (vgl. Teltemann 2010: 42). Dieses Ergebnis konnte in den nachfolgenden Studien etwas verringert werden (Teltemann 2010: 43).
Doch konnte eine signifikante Entkopplung von sozialer Herkunft und Leistungsergebnissen zwischen den PISA-Studien von 2000 und 2003 nicht festgestellt werden (vgl. Ehmke/Jude 2009: 241). Ehmke und Jude verweisen hier auch auf die Ergebnisse der Studien von Ehmke, Siegle und Hohensee von 2005, von Ehmke, Hohensee, Heidemeier & Prenzel, 2004 sowie der OECD von 2004. Mit der „Expansion des Sekundarschulsystems“ (Ehmke/Jude 2009: 247), d.h. einer geringeren Anzahl von Hauptschülerinnen und –schülern und einer steigenden Anzahl von Schülerinnen und Schülern auf höheren Schulen war die Annahme der Verringerung von Bildungsdisparitäten verbunden. Ehmke und Jude ziehen hierzu die Belege der Bildungsforscher Markus Klein, Steffen Schindler, Reinhard Pollak und Walter Müller (2009), Bernhard Schimpl-Neimanns (2000) sowie von Walter Müller und Dietmar Haun (1994) zur Verringerung sozialer Disparitäten in der Bildungsbeteiligung heran. Wohl haben sich der Studie von Kai Maaz, Jürgen Baumert, Cornelia Gresch & Nele McElvany (2010) zufolge die Chancen der Kinder aus unteren und mittleren Schichten inzwischen erhöht, an einer gymnasialen Bildung teilzuhaben, doch bestehen weiterhin Unterschiede an der Gymnasialbeteiligung zwischen den Sozialschichten (vgl. Ehmke/Jude 2009: 248).
Als Ursache für Bildungsungleichheiten untersuchten Maaz, Baumert & Ulrich Trautwein (2009) den im internationalen Vergleich frühen Wechsel in die Sekundarstufe I: Beachtenswert ist der Einfluss von Lehrkräften und Eltern, die durch ihre Entscheidungen Bildungsdisparitäten unterstützen (vgl. Ehmke/Jude 2009: 250). Nachweise für sozialschichtabhängiges Verhalten von Lehrern und Eltern erbrachten auch die Ergebnisse von Hartmut Ditton, Jan Krüsken und Magdalena Schauenberg (2005). Bereits beim Eintritt in die Grundschule oder der Entscheidung einer Zurückstellung können diese wirksam werden etwa durch „bildungsgangspezifische Curricula“ oder „differentielle Lern- und Entwicklungsmilieus“ (vgl. Ehmke/Jude 2009: 250). Diese Effekte wurden auch von Jürgen Baumert, Petra Stanat und Rainer Waterman (2006) untersucht. Außerdem existieren in Deutschland zwischen den Bundesländern zum Teil erhebliche regionale Unterschiede, wie die Befunde aus den Studien von Michel Knigge und Michael Leucht (2010) sowie von Michel Knigge und Olaf Köller (2010) nahelegen (Ehmke/Jude 2009: 250).
Noch in der PISA-Studie von 2009 waren bereits beim Besuch des Kindergartens hinsichtlich der sozialen Herkunft Unterschiede feststellbar: So besuchten Kinder aus höheren sozialen Schichten den Kindergarten signifikant länger, wurden früher eingeschult und wiederholten seltener eine Klasse als Kinder aus niedrigen sozialen Schichten (vgl. Ehmke/Jude 244). Nicht allein der Besuch eines Kindergartens, sondern vor allem die Qualität der frühkindlichen Bildung ist ausschlaggebend wie die NICHD9-Studien der amerikanischen Wissenschaftlerin Alison Clarke-Stewart ergaben, doch fügt der Bildungsforscher Wassilios Fthnakis hinzu:
„Es zeigt sich, dass die Qualität der Fremdbetreuung nur so gut ist, wie es das Gesetz verlangt; wenn eine hohe Qualität nicht vorgesehen ist, stellt sie sich nicht ein.“ (Fthenakis/Textor 1998: 148f).
Clarke-Stewart konnte aufzeigen, dass die Qualität von Kinderbetreuung besonders durch Faktoren wie die Räumlichkeiten der Einrichtung, das Verhalten der Betreuer/innen, das Curriculum und die Struktur des Tagesablaufs sowie die Anzahl der Kinder bestimmt waren (vgl. Fthenakis/Textor 1998: 152f).
Zum unterschiedlichen Leistungsstand in der Grundschule tragen dem Erziehungswissenschaftler und Autor der LUST10-Studie Hans Brügelmann zufolge die unterschiedliche Unterrichtsqualität, individuelle Lernvoraussetzungen und unterschiedlicher Lernbedingungen bei. Die Kinder, die früh lesen können, sind unterfordert; die schwachen Leser dageben überfordert (vgl. Brügelmann 2003: 14). Als eine Ursache vermutet Brügelmann große Entwicklungsunterschiede bereits vor Schuleintritt. Da alle Schüler und Schülerinnen eigene Fortschritte erzielen, partizipieren auch schwache Teilleistungsgruppen an dieser Entwicklung – wenn auch in geringerem Umfang:
„Pädagogisch gesehen sind die Fortschritte jeder Teilgruppe bedeutsamer als die Abstände innerhalb der Gesamtgruppe.“ (Brügelmann 2003: 19, Hervorhebung i.O.).
Brügelmann (2003: 19) nutzt das Bild der Karawane, dass der letzte einer Reihe auch der letzte bleibt, obwohl er einen bedeutenden Weg zurückgelegt hat. Dabei ist der Faktor Zeit entscheidend:
„Dieselben Ziele werden von fast allen Kindern erreicht – nur von den später gestarteten zu einem späteren Zeitpunkt.“ (Brügelmann 2003: 44).
Statt für alle verbindliche Normen und Bildungsstandards zu definieren fordert Brügelmann eine Orientierung an den Bedürfnissen und Begabungen jedes einzelnen Kindes, um diese individuell weiterzuentwickeln.
Der Erziehungswissenschaftler Joachim Schroeder erkennt in der Berücksichtigung der Lernausgangslagen von Schülerinnen und Schülern einen modernen Bildungsauftrag (vgl. Schroeder 2012: 454). Gründe für Bildungsbenachteiligung können nicht allein auf Leistungsdefizite der Jugendlichen oder negative Zuschreibungen durch die Gesellschaft zurückgeführt werden. Ursächlich für schwierige Schulkarrieren sind
„[…] vielmehr die unangemessene Verknüpfung von sozialen Lagen und schulischen Bildungsangeboten“ (Schroeder 2012: 454).
Durch das Aufwachsen in prekären Lebenslagen, unter denen Bildungsprozesse nur erschwert möglich sind, erkennt Schroeder Benachteiligungen. Diese Jugendliche befinden sich häufig in einer erschwerten sozialen Lage, weil sie Lernprobleme aufgrund von Teilleistungsstörungen haben oder in einer Umgebung aufgewachsen sind, in der Leistungsanforderungen und ein sozial erwünschtes Verhalten nicht eingeübt wurden (vgl. Schroeder 2006: 212). Charakteristisch sind hier vor allem die nicht tragfähigen familiären Beziehungen, wodurch die jungen Erwachsenen beim Übergang in ein existenzsicherndes Berufsleben weitgehend auf sich selbst gestellt sind (ebd.). Unterschiedliche Lebenslagen wie Obdachlosigkeit, Suchtprobleme oder Delinquenz (vgl. Schroeder 2006: 213) oder Elternschaft können hinzukommen und kennzeichnen die Gruppe benachteiligter Jugendlicher.
„Benachteiligung“ ist ein schillernder Begriff, der in Lexika kaum erscheint und im Gegensatz zum Terminus der „Behinderung“ juristisch bzw. sozialwissenschaftlich nicht präzise definiert ist (Schroeder 2006: 207). Daher sieht Schroeder diesen als „relationale[n] Begriff“ an, der im semantischen Bedeutungsgehalt auf „Hindernisse“ und Ungleichheiten verweist und „sich normativ auf Ansprüche von Gerechtigkeit und Erhöhung von Chancen gesellschaftlicher Teilhabe bezieht.“ (ebd.). Ein neutraler Begriff, um die „Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf“ (BMBF 201; 2002) zu benennen, fehlt bislang. Die problematische Begriffsbestimmung begründet sich auch historisch aus den verschiedenen Disziplinen, die sich mit Benachteiligtenförderung beschäftigen: der Berufs- und Wirtschaftspädagogik sowie der Sozial-, Sonder- und Schulpädagogik (vgl. Spies/Tredop 2006:15). Die Aufgabe des Bildungssystems sieht Schroeder in der Vorbereitung für den späteren Lebensweg, doch ist es
„dem Bildungssystem bislang nicht gelungen […], in der Gestaltung seiner Binnen- wie auch seiner Außenverhältnisse entsprechende Verknüpfungsleistungen zu erbringen, so dass für alle Schülerinnen und Schüler wesentliche Voraussetzungen zur Existenzsicherung geschaffen werden: nämlich einen Schulabschluss zu erreichen und einen Arbeitsplatz zu finden.“ (Schroeder 2006: 208).
Kennzeichnend für eine besondere Lebenslage können zudem Schwierigkeiten beim Zugang zum Schulsystem sein, dem Verbleib darin und den möglichen Anschlussperspektiven. So kann der Zugang rechtlich nicht möglich sein, aber auch bei fehlenden oder zu geringen Schulabschlüssen können Exklusionsprozesse aus Schule und Beruf folgen ebenso wie bei Umzügen, Schulabsentismus oder einer Erwerbstätigkeit, um zum Familienunterhalt beizutragen. Der Anschluss aus Regel- oder Sonderschulen und aus abgebrochenen Ausbildungen verläuft weitgehend ohne Unterstützung und bleibt der Verantwortung des Einzelnen überlassen. Daher sind hier entsprechende Angebote vorzuhalten ebenso wie unterstützende Maßnahmen zum Verbleib darin und Anschlussangebote nach dem Austritt aus der allgemeinbildenden Schule (Schroeder 2012: 428).
Schroeder untersuchte sog. Angebotsschulen, die gezielt auf die prekären Lebenslagen ihrer Schülerinnen und Schüler Bezug nehmen und die Kompetenzen stärken, die in diesen besonderen Biographien notwendig sind. Diese versuchen den Jugendlichen und deren Bedürfnissen gerecht zu werden, in dem sie abklären, in welcher Lebenslage sich diese befinden und welche Förderung die jungen Menschen in dieser Lage tatsächlich benötigen (Schroeder 2012: 454). Ebenso wird angestrebt herauszufinden, wie diese Jugendlichen benachteiligt werden und wie deren persönliches Lebensumfeld die Lernbemühungen unterstützt oder verhindert; dazu werden institutionelle Barrieren beim Zugang, Verbleib und die Anschlussperspektiven analysiert (ebd.).
Das Angebot der Regelschulen beinhaltet dagegen dem biologischen Alter entsprechende Entwicklungsaufgaben, die zur Reproduktion der generationalen Beziehungen bestimmt sind (Schroeder 2012: 454). Sie gehen häufig von einem Normativitätsverständnis aus, mit dem die Bedingungen des Aufwachsens in prekären Lebenslagen nur unzureichend reflektiert werden (vgl. Schroeder 2012: 434).
Die Aspekte von Gender und Migration können eine Eigendynamik in dem Prozess der Berufsfindung entfalten, die gerade für bildungsbenachteiligte junge Frauen diskriminierend wirken.
Die besondere Lebenslage der frühen Mutterschaft ist häufig prekär und von materiellen Engpässen geprägt. Die minderjährigen oder gerade volljährig gewordenen jungen Mütter müssen häufig Schule, berufliche Orientierung bewältigen und den Bedürfnissen ihrer Kinder gerecht werden, so dass sie unter enormen Zeit- und Leistungsdruck stehen. Schroeder kritisiert, dass die wenigen Hilfen kaum dazu beitragen können, weiterführende Bildungsziele zu verfolgen. Über ein familiäres Netz verfügten die wenigsten, meist unterstützt die eigene Mutter so gut wie möglich. Außer den Frühen Hilfen gibt es in Schulen gerade im Vorfeld von Prüfungen, das schmale Zeitfenster zu erweitern, oder beim Übergang in Ausbildung wenig Teilzeitangebote.
„Denjenigen jungen Müttern, die überwiegend auf sich allein gestellt sind, die auf wirtschaftlich schmaler Basis leben müssen und lediglich auf die beschränkte Unterstützung durch öffentliche Institutionen zählen können, gelingt allzu oft weder eine Fortsetzung des Bildungsverlaufs nach dem Mutterschutz und noch seltener die Aufnahme beziehungsweise das Absolvieren einer beruflichen Ausbildung.“ (Schroeder 2012: 442).
Die existierenden Programme sind „fast nur auf die Vereinbarkeit von Studium und Kind – als auf „die Studentin“ – gerichtet. Dagegen wird die junge Mutter aus einfachen Verhältnissen – „die Schülerin ohne Abschluss“ – sowohl in der Frauenforschung und –politik als auch im Feld der geschlechtergerechten Schulpädagogik bislang überwiegend sich selbst überlassen.“ (Schroeder 2012: 443).
Von rechtlichen Benachteiligungen beim Zugang zu Ausbildung in Schule und Beruf sind häufig Migrantinnen und Migranten betroffen. Weitere strukturelle Barrieren existieren auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, zu dem nicht alle Ausbildungssuchende gleichermaßen Zugang bekommen; auch in der einseitigen Ausrichtung der Förderung auf das duale System erkennt Schroeder eine Marktbenachteiligung. Das Zusammenspiel sozio-ökonomischer und rechtlicher Faktoren, individuellen Lebenslagen und Bildungsstrukturen wird bisher vom Gesetzgeber nicht berücksichtigt. Unternehmensstrukturen in der Wirtschaft, die Migrantinnen und Migranten aufgebaut haben, finden keine Beachtung ebenso wie die fehlende Wertschätzung der sprachlichen und kulturellen Kenntnisse von Migrantenkindern im deutschen Schulsystem (vgl. Schroeder 2006: 210f).
„Englisch und Französisch, Türkisch und Arabisch, Spanisch und Russisch sind aber Sprachen, die in Deutschland einen hohen Marktwert haben, weil sie in den internationalen Wirtschaftsbeziehungen aber auch für den Binnenmarkt bedeutsam sind […] Sprachen sind jedoch ein Kapital, das an andere Lebensorte mitgenommen werden kann und dort verwertbar ist“ (Schroeder 2006: 211).
Die Mobilität von Familien stellt die verschiedenen schulorganisatorischen Ebenen der Kommunen, der einzelnen Region und auf Länderebene vor Herausforderungen. Andere Lebenslagen erfordern eine Planung, die sich eben nicht ausschließlich am Wohnsitz der Schülerinnen und Schüler orientieren (vgl. Schroeder 2012: 430). Gerade die neueren Migrationsbewegungen erfordern laut Schroeder einen transnationalen Diskurs in Europa und einen Austausch zwischen den Nationalstaaten, da diese Fragen nicht auf der Ebene eines einzigen Staates beantwortet werden können (vgl. Schroeder 2012: 431).
Damit der Bedarf, der sich aus besonderen Lebenslagen ergibt, auf den unterschiedlichen Organisationsebenen überhaupt erst ermittelt wird, sind ein umfassendes Bildungsmonitoring und eine Evaluation der bereits bestehenden Angebote erforderlich (vgl. Schroeder 20012: 432). Schroeder fordert zudem die Berücksichtigung von Datenlücken. Jugendliche, die nach Erfüllung der Schulpflicht in der Berufsvorbereitung sind, werden nicht erfasst, da sie weder als arbeitssuchend noch als Schüler gelten. Dies setzt die Entwicklung eines Systems zur Qualitätssicherung von Bildungsangeboten voraus (vgl. Schroeder 2012: 438). Da viele junge Menschen unter prekären Bedingungen aufwachsen, für die noch keine gesetzlich garantierte Hilfe existiert, und um differenzierte Bildungsangebote auch in ländlichen Räumen anbieten zu können, bedarf es nach Schroeder einer „sozialraumorientierte[n] Schulentwicklungsplanung“ (Schroeder 2012: 427) sowie anschließend einer Evaluation dieser Bemühungen durch ein systematisches Bildungsmonitoring (vgl. Schroeder 2012: 432).
„Auch für den Bildungsbereich stellt eine lebenslagenorientierte Planung keine methodische Überforderung mehr dar, die in der Sozialberichterstattung entwickelten Datenkonzepte lassen sich problemlos für eine Bildungsberichterstattung nutzen, die regelmäßig soziale Ungleichheit beobachtet, mehrfache Benachteiligungen in Dimensionen materieller Versorgung und sozialer Teilhabe identifiziert sowie Zusammenhänge und Ursachen zwischen verschiedenen Formen der Benachteiligung darstellt.“ (Schroeder 2012: 433).
Methodische Ansatzpunkte zur Beschreibung pädagogischer Qualität sieht Schroeder in den Konzeptionen und Curricula von Bildungseinrichtungen, die deren Selbstverständnis reflektieren, einer flankierenden Evaluierung von Projekten und Maßnahmen sowie Ex-post-Studien zu den rekonstruierten Lebensläufe der Ehemaligen mit Blick auf die Nachhaltigkeit dieser Hilfen (vgl. Schroeder 2012: 435). Die besonderen Lernbedürfnisse der Angehörigen verschiedener sozialer Milieus bei der Erstellung der Curricula zu berücksichtigen ist eine wirksame Möglichkeit, die Auseinandersetzung mit den Lebenslagen der Schülerinnen und Schüler zu befördern. Dazu sind die Schulen aufgefordert nicht nur ein eigenes Profil zu entwickeln, sondern die soziale Lage ihrer Schülerinnen und Schüler zu berücksichtigen und differenzierte Bildungsangebote für unterschiedliche Lebenslagen u.a. für die Mutterschaft, bei psychischer Erkrankung, für Asylsuchende oder Haftentlassene zu erarbeiten (vgl. Schroeder 2012: 429). Dabei stellt die Orientierung an den Lebenslagen kein neues pädagogisches Konzept dar (vgl. Schroeder 2012: 458). Bildungsgeschichte auf die Wandlung von einer „schlechten“ zu einer „guten“ Schule zu reduzieren hält Schroeder für unangemessen; vielmehr sei „[…] zu versuchen, immer wieder neue, intelligente, zeitlich begrenzte und regional angepasste Lösungen zur Absicherung des Zugangs, Verbleibs und Anschlusses zu öffentlicher Bildung auch für diejenigen Kinder und Jugendlichen zu entwickeln, die in den ‚Zonen der Verwundbarkeit‘ aufwachsen.“ (Schroeder 2012: 459). Schroeder beklagt die Hinwendung zu offenen Unterrichtskonzepten ohne die Inhalte auf ihre Eignung für die jeweilige Zielgruppe zu überprüfen (vgl. Schroeder 2012: 456f). Es geht hier weniger um didaktische Fragen, wie der Lernstoff zu vermitteln ist, sondern auch um das, was vermittelt werden soll. Bildung hat hier das Ziel:
„dass sie die Betroffenen unterstützt, trotz Marginalisierung und Stigmatisierung ein Leben zu führen, das ihre Selbstachtung nicht permanent infrage stellt.“ (Schroeder 2012: 455).
Gerade die Absolventinnen und Absolventen von Hauptschulen benötigen Unterstützung, weil Bildung die Voraussetzung für die Teilhabechancen am gesellschaftlichen und ökonomischen Leben ist. Der Bildungssoziologe Steffen Schindler erkennt in Bildung den „Schlüssel zu Lebenschancen“ (Schindler 2012). Er unterstreicht, dass eine rein formale Chancengleichheit nicht zu einer tatsächlichen Inanspruchnahme von Bildungsangeboten führen muss:
„Akademikerkinder verfügen heute über eine etwa sechsmal so hohe Chance, ein Studium aufzunehmen wie junge Menschen aus bildungsfernen Elternhäusern.“ (Schindler 2012:1).
Nun könnte man annehmen, dass Kindern von Akademikern eben auch mehr leisten, um ihre Ziele zu erreichen, als Kinder von Nicht-Akademikern. Wer weniger leistet, erhält auch weniger. Hinter dieser vermeintlich gerecht klingenden Forderung verbirgt sich die Frage nach der Definitionsmacht: Wer definiert, wer viel oder wenig leistet?
Zudem gilt es zu untersuchen, was überhaupt als Leistung anzusehen ist und welche Ressourcen den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stehen, um bestimmte Leistungen zu erbringen. Was leistet die Hauptschülerin mit Kind, die nebenher jobbt, oder die Studentin, die ein unbezahltes Praktikum in einem großen Wirtschaftsunternehmen absolviert, weil die Eltern dies finanzieren?
Dass die durch die Bildungsexpansion initiierten Öffnungseffekte verpuffen, bestätigt Schindler in seiner Studie „Aufstiegsangst“ (2012) mit Walter Müller: Einerseits gelingt es immer mehr Personen, eine Studienberechtigung zu erlangen – dieses entwickelt sich von einem exklusiven Bildungsprädikat zu einem Massenabschluss – andererseits setzt sich dieser Trend nicht bis an die Universitäten durch mit dem Ziel, ein Studium aufzunehmen. Denn die Öffnungsprozesse bieten lediglich Korrekturmöglichkeiten innerhalb des Bildungssystems an, in dem die Entscheidungen beim Übergang in die Sekundarstufe I in einem jungen Lebensalter erfolgen und daher die Eltern einen wesentlichen Anteil daran haben, in welche Schulform ein Kind einmündet (vgl. Schindler 2012: 12).
Zudem hat das Berufsbildungssystem eine Ablenkungswirkung (vgl. Schindler 2012: 21). Viele erwerben ihre Studienberechtigung überdies an Fachhochschulen, an denen der Anteil der Kinder aus bildungsfernen Familien überwiegt. Der Anteil der Peer-Effekte auf Bildungswünsche ist nicht zu vernachlässigen, werden doch dort die persönlichen Ziele erörtert. Schindler verweist darauf, „dass Schüler aus bildungsfernen Familien dann eher aufgeschlossen für akademische Bildungsinhalte sind, wenn sie durch Alltagskontakte zu Schülern aus akademisch gebildeten Familien entsprechend geprägt werden.“ (Schindler 2012: 25).
Eine Erklärung bietet die Theorie der Herkunftseffekte des französischen Soziologen Raymond Boudon: Primäre Herkunftseffekte betreffen das Wissen und die Kenntnisse, welche in der Institution Schule relevant sind; darüber verfügen meist Eltern mit hohem Bildungsniveau und geben dies an ihre Kinder weiter. Sekundäre Herkunftseffekte werden wirksam, wonach Schüler aus bildungsfernen Elternhäusern selbst bei sehr guten Noten auf bestimmte Bildungskarrieren verzichten, da der höhere Kostenaufwand sowie die Ausbildungsdauer nicht aufgebracht werden können und kulturelle Aspekte wie die Vertrautheit und Erfahrung mit höherer Bildung einfach fehlen. Bei bildungsnahen Familien dagegen spielt außerdem das Motiv des Statuserhalts eine größere Rolle (vgl. Schindler 2012: 8). Sollen „Maßnahmen zur Reduktion sozialer Ungleichheiten“ (Schindler 2012: 25) nachhaltige Wirkung zeigen, müssen sie möglichst frühzeitig einsetzen.
2.3 Diskriminierung von Absolventinnen und Absolventen der Hauptschule beim Übergang in Ausbildung und Arbeit
Von Menschen, die über eine gute Bildung verfügen, ist der Erfolg und Wohlstand in einer Volkswirtschaft abhängig. Doch haben Menschen ganz unterschiedliche Chancen, bestimmte Bildungszertifikate zu erwerben.
Zur Situation der geringqualifizierten Jugendlichen beim Übergang in Ausbildung und Arbeit gab es bereits in den 1970er und 1980er Jahren verschiedene Studien (vgl. Troltsch et. al. 2000:1). Klaus Schweikert und Dorothea Grieger (1975) sowie Schweikert (1979) haben Ergebnisse zur damaligen Jugendarbeitslosigkeit vorgelegt. Ein Jahrzehnt später widmeten sich Thomas Clauß (1989) sowie Clauß mit Rolf Jansen und Friedemann Stooß (1990) dem Thema. Auf der Datengrundlage des Sozio-ökonomischen Panels (SOEP) des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) von 1985 konnte nachgewiesen werden, dass 15,3% der jungen Erwachsenen zwischen 20 und 24 Jahren ohne Berufsabschluss blieb (vgl. Troltsch 2000: 11). 1991 wurden dann vom damaligen Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie weitere Daten vorgelegt. Anfang der 1990er Jahre erregte die EMNID-Studie Aufsehen, da nachgewiesen werden konnte, dass 14% der jungen Menschen ohne Ausbildung blieben (Troltsch et. al. 2000: 9). Diese bezog sich allerdings nur auf die alten Bundesländer. 1991/92 folgte daher zur Ergänzung die INFRATEST-Studie, die alte und neue Bundesländer berücksichtigte (Troltsch et. al. 2000: 9). Ein Vergleich der beiden Studien gestaltete sich durch die unterschiedlichen Schul- und Ausbildungssysteme schwierig. Im Juni/Juli 1998 startete das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung eine Befragung der Zielgruppe von Jugendlichen ohne abgeschlossene Berufsausbildung (vgl. Troltsch et.al. 2000: 71). Diese Untersuchung fügte sich in den Zehnjahreszyklus der seit Mitte der siebziger Jahre durchgeführten Erhebungen ein. Öffentliches Interesse ergab sich aus der damals angespannten Lage des Ausbildungsstellenmarktes sowie der stark rückläufigen Beschäftigung von Ungelernten (vgl. Troltsch et. al. 2000:1).