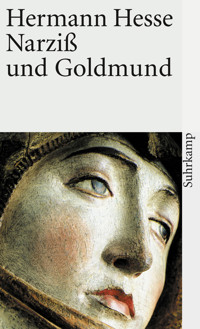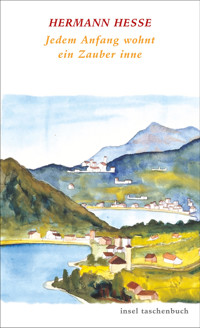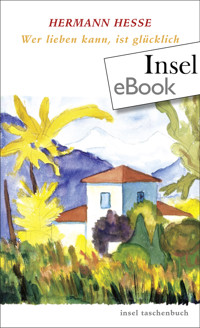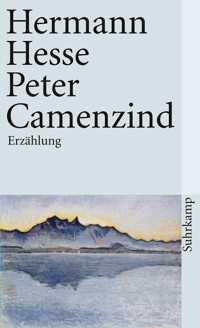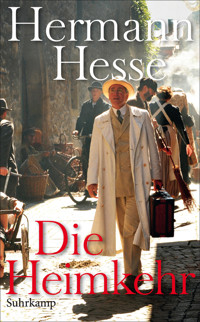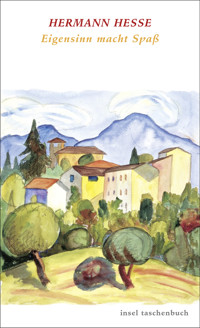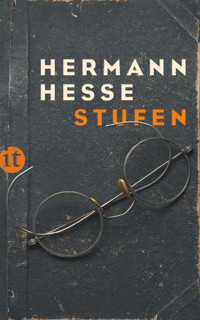16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mehr als sechzig Jahre seines Lebens hat Hermann Hesse in der Schweiz verbracht. Eine Vorliebe für grenzüberschreitende Gemeinsamkeiten wie auch für lokale Prägung, also die unverwechselbaren Eigenheiten der verschiedenen Kantone, Landschaften, Sprachen und Mentalitäten, spricht aus all den nahezu fünfzig Texten dieses Bandes. Meist sind es Reiseberichte, Impressionen von Landschaften und Menschen, Erinnerungen an wichtige, in der Schweiz erlebte Begebenheiten, Schilderungen und Würdigungen von Hesses Schweizer Freunden und Künstlerkollegen. Diese Texte reichen von der Jahrhundertwende bis in die fünfziger Jahre und erfassen die Poesie und Eigenart der schweizerischen Landschaften mit erstaunlicher Intimität.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 431
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Hermann Hesse
Beschreibung einer Landschaft
Schweizer Miniaturen
Herausgegeben und mit einem Vorwort versehen von Siegfried Unseld
Suhrkamp
Inhalt
Siegfried Unseld, Hermann Hesse und die Schweiz
Alemannisches Bekenntnis
Die Eidgenossenschaft
»Hier hatte ich mich durchgekämpft …«
Am Vierwaldstätter See
Am Gotthard
Eine Wandererinnerung
Wintertage in Graubünden
Reisebilder
Der große Horizont
Winterausflug
Landesausstellung
Vor einer Sennhütte im Berner Oberland
Wanderung im Tessin
Kirchen und Kapellen im Tessin
Winterbrief aus dem Süden
Tessiner Sommerabend
Madonna d’Ongero
Madonnenfest im Tessin
Rückkehr aufs Land
Winterferien
Arosa
Wahlheimat
Basler Erinnerungen
Beschreibung einer Landschaft
Aus dem »Rigi-Tagebuch«
Erlebnis auf einer Alp
Zwei August-Erlebnisse
Im Auto über den Julier
Engadiner Erlebnisse
Vierzig Jahre Montagnola
Rede, gehalten am 1. Juli 1962
Schweizer Freunde und Künstlerkollegen
Ein Schweizer Dichter. Albert Steffen
Robert Walser
Erinnerungen an Othmar Schoeck
Erinnerung an Albert Welti
Zum fünfzigsten Geburtstag Ernst Kreidolfs
Die Bilderbücher von Ernst Kreidolf
Cuno Amiet
Ernst Morgenthaler
Der schwarze König
Bundesfeier in Bremgarten
Quellennachweise
Hermann Hesse und die Schweizvon Siegfried Unseld
War Hermann Hesse, als russischer Staatsbürger im schwäbischen Calw geboren, Schweizer? Diese Frage war über Jahre hinweg ein beliebtes Gesellschaftsspiel. Doch Hesse hat sie selbst eindeutig beantwortet.
Am 5. Mai 1941 schrieb Hesse das bedeutsame, Josef Knecht zugedachte Gedicht »Stufen«. Gegen Ende des Jahres war sein opus magnum, das damals noch »Der Glasperlenspielmeister« hieß, fast vollendet. Höchste Zeit also, um mit seinem Verleger Peter Suhrkamp über das Manuskript und auch das Schicksal seiner anderen Bücher zu sprechen, die in Deutschland teils nicht mehr nachgedruckt werden konnten, teils auf andere Weise daran gehindert wurden, ihre Leser zu erreichen. Ihr Absatz war seit 1933 rückläufig, die immer geringeren Honorare wurden auf schwer zugänglichen Sperrkonten festgefroren, um die Überweisung in die Schweiz zu behindern. Peter Suhrkamp beantragte die Einreise in die Schweiz, und Hermann Hesse bat von Baden aus seinen Freund Martin Bodmer, er möge bei der Fremdenpolizei in Bern Suhrkamps Einreisegesuch befürworten: »Für mich ist wie für Suhrkamp die Ermöglichung einer ausgiebigen Besprechung der Lage lebenswichtig.« Am 10. Dezember fand dieser Besuch in Baden statt. Beide wollten trotz der fast aussichtslosen Lage den Versuch unternehmen, »Das Glasperlenspiel« in Deutschland zu veröffentlichen. Doch der Versuch scheiterte am Veto der Reichschrifttumskammer; genau ein Jahr später, im November 1942, mußte Suhrkamp ebenfalls in Baden das Manuskript an Hesse zurückgeben. Die Veröffentlichung erfolgte dann im Zürcher Verlag Fretz & Wasmuth. Doch dem Versuch, »Das Glasperlenspiel« in Deutschland zu publizieren, verdanken wir einen Brief Hesses an Suhrkamp vom 17. 12. 1941, in welchem der Dichter zur Frage seiner Staatsangehörigkeit unmißverständlich Stellung nimmt.
Die Eltern seines Vaters waren beide russische Staatsbürger, nach Herkunft und Sprache deutsche Balten. Der Vater der Mutter war Württemberger, seine Frau Schweizerin, aus dem Westschweizer Kanton Neuchâtel. Sein Vater Johannes war im baltischen Weißenstein in Estland geboren. Von seinem 22. bis 26. Lebensjahr missionierte er im Auftrag der Baseler Mission in Indien. Bald darauf wurde er nach Calw versetzt, um dort Dr. Hermann Gundert, dem Missionar und Redakteur der Calwer Missionsblätter, zu assistieren. Er heiratete 1874 die Tochter seines Vorgesetzten, Marie Gundert, verwitwete Isenberg, die Mutter Hermann Hesses. Sie war 1842 in Talatscheri/Westindien geboren. Als Hesse am 2. Juli 1877 zur Welt kam, war er wie sein Vater russischer Staatsbürger. Johannes Hesse war 1881 von der Mission nach Basel berufen worden, wo er bis 1886 als Herausgeber des Missionsmagazins tätig gewesen ist und einen Lehrauftrag für Missionsgeschichte erhielt. Schweizer Urkunden hatten ihn als »aus Rußland stammend« bzw. »heimatlos« bezeichnet. Er beantragte daher die Aufnahme ins Baseler Bürgerrecht, das ihm am 15. 5. 1883 gewährt wurde. Von diesem Tag an war nun auch Hermann Hesse wie seine anderen Geschwister Schweizer Staatsbürger. Der Tradition der Familie folgend, sollte er ein württembergisches theologisches Seminar besuchen und Geistlicher werden. Eine kostenlose Ausbildung war jedoch nur Württembergern möglich, außerdem galt es, vierzehnjährig das berüchtigte Württemberger Landexamen zu bestehen. Deshalb wurde Hesse, »ohne viel gefragt zu werden«, als Württemberger naturalisiert. Die Staatsangehörigkeitsurkunde des ehemaligen Königreichs Württemberg stammt vom 16. 10. 1895. Warum sein Vater noch drei Jahre später um die Entlassung des Sohnes aus dem Baseler Bürgerrecht bat, ist unklar, denn diese Entlassung wäre nicht mehr nötig gewesen, weil Hesse nur sieben Monate »unterm Rad« im Maulbronner Seminar war. Aber er hatte nun einmal die württembergische Staatsangehörigkeit und war damit Deutscher geworden und blieb Deutscher bis 1924. Von diesen 34 Jahren lebte Hesse nur 18 Jahre lang in Deutschland. Neunzehnjährig begann er eine vierjährige Buchhändlerlehrzeit in Tübingen, um dann im September 1899 als Sortimentsgehilfe in die Reich’sche Buchhandlung in Basel einzutreten und später in der Basler Firma Wattenwyl als Antiquar zu arbeiten.
Hermann Hesses erste Staatsangehörigkeitsurkunde vom 16. 10. 1895.
Seine Baseler Adressen sind bekannt: Holbeinstraße 21 (1900), Mostackerstraße (1901), Burgfelderstraße (1902) und St. Albanvorstadt (1903). In Basel war er regelmäßig zu Gast im »Hinteren Württemberger Hof«, im Brunngäßlein 11, ein Haus, das von berühmten Gelehrten bewohnt wurde – darunter auch von dem Historiker und Staatsarchivar Dr. Rudolf Wackernagel, mit dessen Familie Hesse in enge Verbindung kam. Aus dem Jahre 1901 stammt ein poetisches Zeugnis »Brunngäßlein 11«.
In einem »Rückblick« überschriebenen Gedichtfragment aus dem Jahre 1937 faßte Hesse seine Zugehörigkeit so zusammen:
»Wie meine Eltern aus weit entfernten Gebieten
Deutscher Zunge sich fanden, er Balte, sie Schwäbin,
Beide aber, im Blute
Fremd sich, dem Geist nach Geschwister,
Beide mehr dem Reich Gottes
Als irdischer Herkunft gehörend,
So auch hat meine Kindheit, damit ich
Fremdling werde auf Erden und dennoch
Dieser Erde werbend Liebender,
Mich zwei Heimaten eingepflanzt,
Mich zweier Länder Duft und zweier
Mundarten schlichter Musik beschenkt und gebildet.
Heimat war mir Schwaben und war mir Basel am Rheine.«
Originalhandschrift des Gedichtes »Brunngäßlein 11« aus dem Manuskript »Basler Verse«, 1901, geschrieben für Dr. Rudolf Wackemagel und seine Frau Elisabeth.
In Basel lebte er nun inmitten eines Kreises von Leuten, dessen Denkart und Geschichtsauffassung noch ganz von dem drei Jahre zuvor verstorbenen Kunst- und Kulturhistoriker Jakob Burckhardt geprägt worden war; auch Hesse verdankte ihm unvergeßliche Leseerfahrungen. In einer Rezension, geschrieben zur Zeit, als »Das Glasperlenspiel« entstand und er die Jakob Burckhardt nachempfundene Gestalt des Pater Jakobus entwickelte, heißt es: »Wenn die Unabhängigkeit, die Nichtkäuflichkeit des Gewissens auch heute noch gültige Ideale für die Leistung sind, so verdankte unsere Zeit das vorbildlichen Geistern wie Burckhardt.«
Durch seinen Vater lernte Hesse Friedrich Bernoulli kennen, einen musikalisch begabten Notar aus dem berühmten Baseler Mathematikergeschlecht. Mit dessen Tochter Maria verlobte sich Hesse am 31.5. 1903 und heiratete sie am 2. 8. 1904. Die Jungvermählten zogen nach Gaienhofen am Bodensee nahe der Schweizer Grenze. Viele seiner späteren Schweizer Freunde hat Hesse am Bodensee kennengelernt, so auch Othmar Schoeck, einen der nach Hugo Wolf bedeutenden Liederkomponisten, der 23 Gedichte von Hesse vertonte. Auch Hermann Hesses Musikerroman »Gertrud« ist von ihm inspiriert.
Im September 1912 übersiedelte Hesse mit seiner Frau und den drei Söhnen nach Bern, wo er bis April 1919 das Haus des verstorbenen Malers Albert Welti bewohnte: »Außer privaten Sorgen empfand ich auch mit wachsender Stärke das politische Unbehagen in der überheblichen, protzigen Gesellschaft des wilhelminischen Deutschland.« Zu Bern dagegen hatte er instinktives Vertrauen: Bern sei für ihn »die schönste alte Stadt der Schweiz und ein Land voll Kraft und Schönheit, rassiger üppiger Baumwuchs, tiefer Boden, gutes Wasser, nahe Berge…« Und außerdem habe Bern, wie er an Ludwig Thoma schrieb, ja auch einen Bahnhof, so daß man immer mal fortreisen könne. Er war sicher, sich dort wohl zu fühlen, freilich: »Für mich selbst wird ein wenig Vagabundentum immer dazugehören.« Doch weiträumig vagabundierte er nicht. Seine berühmte Indienreise war ein Fehlschlag. Von 1901 bis 1914 reiste er zwar immer wieder in Italien, doch die anderen Reiseziele waren vorwiegend schweizerische. Er hat häufig betont, er werde in der Schweiz bleiben, denn seine Kinder seien hier aufgewachsen, zur Schule gegangen und sprächen die Berner Mundart, weshalb auch er wiederholt an seine Rückeinbürgerung gedacht habe. Er hätte sie auch längst beantragt, wenn nicht der Weltkrieg gewesen wäre. In dieser Zeit »wäre ein Verzicht auf die deutsche Staatsangehörigkeit mir als unanständig erschienen«. (Hesse hatte den Krieg als politisches Mittel abgelehnt. In seinem berühmten Aufruf »O Freunde, nicht diese Töne« attackierte er schon 1914 den Chauvinismus der Kriegsbegeisterung, was ihm heftige Angriffe aus Deutschland einbrachte, so daß Theodor Heuss den angeblichen »Vaterlandsverräter« verteidigen mußte.) Von 1916 bis 1919 arbeitete er im Auftrag des Deutschen Konsulats in Bern für die Kriegsgefangenenfürsorge.
Die Betrachtungen unter dem Titel »Wanderungen« beschreiben Hesses Weg in den Süden der Schweiz. Am 11. Mai 1919 bezog er vier kleine Zimmer der Casa Camuzzi in Montagnola, einem Dorf oberhalb von Lugano. Nach der Scheidung von seiner ersten Frau bemühte sich Hesse um seine Rückeinbürgerung. An das Schweizer Politische Departement schrieb er am 26.7. 1923: »Daß ich so spät um meine Wiedereinbürgerung nachsuche, hat zweierlei Gründe: Erstens sehe ich jetzt deutlicher als früher, daß meine in der Schweiz aufgewachsenen Söhne völlig hier Wurzeln geschlagen haben und keinerlei Beziehung nach Deutschland nun für sie in Betracht kommt. Zweitens konnte ich, obwohl ich nur eine Art Muß-Deutscher war, während der Kriegszeit und während der ersten Nachkriegsjahre mich nicht dazu entschließen, jenes Wahlvaterland, gewissermaßen fahnenflüchtig, zu verlassen. Heute sind diese Überlegungen mir nicht mehr aktuell.« Aus unerfindlichen Gründen wurde seinem Gesuch nicht entsprochen – vielleicht, weil Hesse den Strafregisterauszug von Calw nicht erbringen konnte; er entschuldigte sich dafür und beteuerte, er habe in Calw einen guten Leumund, die Stadt habe sogar einen Brunnen nach ihm benannt:
Urkunde über Hesses Bürgerrecht in der Einwohnergemeinde Bern vom 26. 11. 1924, die Hesse zum Schweizer Staatsbürger machte.
Am 11. Januar 1924 heiratete Hesse in Basel die Schweizer Sängerin Ruth Wenger, Tochter der Schriftstellerin Lisa Wenger, und richtete nun am 24. 1. 1924 ein zweites Gesuch an den Regierungsrat des Kanton Bern, in dem er sich auf das Berner Bürgerrecht seiner zweiten Frau berief. Der Stadtrat von Bern entsprach dem Gesuch am 9. 5. 1924, der Große Rat des Kanton Bern am 26. 11. 1924. Damit war Hesses Rückkehr in das Schweizer Bürgerrecht endlich vollzogen. Während der zwei Jahre dauernden Ehe mit Ruth Wenger lebte er zeitweise in Basel und immer wieder im Tessin. Seit 1923 jedoch, »nachdem ich in Montagnola vier bittere Hungerwinter durchfroren hatte«, verbrachte er die kalte Jahreszeit jeweils in Basel und Zürich.
Im August 1931 bezog Hesse mit seiner dritten Frau Ninon das Haus, das Hans C. Bodmer für ihn erbaut hatte. Für die »ganze Liegenschaft« erhielt er »ein unentgeltliches und lebenslängliches Wohnrecht im Sinne von Artikel 776/777 des Schweizer Zivilgesetzbuches als Anerkennung seines dichterischen Werkes«. Für 43 Jahre wurde das Haus in Montagnola sein Wohn- und Arbeitsort – nur unterbrochen von Kuraufenthalten in Baden und Sommerwochen im Engadin (von 1949 bis 1961 wohnte Hesse fast jeden Sommer einige Wochen im Hotel Waldhaus in Sils-Maria). 1947 erhielt er den Ehrendoktor der Universität Bern, und zu seinem 85. Geburtstag – eher etwas spät – verlieh ihm die Gemeinde Montagnola das Ehrenbürgerrecht. Hesse dankte mit einer Rede in italienischer Sprache.
Spätestens 1946 jedoch mußte jedem klar werden, daß Hesse Schweizer war. Denn weder Schweizer noch Deutsche verkündeten seine Staatsangehörigkeit, sondern das schwedische Komitee, das ihm 1946 den Nobelpreis verlieh. Der Preis wurde Hesse in der Nachfolge Carl Spittelers eindeutig als einem Schweizer verliehen. Max Frisch hat den damals wieder aufflammenden Streit, ob Hesse nun ein Schweizer sei oder nicht, in seiner Weise entschieden: »Nennen wir ihn einen Europäer.«
Staatsrechtlich war Hesse Schweizer, aber ein Schweizer besonderer und eigener Art. Er bekannte sich nie in einem nationalen Sinn zu seinem Schweizertum. 1936 gab er dem Feuilleton-Redakteur der »Neuen Zürcher Zeitung« Eduard Korrodi zu bedenken, er wisse doch, »wie gern man im Lande die Eingekauften hat, die jeden Satz mit ›Wir Schweizer‹ beginnen«. 1939 lehnte er deshalb auch ab, mit Rudolf Jakob Humm zusammen eine nationale schweizerische Zeitung herauszugeben; »dazu tauge ich als ein so hergelaufener Halb- und Halbschweizer nicht, dem jeder bei jedem Anlaß auf die Schulter klopfen und seinen Mangel an Echtheit vorhalten kann.« Weder Deutschtum noch Schweizertum waren ihm wichtig, noch andere begrenzende Nationalismen. Schon 1919 hatte er sein »Alemannisches Bekenntnis« abgelegt und sich darin zu jenem »Lebens- und Kulturkreis« bekannt, »der von Bern bis zum nördlichen Schwarzwald, von Zürich und dem Bodensee bis an die Vogesen reicht… Dieses südwestdeutsch/schweizerische Gebiet ist mir Heimat«, und das bedeute ihm mehr als Nation. Alles, was alemannisch sei, habe »Heimatgeruch« für ihn. Trotz der Begrenztheit der Verhältnisse habe doch »jedes alemannisch Tal, auch das engste, seine Öffnung nach der Welt, und alle diese Öffnungen und Ausgänge zielen nach dem großen Strom, dem Rhein, in den alles alemannische Wasser rinnt. Und durch den Rhein hängt es von alters her mit der großen Welt zusammen.«
»Heimat war mir Schwaben und war mir Basel am Rheine.« Immer wieder hat Hesse seine Basler Erlebnisse beschrieben, das Kapitel »Meine Kindheit« und das ganze übrige Buch »Hermann Lauscher« entstand in Basel, wie sein erster Roman mit dem urschweizerischen Namen »Peter Camenzind«, dessen erste Studien am Vierwaldstätter See in Vitznau geschrieben wurden. »Untern Rad« ist in Calw, die vielen nachfolgenden Romane und Erzählungen sind in Gaienhofen und Bern entstanden. In den beiden Bänden »Kindheit und Jugend vor Neunzehnhundert« sind seine Lebenszeugnisse aus schwäbischer und Basler Umwelt dokumentiert.
In Hesses zweiter Lebenshälfte seit 1919 ist jedoch der Tessin, den er zum erstenmal 1907 gründlicher kennengelernt hatte, zum »ersehnten Asyl« und zu seiner »Wahlheimat«, zu seiner »vorbestimmten Heimat« geworden. Diesen Weg nach Süden hat er, wie erwähnt, in der »Wanderung« beschrieben. Das Buch sei »nichts anderes als ein Lobgesang auf die Tessiner Landschaft«. In den Städten könne er nicht mehr wohnen, er brauche eine »weite Ländschaft« vor seinem Fenster. Hier im Tessin hatte er sie gefunden. In vielen seiner Dichtungen, auf seinen Zeichnungen und Aquarellen sowie in unzähligen Betrachtungen und Reisebeschreibungen hat er sie dargestellt. Dabei waren ihm neben der »großen Landschaft« vor allem auch die vielen kleinen Besonderheiten der Tessiner Natur und Kultur wichtig: Bäume und Seen, Brot und Nostrano, Kapellen und Grotti: »Der nackte steinerne Tisch bei der steinernen Bank unterm Kirschlorbeer oder Buchsbaum, der Krug und die tönerne Schale voll Rotwein, das Brot und der Ziegenkäse dazu – das alles war zur Zeit des Horaz auch nicht anders.«
Zu Hesses Freunden zählten viele Schweizer Musiker, Maler und Schriftsteller. Unter den Komponisten ist an erster Stelle Othmar Schoeck zu nennen, dann Fritz Brun, Volkmar Andreae und die Sängerin Ilona Durigo. Bei den Malern war es Louis Moilliet. Mit Hans Sturzenegger unternahm Hesse 1911 seine Indienreise. Für Kataloge zu Bilderausstellungen von Cuno Amiet und Ernst Morgenthaler schrieb Hesse Einführungstexte. Der expressionistische Maler Amiet war es, der sich als Lehrer und Erzieher von Hesses ältestem Sohn Bruno annahm. Hans Sturzenegger, Cuno Amiet und Ernst Morgenthaler haben Hesse häufig porträtiert und gezeichnet, die Schweizer Bildhauer Hermann Hubacher und Otto Bänninger Büsten von ihm angefertigt. Dem aus Dresden emigrierten Gunter Böhmer und dem damals als Maler beginnenden Peter Weiss half Hesse und verschaffte ihnen erste Malerateliers in der Montagnoleser Casa Camuzzi.
Aber auch zahlreiche Schriftsteller der Schweiz standen mit Hesse in persönlicher und schriftlicher Verbindung. Jakob Schaffner, Robert Walser, Albert Steffen, Ernst Zahn, Josef Viktor Widmann, Carl Seelig, Hans Reinhart, Hans Morgenthaler, Lisa Wenger, Otto Waser, Rudolf Jakob Humm, Monique Saint-Hélier und viele andere. Mit den meisten war er befreundet, wie Freundschaft überhaupt ein herausragendes Element seines Wesens war. Auch in Buchbesprechungen hat er sich für Schweizer Autoren der Vergangenheit und Gegenwart eingesetzt, immer wieder für Gottfried Keller und C. F. Meyer, aber auch für viele Zeitgenossen. Als einer der ersten bekannte er sich 1954 zu Max Frischs Roman »Stiller«: »Aber nicht nur die geistvolle und auf schöne Art spielerische Kunst im Darstellen und Erzählen ist es, die den einsamen Kauz ›Stiller‹ uns wichtig macht, sondern wir empfinden seine Nöte und seine beinah tödliche Problematik auch als über-individuell, als typisch, als stellvertretend für Zahllose. Gerade, daß er seine schwere Malaise nicht nach einem existenzialistischen Schema darstellt, sondern ganz und gar individuell, gibt ihm diesen Mehrwert über das Literarische hinaus.« Hesse hat sich, wie nur wenige, auch mit Carl Spitteler, seinem Nobelpreis-Kollegen, beschäftigt, dessen politische Rede »Unser Schweizer Standpunkt« von 1914 er als »plausibel und richtig« beurteilte; als Dichter fand er Spitteler »oft ganz großartig, doch sonst von einer koketten Verliebtheit in sich selber, daß er trotz seiner hohen Intelligenz doch wieder klein wird«.
Im Robert Walser-Kapitel meines Buches »Der Autor und sein Verleger« habe ich die Beziehung zwischen Hesse und Robert Walser dargestellt. Hesse war einer der wenigen, die unermüdlich Robert Walsers Meisterschaft reklamiert haben. Es ist erstaunlich, mit welchem Sensorium Hesse die Nuancen des Schweizerdeutschen in der Sprache Robert Walsers aufspürte. Er hat sich ein Leben lang für diesen an seiner Erfolglosigkeit scheiternden Autor eingesetzt, hat sein Werk auch Peter Suhrkamp empfohlen, der aber in der Anfangsphase seines Neubeginns solch eine risikoreiche Edition nicht wagen konnte. Auch mich hat Hesse gedrängt, Robert Walser herauszugeben, und mich mehrfach mit Walsers Nachlaßverwalter Carl Seelig zusammengeführt. Es geht also letztlich auf Hesse zurück, daß wir Walsers Werk übernehmen und ihm, hoffentlich für immer, die verdiente Wirkung sichern konnten.
Viele Schweizer Freunde wurden ihm im Lauf der Jahre zu Mäzenen, die ihm in schwierigen Zeiten halfen. Hans C. Bodmer baute ihm das Haus in Montagnola. Dr. Friedrich Emil Welti setzte ihm eine Rente von jährlich 1000 Franken aus. Zu den Thermalkuren in Baden wurde Hesse von den Brüdern Markwalder eingeladen. Max Wassmer aus Bremgarten war ihm ein treuer Freund und hilfreich auf vielen Gebieten, besonders als Organisator von Festen. Georg Reinhart aus Winterthur, von Hesse »Schwarzer König« genannt, half ihm über die Inflationszeit und immer dann, wenn ihn Hesse für Kollegen und Freunde um Unterstützung bat. Durch Hermann Hesse ist die Familie Reinhart Gesellschafter des Suhrkamp Verlages geworden und der Suhrkamp Verlag dadurch gesellschaftsrechtlich zur Hälfte ein Schweizer Verlag.
Persönlich bin ich Hermann Hesse zum erstenmal im Sommer 1951 begegnet. Daß Bern, genauer Max Wassmers Schloß in Bremgarten, der Ort der Begegnung sein sollte, schien zufällig. Hinter mir lag meine Dissertation über Hesses Werk und seine Einladung, ihn zu besuchen. Max Wassmer empfing mich am Schloßtor und führte mich zu Hesse und seiner Frau Ninon. Später spazierten wir durch das Haus und den Park, für mich, den jungen Hesse-Adepten, eine bewegende Sache. Ich »kannte« diesen Ort zwar nicht aus eigener Anschauung, wohl aber aus meinen »kastalischen« Studien: Die Morgenlandfahrer hielten hier ihre Bundesfeier ab, im Park hatte einst Pablo, mit Rosen bekränzt, seine Rohrflöte geblasen, am Brunnen Don Quichotte seine erste Nachtwache gehalten. Ich hörte durch den Park die Aare rauschen, deren Wasser einst den Morgenlandfahrer H. H. hinab in die kühle Kristallwelt gezogen haben. Auch der Saal des Schlosses mit der berühmten Sammlung Hodlerscher Gemälde war »historisch«, das feierliche Synedrion der morgenlandfahrenden Bundesoberen hatte hier stattgefunden, hier schritt Leo »sorgfältig, demütig, dienend« und verkündete den Mitfahrenden das Gesetz: »Es ist das Gesetz vom Dienen. Was lange leben will, muß dienen. Was aber herrschen will, das lebt nicht lange.« Ich glaube heute, es war jener Gang durch das Schloß und den Park zu Bremgarten, der Hesse und mich zusammenführte; er war überrascht und erfreut, daß ein junger Mann diesen Ort, den er zuvor nie gesehen hatte und der für Hesse wesentlich war, so gut kannte.
Wir betrieben scherzhaft eine Art Glasperlenspiel, indem wir gemeinsam die verschlüsselten Namen der Morgenlandfahrer entschlüsselten. Durch meinen Lehrer Eugen Zeller waren mir schon viele bekannt. So wußte ich, daß Hesses Frau Ninon, deren Lieblingsbuch »Die Morgenlandfahrt« war, dort als ›die Ausländerim vorkomme, eine Anspielung auf ihren Geburtsnamen ›Ausländer‹, und daß sie auch mit der ›Prinzessin Fatme‹, jener Gestalt aus 1001 Nacht, identisch sei. Ihr galt, »ohne es zu wissen«, das ursprünglich zur Fahrt motivierende Ziel des Erzählers H. H. In der ersten Fassung hieß die »Morgenlandfahrt«:»Die Reise ins Morgenland«. Was ich an realen Vorbildern noch nicht kannte, eröffnete mir Hesse. Die Folge dieser Namen beleuchtet einmal mehr Hesses Schweizer Freundeskreis. Hinter Pistorius und Longus steht Dr. Josef Bernhard Lang, sein Psychoanalytiker, bei dem Hesse von Mai bis November 1916 in fast 60 Sitzungen versucht hatte, seiner Depressionen Herr zu werden; Gespräche und Traumanalysen dieser Zeit beschrieb Hesse im »Demian«, in dem auch die Gestalt des Pistorius erscheint. »Jup, der Magier« ist Josef Englert, erstmals in »Klingsors letzter Sommer« so benannt. Er war Ingenieur und Astrologe und erstellte Hesses Horoskop; er hatte ein Haus in St. Moritz und lud ihn immer wieder zum Skifahren ein, mehrfach traf Hesse dort auch mit Thomas Mann zusammen. Fotos zeigen ihn mit der Familie Mann und Jakob Wassermann auf der Skipiste. »Louis der Grausame« zielt auf den Maler Louis Moilliet, der ebenfalls erstmals im »Klingsor« auftaucht. Mein Lehrer Zeller hatte mir eine Postkarte Hesses vom Oktober 1948 gezeigt: »Sie fragen, wer Louis der Grausame sei. Er kommt unter diesem Namen im Klingsor vor und wird im Bremgartener Fest der Morgenlandfahrt als Louis genannt. Er heißt Louis Moilliet und ist einer der mir liebsten Schweizer Maler, wenige Jahre jünger als ich. Er gehört zu den Stammgästen von Schloß Bremgarten, hat in der uralten Bremgartener Kirche die farbigen Fenster gemalt und hatte in der Zeit, wo ich halb Maler war, Einfluß auf mich.« Im »Louis«- Kapitel des »Klingsor« hat Hesse einen Dialog überliefert, der seine Beziehung zu Moilliet darstellt. »Stoecklins Zauberkabinett« im Haus des »Schwarzen Königs« ist ein kleines Studio im Hause Georg Reinharts in Winterthur mit Bildern des Malers Nikolaus Stoecklin, der u. a. auch Hesses »Knulp« illustriert hat. ›Suon Mali‹ ist die Wohnung der Züricher Freunde Alice und Fritz Leuthold, die Hesse in den schweren Jahren zwischen 1925 und 1932 jenes Züricher Winterquartier am Schanzengraben zur Verfügung stellten, wo »Der Steppenwolf« zu Ende geschrieben wurde. Hesse hatte die Leutholds auf seiner Indienreise kennengelernt; Fritz Leuthold, der mehrere Jahre in Siam verbrachte, tritt in der »Morgenlandfahrt« auch als ›König von Siam‹ auf. Die ›Arche Noah‹ ist das Züricher Haus von H. C. Bodmer. Ein Vorfahre von ihm, Johann Jakob Bodmer, hatte das Heldengedicht »Die Noachide« verfaßt, wonach Bodmers Haus in Zürich benannt ist. ›Othmar‹ ist der Komponist Othmar Schoeck, hinter Hans Resom verbirgt sich der Schweizer Schriftsteller und Musikpädagoge Hans Albrecht Moser. Max Wassmer und seine Frau Mathilde figurieren in der »Morgenlandfahrt« als die Schloßherren ›Max und Tilly‹. Im Verhältnis zu all diesen Schweizer Protagonisten gab es nur wenige deutsche, wie z. B. ›Collofino‹, den Rauchzauberer: der Zigarrenfabrikant Josef Feinhals aus Köln, der zusammen mit Franz Schall (»Clangor«) das Motto zum »Glasperlenspiel« ins Lateinische übersetzte (»tract de cristall. spirit ed Clangor et Collof. lib. I, cap. 28«), und ›Lukas‹: der Schriftsteller Martin Lang, ein Freund Hesses aus der Gaienhofener Zeit.
»Mir ist die Schweiz in mehrfacher Beziehung zur Heimat geworden«, schrieb Hesse am 25. Juli 1937, er fühle sich »als Landsmann mitaufgenommen«. Doch im August 1950 glaubte er feststellen zu müssen: »Aber mit den Jahren habe ich doch eingesehen, daß ich auch kein Schweizer bin.« Diese widersprüchlichen Haltungen erklären sich durch den Kosmopolitismus seiner Herkunft, seine Beziehungen zum indischen und chinesischen Kulturraum. Er hat auf nationale und bürgerliche Zugehörigkeit verzichtet, die Bindung an Vaterland und Nation geringgeachtet. In west- oder gar ostdeutsche Politik hat sich Hesse nicht mehr eingeschaltet und gegenüber den ideologisch gespaltenen deutschen Kulturinstitutionen war er mehr als zurückhaltend. 1946 lehnte er ein Mitgliedsangebot der Bayrischen Akademie der Schönen Künste ab: »Man hat hier die Zeit, in der die Schweiz, zumindest die deutschsprechende, von Deutschland als ein ihm zugehörender Gau reklamiert wurde, nicht vergessen.« Auch Alfred Döblins Einladung zum Eintritt in die Berliner Akademie der Wissenschaften lehnte er ab. Selbst die herzlich vorgetragene Bitte von Theodor Heuss, als korrespondierendes Mitglied in den Orden Pour le Mérite einzutreten, schlug er aus. Nie gebärdete sich Hesse als Nationalist, nie als Schweizer Patriot. Ein einziges Mal, im April 1938, nach dem Einmarsch der Deutschen in Österreich, als die Unabhängigkeit und Autonomie der Schweiz in Gefahr schien, legte er ein öffentliches, allerdings fulminantes Bekenntnis zur hergebrachten Form der Schweizer Demokratie ab: »Die Weltgeschichte … hat dem eidgenössischen Versuch, Völkerschaften verschiedener Stämme und Sprachen als einen freiwilligen Bund von Gleichberechtigten zu konstituieren, recht gegeben, und der Bund hat Stürme überstanden, von denen scheinbar viel mächtigere Staatsformen weggefegt worden sind.« Freilich, so Hesse in diesem Aufruf, würde der Schweiz eine »Erneuerung not tun…, eine Erneuerung der Herzen, ein Erwachen zur Wirklichkeit, ein Öffnen der Augen für die Abgründe, die uns umgeben.«
Typoskript der ersten Fassung von Hesses Statement »Die Eidgenossenschaft« für die Zeitschrift »Civitas Nova«, Lugano, datiert von seiner Frau Ninon.
Von seinen 85 Lebensjahren verbrachte Hesse 60 Jahre in der Schweiz, und es ist nur zu verständlich, daß dieser Lebensraum im schriftstellerischen Kosmos seiner Werke Wurzeln schlug. Auch seine Korrespondenz belegt dies. Briefe von ihm und Briefe an ihn. In der Schweizerischen Landesbibliothek in Bern sind etwa 20000 an ihn gerichtete Briefe, sehr viele von Schweizer Absendern, aufbewahrt. Das Hesse-Archiv dieser Landesbibliothek verwahrt auch zwei große Karteikästen aus Holz, in denen Hesse über Jahrzehnte sorgsam genau die jeweils sich ändernden Adressen seiner Korrespondenten und Notizen zu ihrer Person eingetragen hat. Der Leiter der Bibliothek, Rätus Luck, spricht von etwa 5 000 Korrespondenten, von denen 1200 Schweizer sind. »Briefe an Schweizer Freunde« würden also eine voluminöse Edition ergeben. Hesse hat, von den Anfängen abgesehen, fast alle seine Gedichte und Prosabücher in der Schweiz geschrieben, so ist es auch selbstverständlich, daß in den meisten seiner Werke – von »Peter Camenzind« über »Roßhalde«, »Wanderung« und »Morgendlandfahrt« bis hin zum »Glasperlenspiel« – schweizerische Landschaften, Orte und Freunde aus dieser seiner Wahlheimat eine bedeutende Rolle spielen, während natürlich der Geist dieser Werke, Hesses Denken, Fühlen und poetisches Empfinden, Bildern und Einflüssen der Weltliteratur verpflichtet ist.
Bis auf wenige Ausnahmen verzichtet der vorliegende Band auf Auszüge aus Briefen und Werken, die sich, wie z. B. der »Kurgast«, unmittelbar auf die Schweiz beziehen. Wir wollten hier vor allem die weniger bekannten und separat entstandenen Beiträge sammeln, in denen Hesse ein Leben lang seine Schweizer Eindrücke festhielt. Sie beginnen mit dem grundsätzlichen »Alemannischen Bekenntnis« und enden mit einer Laudatio auf seine »Wahlheimat« Tessin. Es sind vorwiegend Beschreibungen von Ausflügen und Wanderungen in Schweizer Kantonen, Schilderungen von Landschaften zu allen Jahreszeiten, Bootsfahrten auf dem Vierwaldstätter See, einer Sennhütte im Berner Oberland, von Kirchen und Kapellen oder einem Madonnenfest im Tessin. Es sind Impressionen von einem der ersten Flüge im offenen Flugzeug über Bern, Erinnerungen an die Kindheit in Basel, die Kriegszeit in Bern, an Zürich und an »Vierzig Jahre Montagnola«.
Hesses Beschreibungen konzentrieren sich in exakter Weise auf das Detail, führen jedoch immer ins Grundsätzliche und Allgemeingültige. Am Vierwaldstätter See beschreibt er ganz konkret die spezifische Farbe des Wassers und endet dann: »… im Anblick dieser Farbe genoß ich für Augenblicke den Triumph der reinen Schönheit über alle Regungen des bewußten und unbewußten Lebens.« So sind seine poetischen Beschreibungen wie die der alemannischen Täler, die aus der Enge ins Weite, Große und Offene führen.
Anläßlich der Schweizerischen Landesausstellung im Jahre 1914 bilanzierte Hesse in einer kritisch ausgewogenen Darstellung: »Man ist fleißig in der Schweiz und sucht sein mäßiges Kapital an natürlichem Reichtum klug und zäh zu verwalten. Man ist auch dem Gemeinsinn und der Vaterlandsliebe offen. Man liebt die Heimat, aber auch in ihrer Schönheit, um ihrer Seele willen… Und schließlich bringt das kleine fleißige Land noch als Luxusblüte diese heute verlachten, später verehrten Sonderlinge von Künstlern hervor, auffallend viele sogar, und in den besten von ihnen mündet denn die kleine Schweiz wieder in die große Welt und aus dem national Determinierten wird Menschheitsgut«.
Auch die Gedenkblätter für Schweizer Schriftsteller und Freunde belegen Hesses lebenslange Verbundenheit mit der Schweiz. Seite für Seite wird spürbar, wie tief dieser große deutsche Dichter mit der Schweiz, ihrer Sprache und der Poesie ihrer Landschaft vertraut war.
Ich danke Volker Michels für seine redaktionelle Hilfe und die Materialien, die er in seinem Band über Hesses »Leben in Bildern und Texten« veröffentlicht hat, Herrn Dr. Uli Münzel, dem Sohn von Hesses Vertrauensapotheker in Baden, der in seiner Studie »Hermann Hesse und die Schweiz« die vielen einschlägigen Belege aus Hesses »Gesammelten Briefen« herausgesucht und thematisch dokumentiert hat. Und ich danke für die Materialien der diesem Thema gewidmeten Calwer Ausstellung aus dem Jahre 1987, die Walter Staudenmeyer betreut hat.
Alemannisches Bekenntnis
Was man unter Alemannen und Alemannentum zu verstehen habe, darüber gibt es verschiedene Meinungen, deren Kritik nicht meine Sache ist. Mein Glaube an »Rassen« ist niemals lebhaft gewesen, und mich in diesem Sinne einen Alemannen zu nennen, würde ich nicht wagen. Dennoch bin ich Alemanne, und bin es stärker und bewußter als die meisten von denen, die es der »Rasse« nach wirklich und zweifellos sind.
Für mich ist die Zugehörigkeit zu einem Lebens- und Kulturkreise, der von Bern bis zum nördlichen Schwarzwald, von Zürich und dem Bodensee bis an die Vogesen reicht, ein erlebtes, erworbenes Gefühl geworden. Dies südwestdeutsch-schweizerische Gebiet ist mir Heimat, und daß durch dies Gebiet mehrere Landesgrenzen und eine Reichsgrenze liefen, bekam ich zwar im kleinen wie im großen oft genug einschneidend zu spüren, doch habe ich diese Grenzen in meinem innersten Gefühl niemals als natürliche empfinden können. Für mich war Heimat zu beiden Seiten des Oberrheins, ob das Land nun Schweiz, Baden oder Württemberg hieß. Im nördlichsten Schwarzwald geboren, kam ich schon als Kind nach Basel, neunjährig wieder in die erste Heimat zurück, und habe mein späteres Leben, von kurzen Reisen abgesehen, ganz in diesem alemannischen Heimatlande verbracht, in Wüttemberg, in Basel, am Bodensee, in Bern. Auch politisch habe ich beiden Rheinufern angehört: mein Vater stammte aus den baltischen Ostseeprovinzen, meine Mutter war die Tochter eines Stuttgarters und einer französischen Schweizerin; in den achtziger Jahren erwarb mein Vater für die Familie das Bürgerrecht von Basel, und ein Bruder von mir ist heute noch Schweizer, während ich noch als Knabe, der Schulen wegen, in die württembergische Staatsangehörigkeit übertrat.
Ich schreibe es zum Teil diesen Umständen und Herkünften zu, daß ich, bei immer zärtlicher Heimatliebe, nie ein großer Patriot und Nationalist sein konnte. Ich lernte mein Leben lang, und gar in der Kriegszeit, die Grenzen zwischen Deutschland und der Schweiz nicht als etwas Natürliches, Selbstverständliches und Heiliges kennen, sondern als etwas Willkürliches, wodurch ich brüderliche Gebiete getrennt sah. Und schon früh erwuchs mir aus diesem Erlebnis ein Mißtrauen gegen Landesgrenzen, und eine innige, oft leidenschaftliche Liebe zu allen menschlichen Gütern, welche ihrem Wesen nach die Grenzen überfliegen und andere Zusammengehörigkeiten schaffen als politische. Darüber hinaus fand ich mich mit zunehmenden Jahren immer unentrinnbarer getrieben, überall das, was Menschen und Nationen verbindet, viel höher zu werten als das, was sie trennt.
Im kleinen fand und erlebte ich das in meiner natürlichen, alemannischen Heimat. Daß sie von Landesgrenzen durchschnitten war, konnte mir, der ich viele Jahre dicht an solchen Grenzen lebte, nicht verborgen bleiben. Das Vorhandensein dieser Grenzen äußerte sich nirgends und niemals in wesentlichen Verschiedenheiten der Menschen, ihrer Sprache und Sitten, es zeigten sich diesseits und jenseits dieser Grenze weder in der Landschaft noch in der Bodenkultur, weder im Hausbau noch im Familienleben merkliche Unterschiede. Das Wesentliche der Grenze bestand in lauter teils drolligen, teils störenden Dingen, welche alle von unnatürlicher und rein phantastischer Art waren: in Zöllen, Paßämtern und dergleichen Einrichtungen mehr. Diese Dinge zu lieben und heilig zu halten, dagegen aber die Gleichheit von Rasse, Sprache, Leben und Gesittung, die ich zu beiden Seiten der Grenze fand, für nichts zu achten, ist mir nicht möglich gewesen, und so geriet ich, zu meinem schweren Schaden namentlich in der Kriegszeit, immer mehr in das Lager jener Phantasten, denen Heimat mehr bedeutet als Nation, Menschentum und Natur mehr als Grenzen, Uniformen, Zölle, Kriege und dergleichen. Wie verpönt und wie »unhistorisch gedacht« dies sei, wurde mir von vielen Seiten vielmals unter den wildesten Schmähungen mitgeteilt. Ich konnte es jedoch nicht ändern. Wenn zwei Dörfer miteinander verwandt und ähnlich sind wie Zwillinge, und es kommt ein Krieg, und das eine Dorf schickt seine Männer und Knaben aus, verblutet und verarmt, das andere aber behält Frieden und gedeiht ruhig weiter, so scheint mir das keineswegs richtig und gut, sondern seltsam und haarsträubend. Und wenn ein Mensch seine Heimat verleugnen und die Liebe zu ihr opfern muß, um einem politischen Vaterland besser zu dienen, so erscheint er mir wie ein Soldat, der auf seine Mutter schießt, weil er Gehorsam für heiliger hält als Liebe.
Nun, meine Liebe zur Heimat, zu dem Land, durch dessen Mitte der Oberrhein fließt, ist mir nie verkümmert und verdunkelt worden. Wie ich schon als Kind den Basler Rhein und die schwäbische Nagold liebte, Schwarzwälder und Schweizer Mundart erlernte und sprach, so fühle ich mich auch heute noch in allen »alemannischen« Landen zu Hause. Wohl hatte ich sehr oft im Leben einen starken Reisetrieb, stets dem Süden und der Sonne nach. Heimisch gefühlt aber habe ich mich weder in Italien noch in Bremen, weder in Frankfurt noch in München oder Wien, sondern immer nur da, wo Luft und Land, Sprache und Menschenart alemannisch war. Bauernhäuser mit rot gestrichenem Fachwerk, alte Städte mit Brücken über den hellgrünen wilden Rhein, blaue Abendberge, Obstland und Fruchtbarkeit, und in den Lüften etwas, was an nahe Alpen erinnert, auch wenn man sie nicht sieht, das und noch viel anderes spricht zu mir heimatlich und vertrauensvoll, das lebt in mir, dahin gehöre ich. Und dazu die Sprache, die vielfältigen, doch nah verwandten schwäbischen und deutsch-schweizerischen Mundarten, eine Sprache von besonderem Klang, von besonderer Melodie. Ich kann sie nicht beschreiben, sie ist für mich Heimat und Mutter, Geborgenheit und Vertrauen.
Als Knabe, nachdem ich neunjährig aus der Schweiz in den Schwarzwald zurückgekehrt war, pflegte ich durch manche Jahre eine gewisse romantische Sehnsucht nach Basel und fühlte mich mit einem richtigen Kinderstolz als Fremdling und Ausländer, obwohl ich nach wenigen Wochen den schwäbischen Heimatdialekt wieder vollkommen wie in meinen ersten Lebensjahren sprach. Später kamen Zeiten, in denen ich mir ganz Schwabe zu sein schien und den schweizerischen Zuschuß stark unterschätzte. Erst allmählich wurde mir klar, daß meine gleichmäßige Liebe zu beiden Heimaten meiner Kindheit (zu welchen später noch der Bodensee hinzukam) nicht eine persönliche Laune von mir war, sondern daß es eine Landschaft, Atmosphäre, Volksart und Kultur gab, die ich schon früher von zwei verschiedenen Seiten her kennengelernt und mitgelebt hatte, die aber in sich Eins war. Seither rechne ich mich zu den Alemannen, und bin nicht betrübt, sondern froh darüber, daß unser Alemannien nicht ein politisch abgegrenzter Staat ist und nicht auf Landkarten und in Staatsverträgen zu finden ist.
Als Gegner der National-Eitelkeiten darf ich nun die Alemannen nicht rühmen und sie mit Tugenden beladen, wie Völker es gerne voreinander tun. Ich halte weder die Treue noch die Schlauheit, weder die Tapferkeit noch den Humor für reservierte Spezialbegabungen der Alemannen, obwohl sie von alledem gute Proben geliefert haben. Ich liebe auch nicht einen alemannischen Dichter, eine alemannische Bauernstube, ein alemannisches Volkslied mehr als andere solche schöne Dinge auf Erden. Die Alemannen haben weder eine Peterskirche gebaut, noch haben sie einen Dostojewski, und wenn sie aus heimatlichem Dünkel nichts von fremder Art und Kunst wissen wollen, so tue ich nicht mit. Aber alles, was von alemannischer Herkunft ist, hat Heimatgeruch für mich, ist mir ohne weiteres verständlich und nah. Manches gefällt mir bei den Schwaben besser: so die wunderbare Musik bei den schwäbischen Dichtern, bei Hölderlin und Mörike. Anderes liebe ich wieder speziell bei den Schweizern: Phantasie hinter dem Anschein von Nüchternheit wie bei Gottfried Keller. Und noch etwas, worin die Schweizer anderen Alemannen voraus waren: eine bürgerlich-demokratische Mischung der Stände und Gesellschaftsschichten ohne scharfe Grenzen, Selbstbewußtsein und Selbstgenügsamkeit beim »Volk«, und Aufgeschlossenheit des »Gebildeten« gegen Volksgenossen aller Stände. Darin hatten wir auf der reichsdeutschen Seite manches verlernt und versäumt, was wir jetzt neu zu lernen im Begriff sind.
Das alemannische Land hat vielerlei Täler, Ecken und Winkel. Aber jedes alemannische Tal, auch das engste, hat seine Öffnung nach der Welt, und alle diese Öffnungen und Ausgänge zielen nach dem großen Strom, dem Rhein, in den alles alemannische Wasser rinnt. Und durch den Rhein hängt es von alters her mit der großen Welt zusammen.
(1919)
Die Eidgenossenschaft
Die Eidgenossenschaft ist unter dem Druck der Not entstanden, und hat durch Jahrhunderte vielen Bedrohungen von außen und von innen standgehalten. Stets waren die inneren die gefährlicheren, und so ist es auch heute. Manche Mitbürger nennen heute, durch ausländische Moden verführt, die Formen unsrer Demokratie veraltet und unsere Ideale abgestorben, und finden es nötig, die alte Eidgenossenschaft durch formale Änderungen oder gar durch Nachahmung neuester, noch unbewährter Methoden und Regierungsformen zu erneuern. Diese Meinung mag aus einem guten Willen kommen, sie hält aber keiner ernsten Prüfung stand, am wenigsten einer Prüfung an der Weltgeschichte. Die Weltgeschichte, das sollten wir immerhin nicht vergessen, hat dem eidgenössischen Versuch, Völkerschaften verschiedener Stämme und Sprachen als einen freiwilligen Bund von Gleichberechtigten zu konstituieren, recht gegeben, und der Bund hat Stürme überstanden, von denen scheinbar viel mächtigere Staatsformen weggefegt worden sind.
Die Erneuerung, die der Schweiz not tut, ist vor allem eine Erneuerung der Herzen, vielmehr ein Erwachen zur Wirklichkeit, ein Öffnen der Augen für die Abgründe, die uns umgeben. Der Kampf der Parteien und Klassen ist unsre Gefahr, wie er die jedes heutigen Staates ist. Wir können ihn weder aus der Welt schaffen, noch dürfen wir ihn leicht nehmen, aber wenn wir nicht fähig sind, ihn zu vertagen, oder mindestens ihn der so viel größeren gemeinsamen Gefahr unterzuordnen, dann haben wir die Weltgeschichte schlecht verstanden.
(1938)
[»Hier hatte ich mich durchgekämpft …«]
[Aus der Erinnerung »Beim Einzug in ein neues Haus« ]
Basel
Von Tübingen kam ich, zweiundzwanzigjährig, im Herbst 1899 nach Basel, und dort erst geriet ich in ein ernsthaftes, lebendiges Verhältnis zur bildenden Kunst: während meine Tübinger Zeit, soweit sie mir gehörte, ausschließlich literarischen und intellektuellen Eroberungen gewidmet gewesen war, vor allem der wie berauschten oder besessenen Beschäftigung mit Goethe und dann mit Nietzsche, ging mir in Basel auch das Auge auf, ich wurde ein aufmerksamer und bald auch ein wissender Betrachter von Architekturen und Kunstwerken. Der kleine Kreis von Menschen in Basel, der mich damals aufnahm und bilden half, war ganz durchtränkt vom Einfluß Jacob Burckhardts, der erst vor kurzem gestorben war[1], und der dann in der zweiten Hälfte meines Lebens allmählich jene Stelle einnehmen sollte, welche vorher Nietzsche gehört hatte. Während meiner Basler Jahre machte ich denn auch zum erstenmal den Versuch, geschmackvoll und würdig zu wohnen, indem ich mir ein originelles hübsches Zimmer in einem Altbasler Hause mietete, ein Zimmer mit großem altem Kachelofen, ein Zimmer mit Vergangenheit. Ich hatte damit aber kein Glück; das Zimmer war wunderschön, aber es wurde niemals warm, obwohl der alte Ofen große Mengen Holz verschlang, und unter seinen Fenstern fuhren durch die scheinbar so ruhige Gasse morgens von drei Uhr an die Milch- und Marktwagen vom Albamor her über das Steinpflaster mit einem Höllenlärm und raubten mir den Schlaf; geschlagen floh ich nach einiger Zeit aus dem schönen Zimmer in eine moderne Vorstadt.
Und jetzt erst beginnt die Zeit meines Lebens, in der ich nicht mehr zufällige und oft gewechselte Zimmer, sondern Häuser bewohnte, und in welcher diese Häuser mir lieb und wichtig wurden. …
Bern
Der Ort, an den wir jetzt ziehen wollten, nach acht Gaienhofener Jahren, war Bern. In die Stadt selbst wollten wir zwar nicht ziehen, das wäre uns wie Verrat an unsern Idealen vorgekommen, aber wir wollten in der Nähe von Bern ein stilles ländliches Haus suchen, etwa ein ähnliches wie das wunderschöne alte Landgut, das mein Freund Albert Welti, der Maler, seit einigen Jahren bewohnte. Ich hatte ihn mehrmals in Bern besucht, und sein hübsches, leicht verwahrlostes Haus und Gütchen weit draußen vor der Stadt hatte mir sehr gefallen. Und wenn meine Frau ohnehin, aus Jugenderinnerungen her, eine große Liebe für Bern und Bernertum und alte Berner Landsitze hatte, so war für mich der Umstand, dort einen Freund wie Welti zu wissen, mitbestimmend, als ich mich für Bern entschied.
Als es aber soweit war und wir wirklich vom Bodensee nach Bern umzogen, da sah schon alles wieder anders aus. Ein paar Monate vor unsrer Übersiedlung nach Bern waren Freund Welti und seine Frau rasch hintereinander gestorben, ich war zu seinem Begräbnis in Bern gewesen, und da hatte es sich ergeben, daß es, wenn wir nun schon nach Bern ziehen wollten, das Beste wäre, Weltis Haus zu übernehmen. Wir wehrten uns innerlich gegen diese Nachfolgerschaft, es roch uns zu sehr nach Tod, wir suchten auch nach einem andern Unterkommen in der Nähe Berns, aber es fand sich nichts, was uns gefallen hätte. Das Weltihaus war nicht Weltis Eigentum gewesen, es gehörte einer Berner Patrizierfamilie, und wir konnten Weltis Miete übernehmen, zusammen mit einigem Hausrat und mit Weltis Wolfshündin Züsi, die ebenfalls bei uns blieb.
Das Haus am Melchenbühlweg bei Bern, oberhalb von Schloß Wittigkofen, war nun eigentlich in jeder Hinsicht die Verwirklichung unsrer alten, seit den Basler Zeiten mehr und mehr befestigten Vorstellung von einem idealen Hause für Leute von unsrer Art. Es war ein Landhaus im Berner Stil mit dem runden Berner Giebel, der an diesem Haus durch seine starke Unregelmäßigkeit etwas besonders Gewinnendes an sich hatte, ein Haus, das aufs angenehmste und in einer wie für uns eigens ausgesuchten Mischung bäuerliche und herrschaftliche Merkmale vereinigte, halb primitiv, halb vornehm-patrizisch, ein Haus aus dem siebzehnten Jahrhundert, mit Anbauten und Einbauten aus der Empirezeit, inmitten ehrwürdiger uralter Bäume, von einer riesigen Ulme ganz überschattet, ein Haus voll wunderlicher Winkel und Versponnenheiten, manchmal behaglicher, manchmal spukhafter Art. Es gehörte dazu ein großes Stück Bauernland mit Bauernhaus, die waren an einen Pächter vergeben, von welchem wir die Milch fürs Haus und den Mist für den Garten bekamen. Zu unsrem Garten, der gegen Süden vom Hause abwärts streng symmetrisch mit Steintreppen in zwei Terrassen angelegt war, gehörten schöne Obstbäume und gehörte auch noch, zweihundert Schritt etwa vom Wohnhaus entfernt, ein sogenanntes »Boskett«, ein Wäldchen aus ein paar Dutzend alten Bäumen, darunter herrlichen Buchen, das auf einem kleinen Hügel lag und die Gegend beherrschte. Hinter dem Hause rauschte ein hübscher steinerner Brunnen, die große Veranda nach Süden war von einer riesigen Glyzine umwachsen, von dort blickte man über die Nachbarschaft und viele Waldhügel auf die Berge, deren Kette man vom Thuner Vorberggebiet bis zum Wetterhorn alle sah, die großen Berge der Jungfraugruppe in der Mitte. Haus und Garten sind ziemlich ähnlich geschildert in meinem Romanfragment »Das Haus der Träume«, und der Titel dieser unvollendeten Dichtung ist eine Erinnerung an meinen Freund Albert Welti, der eins seiner merkwürdigsten Bilder so genannt hatte. Und innen in diesem Hause gab es mancherlei interessante und schätzenswerte Dinge: hübsche alte Kachelöfen und Möbel und Beschläge, elegante französische Pendülen unter Glasglocken, alte hohe Spiegel mit grünlichem Glas, in dem man wie ein Ahnenbild aussah, ein marmorner Kamin, in dem ich an jedem Herbstabend Feuer brannte.
Kurz, es war alles, wie wir es nicht besser hätten ausdenken können – und war trotzdem schon von Anfang an verschattet und unglücklich. Daß diese unsre neue Existenz mit dem Tod der beiden Weltis begonnen hatte, war wie ein Vorzeichen. Dennoch genossen wir zu Anfang die Vorzüge des Hauses, die unvergleichliche Aussicht, den Sonnenuntergang überm Jura, das gute Obst, die alte Stadt Bern, in der wir einige Freunde hatten und gute Musik hören konnten, nur war alles ein wenig resigniert und gedämpft; erst manche Jahre später hat meine Frau mir einmal gesagt, daß sie von Anfang an in dem alten Hause, von dem sie doch gleich mir entzückt schien, oft Angst und Bedrückung, ja etwas wie Furcht vor plötzlichem Tod und vor Gespenstern fühlte. Es kam nun langsam der Druck heran, der mein bisheriges Leben verändert und zum Teil vernichtet hat. Es kam, nicht ganz zwei Jahre nach unsrer Übersiedlung, der Weltkrieg, es kam für mich die Zerstörung meiner Freiheit und Unabhängigkeit, es kam die große moralische Krise durch den Krieg, die mich zwang, mein ganzes Denken und meine ganze Arbeit neu zu begründen, es kam das jahrelange schwere Kranksein unsres jüngsten, dritten Söhnchens, es kamen die ersten Vorboten der Gemütskrankheit meiner Frau – und während ich durch den Krieg amtlich überanstrengt und moralisch immer mehr verzweifelt war, bröckelte langsam alles das zusammen, was bis dahin mein Glück gewesen war. In der spätem Kriegszeit saß ich in dem abgelegenen Hause, das kein elektrisches Licht hatte, oft ohne Petroleum im Finstern, allmählich ging unser Geld verloren, und schließlich, nach langen bösen Zeiten, kam die Krankheit meiner Frau zum Ausbruch, sie war lange Zeit in Heilanstalten; im verwahrlosten, viel zu großen Berner Hause war der Haushalt kaum mehr aufrechtzuerhalten, die Kinder mußte ich in Pension weggeben, lange Monate saß ich mit einer treugebliebenen Magd ganz allein in dem verödeten Haus, und wäre längst fortgegangen, wenn mein Kriegsamt mir das erlaubt hätte.
Montagnola
Endlich, als im Frühling 1919 auch dies Amt zu Ende und ich wieder frei war, verließ ich das verzauberte Haus in Bern, in dem ich nun beinahe sieben Jahre gewohnt hatte. Der Abschied von Bern fiel mir im übrigen nicht mehr schwer. Es war mir klar geworden, daß es moralisch nur noch eine Existenzmöglichkeit für mich gab: meine literarische Arbeit allem andern voranzustellen, nur noch in ihr zu leben und weder den Zusammenbruch der Familie noch die schwere Geldsorge, noch irgendeine andre Rücksicht mehr ernst zu nehmen. Gelang es nicht, so war ich verloren. Ich fuhr nach Lugano, saß einige Wochen in Sorengo und suchte, dann fand ich in Montagnola die Casa Camuzzi, und zog dort im Mai 1919 ein. Aus Bern ließ ich nur meinen Schreibtisch und meine Bücher kommen, im übrigen lebte ich mit gemieteten Möbeln. In diesem letzten meiner bisherigen Häuser blieb ich zwölf Jahre wohnen, die ersten vier Jahre ganz, von da an nur noch in den wärmeren Jahreszeiten.
Dies schöne wunderliche Haus, von dem ich jetzt Abschied nehme, hat mir viel bedeutet, und war in mancher Hinsicht das originellste und hübscheste von allen denen, die ich je besaß oder bewohnte. Freilich besaß ich hier gar nichts, und bewohnte auch nicht das Haus, sondern nur eine kleine Wohnung von vier Stuben als Mieter, ich war kein Hausherr und Familienvater mehr, der ein Haus und Kinder und Dienstboten hat, seinem Hunde ruft und seinen Garten pflegt; ich war jetzt ein kleiner abgebrannter Literat, ein abgerissener und etwas verdächtiger Fremder, der von Milch und Reis und Makkaroni lebte, seine alten Anzüge bis zum Ausfransen austrug und im Herbst sein Abendessen in Form von Kastanien aus dem Walde heimbrachte. Aber das Experiment, um das es ging, ist geglückt, und trotz allem, was auch diese Jahre schwer gemacht hat, sind sie schön und fruchtbar gewesen. Wie aus Angstträumen aufgewacht, aus Angstträumen, die Jahre gedauert hatten, sog ich die Freiheit ein, die Luft, die Sonne, die Einsamkeit, die Arbeit. Ich schrieb noch in diesem ersten Sommer hintereinander den »Klein und Wagner« und den »Klingsor«, und entspannte damit mein Inneres so weit, daß ich im folgenden Winter den »Siddhartha« beginnen konnte. Ich war also nicht zugrunde gegangen, ich hatte mich nochmals zusammengerafft, ich war noch der Arbeit, der Konzentration fähig; die Kriegsjahre hatten mich nicht, wie ich halb gefürchtet hatte, geistig umgebracht. Materiell hätte ich jene Jahre nicht zu überdauern und meine Arbeit nicht zu leisten vermocht, wären nicht mehrere Freunde mir immer wieder treulich beigestanden. Ohne die Unterstützung durch den Freund in Winterthur und die lieben Siamesen wäre es nicht gegangen, und einen besonders großen Freundesdienst hat mir Cuno Amiet geleistet, als er meinen Sohn Bruno zu sich nahm.
Und so habe ich also die letzten zwölf Jahre in der Casa Camuzzi gewohnt, Garten und Haus kommen im »Klingsor« und in anderen meiner Dichtungen vor. Manche Dutzendmale habe ich dies Haus gemalt und gezeichnet, und bin seinen verzwickten launischen Formen nachgegangen; namentlich in den beiden letzten Sommern, zum Abschied, habe ich vom Balkon, von den Fenstern, von der Terrasse aus noch alle Blicke gezeichnet, und viele von den wunderlich schönen Winkeln und Gemäuern im Garten. Mein Palazzo, Imitation eines Barock-Jagdschlosses, der Laune eines Tessiner Architekten vor etwa fünfundsiebzig Jahren entsprungen, hat außer mir noch eine ganze Reihe von Mietern gehabt, aber keiner ist so lange geblieben wie ich, und ich glaube, keiner hat ihn so geliebt (auch belächelt) und ihn sich so zur Wahlheimat werden lassen wie ich. Aus einer ungewöhnlich üppigen und munteren Baulust entstanden, im lustvollen Überwinden großer Terrainschwierigkeiten, hat dieser halb feierliche, halb drollige Palazzo ganz verschiedene Ansichten. Vom Portal des Hauses führt pompös und theatralisch eine fürstliche Treppe hinab in den Garten, der in vielen Terrassen mit Treppen, Böschungen und Mauern sich bis in eine Schlucht hinab verliert und in dem alle südlichen Bäume in alten, großen Prachtexemplaren vorkommen, ineinander verwachsen, von Glyzinen und Clematis überwuchert. Für das Dorf selbst liegt das Haus fast ganz verborgen. Aus dem Tale unten sieht es, mit seinen Treppengiebeln und Türmchen über stillen Waldrücken hervorschauend, ganz wie das ländliche Schloß einer Eichendorffnovelle aus.
Manches hat sich auch hier während der zwölf Jahre geändert, nicht bloß in meinem Leben, sondern auch im Hause und Garten. Der herrliche alte Judasbaum unten im Garten, der größte, den ich jemals gesehen, der Jahr um Jahr vom Anfang Mai bis weit in den Juni hinein so üppig geblüht und im Herbst und Winter mit seinen rotvioletten Schoten so fremdartig ausgesehen hatte, fiel in einer Herbstnacht dem Sturm zum Opfer. Die große Sommermagnolie Klingsors, dicht vor meinem Balkönchen, deren geisterhafte weiße Riesenblüten mir beinahe ins Zimmer hereingewachsen waren, wurde einst während meiner Abwesenheit umgehauen. Einmal kam ich nach langer Abwesenheit im Frühling aus Zürich zurück, da war wahrhaftig meine brave alte Haustür verschwunden und die Stelle zugemauert, ich stand verzaubert und wie im Traume davor und fand keinen Eingang mehr: man hatte ein wenig umgebaut, ohne mir etwas davon zu sagen. Aber das Haus ist mir durch keine dieser Veränderungen entleidet worden, es war mehr das meinige als irgendeines der früheren, denn hier war ich nicht Ehemann und Familienvater, hier war nur ich allein zu Hause, hier hatte ich in bangen harten Jahren nach dem großen Schiffbruch mich durchgekämpft, auf einem Posten, der mir oft vollkommen verloren schien, hier hatte ich viele Jahre die tiefste Einsamkeit genossen, und auch an ihr gelitten, hatte viele Dichtungen und Malereien gemacht, tröstende Seifenblasen, und war mit allem so verwachsen, wie ich es seit der Jugend mit keiner andern Umgebung gewesen war. Zum Dank habe ich dies Haus oft genug gemalt und besungen, habe ihm auf viele Arten zu erwidern gesucht, was es mir gab und war.
Wäre ich in meiner Einsamkeit geblieben, hätte ich nicht nochmals einen Lebenskameraden gefunden, so wäre es wohl nie dazu gekommen, daß ich das Camuzzihaus wieder verlassen hätte, obwohl es in vielen Beziehungen für einen alternden und nicht mehr gesunden Menschen unbequem war. Ich habe in diesem märchenhaften Haus auch bitter gefroren und allerlei andre Not gelitten. Darum war in den letzten Jahren je und je der Gedanke aufgetaucht, aber niemals recht ernst genommen worden: vielleicht doch noch einmal umzuziehen, ein Haus zu kaufen, zu mieten oder gar zu bauen, wo ich fürs Alter eine bequemere und gesundere Unterkunft hätte. Es waren Wünsche und Gedanken, nichts weiter.
Da ereignete sich das schöne Märchen: in der »Arch« in Zürich saßen wir an einem Frühlingsabend des Jahres 1930 und plauderten, und die Rede kam auch auf Häuser und Bauen, und auch meine gelegentlich auftauchenden Hauswünsche wurden erwähnt. Da lachte plötzlich Freund B. mich an und rief: »Das Haus sollen Sie haben!«
Auch dies war, so schien mir, ein Spaß, ein hübscher Spaß am Abend beim Wein. Aber der Spaß ist Ernst geworden, und das Haus, von dem wir damals spielerisch träumten, steht jetzt da, unheimlich groß und schön und soll mir für Lebenszeit zur Verfügung stehen. Wieder einmal unternehme ich es, mich neu einzurichten, und wieder geschieht es fürs »ganze Leben«, und diesmal wird das vermutlich stimmen.
(1931)
[Am Vierwaldstätter See]
(Aus Hermann Lauschers Tagebuch)
Basel, 13. Mai 1900