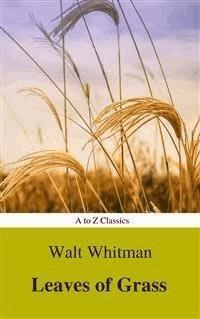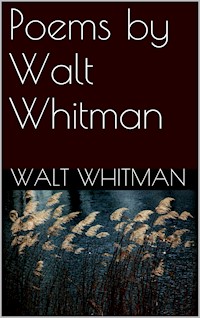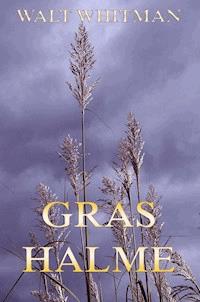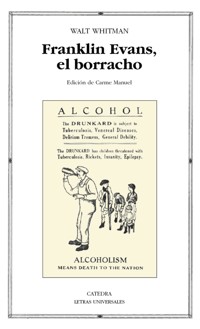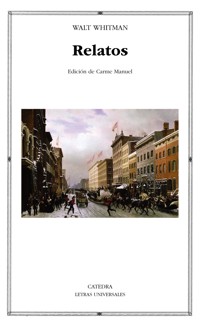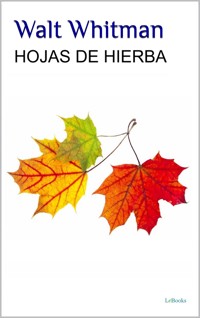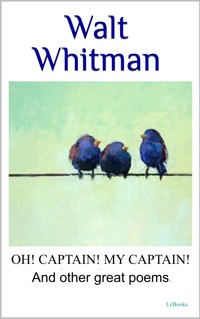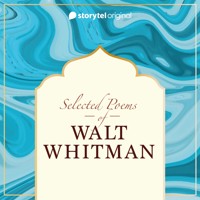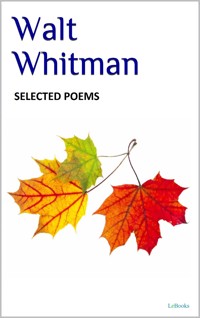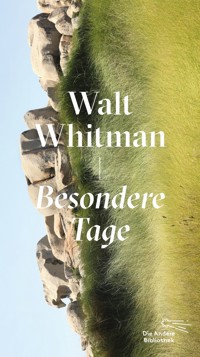
16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Die Andere Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Ein berührendes, erregendes Buch, das uns spüren lässt, was es heißt, lebendig zu sein.
»Specimen Days«, »Besondere Tage« nannte Walt Whitman seine Sammlung autobiographischer Texte. Ihr Herzstück sind seine Erlebnisse während des Amerikanischen Bürgerkriegs. Drei Jahre lang zieht Whitman durch die Lazarette Washingtons, lauscht den Erzählungen der Verwundeten, ihren Hoffnungen und Ängsten, und gibt seelischen Zuspruch – ein erschütterndes Zeugnis jener Seite des Krieges, die nicht in die Geschichtsbücher Eingang findet. Dazu gesellen sich Erinnerungen an die Kindheit und Naturbeschreibungen. Der Duft von Heu, das sanfte Gebrumm der Hummeln, die Luftsprünge der Schwalben, die letzten Strahlen der untergehenden Sonne über dem Teich: eine Quelle des Friedens und des Glücks, worin die menschliche Existenz eingebettet erscheint.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 512
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Ein berührendes, erregendes Buch, das uns spüren lässt, was es heißt, lebendig zu sein.
»Specimen Days«, »Besondere Tage« nannte Walt Whitman seine Sammlung autobiographischer Texte. Ihr Herzstück sind seine Erlebnisse während des Amerikanischen Bürgerkriegs. Drei Jahre lang zieht Whitman durch die Lazarette Washingtons, lauscht den Erzählungen der Verwundeten, ihren Hoffnungen und Ängsten, und gibt seelischen Zuspruch – ein erschütterndes Zeugnis jener Seite des Krieges, die nicht in die Geschichtsbücher Eingang findet. Dazu gesellen sich Erinnerungen an die Kindheit und Naturbeschreibungen. Der Duft von Heu, das sanfte Gebrumm der Hummeln, die Luftsprünge der Schwalben, die letzten Strahlen der untergehenden Sonne über dem Teich: eine Quelle des Friedens und des Glücks, worin die menschliche Existenz eingebettet erscheint.
Mit einem Essay von Rainer Wieland.
Über Walt Whitman
Walt Whitman wurde am 31. Mai 1819 auf Long Island, New York, geboren und wuchs in Brooklyn auf. Er arbeitete als Dorfschullehrer, Zimmermann, Schriftsetzer, Drucker, Journalist, Sekretär im Innenministerium und als freiwilliger Lazaretthelfer während des Sezessionskriegs. Mit seiner bahnbrechenden Gedichtsammlung »Leaves of Grass« gilt Whitman als der Begründer der modernen amerikanischen Dichtung. Er starb am 26. März 1892 in Camden, New Jersey, wo er, gezeichnet von Krankheit, die letzten beiden Dekaden seines Lebens verbrachte.
Götz Burghardt, geboren 1945 in Prösen, Brandenburg, studierte Germanistik, Geschichte und Anglistik/Amerikanistik. Bis zu seiner fristlosen Entlassung aus politischen Gründen 1981 war er Lehrer in der DDR. 1984 siedelte er in die Bundesrepublik über. Er arbeitet als Übersetzer aus dem Englischen u.a. von Walt Whitman, David Malouf, Robert Ferguson, Peter Hopkirk, Bruce Bernard und P. J. O’Rourke.
Rainer Wieland, geboren 1968 in Weißenburg (Bay.), ist Herausgeber, Lektor und Autor und lebt in Berlin. Seit 2023 ist er zusammen mit Julia Franck Herausgeber der Anderen Bibliothek. Er hat zahlreiche viel beachtete Bücher und Anthologien veröffentlicht, darunter »Das Buch des Reisens« und »Das Buch der Tagebücher«. In der Anderen Bibliothek erschien von ihm der Folioband »Die Welt der Enzyklopädie« (mit Anette Selg).
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Walt Whitman
Besondere Tage
Aus dem Amerikanischen von Götz Burghardt
Mit einem Nachwort von Rainer Wieland
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Besondere Tage
Gebot einer glücklichen Stunde
Antwort an einen drängenden Freund
Genealogie – Van Velsor und Whitman
Die alten Friedhöfe der Familien Whitman und Van Velsor
Die Heimstatt der Mutter
Aus dem Leben zweier alter Familien
Paumanok und mein Leben dort als Kind und junger Mann
Meine erste Lektüre – Lafayette
Druckerei – Alt-Brooklyn
Wachstum – Gesundheit – Arbeit
Meine Leidenschaft für Fähren
Broadway-Sehenswürdigkeiten
Omnibus-Ausflüge und Kutscher
Theaterstücke und Opern
Die folgenden acht Jahre
Charakterquellen –Ergebnisse –1860
Beginn des Sezessionskrieges
Nationale Erhebung und Freiwilligenmeldung
Gefühle der Verachtung
Die Schlacht am Bull Run,Juli 1861
Die Erstarrung weicht – etwas anderes beginnt
An der Front
Nach der ersten Schlacht von Fredericksburg
Wieder in Washington
Fünfzig Stunden verwundet auf dem Schlachtfeld zurückgelassen
Lazarettszenen und Personen
Patentamt-Hospital
Das Weiße Haus bei Mondschein
Eine Lazarettstation
Ein Fall aus Connecticut
Zwei Brooklyner Jungs
Ein tapferer Sezessionist
Die Verwundeten von Chancellorsville
Ein Nachtgefecht vor mehr als einer Woche
Ungenannt bleibt der tapferste Soldat
Ein paar beispielhafte Fälle
Meine Vorbereitungen für Besuche
Krankenwagen-Prozessionen
Schlimme Blessuren – Die Jungen
Das erregendste aller Kriegsschauspiele
Schlacht von Gettysburg
Ein Kavallerielager
Ein New Yorker Soldat
Hausmusik
Abraham Lincoln
Hitzewelle
Soldaten und Gespräche
Der Tod eines Offiziers aus Wisconsin
Lazarettkomplex
Ein Bummel in stiller Nacht
Spirituelle Charaktere unter den Soldaten
Viehherden in Washington
Verwirrung im Hospital
Draußen an der Front
Zahlung des Handgeldes
Gerüchte, Wendungen etc.
Virginia
Sommer 1864
Eine Neuorganisierung der Armee, passend für Amerika
Der Tod eines Helden
Lazarettszenen – Vorkommnisse
Ein Yankee-Soldat
Unionisten als Gefangene im Süden
Deserteure
Ein kurzer Blick auf die Höllenszenen des Krieges
Geschenke – Geld – Diskriminierung
Vermerke aus meinen Notizbüchern
Ein Fall von der zweiten Bull-Run-Schlacht
Militärärzte –Unzulänglichkeiten bei der Hilfeleistung
Blau überall
Ein Musterlazarett
Knaben in der Armee
Bestattung einer Krankenschwester
Krankenschwestern für Soldaten
Flüchtlinge aus den Südstaaten
Das Kapitol im Laternenschein
Inauguration
Die Haltung ausländischer Regierungen während des Krieges
Das Wetter – sympathisiert es mit diesen Zeiten?
Inaugurationsball
Szene im Kapitol
Ein ehrwürdiger Yankee
Wunden und Krankheiten
Der Tod von Präsident Lincoln
Der Jubel von Shermans Armee – sein plötzlicher Abbruch
Kein gutes Porträt von Lincoln
Vom Süden entlassene Unionsgefangene
Tod eines Soldaten aus Pennsylvania
Die Armeen kehren zurück
Die große Parade
Soldaten aus dem Westen
Ein Soldat über Lincoln
Zwei Brüder, einer für den Süden, einer für den Norden
Noch ein paar beklagenswerte Fälle
Calhouns wahres Denkmal
Die Lazarette schließen
Typische Soldaten
»Krampfhaftigkeit«
Bilanz dreier Jahre
Auch ein Schlusswort über die Million Toter
Der wahre Krieg wird niemals Eingang in die Bücher finden
Ein Zwischenabschnitt
Neue Themen aufgegriffen
Betreten eines langen Feldweges
Zur Quelle und zum Bach
Ein frühsommerliches Wecksignal
Ziehende Vögel um Mitternacht
Hummeln
Gitterrostzapfen
Sommerszenen und Beschaulichkeiten
Wohlgeruch bei Sonnenuntergang – Wachtelgesang – Die Einsiedlerdrossel
Ein Julinachmittag am Teich
Heuschrecken und Katydiden
Was ein Baum uns lehrt
Herbstliche Beigaben
Der Himmel – Tage und Nächte – Glückseligkeit
Farben – Ein Kontrast
8. November ’76
Krähen über Krähen
Ein Wintertag am Meeresstrand
Strandgedanken
Zum Gedenken an Thomas Paine
Zweistündige Fahrt im Eis
Ankündigungen des Frühlings – Erholung
Eine menschliche Macke
Eine nachmittägliche Szene
Die Tore öffnen sich
Die gewöhnliche Erde – der Boden
Vögel, Vögel, nochmals Vögel
Sternenübersäte Nächte
Königskerzen über Königskerzen
Entfernte Klänge
Ein Sonnenbad – Nacktheit
Die Eichen und ich
Ein Fünfzeiler
Der erste Frost – Erinnerungen
Tod dreier junger Männer
Februartage
Eine Wiesenlerche
Strahlender Sonnenuntergang
Gedanken unter einer Eiche – Ein Traum
Klee- und Heuduft
Ein Unbekannter
Vogelstimmen
Rossminze
Zu dritt
Der Tod von William Cullen Bryant
Den Hudson hinauf
Glück und Himbeeren
Eine exemplarische Tramp-Familie
Manhattan von der Bucht her
Menschliches und heroisches New York
Stunden für die Seele
Strohfarbene und andere Psychiden
Eine Nachterinnerung
Wilde Blumen
Eine zu lange vernachlässigte Höflichkeit
Delaware River – Tage und Nächte
Szenen auf Fähre und Fluss – Letzte Winternächte
Der erste Frühlingstag auf der Chestnut Street
Den Hudson hinauf nach Ulster County
Tage bei J. B. – Torffeuer – Frühlingsgesänge
Begegnung mit einem Eremiten
Ein Wasserfall in Ulster County
Walter Dumont und seine Medaille
Sehenswürdigkeiten des Hudson Rivers
Zwei Stadtgebiete, ganz bestimmte Stunden
Spaziergänge und Gespräche im Central Park
Ein schöner Nachmittag, von vier bis sechs
Auslaufen der großen Dampfer
Zwei Stunden auf der Minnesota
Vollendete Sommertage und -nächte
Ausstellungsgebäude – Neues Rathaus – Flussreise
Schwalben auf dem Fluss
Beginn einer langen Fahrt nach Westen
Im Schlafwagen
Der Staat Missouri
Lawrence und Topeka, Kansas
Die Prärien
Weiter nach Denver – Ein Grenzzwischenfall
Eine Stunde auf dem Gipfel des Kenosha
Eine ichbezogene »Entdeckung«
Neue Empfindungen – Neue Freuden
Dampfkraft, Telegraphen etc.
Amerikas Rückgrat
Die Parks
Kunstmerkmale
Denver-Impressionen
Ich wende mich nach Süden – dann wieder nach Osten
Unerfüllte Wünsche – Der Arkansas River
Ein stiller kleiner Begleiter – Das Mädchenauge
Die Prärien und die Great Plains in Poesie
Die Spanish Peaks – Abend auf den Plains
Amerikas charakteristische Landschaft
Der bedeutendste Strom der Erde
Analogien zu den Prärien – Die Baumfrage
Literatur des Mississippitales
Der Artikel eines Interviewers
Die Frauen des Westens
Der stille General
Präsident Hayes’ Reden
Erwähnenswertes bezüglich St. Louis
Nächte auf dem Mississippi
Über unser eigenes Land
Edgar Poes Bedeutung
Beethovens Septette
Ein Hauch von wilder Natur
Müßiggang im Wald
Eine Kontraalt-Stimme
Den Niagara erleben
Ein Abstecher nach Kanada
Sonntag mit geistig Behinderten
Reminiszenz an Elias Hicks
Großartige einheimische Entwicklung
Ein Zollverein zwischen den USA und Kanada
Der Sankt-Lorenz-Wasserweg
Der wilde Saguenay
Die Kaps Éternité und Trinité
Chicoutimi und Ha Ha Bay
Die Einwohner – Gutes Leben
Wie Zedernzapfen – Namen
Der Tod von Thomas Carlyle
Carlyle aus amerikanischer Sicht
Ein paar alte Freunde – Eine Kleinigkeit von Coleridge
Eine Woche in Boston
Das Boston von heute
Mein Tribut an vier Dichter
Millets Bilder – Letzte Arbeiten
Vögel und eine Warnung
Kostproben aus meinem Notizbuch
Noch einmal Sand und Salz meiner Heimat
Hitze in New York
»Custers letztes Gefecht«
Ein paar alte Bekannte – Erinnerungen
Eine Entdeckung des Alters
Endlich ein Besuch bei R. W. Emerson
Boston Common Park – Noch etwas von Emerson
Eine ossianische Nacht – Teuerste Freunde
Nur ein neues Fährschiff
Der Tod von Longfellow
Das Gründen von Zeitungen
Die große Unrast, von der wir ein Teil sind
An Emersons Grab
Gegenwärtiges Schreiben – Persönliches
Nach der versuchten Lektüre eines gewissen Buches
Letzte Bekenntnisse – Literarische Prüfsteine
Natur und Demokratie – Moral
Anhang
Whitmans Anmerkungen zum Text
Sacherläuterungen und Anmerkungen des Übersetzers
Literaturhinweise
Walt Whitman (1819–1892)
Nachwort
Erläuterungen
Impressum
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
370
371
372
Besondere Tage
Die Vereinigten Staaten während des Bürgerkriegs 1861 bis 1865
Walt Whitman 1854
Gebot einer glücklichen Stunde
Im Walde, 2. Juli 1882
Wenn ich es jemals tun will, dann darf ich nicht länger zögern. Zusammenhanglos und voller Lücken und Sprünge, wie dieses Sammelsurium von Tagebuchaufzeichnungen, Kriegserinnerungen aus den Jahren 1862 bis ’65, Naturbetrachtungen von 1877 bis ’81 und späteren Beobachtungen im Westen und in Kanada auch ist, alles zusammengerollt und mit einem dicken Strick verschnürt, so überkommt mich an diesem Tag, zu dieser Stunde – (Und was für ein Tag! Was für eine Stunde, die soeben vergeht! Die Pracht lächelnden Grases und einer lauen Brise mit all der Herrlichkeit von Sonne und Himmel und angenehmer Temperatur – all das erfüllt meinen Körper und meine Seele wie niemals zuvor.) – so überkommt mich der Entschluss, ja der Auftrag, nach Hause zu eilen, das Bündel aufzuschnüren und die Tagebuchfragmente und anderen Notizen, so wie sie sind, länger oder kürzer, eine nach der anderen in Druck zu geben1, ohne auf die Mängel dieser Sammlung und den oft fehlenden Zusammenhang zu achten. Auf jeden Fall wird es eine Phase der Menschheit illustrieren. Wie wenige Tage und Stunden des Lebens (und auch diese nicht aufgrund ihres relativen Wertes oder ihrer Größe, sondern durch Zufall) werden doch jemals aufgezeichnet. Ein Grund mag auch sein, dass wir eine Sache lange vorbereiten, sie planen, ergründen, gestalten, und dann, wenn die tatsächliche Stunde der Ausführung kommt, noch immer ziemlich unvorbereitet sind und das Ganze zusammenstückeln und damit Hast und Unfertiges die Geschichte besser erzählen lassen als vortreffliche Arbeit. Auf jeden Fall gehorche ich dem Gebot meiner glücklichen Stunde, das mir so merkwürdig zwingend zu sein scheint. Vielleicht werde ich, wenn ich nichts anderes zustande bringe, das eigenwilligste, ursprünglichste, bruchstückhafteste Buch veröffentlichen, das jemals gedruckt wurde.
Antwort an einen drängenden Freund
Du fragst nach Dingen, Einzelheiten meines frühen Lebens – nach Abstammung und Herkunft, besonders nach den Frauen in meiner Ahnenreihe und nach dem weit zurückliegenden niederländischen Stamm mütterlicherseits – nach der Gegend, in der ich geboren wurde und aufwuchs, und mein Vater und meine Mutter vor mir und deren Eltern vor ihnen – mit einem Wort, nach Brooklyn und New York und den Zeiten, die ich als Junge und junger Mann dort lebte. Du sagst, in der Hauptsache möchtest du diese Dinge wegen der Vorgeschichte und Ursprünge von Leaves of Grass erfahren. Also – wenigstens ein paar Proben von allem sollst du haben. Oft habe ich über die Bedeutung solcher Dinge nachgedacht – daran, dass man Dinge dieser Art nur anreißen und vervollständigen kann, indem man unmittelbar selbst zurückforscht, vielleicht weit zurück, hinein in ihre Ursprünge, ihre Vergangenheit und ihre Entwicklungsstadien. Dann war ich kürzlich, wie es das Schicksal so wollte, eine Woche lang krank und musste im Bett bleiben und vertrieb mir die Langeweile damit, dass ich eben diese Einzelheiten für einen anderen (jedoch unerfüllten, wahrscheinlich nun nichtigen) Zweck zusammentrug. Und wenn du dich damit zufriedengeben willst, wie sie sind, authentisch in den Daten, einfach in den Fakten und auf meine Art, geschwätzig, erzählt – hier sind sie! Ich werde nicht zögern, Auszüge zu machen, denn ich greife nach allem, was mir Arbeit erspart; und das werden die besten Versionen dessen sein, was ich mitteilen möchte.
Genealogie – Van Velsor und Whitman
In der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts lebte die Familie Van Velsor, die Familie meiner Mutter also, auf ihrer eigenen Farm in Cold Spring, Long Island, New York State, nahe dem östlichen Zipfel von Queens County, etwa eine Meile vom Hafen entfernt.2 Meines Vaters Familie – vermutlich die fünfte Generation nach den ersten englischen Ankömmlingen in Neuengland – waren zur gleichen Zeit Farmer auf eigenem Grund und Boden (und es war ein schönes Gut, fünfhundert Acres, alles gutes Land, nach Osten und Süden hin sanft abfallend, ein Zehntel davon Wald, gewaltige alte Bäume in Hülle und Fülle), zwei, drei Meilen entfernt, in West Hills, Suffolk County. Der Name Whitman in den östlichen Staaten und somit auch im Süden geht zweifellos auf einen John Whitman zurück, der 1602 in Old England geboren wurde, wo er auch aufwuchs, heiratete und 1629 sein ältester Sohn geboren wurde. 1640 kam er mit der True Love nach Amerika und lebte in Weymouth, Massachusetts, einem Ort, der zum Stammsitz der Neuengländer dieses Namens wurde; er starb 1692. Sein Bruder, Rev. Zechariah Whitman, kam entweder zur gleichen Zeit oder kurz danach ebenfalls mit der True Love herüber und lebte in Milford, Connecticut. Ein Sohn dieses Zechariah, mit Namen Joseph, übersiedelte nach Huntington, Long Island, und ließ sich hier für immer nieder. Laut Savages Genealogical Dictionary (Band IV, Seite 524) hat sich die Familie Whitman vor 1664 in Huntington niedergelassen, durch eben diesen Joseph. Es ist ziemlich sicher, dass von diesem Ausgangspunkt aus und von Joseph die West-Hills-Whitmans und alle anderen in Suffolk, darunter ich, hervorgegangen sind. Sowohl John als auch Zechariah fuhren etliche Male nach England zurück; sie hatten große Familien, und einige ihrer Kinder kamen in der alten Heimat zur Welt. Von Johns und Zechariahs Vater, Abijah Whitman, der bis in die 1500er Jahre zurückreicht, haben wir zwar gehört, wir wissen aber wenig über ihn, außer dass auch er einige Zeit in Amerika war.
Diese Reminiszenzen über meine Herkunft werden in mir lebendig durch einen Besuch, den ich kürzlich (in meinem 63. Lebensjahr) West Hills und den Ruhestätten meiner Vorfahren beider Seiten abgestattet habe. Hier sind Auszüge aus den Notizen von jenem Besuch, dort und damals festgehalten:
Die alten Friedhöfe der Familien Whitman und Van Velsor
29. Juli 1881
Nach einer Abwesenheit von mehr als vierzig Jahren (außer einem kurzen Besuch, um meinen Vater zwei Jahre vor seinem Tod noch einmal dorthin zu bringen) unternahm ich einen einwöchigen Ausflug nach Long Island, zu dem Ort, wo ich geboren wurde, dreißig Meilen von New York City entfernt. Fuhr zu den altvertrauten Plätzen; und wie ich so schaute und nachsann, wurde alles wieder lebendig. Begab mich zu der alten, höher gelegenen Whitman-Heimstatt und schaute ostwärts über das weite, herrliche nach Süden sich neigende Farmland meines Großvaters (1780) und meines Vaters. Da war das neue Haus (1810), die große Eiche, hundertfünfzig bis zweihundert Jahre alt; da der Brunnen, der abfallende Gemüsegarten, und ein kleines Stück entfernt stehen sogar noch die wohlerhaltenen Überbleibsel der Wohnung meines Urgroßvaters (1750–60) mit ihren mächtigen Balken und niedrigen Decken. Ganz in der Nähe ein stattliches Wäldchen hoher, kräftiger Schwarznussbäume, herrlich und schön wie Apoll, zweifellos die Söhne oder Enkel der Schwarzwalnussbäume von 1776 oder davor. Auf der anderen Seite der Straße erstreckte sich der Apfelgarten, über zwanzig Acres groß. Die Bäume, gepflanzt von Händen, die längst im Grabe modern (denen meines Onkels Jesse); ziemlich viele davon aber augenscheinlich noch fähig, alljährlich ihre Blüten und Früchte hervorzubringen.
Ich schreibe diese Zeilen jetzt, während ich auf einem alten Grab sitze (inzwischen zweifellos hundert Jahre alt), auf der Ruhestätte der Whitmans vieler Generationen. Fünfzig oder mehr Gräber sind noch deutlich zu erkennen und nochmal so viele völlig verfallen – niedergedrückte Grabhügel, umgestürzte und zerbrochene Steine, mit Moos bewachsen – die düstere und leblose Anhöhe, die paar Kastanien darum, die Stille, einzig unterbrochen durch den rauschenden Wind. Es herrscht stets die tiefste Beredsamkeit einer Predigt oder eines Gedichts auf all den alten Friedhöfen, von denen es auf Long Island so viele gibt; was muss also dieser für mich gewesen sein? Meine gesamte Familiengeschichte, mit der Abfolge ihrer Verbindungen, von der ersten Ansiedlung bis auf den heutigen Tag, wird hier erzählt – drei Jahrhunderte verdichten sich auf diesem kargen Acker.
Am nächsten Tag, dem 30. Juli, widmete ich mich der nämlichen Stätte mütterlicherseits und war, falls das überhaupt möglich ist, noch stärker ergriffen und beeindruckt. Diesen Abschnitt jetzt schreibe ich auf der Ruhestätte der Van Velsors unweit von Cold Spring, der bedeutendsten Begräbnisstätte, die man sich vorstellen kann: ohne das geringste Beiwerk von Kunst – solcher aber weit überlegen – unfruchtbarer Boden, ein in höchstem Maße ödes Plateau von einem halben Acre, die Kuppe einer Anhöhe, Gestrüpp und wohlgewachsene Bäume sowie dichter Wald rundherum, sehr urwüchsig, abgelegen, keine Besucher, keine Straße (hierhin kann man nicht fahren, man muss die Toten hertragen und ihnen zu Fuß folgen). Vierzig bis sechzig Gräber ziemlich eingeebnet, noch mal so viele fast völlig beseitigt. Mein Großvater Cornelius, meine Großmutter Amy (Naomi) und zahlreiche nähere und entferntere Verwandte mütterlicherseits liegen hier begraben. Der Schauplatz, an dem ich stand oder saß, der köstliche und wilde Duft der Gehölze, der leichte Nieselregen, die bewegende Atmosphäre des Ortes und die damit verbundenen Erinnerungen waren passende Begleiter.
Die Heimstatt der Mutter
Von dieser alten Grabstätte ging ich achtzig, neunzig Ruten hinunter zu dem Gelände des Van-Velsor-Anwesens, wo meine Mutter geboren worden war (1795) und wo mir als Kind und jungem Burschen (1825–40) jeder Flecken vertraut war. Damals stand dort ein weitläufiges, dunkelgraues, um und um mit Schindeln bedecktes Haus, mit Schuppen, Ställen, einer großen Scheune und viel freiem Gelände. Keine Spur von all dem ist übriggeblieben; alles wurde abgerissen, getilgt, und Pflug und Egge waren viele Sommer lang über Fundamente, den Hof und alles weitere hinweggegangen. Gegenwärtig eingezäunt, wachsen hier Getreide und Klee wie auf jedem anderen prächtigen Feld. Nur durch ein großes Loch, vom Keller, mit ein paar Häufchen zerbrochener Steine, grün von Gras und Unkraut, lässt sich der Platz wiederfinden. Sogar der ergiebige alte Bach und seine Quelle schienen größtenteils versiegt. Die gesamte Szenerie, mit dem, was sie erweckte: Erinnerungen an meine jungen Tage dort vor einem halben Jahrhundert, die riesige Küche mit dem stattlichen Kamin und das angrenzende Wohnzimmer, die schlichten Möbel, die Mahlzeiten, das Haus voller fröhlicher Leute, das nette alte Gesicht meiner Großmutter Amy mit ihrem Quäkerhäubchen, mein Großvater, »der Major«, jovial, rothaarig, untersetzt, mit sonorer Stimme und charakteristischer Physiognomie: Das alles und auch die eigentlichen Anblicke machten das ausgeprägteste Halbtagserlebnis meines ganzen Ausflugs aus.
Denn dort, in dieser waldigen, hügeligen, gesunden Umgebung, war meine liebste Mutter, Louisa Van Velsor, aufgewachsen – (ihre Mutter, Amy Williams, von der Religionsgemeinschaft der Freunde oder Quäker – die Familie Williams, sieben Schwestern und ein Bruder – Vater und Sohn Seeleute, beide fanden den Tod auf See). Die Van Velsors waren berühmt wegen ihrer edlen Pferde, die die Männer züchteten. Als junge Frau war meine Mutter eine tollkühne Reiterin, die täglich ausritt. Was das Oberhaupt der Familie betrifft, so hat die alte Spezies der Niederländer, zutiefst verwurzelt auf der Halbinsel Manhattan und in Kings und Queens, niemals ein markanteres, vollständig amerikanisiertes Exemplar hervorgebracht als Major Cornelius Van Velsor.
Aus dem Leben zweier alter Familien
Vom häuslichen und familiären Leben mitten auf Long Island zu dieser Zeit und kurz davor hier zwei Beispiele:
»Zu Beginn dieses Jahrhunderts lebten die Whitmans in einem langen anderthalbstöckigen, mächtigen Fachwerkhaus, das immer noch steht. Eine große rauchgeschwärzte Küche mit riesigem Kamin bildete das eine Ende des Hauses. Dass es zur damaligen Zeit in New York noch Sklaverei gab und die Familie zwölf bis fünfzehn Sklaven besaß, die im Haus und auf dem Feld arbeiteten, verlieh dem Ganzen etwas ziemlich Patriarchalisches. Die jüngeren Negerkinder konnte man gegen Sonnenuntergang in Scharen in dieser Küche im Kreis auf dem Boden hocken und ihr Abendessen aus Indischem Pudding und Milch futtern sehen. In dem Haus war alles, angefangen von der Nahrung bis hin zu den Möbeln, einfach, aber solide. Man kannte weder Teppiche noch Öfen, auch keinen Kaffee, und Tee oder Zucker gab es nur für die Frauen. An Winterabenden spendeten lodernde Holzfeuer Wärme und Licht. Schweine-, Geflügel-, Rindfleisch sowie das gewöhnliche Gemüse und Getreide gab es in Hülle und Fülle. Das übliche Getränk der Männer war Apfelwein, den man zu den Mahlzeiten trank. Die Kleidung war hauptsächlich hausgemacht. Reisen wurden sowohl von Männern als auch Frauen zu Pferd unternommen. Beide Geschlechter griffen bei der Arbeit kräftig zu – die Männer auf dem Feld – die Frauen in Haus und Hof. Bücher waren rar. Das alljährliche Exemplar des Almanachs war ein Hochgenuss. Während der langen Winterabende hockte man darüber. Ich darf nicht vergessen zu erwähnen, dass diese beiden Familien dem Meer nahe genug waren, um es von höher gelegenen Plätzen aus sehen und in ruhigen Augenblicken das Brausen der Brandung, die nach einem Sturm des Nachts sonderbar klang, vernehmen zu können. Dann lief alles, Männlein und Weiblein, häufig hinunter zu Strand- und Badepartys, und die Männer unternahmen praktische Ausflüge, um auf der Salzmarsch Heu zu machen, Muscheln zu suchen und zu fischen.« (John Burroughs:NOTES)
»Die Vorfahren von Walt Whitman, sowohl väterlicher- als auch mütterlicherseits, führten eine gute Küche, waren bekannt für ihre Gastfreundschaft und Sittsamkeit und genossen ein ausgezeichnetes gesellschaftliches Ansehen in der Umgebung. Und sie waren von einer ausgeprägten Individualität. Wenn es der Platz zuließe, würde ich einige Männer einer besonderen Beschreibung für würdig halten; und noch mehr einige der Frauen. Seine Urgroßmutter väterlicherseits zum Beispiel war eine große, dunkelhäutige Frau, die ein gesegnetes Alter erreichte. Sie rauchte Tabak, kam mit den wildesten Pferden zurecht und kontrollierte, nachdem sie in vorgerücktem Alter Witwe geworden war, weiterhin jeden Tag ihr Land, häufig im Sattel, um die Arbeit ihrer Sklaven zu lenken und zu leiten, und zwar in einer Sprache, in der es bei aufregenden Anlässen an Flüchen nicht gerade fehlte. Die beiden Großmütter waren, im besten Sinne des Wortes, außergewöhnliche Frauen. Diejenige mütterlicherseits (Amy William mit Mädchennamen) war eine ›Freundin‹ oder Quäkerin von angenehmem, sensiblem Charakter, hausfraulichen Neigungen, sehr intuitiv und tief religiös. Die andere (Hannah Brush) war ein ebenso edler, vielleicht sogar stärkerer Charakter, wurde sehr alt, hatte eine ganze Anzahl von Söhnen. Sie war eine geborene Dame, in ihren jungen Jahren Lehrerin und bewies einen gediegenen Intellekt. W. W. selbst hält sehr viel von den Frauen unter seinen Ahnen.« (Ebenda)
Aus diesem Ensemble von Personen und Schauplätzen wurde ich am 31. Mai 1819 geboren. Und nun möchte ich ein bisschen an dem Ort selbst verweilen – denn all die Entwicklungsstadien vom Säuglingsalter über Kindheit und Jugend bis hin zum Mannesalter durchlief ich auf Long Island, von dem ich manchmal meine, ich hätte es mir einverleibt. Als Bursche und Erwachsener zog ich umher und habe in fast allen Teilen, von Brooklyn bis Montauk Point, gelebt.
Paumanok und mein Leben dort als Kind und junger Mann
Dieses Paumanok (um ihm seinen ursprünglichen Namen3 zu geben) verdient besonderes Augenmerk. Ostwärts erstreckt es sich über hundertzwanzig Meilen durch die Countys Kings, Queens und Suffolk – im Norden der Long Island Sund, eine herrliche, abwechslungsreiche und malerische Folge schmaler Buchten, »Hälse« und meerartiger Ausweitungen, hundert Meilen bis Orient Point. Auf der Ozeanseite ist die große südliche Bucht mit zahllosen Erhebungen übersät, die meisten klein, einige ziemlich groß, gelegentlich gibt es auch lange Sandbänke, die zweihundert Ruten bis zu anderthalb Meilen vom Ufer entfernt sind. Hin und wieder, wie bei Rockaway und weit östlich, entlang der Hamptons, hebt sich der Strand sacht aus dem Wasser, und das Meer braust unaufhaltsam heran. Etliche Leuchttürme am Ostufer; eine lange Geschichte von Schiffbruchtragödien, einige sogar in den letzten Jahren. Als junger Bursche stand ich unter dem Eindruck vieler dieser Schiffsunglücke – bei einem oder zweien war ich beinahe Augenzeuge. Vor dem Strand von Hempstead zum Beispiel ging 1840 das Schiff Mexico verloren (worauf in »The Sleepers« in Leaves of Grass angespielt wird). Und ein paar Jahre später der Untergang der Brigg Elizabeth, ein schreckliches Ereignis in einem der schlimmsten Winterstürme, wo Margaret Fuller mit ihrem Mann und ihrem Kind ertrank.
Zwischen den äußeren Sandbänken und dem Strand ist diese südliche Bucht verhältnismäßig seicht; in kalten Wintern überall mit dickem Eis bedeckt. Als Junge begab ich mich oft mit ein, zwei Kameraden auf diese gefrorenen Flächen, mit Schlitten, Axt und Aalgabel, um Massen von Aalen zu fangen. Wir hackten Löcher ins Eis, stießen dabei mitunter auf eine, man könnte fast sagen, Aal-Ader und füllten unsere Körbe mit großen, fetten, prächtigen, weißfleischigen Burschen. Diese Szenen, das Eis, das Ziehen des Schlittens, das Hacken von Löchern, das Aalstechen usw. waren natürlich das tollste Vergnügen, wie man es als Junge nur haben kann. Die Ufer dieser Bucht, in Winter und Sommer, und meine Aktivitäten dort in frühen Jahren sind alle in den Leaves of Grass verwoben. Ein Zeitvertreib, den ich sehr mochte, war es, im Sommer auf eine Bucht-Party zu gehen, um Möweneier zu sammeln. (Die Möwen legen zwei oder drei Eier, die etwas mehr als halb so groß wie Hühnereier sind, direkt in den Sand und lassen sie von der Hitze der Sonne ausbrüten.)
Das östliche Ende von Long Island, die Region der Peconic Bay, kannte ich ebenfalls recht gut – segelte mehr als einmal um Shelter Island herum und hinunter nach Montauk – verbrachte manche Stunde bei dem alten Leuchtturm auf dem Turtle Hill, an der äußersten Spitze, und schaute hinaus über das unaufhörliche Wogen des Atlantiks. Ging gern hinunter zu den Blaubarsch-Fischern oder den alljährlichen Trupps von Seebarsch-Abnehmern und freundete mich mit ihnen an. Begegnete auf der Halbinsel Montauk (sie ist rund fünfzehn Meilen lang und gutes Weideland) mitunter den seltsamen, zerzausten, halb barbarischen Hirten, die zu jener Zeit völlig fern jeglicher Gesellschaft oder Zivilisation lebten. Sie waren verantwortlich für riesige Herden von Pferden, Rindern und Schafen auf Weiden, die Farmern in den östlichen Städten gehörten. Manchmal gab es darunter auch ein paar Indianer oder Halbbluts, die es damals auf der Halbinsel Montauk noch gab, inzwischen aber, wie ich annehme, ausgestorben sind.
Mehr in der Mitte der Insel befanden sich die weiten Hempstead Plains, damals (1830–40) noch recht prärieähnlich, offen, unbewohnt, ziemlich unfruchtbar, bedeckt mit Kalbs-Tod- und Heidelbeerbüschen, aber auch reichlich gutem Weideland für Rinder, hauptsächlich Milchvieh, die dort (auch die Ebenen gehörten den Städten und wurden von ihnen gemeinschaftlich genutzt) zu Hunderten, ja Tausenden grasten und abends gesehen werden konnten, wie sie alle ihren Heimweg antraten und stets an den richtigen Stellen abbogen. Oft bin ich gegen Sonnenuntergang draußen am Rande dieser Ebenen gewesen und kann mich noch immer an die endlosen Kuh-Prozessionen erinnern und den Klang der Zinn- oder Kupferglöckchen – weiter weg oder näher – hören, die Kühle der süßen, leicht aromatischen Abendluft atmen und den Sonnenuntergang sehen.
Durch dieselbe Region der Insel, aber weiter östlich, erstreckten sich eintönig und nutzlos weite Flächen von Kiefern und Zwergeichen (Holzkohle wurde hier in großen Mengen gebrannt). Manchen halben oder ganzen Tag wanderte ich durch diese einsamen Gegenden und sog das eigenartige und wilde Aroma ein. Hier und auf der ganzen Insel und ihren Ufern verbrachte ich, mit Unterbrechungen, viele Jahre lang alle Jahreszeiten, manchmal reitend, manchmal mit dem Boot, hauptsächlich aber zu Fuß (ich war damals immer gut zu Fuß) und nahm in mich auf: Felder, Ufer, maritime Geschehnisse, Charaktere, die Menschen der Bucht, Farmer, Lotsen – hatte immer reichlich Bekanntschaft mit den letzteren und mit Fischern – unternahm jeden Sommer Segeltouren – liebte stets den nackten Meeresstrand an der Südseite und verbringe dort bis heute einige meiner glücklichsten Stunden.
Während ich schreibe, werden alle diese Erlebnisse nach einer Zeitspanne von vierzig und mehr Jahren wieder lebendig in mir – das beruhigende Rauschen der Wellen und der salzige Geruch – die Zeiten der Kindheit, das Muschelsuchen, barfuß und mit hochgekrempelten Hosen – die Fahrt den Bach hinunter – der Duft der Riedgraswiesen – das Heuboot und die Ausflüge zum Muschelsuchen und zum Fischen; oder, in späteren Jahren, die kleinen Fahrten mit den Lotsenbooten in die New York Bay hinein und wieder heraus. In jenen späteren Jahren, als ich in Brooklyn lebte (1836–50), fuhr ich in der milden Jahreszeit regelmäßig jede Woche nach Coney Island – zu jener Zeit ein langer, kahler, kaum besuchter Strand – den ich ganz für mich allein hatte und wo ich es liebte, nach dem Baden auf dem harten Sand auf und ab zu gehen und der Brandung und den Möwen Stunde um Stunde Homer und Shakespeare zu deklamieren. Ich komme jedoch zu schnell voran und sollte lieber etwas mehr in meiner Spur bleiben.
Meine erste Lektüre – Lafayette
Von 1824 bis ’28 lebte unsere Familie in Brooklyn, in der Front, der Cranberry und der Johnson Street. In der letzteren baute mein Vater ein hübsches Haus und später noch eines in der Tillary Street. Wir bezogen sie, eines nach dem anderen, aber sie wurden mit Hypotheken belastet, und wir verloren sie. Ich erinnere mich noch an Lafayettes Besuch.4 In diesen Jahren besuchte ich die meiste Zeit öffentliche Schulen. Es muss um 1829, ’30 gewesen sein, da ging ich mit meinem Vater und meiner Mutter nach Brooklyn Heights, um Elias Hicks in einem Ballsaal predigen zu hören. Etwa zur gleichen Zeit war ich in einem Anwaltsbüro – Clarke, Vater und zwei Söhne – in der Fulton Street, unweit von Orange als Gehilfe angestellt. Ich hatte einen hübschen Schreibtisch und eine Fensternische für mich; Edward C. half mir freundlicherweise beim Schreiben und Gestalten von Texten und (das einschneidendste Ereignis meines Lebens bis zu diesem Zeitpunkt) meldete mich auf seine Kosten in einer großen Leihbibliothek an. Eine Zeitlang schwelgte ich nun im Lesen von Liebesgeschichten jeglicher Art, zuerst alle Bände von Tausendundeiner Nacht – ein unglaubliches Vergnügen. Dann, mit Abstechern in viele andere Bereiche, verschlang ich Walter Scotts Romane, einen nach dem anderen, und seine Gedichte (und genieße bis zum heutigen Tag Romane und Gedichte).
Druckerei – Alt-Brooklyn
Nach etwa zwei Jahren begann ich, bei einer Wochenzeitung und Druckerei zu arbeiten, um dieses Handwerk zu erlernen. Die Zeitung hieß Long Island Patriot und war im Besitz von S. E. Clements, der auch Postmeister war. Ein alter Drucker, William Hartshorne, ein revolutionärer Mensch, der noch Washington gesehen hatte, war ein besonderer Freund von mir, und ich führte mit ihm manches Gespräch über längst vergangene Zeiten. Die Lehrlinge, ich inbegriffen, wohnten bei seiner Enkelin. Gelegentlich ritt ich mit dem Chef zusammen aus. Zu uns Jungen war er sehr gut; sonntags nahm er uns alle mit in eine recht alte, massive, an eine Burg erinnernde Kirche aus Stein in der Joralemon Street, unweit der Stelle, da jetzt das Rathaus von Brooklyn steht – (damals überall weite Felder und Landstraßen5). Später arbeitete ich für den Long Island Star, Alden Spooners Zeitung. All diese Jahre hindurch betrieb mein Vater sein Gewerbe als Zimmermann und Bauhandwerker, jedoch mit wechselndem Erfolg. Wir waren eine große Familie, acht Kinder – Jesse, der Älteste, ich, der Zweite, meine lieben Schwestern Mary und Hannah Louisa, meine Brüder Andrew, George, Thomas Jefferson und schließlich der Jüngste, Edward, 1835 geboren und sein Leben lang schwer körperbehindert, wie auch ich seit einigen Jahren.
Wachstum – Gesundheit – Arbeit
Ich entwickelte mich (1833, ’34, ’35) zu einem gesunden, kräftigen jungen Burschen (wuchs jedoch etwas zu schnell und war mit fünfzehn, sechzehn fast schon so groß wie ein erwachsener Mann). Zu dieser Zeit zog unsere Familie zurück aufs Land; meine liebe Mutter war lange krank, erholte sich aber schließlich wieder. In all diesen Jahren war ich mehr oder weniger jeden Sommer auf Long Island, bald im Osten, bald im Westen, mitunter monatelang. Mit sechzehn, siebzehn etc. liebte ich Debattierklubs und war ab und an auch in Brooklyn und ein, zwei Provinzstädten auf der Insel aktives Mitglied solcher Klubs. Ein ausgesprochen omnivorer Romanleser, verschlang ich in diesen Jahren und auch später alles, was mir in die Hände kam. Vom Theater ebenfalls angetan, besuchte ich es in New York, sooft ich konnte, und erlebte manche großartige Aufführung.
Arbeitete 1836–37 als Setzer in Druckereien in New York City. Dann, mit etwas über achtzehn, zog ich für eine Weile umher und unterrichtete in Dorfschulen in den Countys Queens und Suffolk, Long Island. (Dieses Herumziehen halte ich für eine meiner besten Erfahrungen und nachhaltigsten Lektionen bezüglich der menschlichen Natur hinter den Kulissen und in der Masse.) 1839–40 gründete ich in meiner Heimatstadt Huntington eine Wochenzeitung. Arbeitete dann, nach New York City und Brooklyn zurückgekehrt, als Drucker und Schriftsteller, schrieb meist Prosa, versuchte gelegentlich aber auch »Poesie«.
Meine Leidenschaft für Fähren
Dadurch, dass ich von dieser Zeit an in Brooklyn und New York City wohnte, war mein Leben damals und später noch stärker mit der Fulton-Fähre verbunden, die in Bezug auf ihre allgemeine Bedeutung, ihre Größe, ihre vielfältige Nutzung, Schnelligkeit und malerische Schönheit die hervorragendste ihrer Art in der Welt war. Später (1850 bis ’60) fuhr ich beinahe täglich auf den Schiffen, oftmals oben im Steuerhaus, von wo ich den besten Rundblick hatte, und konnte so viele Erscheinungen und deren Begleitumstände, die ganze Umgebung in mich aufnehmen. So wie die Strömungen des Meeres, die tiefen Strudel – ist auch das große Wogen der Menschheit, die ewig sich ändernde Bewegung. Ich habe in der Tat stets eine Leidenschaft für Fähren besessen; sie sind für mich einzigartige, fließende, niemals versagende, lebendige Gedichte. Die Fluss- und Buchtlandschaft überall in New York, zu jeder beliebigen Zeit eines schönen Tages – die eilenden, spritzenden Meeresströmungen – das wechselnde Panorama von Dampfern aller Größen, oft eine ganze Kette der größeren auf der Heimreise zu fernen Häfen – die Myriaden weißer Segel von Schonern, Schaluppen, Barken und die hübschen Yachten – die majestätischen Sundboote, da sie die Battery umsegelten und nachmittags gegen fünf herankamen, unterwegs nach Osten – den Blick nach Staten Island gerichtet oder hinunter nach Narrows oder in die andere Richtung, den Hudson hinauf – welche Erfrischung des Geistes mir solche Schauspiele und Erlebnisse vor Jahren (und seither noch viele Male) gaben! Meine alten Freunde, die Lotsen Johnny Cole, Ira Smith, die Balsirs, William White und mein junger Freund, der Fährmann Tom Gere – wie gut ich mich an sie alle erinnere!
Broadway-Sehenswürdigkeiten
Außer der Fulton-Fähre kannte und besuchte ich jahrelang immer wieder den Broadway – die berühmte Avenue der bunt zusammengewürfelten Menschenmassen und so vieler Persönlichkeiten. Hier sah ich in dieser Zeit Andrew Jackson, Webster, Clay, Seward, Martin Van Buren, den Filibuster Walker, Kossuth, Fitz Greene Halleck, Bryant, den Prince of Wales, Charles Dickens, die ersten japanischen Botschafter und viele andere Berühmtheiten der Zeit. Stets gab es etwas Neues und Belebendes; für mich jedoch meist die hastende und riesige Fülle jener nie endenden menschlichen Strömungen. Ich erinnere mich, James Fenimore Cooper in einem Gerichtssaal in der Chambers Street, hinter dem Rathaus, gesehen zu haben, wo er einen Rechtsstreit führte. (Ich glaube, es war eine Verleumdungsklage, die er gegen jemanden erhoben hatte.) Ich entsinne mich auch, Edgar A. Poe gesehen und ein kurzes Gespräch mit ihm geführt zu haben (es muss 1845 oder ’46 gewesen sein), in seinem Büro, im zweiten Stock eines Eckhauses (Duane oder Pearl Street). Er war Herausgeber und Inhaber oder Teilhaber des Broadway Journals. Ich suchte ihn auf, weil er etwas von mir veröffentlicht hatte. Poe war sehr herzlich, unaufdringlich, eine angenehme Erscheinung in Person, Kleidung etc. Ich habe eine klare und wohltuende Erinnerung an sein Aussehen, seine Stimme, sein Auftreten und seine Art; sehr liebenswürdig und wohlwollend, aber beherrscht, vielleicht ein wenig erschöpft. Eine weitere meiner Erinnerungen ist, ich sah einst hier auf der Westseite, direkt unterhalb der Houston Street (es muss so um 1832 gewesen sein, an einem klaren, strahlenden Januartag) einen gebeugten, schwachen, aber stämmig gebauten, sehr alten Mann, bärtig, in kostbare Pelze gehüllt, mit einer großen Hermelinmütze auf dem Kopf, geführt und gestützt, die Stufen seiner hohen Treppe zur Haustür beinahe hinuntergetragen (ein Dutzend Freunde und Diener, fast wetteifernd, ihn sorgsam haltend, führend) und dann in einen prachtvollen Schlitten gehoben, eingepackt und für eine Ausfahrt in weitere Pelze gewickelt. Der Schlitten wurde von einem so tollen Pferdegespann gezogen, wie ich es noch nie gesehen hatte. (Man braucht nicht zu glauben, heutzutage würden die besten Tiere gezüchtet; nie wieder gab es solche Pferde auf Long Island oder im Süden oder in New York City wie vor fünfzig Jahren; die Leute damals legten Wert auf Charakter und Temperament, nicht nur auf unterwürfige Schnelligkeit.) Nun, ich, ein Junge von vielleicht dreizehn, vierzehn Jahren, blieb stehen und glotzte auf das Schauspiel jenes in Pelze gewickelten alten Mannes – umgeben von Freunden und Bediensteten – und sein behutsames Hineinsetzen in den Schlitten. Ich erinnere mich an die temperamentvollen, ungeduldigen Pferde, den Kutscher mit seiner Peitsche und, aus besonderer Umsicht, einen zweiten Kutscher an seiner Seite. Den alten Mann, den Gegenstand so vieler Aufmerksamkeit, kann ich beinahe jetzt noch vor mir sehen. Es war John Jacob Astor.
Die Jahre 1846–47 und die folgenden sehen mich immer noch in New York City, als Schriftsteller und Drucker arbeitend. Ich erfreue mich meiner gewohnten guten Gesundheit und lasse es mir im Allgemeinen recht gut gehen.
Omnibus-Ausflüge und Kutscher
Eine Sache jener Tage darf auf keinen Fall unerwähnt bleiben – und zwar die Broadway-Omnibusse mit ihren Kutschern. Diese Fahrzeuge prägen in gewissem Maße immer noch (ich schreibe diesen Abschnitt 1881) den Charakter des Broadway – die Linien der Fifth Avenue, der Madison Avenue und der Twenty-third Street fahren noch immer. Die Glanzzeit der alten Broadway-Kutschen jedoch, so charakteristisch und zahlreich sie auch waren, ist vorüber. Die Linien Yellowbirds, Redbirds, Broadway, Fourth Avenue, Knickerbocker und ein Dutzend andere von vor zwanzig, dreißig Jahren sind alle verschwunden. Und auch die Männer, die sich besonders mit ihnen identifizierten und ihnen Vielfalt und Bedeutung verliehen – die Kutscher – ein seltsamer, natürlicher, scharfäugiger und wundersamer Menschenschlag (nicht nur Rabelais und Cervantes hätten sich an ihnen ergötzt, sondern auch Homer und Shakespeare) – wie gut ich mich doch an sie erinnere und muss darum hier ein paar Worte über sie verlieren. Wie viele Stunden, Vormittage und Nachmittage – wie viele berauschende Nächte ich verbracht habe – vielleicht im Juni oder Juli, in kühlerer Luft – den Broadway in seiner gesamten Länge hinunterfahrend, mancher Geschichte lauschend (dem schillerndsten Garn, das jemals gesponnen wurde, und der ungewöhnlichsten Mimik) – oder vielleicht deklamierte ich ein paar stürmische Passagen aus Julius Cäsar oder Richard (man konnte brüllen, so laut man wollte in jenem wuchtigen, undurchdringlichen, niemals unterbrochenen Straßenlärm). Ja, damals kannte ich die Kutscher alle – Broadway Jack, Dressmaker, Balky Bill, George Storms, Old Elephant, dessen Bruder Young Elephant (der später kam), Tippy, Pop Rice, Big Frank, Yellow Joe, Pete Callahan, Patsy Dee und Dutzende mehr; es waren ja immerhin Hunderte. Sie besaßen ungemeine Eigenschaften, weitgehend animalische – Essen, Trinken, Frauen – großen persönlichen Stolz auf ihre Art – hier und da vielleicht ein paar Nieten darunter, auf die große Masse von ihnen hätte ich mich aber auf jeden Fall verlassen können. Ich fand nicht nur Kameradschaft und manchmal auch Zuneigung – sie waren auch großartige Studienobjekte für mich. (Ich nehme an, die Kritiker werden herzhaft lachen, aber der Einfluss dieser Broadway-Omnibustouren und -kutscher, der Deklamationen und Eskapaden ist den Leaves of Grass zweifellos anzumerken.)
Theaterstücke und Opern
Auch gewisse Schauspieler und Sänger hatten ziemlich viel damit zu tun. In all den Jahren besuchte ich hin und wieder das alte Park-, das Bowery-, das Broadway- und das Chatham-Square-Theater sowie die italienischen Opern in der Chambers Street, dem Astor Place oder in der Battery – viele Jahre lang gehörte ich zu den Empfängern von Freikarten, denn ich schrieb für Zeitungen, sogar schon als ganz junger Mann. Das alte Parktheater – was für Namen, Erinnerungen diese Worte wachrufen! Placide, Clarke, Mrs. Vernon, Fisher, Clara F., Mrs. Wood, Mrs. Seguin, Ellen Tree, Hackett, der jüngere Kean, Macready, Mrs. Richardson, Rice – Sänger, Tragiker, Komiker. Welch perfektes Spiel! Henry Placide in Napoleon’s Old Guard oder Grandfather Whitehead – oder The Provoked Husband von Cibber, mit Fanny Kemble als Lady Townley – oder Sheridan Knowles in seinem eigenen Virginius – oder der unnachahmliche Power in Born to Good Luck. Diese und viele mehr in meinen Jugendjahren und danach. Fanny Kemble – ein Name, mit dem man obendrein große schauspielerische Darstellungen heraufbeschwören kann – vielleicht die größten. Ich erinnere mich gut an ihre Darstellung der Bianca in Fazio und der Marianna in The Wife. Nichts Schöneres hat es je auf der Bühne gegeben – das sagten die Veteranen aller Nationen, und auch mein junges Herz und mein Kopf fühlten das bis in die kleinste Zelle. Die Dame war künstlerisch gerade ausgereift, energisch, mehr als nur hübsch, ein Kind des Rampenlichts. Nach einer dreijährigen Zeit in London und anderen britischen Städten war sie gekommen, um Amerika die junge Reife und den optimistischen Elan ihrer Kunst in voller Blüte zu schenken. Ich hatte das Glück, sie nahezu jeden Abend, an dem sie im alten Parktheater spielte, zu sehen – ganz bestimmt in all ihren Hauptrollen.
In diesen Jahren erlebte ich, in guten Aufführungen, all die italienischen und anderen Opern, die gerade in Mode waren: La Sonnambula, The Puritans, Der Freischütz, Die Hugenotten, Fille du regiment, Faust, Étoile du Nord, Polutio und andere. Verdis Ernani, Rigoletto und Troubadour, Donizettis Lucia, Favorita und Lucretia, Aubers Massaniello und Rossinis Wilhelm Tell und Gazza Ladra gehörten zu meinen besonderen Favoriten. Die Alboni hörte ich jedes Mal, wenn sie in New York oder Umgebung sang – auch die Grisi, den Tenor Mario und den Bariton Badiali, den besten in der ganzen Welt.
Diese Leidenschaft für die Musik folgte der für das Theater. Als Knabe oder junger Mann hatte ich nahezu alle Dramen von Shakespeare, und zwar in hervorragenden Aufführungen, gesehen. (Selbstverständlich hatte ich sie jedes Mal vorher sorgfältig gelesen.) Selbst jetzt noch kann ich mir nichts Großartigeres vorstellen als den alten Booth in RichardIII. oder König Lear (Ich kann nicht sagen, in welcher Rolle er am besten war.) oder Iago (oder Pescara oder Sir Giles Overrach, um Shakespeare zu verlassen) oder Tom Hamblin in Macbeth – oder den alten Clarke, entweder als Geist in Hamlet oder als Prospero in Der Sturm, mit Mrs. Austin als Ariel und Peter Richings als Caliban. Dann andere Dramen und die hervorragenden Darsteller darin – Forrest als Metamora oder Damon oder Brutus – John R. Scott als Tom Cringle oder Rolla – oder Charlotte Cushmans Lady Gay Spanker in London Assurance. Dann ein paar Jahre später in Castle Garden, Battery, erinnere ich mich noch an die herrlichen Gastspiele der Musiktruppe aus Havanna unter Maretzek – die herrliche Band, die kühle Meeresbrise, die unübertroffene Sangeskunst – Steffanone, Bosio, Truffi, Marini in Marino Faliero, Don Pasquale oder Favorita. Niemals gab es besseres Schauspiel oder besseren Gesang in New York! Hier war es auch, wo ich später Jenny Lind gehört habe. (Die Battery – ihre alten Erinnerungen – was für Geschichten diese alten Bäume und Wege und Kaimauern erzählen könnten!)
Die folgenden acht Jahre
Die Jahre 1848–49 war ich als Redakteur der Zeitung Daily Eagle in Brooklyn beschäftigt. Das letztere der beiden verging auf einer gemächlichen Reise und Arbeitsexpedition mit meinem Bruder Jeff durch all die mittleren Staaten und den Ohio und Mississippi hinab. Lebte eine Weile in New Orleans und arbeitete dort in der Redaktion des Daily Crescent. Kehrte nach einiger Zeit zurück nach Norden, den Mississippi hinauf und dann über die großen Seen Michigan, Huron und Erie zu den Niagara-Fällen und Lower Canada, schließlich durch New York State und den Hudson hinunter; legte auf dieser Reise hin und zurück insgesamt wahrscheinlich achttausend Meilen zurück. 1851 bis ’53 war ich in Brooklyn mit Hausbauen beschäftigt. (Und kurze Zeit, im ersten Abschnitt der betreffenden Jahre, mit dem Drucken einer Tages- und Wochenzeitung: The Freeman.) Verlor im Jahr 1855 meinen lieben Vater. Begann in der Akzidenzdruckerei meiner Freunde, den Brüdern Rome in Brooklyn, mit dem endgültigen Druck von Leaves of Grass; und zwar nachdem ich zahlreiche Änderungen des Manuskripts vorgenommen und wieder rückgängig gemacht hatte. (Ich hatte große Mühe, den abgedroschenen »poetischen« Anstrich wegzulassen, aber schließlich gelang es mir.) Ich befinde mich jetzt (1856, ’57) im siebenunddreißigsten Lebensjahr.
Charakterquellen –Ergebnisse –1860
Um das Vorhergehende von Anfang an zusammenzufassen (und gewiss noch viel, viel mehr unerwähnt zu lassen): Ich bezeichne drei Hauptquellen und formende Eindrücke für meinen Charakter, jetzt verfestigt im Guten wie im Schlechten, und für die spätere literarische und sonstige Entwicklung – erstens die Herkunft mütterlicherseits, mit ihren Wurzeln in den weit entfernten Niederlanden (zweifellos die beste Quelle) – zweitens die verborgene Zähigkeit und zentrale knöcherne Struktur (Hartnäckigkeit, Eigensinn), die ich von meinem väterlichen, englischen Element erhalten habe –; und drittens die Kombination meines Geburtsortes Long Island, der Meeresküste, der Schauplätze meiner Kindheit, der Absorbierung des Gewimmels von Menschen in Brooklyn und New York mit – wie ich vermute – meinen späteren Erfahrungen im Bürgerkrieg.
Denn 1862, aufgeschreckt durch die Nachricht, dass mein Bruder George, Offizier im 51. New Yorker Freiwilligenkorps, schwer verwundet worden war (erste Fredericksburg-Schlacht, 13. Dezember), fuhr ich eilends hin zum Schlachtfeld in Virginia. Doch ich muss erst einmal ein wenig zurückblenden.
Beginn des Sezessionskrieges
Die Nachricht vom Angriff auf Fort Sumter und die Flagge im Hafen von Charleston, South Carolina, traf am 13. April 1861 spätabends in New York ein und wurde sofort in Extrablättern veröffentlicht. Ich bin an dem Abend in der Oper in der Fourteenth Street gewesen und ging nach Ende der Vorstellung, so gegen 24 Uhr, den Broadway hinunter, auf dem Weg nach Brooklyn. Da hörte ich in der Ferne die lauten Rufe der Zeitungsjungen, die kurz darauf schreiend die Straße einherjagten und wilder als sonst von einer Seite auf die andere stürmten. Ich kaufte mir ein Extrablatt und ging zum Metropolitan Hotel (Niblos Hotel) hinüber, wo die großen Laternen noch hell brannten, und las gemeinsam mit einer Vielzahl anderer, die spontan zusammengekommen waren, die Nachricht, die ganz offensichtlich der Wahrheit entsprach. Für diejenigen, die keine Zeitung hatten, las einer von uns das Telegramm laut vor, während alle anderen still und aufmerksam zuhörten. Kein einziger aus der Menge, die auf dreißig bis vierzig Mann angewachsen war, machte eine Bemerkung; aber alle blieben, wie ich mich erinnere, ein, zwei Minuten lang stehen, ehe sie auseinandergingen. Fast kann ich sie jetzt wieder dort sehen, unter den Laternen um Mitternacht.
Nationale Erhebung und Freiwilligenmeldung
Irgendwo habe ich gesagt, dass die drei Präsidentschaften vor 1861 gezeigt haben, dass Schwäche und Verderbtheit der Herrschenden hier in Amerika unter republikanischen Einflüssen ebenso möglich sind wie in Europa unter dynastischen. Doch was vermag ich zu sagen über jenes unverzüglich einsetzende, großartige Ringen mit der Sklaverei der Südstaaten, unserem personifizierten Erzfeind, in dem Augenblick, da er unmissverständlich sein wahres Gesicht zeigte? Der vulkanische Aufruhr der Nation nach der Beschießung der Flagge in Charleston lieferte den sicheren Beweis für etwas, woran bis dahin große Zweifel bestanden hatten, und entschied sofort und grundsätzlich die Frage der Abspaltung. Meines Erachtens wird er als das großartigste und ermutigendste Schauspiel in Erinnerung bleiben, das jemals, in alten wie in neuen Zeiten, für politischen Fortschritt und Demokratie einstand. Es ging nicht um das, was an die Oberfläche kam – obgleich das bedeutsam war –, sondern um das, was sich darunter abzeichnete und von ewiger Bedeutung war. In den Abgründen des Menschengeschlechts der Neuen Welt hatte sich ein erster fester nationaler Unionswille gebildet und erhärtet, entschlossen und sich mehrheitlich weigernd, beeinträchtigt oder in Zweifel gezogen zu werden, allen Notlagen mutig zu begegnen und jederzeit in der Lage zu sein, alle oberflächlichen Bindungen zu sprengen und wie ein Erdbeben loszubrechen. Dies ist in der Tat die beste Lektion des Jahrhunderts oder Amerikas, und es gilt als großartiges Privileg, das miterlebt zu haben. (Zwei gewaltige Schauspiele, unsterbliche Beweise für Demokratie, die in der gesamten bisherigen Geschichte ohnegleichen sind, liefert uns der Sezessionskrieg – das eine am Anfang, das andere am Ende. Dies sind die allgemeine, freiwillige bewaffnete Erhebung und die friedliche und ohne Zwischenfälle vonstattengegangene Auflösung der Armeen im Sommer 1865.)
Gefühle der Verachtung
Selbst noch nach der Beschießung von Fort Sumter wurden die Schwere der Revolte und die Kraft und Entschlossenheit der Sklavenhalterstaaten zu einem starken und anhaltenden militärischen Widerstand gegen die nationale Autorität im Norden, mit wenigen Ausnahmen, keineswegs erkannt. Neun Zehntel der Bevölkerung der freien Staaten betrachteten die Rebellion, die in South Carolina begonnen hatte, mit einem Gefühl, das zur einen Hälfte aus Verachtung und zur anderen aus Wut und Fassungslosigkeit bestand. Man glaubte nicht, dass sich Virginia, North Carolina und Georgia anschließen würden. Ein hoher und vorsichtiger Staatsbeamter sagte voraus, dass das »in sechzig Tagen« vorbei sein würde, und die Leute schenkten dieser Voraussage allgemeinen Glauben. Ich erinnere mich noch, auf einem Fulton-Fährboot mit dem Bürgermeister von Brooklyn darüber gesprochen zu haben, der sagte, er hoffe nur, dass die Hitzköpfe aus den Südstaaten einen offenkundigen Akt des Widerstandes begehen mögen, da sie dann sofort endgültig zermalmt würden, sodass man nie wieder etwas von Spaltung hören würde – doch er fürchtete, sie würden nie den Mut dazu haben, wirklich etwas zu unternehmen. Ich erinnere mich auch daran, dass einige Kompanien des 13. Brooklyn-Regiments, die sich vor dem Zeughaus der Stadt sammelten und von dort aus als Freiwillige für dreißig Tage aufbrachen, mit Seilen ausgerüstet waren, die sie ganz auffällig an ihren Gewehrläufen befestigt hatten. Daran wollte jeder unserer Männer bei ihrer baldigen und triumphalen Rückkehr einen Gefangenen aus dem dreisten Süden, in einer Schlinge geführt, mitbringen!
Die Schlacht am Bull Run,Juli 1861
Alle Gefühle dieser Art waren bestimmt, durch einen schrecklichen Schock – die erste Schlacht am Bull Run – ausgebremst und in ihr Gegenteil verkehrt zu werden, sicherlich, wie wir heute wissen, eine der eigentümlichsten Schlachten der Geschichte. (Alle Gefechte und ihre Ergebnisse sind weit mehr eine Sache des Zufalls, als allgemein angenommen wird; dieses jedoch war ganz und gar ein Unglück, ein Zufall. Bis zum letzten Augenblick nahm jede Seite an, sie hätte gewonnen. Die eine hätte in der Tat ebenso gut in die Flucht geschlagen werden können wie die andere. Durch ein Gerücht jedoch oder eine Reihe von Gerüchten gerieten die nationalen Truppen im letzten Moment in Panik und flohen vom Schlachtfeld.) Die geschlagenen Truppen begannen, sich am Montag, den 22. Juli – einem Tag, an dem es unaufhörlich regnete – bei Tagesanbruch über die Long Bridge nach Washington zu ergießen. Am Sonnabend und Sonntag (dem 20. und 21.), den Tagen der Schlacht, war es sengend heiß und trocken gewesen – Staub, Dreck und Qualm, in Schichten, durchgeschwitzt, darüber weitere Schichten, wiederum durchgeschwitzt, aufgesogen von jenen aufgeregten Seelen – ihre Kleider schienen nur aus Erde und Staub zu bestehen, der die Luft erfüllte – überall auf den trockenen Straßen und zertrampelten Feldern wurde er von den Regimentern, den dahinrollenden Wagen, der Artillerie etc. aufgewirbelt. Alle die Männer mit dieser Kruste von Schmutz und Schweiß und Regen zogen sich nun zurück, strömten über die Long Bridge – in einem unheimlichen Marsch von zwanzig Meilen kamen sie nach Washington zurück, geschlagen, gedemütigt, von Panik ergriffen. Wo sind die Prahlereien geblieben, die hochmütigen Aufschneidereien, mit denen ihr ausgezogen seid? Wo sind eure Paniere, eure Pauken und Trompeten und eure Seile, an denen ihr eure Gefangenen mitbringen wolltet? Nun, nicht eine einzige Kapelle spielt – da ist auch keine Fahne, die nicht beschämt und schlaff an der Stange hängt.
Die Sonne geht auf, aber sie scheint nicht. Die Männer tauchen in den Straßen Washingtons auf, zunächst recht vereinzelt und verschämt, dann zahlreicher – erscheinen in der Pennsylvania Avenue, auf Treppen und in Kellereingängen. In ungeordneten Haufen kommen sie daher, einige in Trupps, als Nachzügler, in Kompanien. Gelegentlich ein gelichtetes Regiment in perfekter Ordnung, das mit seinen Offizieren (einige Lücken, Tote, die wahren Tapferen) schweigend, gesenkten Hauptes marschiert, todernst, zum Umsinken erschöpft, alle düster und schmutzig, doch jeder mit seiner Muskete und lebhaftem Tritt, aber das sind Ausnahmen. Die Bürgersteige der Pennsylvania Avenue, der Fourteenth Street etc. sind dicht bevölkert, vollgestopft mit Bürgern, Darkies, Angestellten, jedermann, Zuschauern; Frauen an den Fenstern, mit neugierigen Blicken in den Gesichtern, während die Scharen der schmutzbedeckten zurückgekehrten Soldaten (wollen sie denn kein Ende nehmen?) vorüberziehen; doch kein Wort, keine Bemerkung fällt (die Hälfte unserer Zuschauer sind Sezessionisten übelster Sorte – sie sagen nichts; doch der Teufel kichert aus den Falten ihrer Gesichter). Im Laufe des Vormittags wird ganz Washington zu einem bunten Gewimmel dieser geschlagenen Soldaten – sonderbar aussehende Gestalten, seltsame Augen und Gesichter, durchnässt (der Regen hält den ganzen Tag über an) und von Furcht verzehrt, hungrig, ausgemergelt, die Füße voller Blasen. Gütige Menschen (doch es sind nicht übermäßig viele) machen ihnen schnell etwas zu essen. Sie setzen Waschkessel aufs Feuer, für Suppe, für Kaffee. Sie stellen Tische auf die Bürgersteige – Wagenladungen von Brot werden gekauft und rasch in dicke Runksen geschnitten. Hier sind zwei bewundernswerte ältere Damen, die allerersten der Stadt nach Lebensart und Charme – mit einem Vorrat an Essen und Trinken stehen sie an einem improvisierten Tisch aus groben Brettern, verteilen das Essen und lassen den ganzen Tag über, jede halbe Stunde, aus ihrem Hause die Vorräte nachfüllen; und da stehen sie, im Regen, rührig, schweigsam, mit weißem Haar, und verteilen die Lebensmittel, obwohl ihnen die ganze Zeit fast ununterbrochen Tränen über die Wangen laufen. Inmitten der großen Aufregung, der Massen und der Bewegung und des verzweiflungsvollen Eifers wirkt es sonderbar, viele, sehr viele Soldaten schlafen zu sehen – inmitten von allem tief zu schlafen. Sie lassen sich einfach irgendwo nieder, auf den Treppen der Häuser, dicht am Gemäuer oder an Zäunen, auf dem Gehsteig, abseits an einem ruhigen Fleck, und schlafen tief. Ein armer siebzehn-, achtzehnjähriger Bursche liegt da auf der Vortreppe eines vornehmen Hauses; er schläft so ruhig, so tief. Selbst im Schlaf umklammern einige ihre Gewehre. Manche zu mehreren; Kameraden, Brüder, dicht beieinander – und verdrossen tropft auf sie, wie sie so daliegen, der Regen.