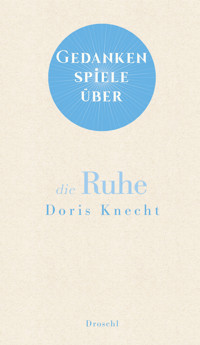9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Antonia Pollak hat ein Leben, von dem viele träumen – ihr Mann Adam trägt sie und die beiden Kinder auf Händen, man leistet sich, worauf man Lust hat, hat Freunde mit interessanten Jobs, alles läuft in festen Bahnen. Doch Toni Pollak hat auch ein paar Geheimnisse, von denen ihr Liebhaber noch das kleinste ist. Zu ihrer Mutter hat sie jeden Kontakt abgebrochen, und als junge Frau kannte Toni die falschen Leute, was sie fast vergessen hat – bis eines Tages ein Mann von früher auftaucht. Während der ökohedonistische Alltag weiterläuft, wächst in Toni die Angst, die Vergangenheit könne sie einholen … Doris Knecht schickt ihre Heldin, die immer das Gefühl hat, gar nicht in ihr schönes Leben zu passen, durch Feuerproben, in denen sie alles zu verlieren fürchtet und langsam ein paar Dinge zu begreifen beginnt. Und wie nebenher porträtiert Doris Knecht mit unbestechlichem Blick unsere Zeit, ihre Typen und Lebensentwürfe. Ein verteufelt ehrliches Buch über das Dasein und die wahrhaften Lügen, die es zusammenhalten – und ein ebenso schwarzer wie komischer Roman über das richtige Leben im falschen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 323
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Doris Knecht
Besser
Roman
Rowohlt Digitalbuch
Inhaltsübersicht
Eins
Ich werde nicht kommen heute, ich weiß es jetzt schon. Zu nervös. Zu nüchtern. Zu viele Sachen im Kopf. Und die Narbe an seinem Hals zu deutlich vor meinen Augen, viel deutlicher als sonst. Er liegt auf mir, in mir und ich mache die Augen zu und sehe diese Narbe trotzdem. Es ist nicht die Narbe an dem anderen Hals, die Narbe, die ich vergessen wollte, schon vergessen hatte, an dieser Narbe hier war kein Messer schuld, keine Wut und kein Krieg, es ist eine harmlose, alte Narbe, ein Kinderfahrradunfall, ein dummer Sturz, irgend so etwas, aber ich sehe diese Narbe und erinnere mich an die andere Narbe an dem anderen Hals. Ich dränge die Erinnerung weg, verscheuche sie und lasse meinen Körper mit seinem sprechen, während ich überlege, wie spät es jetzt ungefähr ist … Halb drei vermutlich, um halb sieben werden zehn Leute zum Essen kommen, sechs Erwachsene, vier oder fünf Kinder. Adam kocht den Hauptgang, was bedeutet, dass ich mich um alles andere zu kümmern habe. Er fickt mich, drückt mit seinen Händen meine Handgelenke auf die Matratze, sein langer, knochiger Körper bewegt sich auf mir, er stöhnt laut und ich mache die vorgesehenen Geräusche, während ich an die fertigen Vorspeisen im Kühlschrank denke, an die gestern bereits zubereitete Entenleber-Pâté, an die Ziegenkäse-Tartes und an die Würstchen in Blätterteig für die Kinder, die ich nur mehr aufzubacken brauche. Ich wünschte, ich wäre mehr bei der Sache, aber ich bin es nicht, ich will mich darauf einlassen, aber es gelingt nicht. Er stemmt sich hoch, aus mir heraus, dreht mich herum und schiebt mit den Knien meine Beine auseinander. Ich habe zur Sicherheit noch italienische Wildschweinsalami besorgt, ein Stück Parmesan, fette, schwarze Oliven und Avocados, es wird reichen, auch falls Adam das Lamm, sein erstes Lamm, versemmelt. Er packt meine Hüften, keucht und stöhnt. Es wird alles gut sein, alles wird gut aussehen, perfekt, vorschriftsmäßig, nichts verrät mich. Schweiß rinnt meinen Nacken hinab, ich spüre, wie in meinem rechten Oberschenkel ein Muskel verkrampft. Das Kissen riecht nach billigem Waschmittel. Er wird schneller, heftiger, gleich kommt er. Zum Dessert in Rotweinsud gedünstete Birnen mit Vanilleeis, er wimmert jetzt und krächzt meinen Namen, und für die Kinder Schokosauce auf Birnenpüree, schnell gemacht. Er krallt sich mit beiden Händen in meine Hüften, und jetzt kommt er, er kommt endlich, und ich tue so, als käme ich auch, er brüllt, er stöhnt ein letztes Mal wie erlöst auf, er fällt, seine Hände in meinen Haaren, schwer auf mich und atmet heiser in meinen Nacken. Ich bleibe einfach mal so liegen. Ist gut so. Ich werde heute das Geschirr von Adams Großmutter verwenden, das mit dem Rosenmuster.
«Hast du den Knoblauch mitgebracht?»
Hatte ich.
«Habe ich. Und Bratenschnur auch, wie befohlen.»
Adams SMS war da gewesen, als ich das Handy wieder eingeschaltet habe.
«Hatte ich vergessen», sagt Adam. «Weil ich wieder mal in Hundescheiße gestiegen bin und mich so aufgeregt habe. Irgendwann rutscht mir die Faust aus.»
Ja, haha, Adams Mädchenhammer, sicher.
«Da ist ja der Supermarkt neben dem Atelier, war kein Problem … Hier.»
«Danke.» Adam küsst mich hastig auf den Mund und reißt dann die Folie vom Schnurknäuel.
«Für dich immer, Schatz», sage ich.
Adam kocht jetzt. Oder besser: Er glaubt, er kocht. Als Elena aus der Säuglingszeit herauswuchs und wir sie nicht mehr so einfach in die Restaurants mitnehmen konnten, in denen Adam damals praktisch wohnte, als wir uns also gezwungenermaßen privat mit anderen Familien mit ebenfalls nicht gesellschaftsfähigen Kleinkindern sozialisierten, hatte er begonnen, vom Kochen zu reden, und dass er das jetzt auch anfange. Denn wenn ihr Luschen kochen könnt, kann ich das schon lange, so Adam zu den anderen Vätern, die fast alle kochen, zum Teil gut kochen, weil auf täglicher Basis. Dann fing er an, und jetzt kocht er manchmal, meistens für Gäste. Was man sich so vorstellen muss, dass Adam große, teure Fische vom Naschmarkt daherschleppt und dann Manuel anruft, der ihm erklärt, was er damit tun soll. Manuel kennt Adam lange genug, er hat Adam in seinem Restaurant ungefähr eine Million Mal bekocht, er kennt Adam und seine Möglichkeiten und sagt ihm deshalb nur die einfachsten Dinge: Leg den Fisch auf ein Blech, fülle ihn mit Zitronenscheiben und Kräutern, bepinsle ihn mit Olivenöl und schieb ihn eine halbe Stunde in den Backofen. Bei hundertachtzig Grad, ja. Ich würde das, was Adam da macht, nicht als Kochen bezeichnen, es ist mehr wie Malen nach Zahlen. Aber am Schluss kommt meistens etwas heraus, das ganz gut und eindrucksvoll aussieht und auch so schmeckt, außer Manuel hatte vergessen zu erwähnen, dass da auch Salz drangehört, was für einen Koch zu selbstverständlich ist, um es eigens anzuführen, aber nicht für einen, der vom Kochen nichts versteht, null. Einmal, zu Elenas zweitem Geburtstag, buk Adam einen Schokoladenkuchen, er rief Manuel an, und der mailte ihm ein Rezept, alle Zutaten schön aufgelistet, nur das Mehl hatte er vergessen, weil er das immer nach Gefühl macht. Ist Adam nicht aufgefallen. Also mischte er kein Mehl darunter, gar keins. Elena verschlang den Kuchen trotzdem, Hauptsache süß und obendrauf tüchtig Schokoguss und Smarties. Für die Erwachsenen kaufte Adam dann schnell noch eine Sachertorte dazu, eine echte, die seinen feinen Gaumen nicht beleidigte. Einsatz hatte er ja schließlich gezeigt, oder. Aufrichtigen Einsatz. Ganz engagierter Vater und zupackender Partner. Damals war er kochmäßig noch nicht so ehrgeizig.
Jetzt wickelt Adam die Schnur um das Lamm, eine ausgelöste Haxe, in die er ein paar Zweige Rosmarin gesteckt hat. Die Schnur rutscht immer wieder herunter, während er wickelt, und er flucht. Ich weiß, wie man das richtig macht, ich könnte ihm zeigen, wie es geht. Adam hat mir zu meinem Geburtstag kurz nach Elenas Geburt einen zweitägigen Kochkurs bei einem seiner Lieblingsköche geschenkt, in einem Haubenlokal im Burgenland. Ich hatte nicht recht gewusst, ob ich mich freuen sollte oder es beleidigend und erniedrigend und frauenfeindlich finden. Aha, ich soll also kochen für dich und das Baby, und zwar besser als bislang. Adam war klug genug gewesen, Astrid mit einzuladen, er hatte alles mit ihr abgesprochen, und meine Schwester fand es super. Zwei Tage mit mir, gut essen und tollen Wein trinken und quatschen. Jedenfalls beschloss ich, es auch gut zu finden, und als Elena ungefähr vier Monate alt war, fuhren wir hin. Astrid war begeistert, bloß fand sie schade, dass das Baby nicht mitkam. Und ich muss sagen, es war toll. Und ich habe etwas gelernt.
«Soll ich dir einen Trick zeigen?»
Ich höre Elena hinten im Kinderzimmer murmeln; das typische Elena-Feierabendgeräusch. Sie hat das gern, sie braucht das, ein bisschen Ruhe nach dem Kindergarten, ein bisschen ihre Autos herumschieben oder ihren Puppenwagen, einfach so vor sich hin kramen, einfach in Ruhe gelassen werden. Ich verstehe das; sie hat das von mir. Der Kleine, das höre ich auch, rast auf seinem Rutschauto durch das riesige Wohnzimmer. Durch das viel zu große Wohnzimmer. Manchmal sind mir so große Räume immer noch fremd, nach wie vor. Eng, klein und eng waren Zimmer für mich immer, und eng ist gut, solange es eine Tür gibt, die man öffnen kann, und Fenster, durch die Licht dringt. Juri rast wieder zurück. Er ist eindeutig ein Kerl. Und ich danke Gott periodisch, dass unter uns Leute wohnen, die ebenfalls ein kleines Kind haben.
«Was für einen Trick», sagt Adam mit einem Unterton. Er verliert nicht leicht die Nerven, er hat eine endlose Geduld, aber es ärgert ihn, wenn ihm etwas so Babyleichtes, das doch jeder kann, jeder können müsste, misslingt. Die Schnur verrutscht, hält das Fleisch nicht zusammen. Schön aussehen tut es auch nicht, es ist ein Durcheinander. Adam hat Durcheinander nicht gern. Adam hat es gern übersichtlich, genau und ordentlich.
«Einen Wickeltrick.»
Er trägt eine schwarze Kellnerschürze, so eine, wie sie die Kellner in Manuels Restaurant tragen. Sven hat sie ihm geschenkt, zusammen mit dem Marcella-Hazan-Kochbuch, nachdem Manuel wohl den einen oder anderen Witz über Adams Anrufe gemacht hatte. Adam schaut mich skeptisch an. Er lässt sich nicht gern helfen, schon gar nicht von einer Frau. Schon gar nicht von seiner Frau. Und schon überhaupt nicht beim Kochen von einer Künstlerin. Von einer Künstlerin i. R., um genau zu sein, derzeit zumindest, aber davon weiß Adam nichts. Braucht er auch nicht zu wissen. Ist ja auch nichts Endgültiges. Kann sich jederzeit wieder ändern.
«Bitte, wenn du es besser kannst.»
Kann ich. Hab ich gelernt. Er hat dafür gesorgt, dass ich es lerne.
Ich kremple die Ärmel meiner Bluse hoch, wasche mir die Hände mit Seife, trockne sie an einem Geschirrtuch ab und wickle dann die Schnur um das kalte, feuchte Fleisch. Einmal rundherum, dann unter der Schnur durch, in einer kleinen Schlinge, dann wieder um das Fleisch, dann wieder unter der Schnur durch. Ein dicker Zweig Rosmarin ragt aus dem zusammengerollten Fleisch. Das Hazan-Kochbuch liegt aufgeschlagen auf der Kücheninsel.
«Ach so geht das», sagt Adam muffig.
«Ja, so geht das. Habe ich von Kurt gelernt.» Jess, von Kurt, deinem Zweitlieblingskoch, das muss dich doch …
«Okay, gib her.» Es stimmt ihn gleich hörbar milder, dass ich das Bratenwickeln auch nicht in der Genetik habe. Sondern erst lernen musste, in dem Kurs, den er mir geschenkt und bezahlt hat, er. Jetzt ist es in Ordnung für Adam, er bleibt der Bestimmer, so ist es richtig.
Er wickelt weiter und verpackt den Braten sofort wie ein Profi, in perfekten Abständen schneiden die Schnüre in das Fleisch ein. Wenn Adam etwas macht, muss es richtig sein oder zumindest schön ausschauen. Das, und beinahe nur das, macht ihn unrund: wenn er etwas nicht kann, wenn etwas nicht sofort so gelingt, wie es gehört. Und, ach ja, Hundescheiße auf der Straße, da zuckt er aus. Allerdings hat er’s auch nicht gern, wenn ich etwas besser kann. Ich schaue zu, wie er das Fleisch auf dem Brett dreht, öffne den Schrank und zähle vierzehn Teller herunter, hebe sie heraus und denke an drei Stunden vorher. Meine Haut, seine Haut. Manchmal ist die Erinnerung besser als die Realität. Die Erinnerung verklärt alles, lässt das Unangenehme verschwinden, die Dissonanzen, die Kanten. Die Erinnerung macht mich verliebt. Und geil. Ich würde mich jetzt gern in Ruhe ein bisschen erinnern.
«Die nimmst du? Die Oma-Teller? Willst du nicht lieber das schöne neue Geschirr nehmen?»
Nein, will ich eigentlich nicht, sonst hätte ich das neue nämlich genommen. Andererseits ist es mir einerlei. Teller egal. Ich hatte meinen Nachmittag. Ich verfüge heute über ein enormes Potenzial an Großzügigkeit.
«Mir ist es wurscht. Wie es dir gefällt.»
«Na, nimm halt dein Oma-Geschirr, wenn du es so gern hast.»
«Nein, ganz egal, im Ernst.»
Ich schiebe die Blümchen-Teller wieder in den Schrank und zähle daneben acht von den großen flachen Iittalas herunter und acht von den kleineren, olivgrünen, die es nicht mehr gibt. Nach denen ich an den Tagen, an denen ich vorgeblich im Atelier an meiner Kunst arbeite, im Internet suche, in irgendwelchen obskuren Shops, die noch Restbestände lagern und sie überteuert verkaufen. Mit so etwas kann man seine Zeit verbringen, doch. Ich stelle die Teller auf den Tisch, schiebe Adam zur Seite, der das hasst, und nehme aus einer großen Lade noch sechs von den sonnengelben, viereckigen, unzerstörbaren Melamin-Tellern, für die Kinder.
«Ich hab gerade noch Mirkan getroffen.» Mirkan ist unser Hausmeister. Er und Alenka wohnen in der Erdgeschosswohnung, sie haben eine einjährige Tochter, Adile, die Mirkan vergöttert. Er war gerade mit ihr im Hof, als ich zur Haustüre hereinkam, ich hatte kurz mit Mirkan geplaudert und mit Adile gescherzt. «Adile ist wahnsinnig süß.»
«Das Baby?»
«Ja, das Baby.» Adam kann sich keine Namen merken, manchmal wundere ich mich, dass er die Namen seiner eigenen Kinder nicht vergisst. «Die Frau heißt Alenka.»
«Weiß ich doch.»
«Aber die findest du vielleicht süß.»
«Nein. Zu dünn.»
«Aha.»
Jetzt fünf Minuten für mich. Fünf Minuten unter der Bettdecke. Fünf Minuten Autonomie, bevor ich wieder nur Frau und Mutter bin, Mutter und Frau. Fünf Minuten, bevor ein Rudel hipper junger Eltern bei uns einmarschiert, mit denen ich hippe Jung-Eltern-Gespräche führen werde, als wäre ich genauso wie sie. Sie denken, ich sei genauso. Aber das bin ich nicht. Ich bin jemand, der sich jetzt gern irgendwo verkriechen und sündigen Gedanken nachhängen würde. Das könnte ich jetzt brauchen, das wäre jetzt … Draußen im Flur macht es einen Rumpler, dem bitteres Wehgeschrei folgt. Der Kleine hat die Entfernung zur Wand offenbar falsch eingeschätzt. Ich werfe das gerade aus der Lade gezählte Besteck auf den Tisch und laufe hinaus. Hebe Juri hoch, drücke ihn an meine Brust, bette seinen Kopf an meine Schulter, streichle seinen Rücken. Er ist ein kompaktes, blondes, eher grobschlächtiges Kind mit einem Bauerngesicht, er hat nichts von Adam. Ich setze mich mit ihm aufs Sofa, bette ihn auf meine Knie, tröste ihn, tätschle seinen Bauch. In meiner Tasche, drüben auf der Küchenbank, höre ich mein iPhone galagang machen. Ich blase auf seinen wehen Fuß. Alles ist gut, Schnucki, alles ist gut, armer, kleiner Juri, schau, wir pusten es einfach weg, da schau: schon weg.
«Ist was passiert?», fragt Adam über die Schulter.
«Ja, ganz großes Aua», sage ich, «wird aber schon besser. Wollen wir doch sehen, ob sich nicht trotzdem ein kleines Lachen in dem Juri versteckt.» Ich kitzle seine Wange. Der Kleine konserviert seine Jammermiene noch zwei Sekunden, dann strahlt er. Funktioniert immer.
«Auto bös», kichert er, und fasst nach meiner Brust. Das ist eine merkwürdige Sache; ich habe ihn nie gestillt, und trotzdem geht er mir an die Brust. Vielleicht weil er ein Kerl ist. Oder einfach, weil er es bei anderen Zweijährigen sieht, die auf ihre am Tisch plaudernden Mütter zumarschieren, ihnen mit beiden Händen eine Brust aus der Bluse fassen und sich festsaugen. Wird heute wohl auch wieder so sein. Ich muss jedes Mal wegsehen und mir auf die Zunge beißen. Ich finde es abartig, wie diese Mütter ihre Kinder nicht loslassen können. Sind übrigens meistens, eigentlich immer, männliche Kinder, Mädchen stillen sich offenbar freiwillig früher ab, oder Mütter haben zu ihren Töchtern schon in der Säuglingsphase eine andere, weniger symbiotische Beziehung. Ich kann da nicht mitreden. Ich habe das Stillen bei Elena kurz probiert, es ging nicht. Ich glaube, ich wollte gar nicht richtig. Ich glaube, ich will meine Brüste nur zum Spielen. Ich will nur volljährige Männer an meinen Brüsten.
Ich würde jetzt gern seine SMS lesen, würde gern wissen, was er geschrieben hat. Dass er es schön fand und geil, dass er mich schon vermisst, und wie sehr er mich vermissen wird in Damaskus oder wohin er schon wieder fährt, aber ich setze den Kleinen in den Hochstuhl, mache ein Glas Obstbrei auf, schütte es auf seinen Teller mit den grinsenden Monstern, ziehe ihm einen Frottee-Latz über den Kopf. Ich drücke ihm einen Plastiklöffel in die eine Hand und eine Baby-Biskotte in die andere. Juri gluckst glücklich und haut rein. Und dann decke ich, soweit sein Gepatze am Tischende das zulässt, in sicherem Abstand auf. Moosgrüne Teller auf weiße Teller, die gelben Kinderteller, dazu hellgrüne Servietten, Silberbesteck und Plastikbesteck, Riedel-Gläser und die schweren Ikea-Gläser, die auch kleine Kinder nicht kaputt kriegen.
«Ich weiß jetzt», hatte Moritz am Tag vorher am Telefon gesagt.
«Was weißt du?»
«Meine Vorsätze für heuer.»
«Silvester ist vorbei», sagte ich.
«Egal», sagte Moritz.
«Also?»
«Ich werde nicht mehr bei H&M einkaufen. Überhaupt bei keinen Billigdiskountern mehr. Ich werde kein Fleisch mehr essen. Ich erwäge, mir einen Hund zuzulegen. Und ich habe dieses Jahr zum frauenlosen Jahr erklärt. Die Weiber sind mir jetzt wurscht. Die sollen mich jetzt alle mal. Frauen interessieren mich heuer nicht.»
«Keine Frauen mehr? Das ganze Jahr?»
«Ja. Sie sollen ruhig kommen: Ich lasse sie abprallen und auflaufen.»
«Ein fast ganzes frauenloses Jahr?»
«Genau. Das Jahr ohne Frauen.»
«Das ist doch mal ein guter Anfang.»
«Wie meinst du das jetzt?»
«Ach, nur so», sagte ich.
«Ich bin nicht schwul», sagte Moritz, «wie war dein Nachmittag?»
«Ich weiß nicht, wovon du sprichst», sagte ich. «Was für einen Hund?»
«So einen wie in ‹The Artist›», sagte Moritz.
«Steht dir sicher», sagte ich.
Ich habe auch Moritz eingeladen, aber er fühlt sich heute nicht gut. Oder hat wahrscheinlich eher keine Lust. Er ist, wie ich, kein Fan von Felizitas von und zu Dingshausen, aber im Unterschied zu mir kann er sich aussuchen, ob er mit ihr befreundet sein will oder nicht. Und ob sie an seinem Tisch sitzt oder nicht. An meinem sitzt sie jetzt, neben Sven, Adams ältestem Freund.
«Aber es ist doch ganz logisch, dass die Mitte-Parteien ihren Kurs ändern, wenn ihnen sonst das gesamte unzufriedene Klientel von den Rechten abgenommen wird», sagt Sven. Er hat das Kartoffelpüree abgelehnt und vom Fleisch etwa ein Zehntel seiner üblichen Portion genommen, bitte lieber mehr Spinat und Erbsen, danke. Fräulein Aristo hat’s, ich hab es aus dem Augenwinkel gesehen, befriedigt zur Kenntnis genommen. Sven hat sichtbar abgenommen, er verliert die Kilos gerade ebenso rasant wie ihm parallel dazu die Haare ausgehen, offenbar hat er nach einer Million Fehlversuchen mit frustrierenden Rückschlägen endlich eine Diät gefunden, die wirkt. Sie heißt Felizitas. Felizitas von Dings zu Irgendwas, ich kann mir das nicht merken. Ich will es mir nicht merken, ich hoffe, dass sie schon bald wieder zu den Leuten gehört, deren Namen man zu Recht vergessen hat, über die man bei Einladungen Witze machen kann, weißt du noch, Svens Aristotrutscherl, wie hieß die noch gleich … Schaut aber derzeit leider nicht danach aus, so gar nicht. Sven scheint es nicht zu bemerken, dass die nicht zu ihm passt. Ich konnte mich bislang dennoch nicht entschließen, sie zu mögen. Ja, sie sieht fantastisch aus, auf diese angeboren makellose Art, wie es nur höhere Töchter draufhaben. So einen Teint kriegt man in der Unterschicht nicht zugeteilt, nicht mal in der Mittelschicht, diesen Teint gibt’s nur für Aristos und Großindustrielle. Das hat man in den Genen oder man hat es nicht. Und solche Nasen gleichfalls. Obwohl, die Felizitas-Nase ist eigentlich zu perfekt, die kommt vielleicht eh aus der Schönheitsklinik. Wobei mir hier die moralische Basis fehlt, ein Urteil zu fällen, aber. Die Frau ist auch sonst sehr attraktiv, aber auf eine, wie soll ich sagen, irgendwie asexuelle, aseptische Weise. Adam findet sie, jedenfalls hat er das kürzlich dahergewitzelt, offenbar scharf, was mir irgendwie nicht so egal ist, wie es mir sonst egal ist, wenn er andere Weiber scharf findet. Woran sich wieder einmal zeigt, dass wir sehr, sehr verschieden sind, Adam und ich. Ich bin zum Beispiel nicht der Perlenohrstecker-Typ. Aber er ist eben mit derlei aufgewachsen, der hat bis achtzehn vermutlich gar nicht gewusst, dass Frauen an und für sich ohne Perlenohrstecker aus der Fabrik geliefert werden, der wuchs in dem Glauben auf, Frauen hätten das serienmäßig wie Zähne und Brüste und flache Mokassins mit Troddeln dran. Ich stehe auch nicht auf Designer-Mokassins, obwohl sie jetzt gar keine trägt, ich glaub sogar, ich habe sie noch nie in flachen Schuhen gesehen. Aber die verstellt sich doch. Die hat sich die Troddel-Tod’s mühsam von den Füßen schälen müssen, ich würd’s schwören. Ich brauch ja nur zu sehen, wie unstimmig ihr existenzialistisch-schwarzes Fashion-Victim-Outfit daherkommt: schwarze Pumps (nicht hoch genug, deshalb bisschen bieder), schwarze Hochwasserhosen (nicht eng genug oder sie zu dünn dafür) und einen, okay, der ist fantastisch, den hätte ich auch gern, schwarzen Rollkragenpullover aus Seide, der ihre perfekten Brüste perfekt ausstellt. Alles wie von der «Vogue» für Kreative vorgeschrieben, nur mutloser, weil verschwendet an einer Frau, die für die Schärfe, die so ein Outfit verlangt, letztlich zu feig ist. Nein, anders: die über so eine Schärfe nichts weiß, sie nie erlebt hat, nicht kennt, nicht hat. Solche Pullover stehen prinzipiell nur Frauen, die sie sich nicht leisten können. Sobald man sich so einen Pullover leisten kann, hat man nicht mehr die innere Haltung dafür. Jedenfalls hat Felizitas nicht die Haltung dafür, weder innen noch außen. Das Zeug hängt an ihr wie an einer Puppe in der Auslage vom Künstlerbedarfsladen. Vermutlich trägt sie darunter endgeile Dessous von Agent Provocateur, in denen sie sich nicht ganz wohlfühlt, weil sie so was eigentlich pervers findet, die sie aber trotzdem anhat, weil sie noch ein bisschen mehr davon ablenken sollen, wie beige Felizitas von Natur aus ist. Ich glaube, darunter ist die komplett beige, bis in ihre Ohrlöcher und in die Wurzeln ihrer beigen, blondierten Haare hinein. Ich bin sicher. Ich weiß es. Ihre Lider sind beige unter den Smokey Eyes. Wahrscheinlich ist auch ihre Muschi beige. Und ihr Arschloch; obwohl, ihr Arschloch könnte auch lodengrün sein oder burberry-kariert, nicht dass ich es herausfinden möchte. Die Frau regt mich auf, ich könnte kotzen, wenn ich ihr zusehe, wie sie einen auf urcool und extra modern macht und auf superliberal und aufgeschlossen und sich auf der Bühne auszieht und total arg aus sich herausgeht und überhaupt total eine von uns ist, als Künstlerin und Frau, also eigentlich noch viel unsriger ist, als wir es je sein werden. Kontraaristokratisch, quasi. Ich hätte es ihr fast geglaubt. Jetzt glaube ich es ihr nicht mehr, nichts mehr glaub ich der, kein Wort. Alles falsch an ihr, alles Fake. Kunst? Hahaha. Für Kunst muss man sich auch mal dreckig machen, fragt mich, ich mach mich mächtig dreckig, oft, immer. Das tut die nicht. Schmutz kennt die nicht, Schmutz bleibt an der nicht kleben, perlt an der ab. Die könnte kopfüber in eine Jauchegrube tauchen, die würde blitzsauber wieder herauskrabbeln. Alles klinisch sauber an der, jeder Geruch aufgesprüht, jedes Futzelchen Schmutz nach Plan aufgemalt, alles Trompe-l’Œil.
«Die linken und liberalen Parteien müssen auf den Rechtsruck doch reagieren. Und wie, wenn nicht so?», sagt sie jetzt. Meine Güte. Ich könnte ihr erklären, was ich davon halte und warum das totaler Quatsch ist, was sie da erzählt, aber es ist mir zu blöd. Sie ist mir zu blöd. Schade, dass Moritz nicht da ist, der hätte dem Spuk schon ein Ende bereitet. Aber Moritz ist ja heute krank. Irgendwas mit dem Magen. Sagt er.
«Eben», sagt Sven.
«Es hat ja keinen Sinn», sagt die von Pfitzendingshausen, «mit linken Idealen und überholten sozialen Ideen an den Menschen vorbeizuregieren und sie damit als Wähler letztendlich zu verstoßen, da gebe ich Sven ganz recht.»
Sven strahlt: Habt ihr das gehört, habt ihr das alle gehört? Die zu Pfitzenfotzner hat mir recht gegeben, seht ihr?, sie hält zu mir, sie liebt mich, diese großartige, schöne Frau von edlem Blute liebt mich! Der Narr. Er kapiert nicht, dass das nichts anderes war als die Belohnung dafür, dass er Adams Essen fast vollständig entsagt hat, dass es ihr gelungen ist, ihn seinem besten Freund zu entfremden, kulinarisch und nun auch politisch, dass Sven jetzt superdepperte Meinungen vertritt, von seinem üblichen, eher konservativen Standpunkt jetzt plötzlich zum Reaktionären schielt, und dass er unsere Vorspeisen mit einem verlegenen und gleichzeitig gierigen Grinsen verschmäht und seit zehn Minuten winzigste Stückchen von einer fast durchsichtigen Scheibe Lammbraten heruntersäbelt, nicht so viel, nicht so viel! Der Lammbraten ist, by the way, überraschend fantastisch geworden: zart, rosa, saftig, rosmarinig. Und die Schnur hat gehalten. Das Kartoffelpüree kommt vielleicht eine Ahnung zu fest und trocken daher, aber sonst alles picobello. Hätt’s nicht besser machen können. Adam ist zufrieden mit sich, er genießt es gerade, man sieht es ihm an. Er lehnt glücklich in seinem Sessel, die Ärmel seines hellblau karierten Hemdes aufgekrempelt, die Backen rot und ein bisschen schweißig glänzend unter dem graugesprenkelten Bart, seine Glatze über den übrig gebliebenen, penibel rasierten Seitenhaaren leuchtet. Ich schaue ihm zu (und spüre, wie der Miller mir dabei zuschaut), wie er dem Moser (der Miller steht jetzt von seinem Stuhl auf und geht aufs Klo) zuschaut, wie der die Riesenportion reinhaut, die er sich hat auflegen lassen, ruhig noch ein bisschen mehr, gerne, und Svens Vollversagen als Gast wettmacht – und ihn nicht ohne Absicht ein bisschen demütigt. Der Moser verträgt es nicht, wenn man Essen verschmäht, und ich schaue Adam zu, wie er das sichtbar gut findet. Ich lächle zu ihm hinüber. Er ist ein toller Mann. Es hat nichts mit ihm zu tun.
«Doch ein Glas Wein, Feli?» Sie hat irgendwann erwähnt, ein, zwei oder vielleicht sogar drei Mal, dass es ihr (Bühnenschauspielerinnen heißen nun mal nicht Feli und adelige schon gar nicht) lieber wäre, Felizitas genannt zu werden, und während ich ihr, sie hat den Wein abgelehnt, Wasser nachschenke, registriere ich, dass es sie nervt. Okay. Geht doch. Ich würde die Frau im Leben nicht einladen, aber man kriegt Sven nicht mehr ohne sie, und Adam braucht Sven, auch bei solchen Familienanlässen. Speziell bei solchen Familienanlässen: Sven gibt Adam das Gefühl, nicht völlig vervatert und bekindert zu sein. Sven ist sein Beweis dafür, dass er noch am Leben ist, trotz mir und den Kindern. Dass sein altes Leben noch da ist, auf Standby, und praktisch jederzeit wieder eingeschaltet und aufgenommen werden könnte: Adam Pollak, der wilde Hund. Nicht dass ich glaube, dass Adam je ein wilder Hund gewesen wäre, jetzt außer im Sinne von Harley-Davidson-wild, und das ist ja wie Metallica unplugged, Metal, aber bitte ohne das Gefährliche, Wilde, Stinkende daran, und die Haare bitte gewaschen und gekämmt. Zudem ist Sven, seit er mit dieser Frau zusammen ist, im Handumdrehen zehnmal spießiger geworden als Adam je sein kann; so radikal wie Sven das in den letzten acht Monaten hingekriegt hat, kann Adam in vier Leben nicht verspießern, selbst wenn wir noch vier Kinder kriegen. Und natürlich hat er sich den Anker in sein früheres, echtes Leben aufgehoben. Der parkt zwei Gassen weiter in einer sauteuren, bewachten Garage und wird jeweils dann ausgefahren, wenn wir wirklich schlimmen Krach haben. Die Harley, das Spießermotorrad, über das ich mich gern lustig mache … Aber wenn Adam, was zum Glück selten vorkommt, die Tür hinter sich zuknallt und ich weiß, jetzt marschiert er zur Garage, dann ängstige ich mich, und das gehört selbstverständlich zu Adams Racheplan, jedes Mal bis in die Knochen. Und wenn er nach ein paar Stunden wieder zurückkommt, bin ich, auch wenn ich es nicht zugebe, nur noch erleichtert und froh. (Danke, Gott, dass er wieder da ist, danke.) Das ist doch programmierter Selbstmord, so eine Maschine. Ein Streitwagen, buchstäblich. Damit kann man wirklich viel kaputt machen, vor allem sich selbst, vor allem wenn man voller Zorn darauf steigt, auch wenn Adams Zorn nur ein Zörnchen ist, jetzt mal verglichen mit meinem.
Oder dem Zorn vom Moser, wenn ihm was nicht passt. Und schau her, dem Moser reicht’s jetzt, der Moser sammelt sich, er schaufelt ein paar Erbsen auf die Gabel und schiebt ein bisschen Kartoffelpüree hinterher, er ist gleich so weit. Ich schenke mir schnell noch ein Glas Veltliner nach und dem Moser auch, weil der das gleich brauchen wird, wie ich ihn kenne. Ich lehne mich schon mal zurück.
Der Moser wirkt harmlos, fast unsichtbar, in seiner formlosen, unrasierten Bärigkeit, ein gemütlicher Teddy, wuschelig, kuschelig, lieb, ein netter Papi, aber solche wie die Felizitas frisst der Moser zum Frühstück. Auf so eine wie die Felizitas hat der Moser nur gewartet, wartet er eigentlich die ganze Zeit. Die machen sein Leben erst lebenswert, gerade ein Moser muss und möchte sich hin und wieder einmal abreagieren, und wenn man ihm die Gelegenheit dazu quasi auf den Bauch bindet, dann nutzt er sie auch. Wenn man dem Moser eine wie die Pfützenfotze gegenübersetzt, sagt er nicht nein. Der Moser genehmigt sich noch einen Schluck und holt dann tief Luft. Geht schon los.
«Fahrt ihr eigentlich heuer wieder nach Sizilien?», sagt Adam.
In Richtung Moser. Spielverderber! Verdammter Spielverderber. Adam hat es auch kommen sehen, hat gesehen, wie der Moser sich aufmunitionierte und hat ihn in einem Anflug von Harmoniesucht ausgebremst. Wobei es wahrscheinlich nur um sein Lamm ging, er wollte sich die Feier seines ersten und auch noch perfekten Lammes nicht durch einen Streit verderben. Und er hat, was mir nun überhaupt nicht gefällt, offenbar Mitleid mit der Aristotusse … Die Kuh hat kein Mitleid verdient. Schon gar nicht von Adam. Es nervt mich. Es gefällt mir nicht. Zum Glück ist ihr offenbar nicht aufgefallen, dass Adam eben wie ein Ritter auf dem weißen Ross zu ihrer Rettung herbeigaloppierte.
«Ja», sagt der Moser und schiebt sich noch ein Stück Fleisch in den Mund.
«Mit wem?», fragt Adam. «Sind die Fricks wieder mit dabei?» Er macht es kaputt. Letztklassig. Er hält das einfach nicht aus, eine Disharmonie. Der Schwächling, der Lulu.
«Nein», sagt der Moser, «nicht die Fricks. Die Fricks nicht mehr.» Die Millers kennen die Fricks auch, ich sehe die Millerin aufhorchen, Tratschalarm, aufgepasst, bin schon da. Die Mosers waren jahrelang immer mit den Fricks in Sizilien, jedes Jahr zwei Wochen zur gleichen Zeit im gleichen Haus, man hat Kinder im gleichen Alter und verstand sich gut. Jetzt, infolge kulinarisch-ideologischer Zerwürfnisse, nicht mehr. Unüberbrückbare Gegensätze sozusagen. Über die man vom Moser heute nichts erfährt.
«Warum nicht mehr mit den Fricks?», fragt Adam. Er kennt den Grund nicht.
«Ach, Terminprobleme», sagt der Moser. Lügt der Moser. Ich kenne den Grund. Es hat was mit den berühmten Moser-Schnitzeln zu tun, zu denen wir alle schon eingeladen waren, und mit Neo-Vegetariern. Ich werde es Adam später erzählen, wenn alle weg sind, wenn wir die Küche aufräumen. Falls ich ihm bis dahin seinen Verrat verziehen habe.
«Und mit wem fahrt ihr heuer?», fragt Adam. Er ist offenbar entschlossen, zu kalmieren und das egalisierende Element zu bilden, zur Not auf Kosten des Mosers. Mein iPhone macht galagang. Ich weiß, wer das ist. Ich spüre es zwischen meinen Beinen.
«So, wie es ausschaut, kommt die Strasser mit den Kindern mit.»
Das war’s mit Adams Egalität.
«Was?», sagt Adam. «Ist nicht wahr! Die Strasser? Du hältst die Strasser aus? Kein Mensch hält doch die Strasser länger als einen Nachmittag aus! Ach, keine zwei Stunden!»
Der Moser schaut jetzt ziemlich muffig. Er hat’s nicht gern, wenn man seine Entscheidungen und Freundschaften in Frage stellt. Aber Adam kann nicht zurück. Er hatte, ich weiß das von seiner Mutter, vor langer Zeit mit der Strasser ein Gspusi. Als er noch mit Sissi zusammen war. Sie haben sich, so erzählt es seine Mutter, bei irgendeiner beruflichen Sache getroffen, sind zusammengeknallt und kamen fünf Tage nicht aus dem Bett. Am sechsten soll es zu einem Heiratsantrag und seiner feierlichen Akzeptanz gekommen sein. Am siebten zum ersten Konflikt. Einem ernsten, seither immerwährenden Konflikt, denn am achten Tag soll er wieder bei Sissi vor der Tür gestanden haben. Die knallte ihm diese Tür vor der Nase wieder zu und ließ ihn noch zwei oder drei Wochen bei Sven schmoren, dann durfte er auf Bewährung heim. Er soll jahrelang nicht mehr mit der Strasser gesprochen haben, aber nicht, weil es die Sissi so verlangt hatte, sondern aus eigenem Bedürfnis. Das mit der Strasser war wohl traumatisch, auch wenn wir sie jetzt hin und wieder bei Freunden treffen und Adam zwischenzeitlich in der Lage ist, mit ihr so etwas wie Smalltalk zu machen. Er hat mir nie erzählt, was am siebten Tag passiert war.
«Zwei Wochen in einem Haus mit der Strasser! Allein ihre Stimme schlägt einen ja sofort in die Flucht!» Offenbar wurde während der Liaison nicht viel geredet. Aber, gut, das kennt man ja. Ich kenne das ja.
«Wegen zwei Wochen?», sagt der Moser. «Da bin ich aber völlig gelassen. Komplett unbesorgt. Zwei Wochen halte ich es mit jedem in einem Haus aus.»
«Ach so?», sagt Adam.
«Definitiv», sagt der Moser. «Zwei Wochen vertrag ich mich mit wurscht wem. Zwei kleine Wochen», sagt der Moser, und schüttet sein Glas in einem radikalen Zug hinunter, «zwei Wochen vertrag ich mich sogar mit Hitler. Gemeinsam in einem Zimmer.»
«Hahaha», sagt Adam.
«Aber Hitler sich vielleicht mit dir nicht», sagt die Millerin.
«Speziell, wenn du ihm jeden Tag einen Berg Wiener Schnitzel brätst», sage ich.
«Am achten Tag bettelt er auf Knien um teutsches Kemüse», sagt der Miller, der vom Klo zurück ist.
«Aber der Moser kennt keine Knade», sagt Sven.
«Also, ich finde, dieses Gespräch geht in eine sehr merkwürdige Richtung», sagt Felizitas.
Die Kinder sind längst in ihrem Zimmer verschwunden, mit dem Kindermädchen der Millers. Ich mag die Millers, aber ich finde es total affig, dass die immer ihre Nanny mitbringen, völlig selbstverständlich, ohne uns vorher auch nur zu fragen, ob uns das recht ist. Dabei haben die auch nur zwei Kinder, man kann doch mal mit zwei Kindern das Haus verlassen, ohne das Personal mitzunehmen. Das muss für moderne Menschen doch möglich sein, mal mit zwei Kindern, einer Wickeltasche und einer Flasche Wein andere Leute in deren Wohnung zu besuchen, zumal wir ja auch Kinder haben, ist ja nicht so, dass bei uns Kinder irgendwie ruhiggestellt oder weggesperrt werden müssen. Ich bin einigermaßen an Kindergeräusche gewöhnt, und Adam putzt auch nicht mehr wie am Anfang jedes Fleckchen Kinderdreck sofort weg. Ich sollte die Kindermädchensache mal diesem Moral-Onkel vom «Süddeutschen»-Magazin schreiben, der immer so Fragen zu ethischen Zwiespälten beantwortet. Ich sollte den mal anmailen, ob das okay ist, einfach ungefragt das Kindermädchen mitzubringen, wenn man bei anderen Leuten zum Essen eingeladen wird, ob das Kindermädchen also sozusagen zur Familie zählt und keiner extra Einladung bedarf, beziehungsweise, ob es okay ist, das nicht okay zu finden, wenn Leute, die man zum Essen einlädt, einfach die Nanny anschleppen. Ob es moralisch vertretbar ist, das daneben zu finden. Ich finde das nämlich sehr daneben, unhöflich und taktlos. Ich weiß nie, wie ich dann umgehen soll mit dem Kindermädchen, da gibt’s sicher auch irgendeinen Verhaltenskodex, und ich kenne ihn nicht.
Für die Millers ist es selbstverständlich, dass das Kindermädchen nicht mit uns isst, und sie speisen sie, diese hier heißt Ankica, mit ein paar Würsteln gemeinsam mit den Kindern ab, bevor die Erwachsenen, die richtigen Erwachsenen, zusammen essen. Mir ist das nicht recht. Ich will, dass wir alle gemeinsam essen, Kinder, Kindermädchen und wir, aber wer das Kindermädchen bringt, darf offenbar auch bestimmen, wer wann isst. Adam greift da nie ein, der ist Kindermädchen und ihre soziale Ausgrenzung ja gewohnt, aber ich finde das, ehrlich gesagt, übergriffig, ja widerwärtig. Aber wer hat in so einer Situation die Hoheit über Rechte und Pflichten des Kindermädchens, die Arbeitgeber oder die Gastgeber? Wer bestimmt, wann das Kindermädchen wo was isst? Wenn wir bei Millers sind, isst die Nanny überhaupt mit den Kindern, auch mit unseren, in der Küche oder im Kinderzimmer, während wir im Esszimmer dinieren, das macht mich jedes Mal unrund. Dieses hochherrschaftliche Getue. Die sind sonst ja wirklich okay, die Millers, nur im Umgang mit Personal kommt denen immer so was Snobistisches durch, das mich anwidert. Ich werde jedes Mal giftig davon, kann aber nichts sagen, ist ja deren Haus, ich werde höchstens schnippisch, und die wissen dann nicht, wie ihnen geschieht. Adam weiß, woran es liegt. Ich muss diesem Ethik-Kerl schreiben, mich beschäftigt das. Ich muss ihn fragen, ob man beim nächsten Mal, zumindest bei uns im Haus, etwas sagen darf oder soll oder nicht: Bitte lasst euer Kindermädchen daheim oder sagt es uns zumindest vorher, wenn ihr sie mitbringt, und dann isst sie mit uns am Tisch.