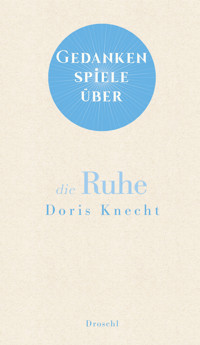Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser Berlin
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Frau – eine Nachricht – eine Verunsicherung. In ihrem neuen Roman schreibt Doris Knecht über familiäre Geheimnisse und die fatalen Folgen von Frauenverachtung und digitaler Gewalt
"Die Nachricht" handelt von Frauen, deren Souveränität stets aufs Neue infrage gestellt wird – und von den Lügen, die wir gerade den Menschen erzählen, die uns am nächsten stehen.
Vier Jahre nach dem Tod ihres Mannes lebt Ruth allein in dem Haus auf dem Land, wo die Familie einst glücklich war. Die Kinder haben längst ihr eigenes Leben, während Ruth das Alleinsein zu schätzen lernt. Bis sie eines Tages eine anonyme Messenger-Nachricht bekommt, von einer Person, die mehr über ihre Vergangenheit zu wissen scheint als Ruth selbst.
Doris Knecht schreibt über eine Frau, die plötzlich zur Verfolgten wird, und erweist sich einmal mehr als virtuose Skeptikerin zwischenmenschlicher Beziehungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Eine Frau — eine Nachricht — eine Verunsicherung. In ihrem neuen Roman schreibt Doris Knecht über familiäre Geheimnisse und die fatalen Folgen von Frauenverachtung und digitaler Gewalt»Die Nachricht« handelt von Frauen, deren Souveränität stets aufs Neue infrage gestellt wird — und von den Lügen, die wir gerade den Menschen erzählen, die uns am nächsten stehen. Vier Jahre nach dem Tod ihres Mannes lebt Ruth allein in dem Haus auf dem Land, wo die Familie einst glücklich war. Die Kinder haben längst ihr eigenes Leben, während Ruth das Alleinsein zu schätzen lernt. Bis sie eines Tages eine anonyme Messenger-Nachricht bekommt, von einer Person, die mehr über ihre Vergangenheit zu wissen scheint als Ruth selbst. Doris Knecht schreibt über eine Frau, die plötzlich zur Verfolgten wird, und erweist sich einmal mehr als virtuose Skeptikerin zwischenmenschlicher Beziehungen.
DORIS KNECHT
DIE NACHRICHT
Roman | Hanser Berlin
ERSTE NACHRICHT
Die erste Nachricht kam an einem Sonntag im September. Ich saß auf der Bank im Schatten hinter dem Haus und rauchte eine Zigarette, Laptop auf den Knien, und ich ahnte nicht, dass das der Moment war, in dem sich meine Verhältnisse verschoben, erneut, ganz leicht nur. Wolf saß neben mir, schaute in sein Handy und rauchte nicht. Er hasste das Rauchen, seit er vor ein paar Monaten damit aufgehört hatte, und versuchte jetzt, jeden zu missionieren, der es immer noch tat. Normalerweise vermied ich es in seiner Gegenwart, aber ich hatte mich den ganzen Nachmittag auf diese Zigarette gefreut und versuchte jetzt, sie mir schmecken zu lassen, mit zügig nachlassendem Erfolg.
Die Nachricht wartete im Postfach meines Facebook-Accounts, dem offiziellen. Ich habe zwei Accounts, einen unter meinem Namen und einen privaten unter einem Namen, den nur meine Freunde kennen. Ich erinnere mich an gelbes Herbstlicht, an laue Luft und an die Farbe des Himmels über mir: ein grünliches, warmes Blau, verschmiert von zerlaufenden Kondensstreifen. Wolf und ich waren den ganzen Tag am Berg gewesen, jetzt waren wir zurück zu Hause, zufrieden erschöpft, wir tranken Wein nebeneinander auf der Bank an der Hauswand, und ich spürte, dass ich lieber allein gewesen wäre. Ich hätte lieber allein geraucht, ungestört meine Mails gelesen, Instagram und Twitter und die News durchgesehen.
Die Nachricht kam von einer Person ohne Gesicht und mit dem Namen Ernst Breuer. Erst wollte ich sie einfach ungeöffnet wegdrücken, aber dann besiegte mich die Neugier. Gerade als ich die Nachricht anklickte, machte Wolf eine Handbewegung, ein ganz leichtes Wegwedeln des Rauchs meiner Zigarette.
Ich stand auf und sagte: »Soll ich mich woanders hinsetzen?«
»Aber nein, alles gut«, sagte Wolf mit so einem zart gequälten Dulder-Ausdruck im Gesicht, und ich setzte mich doch auf die andere Seite der Bank, mit meinem Weinglas in der einen und dem MacBook in der anderen Hand, zwischen den Lippen die Zigarette, die mir nicht mehr schmeckte. Ich hätte sie einfach ausdrücken können, aber es war meine Lunge, meine Luft, mein Leben.
Die Nachricht des Gesichtslosen enthielt nur einen Satz: Weisst du eigentlich von der Affaire deines prächtigen Ehemannes?
»Trump, der Idiot«, sagte Wolf, »fängt noch den Dritten Weltkrieg an.« Er hatte Sonnenbrand auf Stirn und Glatze. Ich fand kurz nicht die richtige Reaktion auf das, was er gesagt hatte, die Information steckte halb verarbeitet in meinem Gehirn, überdeckt von einem feinkörnigen, hellgrauen Rauschen, aber Wolf brauchte gar keine Reaktion.
»Ich habe Hunger«, sagte er, »soll ich uns was zu essen bestellen?«
»Okay«, sagte ich.
»Pizza oder Sushi?«, sagte Wolf. »Oder lieber indisch?«
»Egal«, sagte ich und drückte jedes Wort durch das Rauschen heraus.
»Dann Sushi«, sagte Wolf, »bestellst du?«
Wolf hatte doch eben gesagt, er wolle bestellen, aber bitte. Ich schloss die Nachricht und versuchte, das Hellgrau in meinem Kopf leiser zu drehen. Ich sagte: »Warte, ich frag noch Sophie, ob sie auch was mag. Die darf ja kein Sushi.« Ich drückte den Rest meiner Zigarette in die tote Erde des Blumentopfs neben der Bank. Ich klickte Facebook weg und öffnete WhatsApp. Meine Stieftochter wohnte normalerweise in meiner alten Studentenwohnung in Wien, aber jetzt lag sie hinter halb heruntergelassenen Rollos auf ihrem Bett in ihrem alten Zimmer, schaute Netflix auf ihrem Laptop und tippte gleichzeitig in ihr Smartphone, der dicke Bauch verpasste ihrem langen, mageren Mädchenkörper eine groteske Wölbung. Ich hatte kurz nach ihr gesehen, nachdem Wolf und ich zurückgekommen waren — »Alles gut bei dir, Schätzchen?« »Alles bestens, Ruth.« »Was machst du?« »Bisschen herumwhatsappen, bisschen Modern Family schauen.« »Haha, irgendwie passend« —, und jetzt war ich zu faul, um nochmal zu ihr hinaufzugehen. Der WhatsApp-Chat mit Sophie wurde angezeigt zwischen dem mit Simon Brunner und dem mit Iris, die gerade ein neues Foto geschickt hatte, von irgendetwas Veganem, das sie gekocht hatte und das wie immer ziemlich eklig aussah. Ich klickte Sophie an und sah, dass sie online war. Wir bestellen Essen, du auch was? Eine Krähe schrie vom Nachbardach herüber, in diesem beleidigten Tonfall, den Krähen immer draufhaben. Unter Sophies Namen erschien sofort der Hinweis, dass sie zurückschrieb, und ein paar Sekunden später ploppte ihre Nachricht auf: thx, grad gegessen und das Herzaugensmiley. Ok!, schrieb ich, drückte ein Herzchen dazu, löschte beides wieder, antwortete mit einem Thumbsup und machte einen Screenshot.
Wolf krümmte sich neben mir auf der Bank.
»Was hast du?«, sagte ich.
»Ach, nur mein Rücken«, sagte Wolf, »nervt mich schon eine Zeitlang«.
»Oje. Armer Wolf.«
Wolf starrte immer noch auf sein Handy. Ich sagte, dass ich eine gute Physiotherapeutin kenne, Wolf sagte, ach, das werde schon wieder. Er hatte es nicht so mit Ärzten, hatte er noch nie gehabt, seit ich ihn auf der Uni kennengelernt hatte. Im Unterschied zu mir hatte er sein Kunststudium irgendwann abgeschlossen und lebte in Wien, in einer Wohngemeinschaft, wie damals, nur waren seine Mitbewohnerinnen jetzt halb so alt wie er.
»Sushi ist okay«, sagte ich, »Sophie mag nichts.«
»Gut«, sagte Wolf. Ich öffnete die Speisekarte vom Sakura Palace. Wolf beugte sich über meinen Laptop und drückte sich an meine Schulter, er war mir zu nah, viel zu nah. Weisst du eigentlich von der Affaire deines prächtigen Ehemannes? Ja, Ernst Breuer, ich weiß von der Affäre, das weiß ich schon seit einiger Zeit. Die Frage ist, warum du es weißt.
»Ich hätte gern California-Maki, zwölf Stück, und, warte, ja, ein großes Sushi«, sagte Wolf. Ich klickte noch Tempura-Maki mit Garnelen, ein paar Frühlingsrollen und zwei Flaschen japanisches Bier in den Warenkorb und schickte die Bestellung ab. Wolf sagte etwas über die Situation in Nordkorea und wischte weiter über sein Smartphone. Ich zog den Screenshot in eine Fotobearbeitungs-App, radierte Sophies Namen aus, postete das Bild mit den Worten Modern Family auf Instagram und beobachtete eine Minute lang, wie die Herzchen und Kommentare von einigen meiner siebentausend Abonnenten reintröpfelten. Ich las nochmal die Nachricht. Nicht wichtig. Merkwürdig ja, aber nicht wichtig, nur ein Versuch, mich zu ärgern, nicht der erste. Ich klickte die Nachricht an, las sie nochmal und beantwortete sie. Ich schrieb: »Sg. Herr Breuer, danke für die Info, kümmern Sie sich doch um Ihren eigenen Dreck, mfG.«
»Ist alles okay?«, sagte Wolf.
»Jaja«, sagte ich. Ich drückte auf Absenden. Facebook informierte mich in roter Schrift, dass ein vorübergehender Fehler aufgetreten sei: Zum erneuten Senden klicken. Ich klickte erneut, wieder die rote Fehlermeldung. Ich öffnete die Messenger-App und die Nachricht ploppte auf, aber sie hatte jetzt keinen Absender mehr, es gab nur noch einen anonymen Facebook-Nutzer, ich konnte auf die Unterhaltung nicht antworten. Ernst Breuer gab’s schon nicht mehr, es hatte ihn nie gegeben.
»Ist wirklich alles okay?«, sagte Wolf.
»Ja, nur wieder so eine dumme Nachricht von einem Troll, der sich an mir festbeißt«, sagte ich.
»Was steht drin?«, sagte Wolf, immer interessiert an den Abgründen der Menschen. Er las alles, was er über Serienkiller in die Hände bekam, und sah sich am liebsten Filme an, in denen Menschen auf verheerend unnatürliche Weise zu Tode kamen. Ich wäre jetzt wirklich lieber allein gewesen.
»Ach, nichts Wichtiges«, sagte ich. Nichts Wichtiges, nur ein paar Buchstaben in einem virtuellen Briefkasten, nichts Echtes, nichts Reales. Mein Mann ist tot, also fuck you, Ernst Breuer.
Als Ludwig starb, dachte ich, mir könne nicht mehr viel passieren. Ich fühlte mich sicher. Ich hatte überlebt, dass mein Mann gestorben war, was sollte noch geschehen. Das glaubte ich damals jedenfalls.
»Wann bist du mal wieder in Wien?«, fragte Wolf.
»Ich weiß noch nicht genau«, sagte ich. »Wahrscheinlich wenn Sophies Baby da ist. Sie bleibt jetzt erst mal hier. Sie ist in einer Geburtsklinik in der Nähe angemeldet.«
»Wann ist es denn so weit?«, fragte Wolf.
»In ein paar Tagen«, sagte ich.
»Aufregend«, sagte Wolf.
Die Nachricht schwamm langsam aus meinem Bewusstsein heraus. Ich war sowas gewohnt, noch aus der Zeit, als das Internet neu war. Irgendwelche Kerle hatten mich im Fernsehen gesehen, wo ich damals ein Kunstmagazin moderierte, bis es eingestellt wurde, und sie schrieben mir Briefe oder Postkarten, mit Beschimpfungen und Liebeserklärungen oder beidem gleichzeitig. Die meisten warf ich ungelesen weg, die schlimmeren schickte ich an die Chefredaktion weiter, die sie dann wegschmiss. Später kamen Mails, im Affekt geschrieben, schnell abgeschickt von Gmail-Konten, und inzwischen blockierte ich auf Twitter regelmäßig die lästigsten Stalker, die rücksichtslosesten Beschimpfer, die Vergewaltigungsdroher. Ich hatte gedacht, es würde besser, wenn man älter wird, aber das wurde es nicht. Oder nur unmerklich. Ich hatte mich daran gewöhnt, solche Nachrichten nicht ernst zu nehmen. So wie alle Frauen, die sich auch nur ein bisschen in der Öffentlichkeit bewegten. Es gehörte eben dazu, wenn man eine Frau war, und wenn man sich zur Wehr setzte, wurde es nur schlimmer; nicht für die Männer, gegen die man sich wehrte, sondern für die Frauen, die es wagten. Ich war es gewohnt. Ich nahm es nicht ernst.
Es gab in meinem Leben viel wichtigere Dinge. Mein Mann war vor drei Jahren gestorben, und noch immer war ich mit den Problemen konfrontiert, die er früher gelöst hatte. Meine Trauer um Ludwig und das Gift, das dieser Trauer beigemischt war, seit ich kurz nach seinem Tod herausgefunden hatte, dass er eine heimliche Geliebte gehabt hatte, von der ich nicht einmal etwas geahnt hatte. Sophie, die bald ein Baby bekommen würde und nicht sagen wollte, von wem. Mein fünfzehnjähriger Sohn Benni, der noch bei mir wohnte und sich mit der Schule plagte, mit der Trauer um seinen Vater und mit Schuldgefühlen wegen seines Todes. Mein älterer Sohn Manuel, der vor ein paar Wochen ausgezogen war, in Amsterdam studierte und offenbar einen neuen Freund hatte. Mein Garten drohte zuzuwuchern, weil ich mich zu wenig darum kümmerte. Ich hatte einen Abnahmetermin für ein Drehbuch vor mir, und ich hatte meinen Vater schon viel zu lang nicht mehr in dem Pflegeheim besucht, in dem er seit Jahren lebte. Wie sehr es ein Jetzt gab und ein Dann, das bemerkte ich erst später. Damals dachte ich noch, ich sei die Architektin meines Glücks und ich könne alles, was nicht durch Krankheit und Tod, Naturkatastrophen und schreckliche Unfälle über mich hereinbräche, kontrollieren, beeinflussen und abwenden. Damals dachte ich noch, dass ich, anders als andere in meinem Umfeld, mein Leben im Griff hätte, weil ich mich für stärker, schlauer, abgehärteter und robuster hielt als sie. War ich vielleicht auch, aber es half mir nichts, im Gegenteil. Es fordert Leute heraus, wenn sie deine Stärke spüren und deine Unabhängigkeit, und manche von ihnen wollen dir das dann wegnehmen. Sie wollen dir zeigen, dass du gar nicht so stark bist und so unabhängig, wie du glaubst. Und sie beginnen ein Kräftemessen, ihre Kraft gegen deine, ohne dass du es merkst, und dann merkst du es.
SOMMER 2019
So lebte ich. Ein Fahrrad stand in meinem Garten, als ich nach Hause kam. Lehnte innen am schmiedeeisernen Gartentor, blau glänzend, mit einem weißen Schriftzug über der Querstange. Wein rankte über das schwarze Eisen, die Trauben waren noch klein und fest und zum Ausspucken sauer. Das Fahrrad gehörte Hartmann, einem Nachbarn, der ein Stück entfernt wohnte und mit dem ich manchmal ein Bier trank. Ich stellte kurz meine Einkaufstaschen ab und holte die Post aus dem Briefkasten, der außen am Tor hängt, fast ganz überwuchert vom Wein, ein Wunder, dass die Postfrau ihn noch fand. Ich holte Werbeprospekte von Discountern heraus, gut zum Anfeuern, eine Stromrechnung, die Bezirkszeitung, die Ankündigung eines Flohmarkts in der Stadt und einen Einladungs-Flyer zu einer Veranstaltung der Kraftwerksgegner.
Ich warf alles in eine der halbvollen Taschen. Ich freute mich, das Fahrrad in meinem Garten zu sehen. Das war nicht immer so, manchmal nervte es mich, Hartmann in der Nähe zu wissen, überhaupt irgendjemanden in der Nähe zu wissen, obwohl ich mich vor der Welt und ihren Ansprüchen, ihrem Gerede, ihrem unerträglichen Geschau schon gerettet hatte in meinen stillen Garten, in dem die Atmosphäre nur von meinen Bewegungen durcheinandergebracht wurde, vom Wind, der in Bäume fuhr, von den Geräuschen, die hinter den Mauern und Gabionen der Nachbarn herüberdrangen, von Tieren, die, ohne meine Aufmerksamkeit zu verlangen, den Garten durchstreiften. Nichts störte. Niemand nervte. Benni war für drei Wochen in einem Sprachkurs in England, und ich war gern allein in diesem Haus und auf diesem Grundstück, das kein Fremder betrat, ohne sich vorher anzukündigen. Nur Hartmann kam hier immer wieder durch, weil mein Garten weiter vorn an das Ufer des Flusses stieß, aber heute störte es mich nicht, dass er mit seiner Angel die Abkürzung durch meine Wiese genommen hatte und nun meine schöne, wortlose Autonomie mit seiner Anwesenheit ruinierte.
Als wir damals dieses Haus bauten, stand hier auf dem Grundstück nur ein kleiner, wackeliger Schuppen, ein Unterstand für Schafe, und rundherum war fast nichts, nur ein paar alte Häuser, Wiesen und Felder und Weideland, niemand wollte hier wohnen, in der Peripherie einer eh schon peripheren mittelkleinen Stadt. Ich wollte hier eigentlich auch nicht wohnen, nur hatten wir nicht viel Auswahl, und Ludwig hatte diesen Flecken Land geerbt, zwischen den Flecken seiner Brüder, die ihre bald verkauften. Aber Ludwig wollte für uns und für die Kinder, die er schon im Herzen hatte, ein Haus bauen. Auf seinem Land. Nach seinen Vorstellungen. Mit seinen Händen.
Innen an einem der Balken des Schuppens fand ich, mit einem Reißnagel festgepinnt, ein Foto von einem Hund. Ich wusste erst später, was für ein Hund das war, als ich das Foto einmal Helga, meiner Nachbarin, zeigte, die den Hund gekannt hatte und sich erinnerte, dass es ein Appenzeller war. Der Hund hatte den Leuten gehört, die viele Jahre lang das Grundstück für ihre Schafe gepachtet und den Schuppen gebaut hatten. Das Foto hatte hinten einen Stempel, es war in den siebziger Jahren aufgenommen worden: ein scheckiger, halbhoher Hund mit freundlichen, treuherzigen Augen, er sah direkt in die Kamera. Ich hätte gern gewusst, wie der Hund geheißen hatte, aber Helga wusste es auch nicht mehr, er musste schon lange tot gewesen sein, als ich das Foto fand. Ich ließ es an dem Balken hängen, bis ich es wieder bemerkte, als das Haus fertig war und wir den baufälligen Schuppen niederrissen, um an seiner Stelle die Werkstatt für Ludwig zu bauen, ich steckte es in einen Rahmen und hängte es in den Vorraum, und dort hing es immer noch. Ich hatte das Gefühl, dass der Hund zu dem Haus und dem Grundstück gehörte und dass er es immer noch bewachte, von seinem Hundehimmel aus, auch wenn ich das vor niemandem zugegeben hätte, weil jemand, der nicht an Gott glaubte, aber an fremde, tote Hunde, die einen bewachen, auf andere eher merkwürdig wirkt. Und ich dachte irgendwann, dass ich mich besser nach einem lebendigen Hund umsehen sollte, und vielleicht auch einem größeren, furchteinflößenderen, einem, der was hermachte, wenn er am Gartentor Fremde anbellte, lästige Nachbarn und Immobilienheinis. Manchmal fiel mir dann ein, dass ich nie so jemand sein wollte, an den man nicht rankam, jemand, der nur bestimmte Leute an sich ranließ, aber jetzt war ich es vielleicht. Oder auch nicht. Oder eben manchmal. Ich hatte meine Freunde, genug davon, und ich dachte, die seien jetzt für immer, und mehr brauchte ich damals nicht.
Ich hatte Johanna von den anonymen Nachrichten erzählt, gleich nachdem sie zum ersten Mal gekommen waren. Ich hatte drei weitere von einem Messenger-Absender erhalten, sie waren schärfer geworden, beleidigender, hasserfüllter, drohender. Wir trafen uns in Billys Bar, unserem Stammlokal seit immer. Johanna hatte dazu wie immer eine klare Meinung.
»Ma bitte, scheiß drauf. Du kriegst doch ständig so einen Mist, oder?«
»Ja, aber woher weiß der das alles? Oder die: Bei den letzten beiden sind es plötzlich Frauennamen im Absender.«
»Das Zeug ist übel, ja, wirklich, aber da hat irgendwer dein Twitter oder dein Facebook gelesen, ins Blaue hinein gezielt und zufällig was gestreift, mach dir keinen Kopf deswegen, vergiss es, trinkst du noch einen Wein?, sicher trinken wir noch einen, Billy, bitte noch zwei Gläser von dem roten Veltliner!, und mehr Erdnüsse, Billy, danke!, vergiss es, Ruth. Weißt du noch, wie der Typ mit dem blutigen Schweineherz in den Sender gekommen ist, und vom Portier verlangte, dass er dich herunterruft, damit er es dir persönlich überreichen kann?«
»Ja, meine Güte, das hatte ich ganz verdrängt. Das war zum Glück ein harmloser Irrer.«
»Genau, ein harmloser Irrer, genau wie der, der dir jetzt schreibt. Oder die.«
»Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ich weiß noch, wie der hieß, der schrieb mir noch länger. Wie hieß der.«
Johanna und ich waren beste Freundinnen, seit wir acht waren, wir waren zusammen in die Schule gegangen, hatten jeden Tag telefoniert, als ich studierte und sie eine Ausbildung zur Physiotherapeutin machte, weil sie lieber was mit den Händen machen wollte und eilig Geld verdienen. Sie hatte dann zwei Kinder von zwei Männern bekommen, und vielleicht auch wegen all den Konflikten mit ihnen hatte sie vor ein paar Jahren eine weitere Ausbildung gemacht: zur Familientherapeutin.
Wir schrieben uns mehrmals täglich, eine Unterhaltung aus Erlebnissen, Fragen, Tratsch, aus Fotos, die wir uns von dort schickten, wo wir gerade waren, oder von Dingen, die wir gerade taten.
»Klingt mir übrigens tatsächlich ein bisschen nach einer eifersüchtigen Frau. Weil du es gerade erwähnst«, sagte Johanna.
»Norbert! Norbert hieß er. Der mit dem Herz. Was?«
»Ich sagte, für mich klingt das ein bisschen nach einer eifersüchtigen Frau.«
»Du meinst… es könnte Ludwigs Affäre sein?«
»Sie fällt mir jedenfalls als Erstes ein, wenn ich das lese.«
»Jetzt, wo du es sagst …«
»Auch wenn’s komisch ist, dass sie sich jetzt meldet, nach so langer Zeit.«
»Ja, aber sie weiß das natürlich alles, so gesehen …«
In den drei Jahren nach dem Unfalltod meines Mannes hatte ich mich zurückgezogen und mich nur um meine Familie gekümmert, um meine beiden Söhne, um meine Stieftochter, um mich und den Schmerz, den Ludwigs Tod mir zugefügt hatte. Ein zuerst reiner Schmerz, der aber versaut und verschmutzt wurde, als ich herausfand, dass Ludwig eine Affäre hatte, wegen der er mich vielleicht verlassen wollte, es ließ sich aus den Mails, die ich auf seinem Computer gefunden hatte, nicht genau schließen.
»Lass uns über was anderes reden«, sagte Johanna. »Über den Therapeuten deines Sohnes.« Sie grinste. »Du hast übrigens einen merkwürdigen Hang zu Therapeuten, stelle ich fest.«
»Er ist nicht mehr Bennis Therapeut, wie du ganz genau weißt. Schon lange nicht mehr.«
»Okay, okay. Also, wie läuft’s mit dem Schweizer?«
»Ach, Simon … Ich glaube, ich lass das besser. Muss mich ja jetzt auch mehr um Sophie kümmern, jetzt, wo Molly da ist.«
»Klar, du bist ja jetzt …«
»Sag es ja nicht. Außerdem ist sie bekanntlich meine Stieftochter, wir sind nicht verwandt, also.«
Wir redeten dann nicht mehr über die Nachrichten. Wir redeten darüber, wie es war, wieder einen Säugling in der Nähe zu haben, wir redeten über meine Beziehung oder, wie es zu diesem Zeitpunkt gerade aussah, Exbeziehung zu Simon, wir redeten über unsere Kinder, über Benni und Manuel und diesen Diego, Manuels neuen Freund, von dem ich bisher nur Fotos gesehen hatte. Wir sprachen über Johannas Töchter, die nicht daran dachten auszuziehen. Meine beste Freundin hatte vermutlich recht, was die Nachrichten betraf, schließlich war sie Psychotherapeutin, ich vertraute ihrem Urteil. Ich vergaß es, ein paar Tage lang, dann whatsappte Johanna, und Wolf rief mich an, beide erzählten mir, sie hätten auch so eine komische Nachricht bekommen: Dass Ludwig mich betrogen habe, dass er mich schon längst nicht mehr wollte und dass auch kein anderer mich falsche Witwe wolle, auch wenn ich mir nichts sehnlicher wünschte. Ich war so schockiert, ich konnte kaum reagieren. Sie griff jetzt nicht nur mich persönlich an, sie zog auch meine Freunde in die Sache hinein. Was ist da los?, fragte Wolf, und ich spielte es herunter, ach, das ist nur diese Geliebte von Ludwig, ich hab dir doch von ihr erzählt.
Ich ging den rosengesäumten Weg zu meinem Haus, als das Telefon klingelte. Heiße, süße Luft. Ich blieb stehen, wühlte das Telefon aus meiner Umhängetasche. Links und rechts faulte schon das Obst unter den Bäumen, unreif vom Baum gefallen, voller Würmer, die sich ins Innerste fraßen. Außen bemerkte man kaum eine Spur ihres Eindringens, innen tobte widerliche, schwarze Verwüstung. Das Telefon klingelte noch, als ich es erwischte, und ich spürte eine kurze Erleichterung, dass dort nicht Simon stand, sondern Wolf, und weil es immer länger dauerte, wenn Wolf anrief, weil er immer ausholte und sich verlief in seinen Geschichten, hob ich nicht ab. Ich wollte nicht die nächsten zwanzig, fünfundzwanzig Minuten herumstehen und darauf warten, dass Wolf über einen langen Umweg auf den Grund seines Anrufs kam, während die Lebensmittel in meinen Einkaufstaschen in der Hitze welkten, und ich ebenfalls. Ich würde ihn später zurückrufen, wenn ich mit einem kalten Bier vor dem Haus saß, und ich würde behaupten, ich hätte gerade den Rasen gemäht und seinen Anruf nicht gehört.
Ich steckte das klingelnde Telefon zurück in die Tasche. Diese Süße um mich, ich roch sie jetzt nicht nur, ich glaubte, sie aufsteigen zu sehen, kleine Tornados aus Fäulnisbakterien und Schimmel, wie in einem Zeichentrickfilm, ich schmeckte sie auf den Lippen. Das Klingeln hörte auf. Die viel zu frühen Äpfel verschrumpelten in der Hitze zu fauligen, schwarzen Knödeln, jemand hätte sie einsammeln und auf den Komposthaufen werfen sollen, bevor die Wespen darüber herfielen. Aber außer mir war niemand zuständig, niemand sonst war da, das war der Preis der Ungestörtheit.
Nur ich war da, die Frau, die mühevoll gelernt hatte, Dinge selbst zu tun, die vorher ein anderer erledigt hatte. Jetzt stand die Frau mitten in dieser Unordnung, die die Natur zur Unzeit angerichtet hatte. Im Sommer werden die Früchte reif, im Herbst werden sie geerntet, im Winter nähren sie dich; nichts stimmte mehr. Diese Querulanz der Natur, sie kotzte mich an. Aber gut, sollte all das eben in das Gras hineinfaulen und durch das Gras hindurch, sollte es das Grün mit seiner Fäulnis anstecken und mitnehmen in die schwarze, weiche Erde hinein. Sofort wollte ich den Gedanken wegscheuchen, aber er drängte sich vor, der Gedanke an meinen Ehemann, an Ludwig, wie er in der Erde verweste. Ludwig in seinem Totengewand, schwarze Hose, weißes Hemd, die Ärmel an den Gelenken zugeknöpft, nicht aufgekrempelt wie im Leben. Die fahle, fremde Haut. Ich wollte dieses Bild nicht sehen, das hatte nichts mit dem hier zu tun, das hier war harmlos, aber da war er, ich sah ihn, in der Erde.
Sei nicht so eine Idiotin.
Sei nicht so schwach.
Geh weiter.
Geh einfach weiter.
Wirst noch merken, wie allein du bist, du eingebildete Kuh.
Dabei war es am Tag von Ludwigs Begräbnis nicht heiß wie an diesem Tag, es war früher Frühling, ein eisiger Wind wehte. Ich wollte Ludwig verbrennen, genau deshalb wollte ich ihn verbrennen, um genau solche Gedanken nie denken zu müssen, aber er wünschte, im Familiengrab zu verrotten, er hatte es extra aufgeschrieben, ließ sich in die eiskalte Erde buddeln, neben seinem furchtbaren Vater, mit dem ihn im Leben nichts verbunden, mit dem er immer nur gestritten hatte. Wie die unreifen Birnen hier wollte er zu Erde werden. Ich verstand es nicht und würde es niemals verstehen und konnte auch darüber nicht mehr mit ihm streiten und wollte mit ihm streiten, gerade deshalb.
Geh weiter.
Denk an was anderes.
Denk nicht an den toten Ludwig, schau dort nicht hin.
Aber es war zu spät. Es war unmöglich, nicht an Ludwig zu denken, nicht vor oder in diesem Haus, das voll von ihm war. Voll von Nägeln, die er in Latten und Balken gehämmert, von Schrauben, die er eingedreht, von Regalen, die wir gezimmert, von Lampen und Steckdosen, die wir gemeinsam montiert hatten. Und er ließ sich nicht wegdenken auf diesen Granulitplatten, die er zusammen mit seinem jüngeren Bruder in die Wiese gesetzt hatte, von der Straße bis zur Haustür, unter einer Sonne wie dieser, tagelang. Nie konnte ich einen Schritt daraufsetzen, ohne zumindest einmal dieses Bild zu denken, Ludwig und Klaus, gebeugt in der Hitze, mit Schaufeln und Schubkarren voller Steinplatten. Ich wollte es nicht denken, so wie ich nicht daran denken wollte, dass wahrscheinlich die Nachbarn zu mir herüberblickten, aus den Scharten ihrer Festungen links und rechts oder von vorne an der Straße, aus ihren SUVs, mit denen sie durch schnurrend sich öffnende Tore fuhren, die hinter ihnen wieder zuschnurrten. Vielleicht auch Helga, aus dem Fenster ihres kleinen alten Hexenhauses gegenüber, das so übrig geblieben und verloren in dieser Straße stand wie meins.
Irgendjemand sieht dich immer, die merkwürdige Frau, die fahläugige Witwe, wie du da stehst, in der Hitze eines blendenden, klebrigen Nachmittags, im Grün deines Rasens, im Schatten deiner Bäume, in dieser Fäulnis. Hässliche Ziege. Auch sie wusste von diesem Ort, die Person, die mir die Nachrichten schickte.
Ich hatte gerade angefangen, mich mit Simon Brunner zu treffen, als die ersten Nachrichten kamen. Ich hatte mir nach Ludwigs Tod eine Sprödheit zugelegt, die Fremde vertreiben sollte. Es funktionierte meistens; nicht bei Simon. Dabei sprach eigentlich alles dagegen. Er erzählte mir später, dass er eine Professur in Wien angeboten bekommen hatte und geblieben war und eine Praxis eröffnet hatte. Ein Bekannter einer Bekannten hatte ihn mir empfohlen, den Kinderpsychologen aus der Schweiz, als es Benni nicht besserging, als er nicht aufhörte, herumzukauen am Verlust seines Vaters, als er immer stiller wurde und ich immer stärker den Verdacht hegte, er gäbe sich vielleicht die Schuld an Ludwigs Tod oder zumindest eine Mitschuld. Simon hatte Benni nur ein paar Monate lang betreut, eine Art Krisenintervention. Dann war Benni zu einem anderen Therapeuten gewechselt, so war das von Anfang an geplant gewesen, Simon empfahl Benni einen Kollegen bei uns in der Nähe, was Benni und mir die wöchentliche Fahrt in die Großstadt ersparte.
Die Sache zwischen Simon und mir begann mit einer zufälligen Begegnung, in dem Kaffeehaus, in dem ich gelegentlich nachmittags mit meinem MacBook in einer Nische saß und schrieb, wenn ich gerade in Wien war. Es wurde eine Unterhaltung daraus, ein Gespräch, er interessierte sich für mich und mein Leben, über das er wohl schon ein bisschen was wusste, von Benni, aber er blieb professionell und ließ mich nie merken, wie viel. Wir verabredeten uns für ein Abendessen, das wir aber stets aufs Neue verschoben, bis es dann endlich stattfand, in einem angesagten israelischen Restaurant, in das ich schon lange hatte gehen wollen. Er hatte sich um den Tisch gekümmert und saß schon da, als ich kam, stand auf, strahlte mich an, umarmte mich, als würden wir uns ewig kennen. Ich spürte sofort eine für mich eher unübliche Vertrautheit. Er konnte gut zuhören, ich fühlte mich wohl mit ihm. Wir bestellten Wein und viele Schüsselchen voller gut gewürzter Sachen, die wir uns teilten. Wir sprachen über schlechtes und gutes Licht in Restaurants, über seine biederbürgerliche Baseler Herkunft, über die er sich auf liebevolle Weise lustig machte, über Ottolenghi, warum man Blumenkohl hassen oder lieben musste, über unsere liebsten Serien, über Trauer. Er hatte ein Buch darüber geschrieben, wie man Kinder zu resilienten Persönlichkeiten erzog, manchmal wurde er deswegen im Radio oder im Fernsehen interviewt, darüber redeten wir auch und über meine eigene kleine Fernsehvergangenheit. Er stellte viele Fragen, er war gut darin, Fragen zu stellen, eine Berufskrankheit, wie er im Scherz sagte. Wir sprachen über das Recht, Trauer zu beenden oder zumindest vorübergehend zu unterbrechen oder zuzulassen, dass sie schwächer wurde, und darüber, was das für die Erinnerung bedeutete. Wir sprachen über gemeinsame Bekannte, über sein Auto (ein Geländewagen, er wisse schon, SUV, aber seine Familie habe in der Schweiz eine Hütte in den Bergen), mein Auto (ein alter Skoda Octavia), über politisch unkorrekte Witze, über Freud und Frankl.
Das Lokal war groß und lärmig, aber er hatte uns einen kleinen Tisch in einer Nische reservieren lassen, es war wie eine Miniversion einer Großstadt: Ich fühlte mich unsichtbar im Gewusel der Menge, in der Intimität des Trubels, der um uns herum eine Art Blase bildete. Simon war mir zugeneigt, die Ellbogen auf dem Tisch, die Ärmel seines blauen Hemdes aufgekrempelt, wie es Ludwigs karierte Ärmel immer gewesen waren, aber Simons Hemd war schmal über einer schmalen Brust, wie die Hemden des jungen Kanzlers und seiner Gefolgschaft, straff, kein Zentimeter Stoff zu viel. Zwischen den Knöpfen konnte ich Simons Unterhemd sehen, und ich erinnere mich, dass ich immer wieder hinschauen musste, dass ich mir, während Simon mit einer Kellnerin sprach, überlegte, ob das etwas zu bedeuten hatte, ob das bedeutete, dass er diesen Kanzler gewählt hatte, erinnerte mich dann aber, dass er ja Schweizer war.
Das Lokal leerte sich um uns, während unser Gespräch immer intensiver wurde. Der Wein hatte mich lockerer gemacht, und schließlich erzählte ich ihm von Ludwig, von seinem Unfall und wie mir bald nach dem Begräbnis klarwurde, dass er eine Geliebte gehabt hatte. Wie mich das aus der Spur warf, weil ich von diesem Moment an nicht mehr normal trauern konnte um ihn und weil ich es nicht mehr mit Ludwig ausdiskutieren und ihn nicht anschreien konnte. Simon sagte, er könne sich vorstellen, wie schwer es sei, einem Toten etwas zu verzeihen, mit dem keine Versöhnung mehr möglich war. Ja, genau. Er verstand es, auf eine gleichzeitig professionelle und liebevolle Art. Ich gestand ihm, dass ich Ludwig immer noch nicht richtig verziehen hatte, gerade so viel, dass es mich nicht mehr verrückt machte, aber ganz würde mein Zorn auf ihn nie verrauchen. Und das sei, sagte Simon, wahrscheinlich auf untrennbare Weise mit meiner Trauer verbunden. Um das Thema zu beenden, fragte ich ihn nach seiner Vergangenheit, nach seinen Lieben, und er sagte: Erzähl ich dir beim nächsten Mal. Erst da bemerkte ich, dass wir uns fast allein in einem plötzlich still gewordenen Lokal unterhielten, und spürte, dass das Personal uns allmählich loswerden wollte. Simon zahlte, er bestand darauf, ich wollte einen Witz darüber machen, wie viele Abendessen ich mit Bennis Therapiestunden schon gesponsert hätte, ließ es aber bleiben.
Ich trug einen karierten Vintage-Mantel von Vivienne Westwood, und ich hatte mir an diesem Tag die Haare geschnitten, selber, vor dem Spiegel, ein paar Stufen in meinen braven, mittelgescheitelten Pagenkopf. Ich hatte ein unkompliziertes Kleid ausgesucht und auf Lippenstift verzichtet. Lippenstift sah früher ohnehin besser aus, erst unlängst war mir aufgefallen, wie sich mein Mund verändert hatte, schmaler geworden war, gerade wie ein Strich. Ich hatte es auf einem alten Foto gesehen, einem offiziellen Pressefoto zu der Kunstsendung, die ich moderiert hatte, bevor sie eingestellt wurde: Was ich früher für schöne, volle Lippen hatte, prall und geschwungen, und dickes Haar. Mir war das damals nicht richtig klar gewesen, ich fand nichts Besonderes daran, und ich dachte mir, was für ein Jammer, jetzt erst bemerkst du das, jetzt, wo es für immer verloren ist. Ich sagte Sophie jedes Mal, wenn ich sie sah, wie schön sie war, um es ihr bewusst zu machen, und sie verdrehte immer nur die Augen.
Auf der Straße zog ich meinen Mantel zu, und Simon legte ganz kurz den Arm um mich und drückte mich an sich. Mir fiel auf, wie groß er war, viel größer als Ludwig.
»Wir gehen noch in eine Bar«, sagte er. Ich widersprach ihm nicht.
Die Bar hatte hohe Decken und war modern, die Musik und das Licht leise, kleine, warme Lichtinseln, in denen alle schön aussahen, und alle Kellner waren jung und attraktiv und trugen Man Buns.
Ich trank einen Cocktail mit einem Fichtenzweig, den mir einer von ihnen empfohlen hatte, Simon trank einen Gimlet. Wir saßen uns gegenüber, und dass der Abstand zwischen uns immer kleiner wurde, lag an der Musik und am Licht.
»Geht es dir gut?«, fragte Simon.
»Es geht mir sehr gut«, sagte ich.
»Das ist ein schöner Ort.«
»Ja, das stimmt.«
Wir blieben nicht lange, ich musste früh raus am nächsten Tag, Simon auch, und diesmal übernahm ich die Rechnung. Als wir auf der Straße standen, zündete er meine und seine Zigarette an, hielt konzentriert die Hand vor, und wir gingen eine stille, wenig beleuchtete Gasse entlang zu einem Taxi. Wir redeten jetzt nicht mehr. Er nahm meine Hand, er sagte, er würde mich nach Hause bringen, meine Wohnung läge auf seinem Weg, ich wusste, dass das nicht stimmte, und es war mir egal. Er hielt mir die Tür eines Taxis auf und drückte sie hinter mir zu. Das Taxi fuhr los, wir redeten jetzt wieder, flüsterten im Rücken des Taxifahrers, und das Flüstern zog uns zueinander, ineinander, das Küssen kam ganz von selber. Er schmeckte gut, trotz der Zigarette, und das Küssen fühlte sich richtig an, absichtslos. Ich erinnere mich, dass ich dachte, das sei ein perfekter Kuss, genau dieser Gedanke hatte neben dem Kuss noch Platz in meinem Kopf. Ich dachte nicht an Ludwig, ich dachte nicht mal an Simon, ich dachte an gar nichts. Wahrscheinlich hatten auch der Wein und der Fichtenzweig-Cocktail etwas damit zu tun, aber ich war voll von diesem Küssen. Es hing kein Sex an diesem Kuss, noch nicht, aber es fühlte sich möglich an, vorstellbar.
Wir küssten uns bis zu meinem Haus, ohne Pause. Nein, einmal unterbrach ich den Kuss, um ihm etwas zu sagen, das ich wichtig fand, ich sagte, dass meine Trauer, auch wenn sie zwischendurch intensiver war, als mir guttat, mich dennoch nicht verunsichere, weil ich meine Trauer genau kannte, weil ich sie kontrollieren konnte. Ich wollte nicht, dass er mich für verdreht hielt. Offenbar hatte sich dieser Gedanke also doch noch irgendwo formieren können, irgendwo in meinem Kopf. Er schaute mir in die Augen, während ich sprach, ernst und aufmerksam, und sagte dann: Ja, verstanden. Er hörte wirklich gut zu. Wir küssten uns weiter, bis das Taxi an meiner Adresse hielt. Ich stieg aus und er stieg aus und hielt mir die Tür auf, und ich sagte, gute Nacht, und küsste ihn nochmal zum Abschied, kurz und fest, mit Blickkontakt. Er blieb in der geöffneten Taxitür stehen, bis ich meine Haustür hinter mir zugeschoben hatte, rief mir ein Ade nach, betont auf dem A mit einem ganz kurzen E, ich winkte ihm durch die bunten Scheiben zu, er lächelte, während er wieder in das Taxi stieg. Ich sah nicht mehr, wie das Taxi davonfuhr, und ich weiß noch, dass ich dachte, das war ein Anfang, während ich die Treppen hochging, das war ein Anfang, dieser Abend hatte in Küssen geendet, der nächste würde anders enden.
Und so war es auch. Er rief mich am nächsten Tag an, wir sahen uns am übernächsten, und wir verbrachten in seiner Wohnung eine Nacht, die eine logische Fortsetzung des Kusses war.
Er erzählte mir von seiner Exfrau, die er beim letzten Mal nur angedeutet hatte, von der schwierigen Trennung nach zwölf Jahren Ehe, und wie sie ihm nie verzeihen konnte, nie verzeihen würde, dass er keine Kinder haben wollte, und als er sich von ihr trennte, wegen einer anderen, jüngeren Frau, die ein kleines Kind hatte, war es für seine erste Frau zu spät für eigene Kinder. Er sagte, wie leid ihm das alles tue, vor allem, weil die neue Beziehung nicht lange gehalten habe und seine Exfrau eine fabelhafte Person sei und er manchmal nicht nur sie vermisse, sondern auch die Kinder, die er mit ihr hätte haben können. Ich lag in seinem Arm, während er das erzählte. Danach schlief er ein.
Im Morgengrauen sah ich aus dem Fenster seiner Altbauwohnung in den rosafarbenen Himmel, während er neben mir lag, und nichts an ihm wirkte fremd, und ich dachte: Ja, so fängt etwas Neues an.
Der Kuss war schon vertraut, als wir uns am nächsten Tag verabschiedeten und ich mit dem Zug zurück in meine Kleinstadt fuhr, in mein Haus an ihren Rändern. Die ganze Strecke über schrieb er mir SMS, in denen er mich fragte, wie es mir gehe, was ich noch vorhabe und was er für einen Teppich kaufen sollte, für sein Schlafzimmer. Da lag eine Ahnung von Gemeinsamkeit darin, von einer Komplizenschaft des Alltags, und es gefiel mir. Es gefiel mir sehr. Er schrieb auch von einem Wochenende in drei Wochen, das er in London verbringen müsse, ob ich ihn nicht begleiten wolle. Ich schrieb, ich würde darüber nachdenken, er schrieb: Famos!