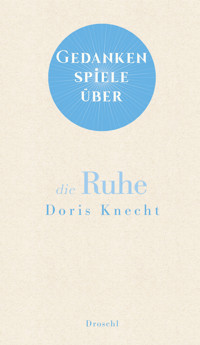9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei, die nichts miteinander zu tun haben, auf einer Reise mit unbekanntem Ziel: Eine Frau und ein Mann, die sich kaum kennen und nicht besonders mögen, zwei Verschiedene, die ganz woanders und ganz unterschiedlich leben. Dieser Mann und diese Frau müssen sich gemeinsam auf die Suche machen, nach dem einzigen, was sie im Leben gemeinsam haben: eine Tochter. Schon erwachsen, aber mit psychischen Probleme. Und plötzlich verschwunden. Heidi verlässt ihr Kleinbürgerparadies bei Frankfurt, Georg seinen österreichischen Landgasthof, wo sie mit ihren neuen Familien leben. Im Flugzeug, auf Booten und auf Mopeds reisen sie durch Vietnam und Kambodscha den Hinweisen auf ihre Tochter hinterher. Die Hindernisse, die sich ihnen in den Weg stellen, stecken auch in ihnen selbst, in ihrer Vergangenheit, in der Unfähigkeit, sich der Gegenwart zu stellen. Doris Knecht erzählt von Entscheidungen, deren Gewicht nie geringer wird, vom Festhalten und Loslassen, vom Erwachsenwerden und davon, wie man über sich selbst hinauswächst; ein bisschen wenigstens. Ein spannender Roman im kraftvollen Knecht-Sound, der zwei fast fremde Menschen auf eine gemeinsame Mission schickt, mit unsicherem Ausgang.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Doris Knecht
weg
Roman
Über dieses Buch
Zwei, die nichts miteinander zu tun haben, auf einer Reise mit unbekanntem Ziel: eine Frau und ein Mann, die sich kaum kennen und nicht besonders mögen, zwei Verschiedene, die ganz woanders und ganz unterschiedlich leben. Dieser Mann und diese Frau werden gezwungen, sich gemeinsam auf die Suche zu machen, nach dem Einzigen, was sie im Leben gemeinsam haben: eine Tochter. Lotte ist schon erwachsen, aber sie hat psychische Probleme. Und sie ist plötzlich verschwunden.
Heidi verlässt ihr Kleinbürgerparadies bei Frankfurt, Georg seinen österreichischen Landgasthof, wo sie mit ihren neuen Familien leben. Im Flugzeug, auf Booten und auf Mopeds reisen sie durch Vietnam und Kambodscha den Hinweisen auf ihre Tochter hinterher. Die Hindernisse, die sich ihnen in den Weg stellen, stecken auch in ihnen selbst, in ihrer Fremdheit, in ihrer Vergangenheit, in der Unfähigkeit, sich der Gegenwart zu stellen.
Es ist eine Geschichte übers Erwachsensein, ob man es will oder nicht. Und darüber, was es heißt, ein Vater zu sein, eine Mutter, verantwortlich zu sein für ein Kind, für immer.
Doris Knecht erzählt von Entscheidungen, deren Gewicht nie geringer wird, vom Festhalten und Loslassen, von Freiheit und Zwängen, vom Erwachsenwerden und davon, wie man über sich selbst hinauswächst; ein bisschen wenigstens. Ein spannender, kraftvoller Roman im rasanten Knecht-Sound, der zwei fast fremde Menschen auf eine gemeinsame Mission schickt, mit unsicherem Ausgang.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, März 2019
Copyright © 2019 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Umschlaggestaltung Frank Ortmann, Berlin
Umschlagabbildung Universal Images Group via Getty Images
ISBN 978-3-644-10060-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Wie man auf einem Moped fahren kann: allein. Zu zweit. Zwei Männer. Zwei Frauen. Ein Mann und eine Frau, der Mann vorne, die Frau hinten; die Frau vorne, der Mann hinten. Ein Mann, eine Frau, dazwischen ein Säugling auf dem Arm der Frau. Ein Mann, eine Frau, zwischen ihnen ein kleines Kind sitzend oder stehend, das Kind hält sich an den Schultern des Mannes fest, die Frau hält das Kind an den Hüften. Ein Kleinkind vorne, zwischen den Beinen des lenkenden Mannes, ein kleines Polster am Lenker schützt das Kind, hinter dem Mann eine Frau. Ein Kind vorne, zwischen den Beinen des Mannes stehend, dann eine Frau mit einem Säugling im Arm, wach oder schlafend. Ein Kleinkind vorne zwischen den Beinen des Mannes stehend, ein Kind dahinter, dahinter eine Frau, vielleicht mit einem Säugling im Arm. Ein Mann, dahinter ein Teenager, der während der Fahrt sein Smartphone studiert. Eine Frau, dahinter zwei Kinder, vorne hat die Frau einen Säugling an die Brust gebunden, den sie stillt, während sie fährt. Zu viert, zwei Männer, eine Frau, ein Mann, der raucht. Zu dritt. Zu zweit. Allein. Wie man auf einem Moped fährt: Kommt darauf an, wo man geboren wurde, wie man lebt und wer man ist.
Heidi hat angerufen. Lotte ist irgendwie verschwunden. Georg war grad draußen, hinter dem Gasthaus, kurz eine rauchen, mal schnell raus aus der Küche, hinten durch die Tür, wo es zum Hühnerstall geht. Er rauchte und sah den Hühnern zu, die in der kargen, winterlichen Wiese herumpickten. Da hat sie angerufen. Das war komisch, ihren Namen auf dem Handy zu sehen, weil sie sonst eigentlich kaum mehr miteinander zu tun haben. Also, seit Lotte allein lebt. Heidi hat versucht, cool zu tun, aber sie ist offensichtlich besorgt, Georg hat das sofort herausgehört. Als es klingelte, zog er erst noch mal hastig an seiner Zigarette, bevor er den Anruf annahm: Er erinnerte sich sofort wieder an diese früheren, stressigen Heiditelefonate, er hatte sie sofort wieder präsent, diese Heidi, mit der er so viele Jahre zu tun hatte, es triggert in ihm schlagartig die alte Reiz-Reaktions-Kette, und er nimmt sofort eine innere Verteidigungshaltung ein. So war das immer: Sie will was, er muss etwas tun, etwas bezahlen, etwas unternehmen, wegen irgendwas auf Lotte einwirken, muss dringend etwas regeln. Georg muss sich um Lotte kümmern, sich gefälligst auch mal um seine Tochter kümmern. Auch jetzt praktizierte Georg, was er sich über die Jahre angeeignet hat: Durchatmen, durchatmen, durchatmen, ruhig bleiben, nicht aufregen, um Heidi dann ganz freundlich und gelassen zur Kenntnis bringen zu können, dass es Lotte ja gut geht, dass Lotte so gut wie erwachsen ist, dass man – Heidi – sich jetzt nicht mehr so umfassend um Lotte zu kümmern braucht. Was meistens nichts half. Aber wenn Georg zurückkeifte, fühlte er sich danach noch schlechter, also ließ er sie jammern, ihm ein schlechtes Gewissen machen, ließ sie Martin als Idealvater vorführen, als viel besseren, viel authentischeren Vater als ihn; authentisch: Das Wort verwendet sie ständig, mit fetten, knallenden Piefke-Ts darin, Deutsche, immer. Durchatmen, atmen, atmen. So liefen Gespräche mit Heidi normalerweise.
Diesmal nicht, kein Gequengel, kein Appell an sein Gewissen, nur Besorgtheit. Und die Frage: Kann er’s vielleicht auch mal bei Lotte probieren?, vielleicht antwortet sie ja bei ihm. Ja, wird er versuchen, es wird schon nichts sein, mach dir keine Sorgen, sie ist einfach ein junger Mensch in Berlin und treibt bestimmt bloß ein bisschen harmlosen Rambazamba.
Hinterm Hühnerzaun stellen zwei der Hähne sich gegeneinander auf, mit aufgeplusterten Hälsen, die Kämme steil nach vorn. Er drückt die Zigarette aus und verabschiedet sich: Ja, okay. Vielleicht. Ich meld mich, wenn ich was höre. Ich auch. Mach dir keine Sorgen. Okay, bis dann.
Er kann seinen Atem sehen, die Luft ist kalt, aus dem Bach steigt der Nebel auf und wirft einen Schleier über den Mischwald, der dahinter den Hang hochsteigt. Georg geht wieder hinein, legt sein Smartphone auf das Edelstahlregal. Rund um ihn herum dampft und zischt es, bald kommen die ersten Mittagesser in den Hirschen. Amelie und Steve hacken Gemüse und bereiten das Menü vor.
Heidis Anruf beschäftigt ihn: Offenbar geht Lotte nicht ans Telefon und antwortet auf keine Nachrichten. Seit Tagen schon. Sie macht sich Sorgen, nach allem, was war. Er macht sich auch Sorgen. So ein Scheiß. Er macht sich auch Sorgen.
Dabei sah es gerade seit einiger Zeit so aus, als sei alles gut, als braucht Lotte jetzt keine Kümmerer mehr, sie ist dreiundzwanzig, sie kriegt ihre Dinge selber geregelt. Ja, es war hart in den Jahren davor, für jeden, für sie selbst, für alle um sie herum. Es gab schwere Tage, schwierige Wochen, viel Sorge, blanke Angst. Die wilde Tochter, die nicht nur aufmüpfig, sondern ernsthaft krank ist. Das Kind, das man liebt, das einen so zornig gemacht hat, und dann erfährt man: Die konnte gar nichts dafür, für den Pallawatsch in all den Jahren. Das war nicht nur eine Extrempubertät, das war nicht nur normale juvenile Rebellion. Schwer zu begreifen, für sie, für alle: Was war da wirklich los? Was ist da passiert? Wieso hat das bisschen Kiffen bei Lotte etwas ausgelöst, das es bei so gut wie keinem anderen auslöst? Jetzt hört man immer öfter von drogeninduzierten Psychosen, von Veranlagungen, von vielleicht schlummernder genetischer Disposition, jetzt wird man davor gewarnt, als Vater, als Mutter, als Jugendliche, im Schulunterricht, das ist jetzt ein Ding, eine Tatsache, das gilt nun als reale Gefahr. Aber vor ein paar Jahren, als es bei seiner Tochter losging, war das noch nicht im Mainstream angekommen. Es war, wenn auch vielleicht keine Schande, so doch ein Schwächeln, ein Makel, etwas, wofür man sich ein bisschen schämte. Weniger auf Georgs Seite, aber bei Heidi spürte er das stark, zumindest am Anfang: dass sie sich schämte für die Krankheit im Kopf, das Familienerbe, das sich genau dieses Kind ausgesucht hatte und Lotte weh tat.
Es war schwer. Die Zeiten, in denen sein Telefon läutete, mitten in der Nacht, und er seine Tochter dran hatte, dreizehn-, vierzehn-, fünfzehnjährig, besorgniserregend depressiv oder völlig überdreht, zu euphorisch oder voller Hass und mit unerfüllbaren Wünschen: Hol mich hier raus!, hier versteht mich NIEMAND!, ich bin immer nur die Böse! Ich will zu dir!, weinend, brüllend, flüsternd, schluchzend: Ich will bei euch leben, bei dir und Lea, ich halte diese Arschmutter nicht mehr aus, dieses Kleinbürgerleben, dieses Haus, diese Biederkeit, zum Kotzen!, niemand vertraut mir hier, lasst mich zu euch, bitte, Papa, bitte, bitte, hol mich hier raus. – Sie wühlen in meinen Sachen, sie kontrollieren mich. Danach immer lange Telefonate mit Heidi, was ist da los, was habt ihr für Probleme, was unternehmen wir.
Zweimal stand Lotte tatsächlich vor der Tür beziehungsweise am Bahnhof, das erste Mal in St. Pölten, das zweite Mal in Wien. Beide Male blieb sie ein paar Tage, in denen er und Lea sie beruhigen konnten. Lea hat einen Draht zu ihr, vielleicht, weil sie selber oft genug an ihre Grenzen gegangen ist und manchmal darüber. Sie konnte sie überreden, zurück zu ihrer Mutter zu fahren, wieder in ihre Schule zu gehen, diese Landschule hier, du willst hierher nicht wechseln, ich schwör’s dir. Da ahnten sie noch nicht, was es wirklich war. Später, nach der Diagnose, machte Lea sich Vorwürfe: Warum hab ich das nicht bemerkt, warum hab ich nicht genauer hingesehen? Das erste Mal fuhr Georg Lotte selber mit dem Auto nach Rebenborn und gab sie bei Heidi ab, die sich überraschend gut hielt.
Als Lotte sechzehn war, dann diese Nacht, der völlige Zusammenbruch, die totale Katastrophe, Einweisung, wochenlang Psychiatrie, schließlich der Befund: substanzinduzierte Psychose. Ausgelöst und angezündet vom Kiffen, bei den meisten Kids ein harmloses Hobby. Aber für Lotte wurde es lebensgefährlich. Etwas, das in ihr geschlummert hatte, war vom Marihuana aktiviert worden, war nun nicht mehr zu heilen, nur zu behandeln, mit Therapie und heftiger Medikation. Sie brauchte einen kompletten Neustart. Und sie braucht weiterhin Medikamente.
Es dauerte, dann sie ist wieder auf die Beine gekommen, mit viel Hilfe, Therapie und einigen Rückschlägen. Es gab Zusammenbrüche und Tränen und Widerstand und mühsame Gespräche. Aber jetzt ist sie stabil. Jetzt hat sie sich, ihre Probleme und die Krankheit im Griff, hält sich gut, hält sich an dem Geländer fest, das ihr gebaut wurde, von Ärztinnen, Therapeuten, Mutter, Vater, Stiefvater, Heidis Schwester und ihrem Freundeskreis, nimmt ihre Medikamente, passt auf sich auf, sieht die Zeichen, nimmt sie ernst, lässt sich helfen. Sie stürzt nicht mehr, keine größere Stolpergefahr, schon lange. Sie ist nicht glücklich über die Medikamente, die sie täglich nehmen muss: In der ersten Zeit nahm sie davon zu; so lange, bis sie anfing, Sport zu machen. Und jeden Morgen, wenn sie ihre Pille schluckt, wird sie daran erinnert, dass sie nicht gesund ist. Aber es geht Lotte jetzt doch gut, weil sie nun ja weiß und akzeptiert, was gesund für sie ist und was nicht. Sie geht regelmäßig ins Fitnessstudio und macht Yoga, das hat sie Georg jedenfalls irgendwann erzählt. Es ist doch alles soweit in Ordnung. Jedenfalls so einigermaßen. Jedenfalls, soweit Georg informiert ist. Jedenfalls bis eben.
Bis eben, und jetzt spürt Georg, wie die ganze fragile Alles-ist-gut-Architektur Risse bekommt. Wie sich ein Unbehagen in ihn schleicht.
Ja, er hat auch schon länger nichts von Lotte gehört, aber das ist eigentlich normal. Sie ruft jetzt nicht mehr mitten in der Nacht an, schon lange nicht mehr. Sie skypen zu vernünftigen Tageszeiten, und sie kommunizieren regelmäßig per Whatsapp, alle paar Tage. Na ja, Wochen manchmal, es ist immer so viel los im Hirschen, bis spät, dann Lea und die Kinder … Und Lotte ist ja selber immer so beschäftigt mit ihrem Studium, die hat Spaß in der großen Stadt, ist viel unterwegs, scheint es, nach dem, was sie so erzählt. Sie antwortet jedenfalls oft länger nicht, das ist normal. Es ist alles okay zwischen ihnen, alles im grünen Bereich. Ja, er ist der entfernte Vater, ja, er ist der immer ein bisschen fremde Vater, der ihr Heranwachsen nur aus der Ferne begleiten konnte, aber sie haben trotzdem eine liebevolle Beziehung zueinander, trotz der Distanz von Beginn an. Er hat sich bemüht, es war ihm wichtig, das in Deutschland aufwachsende Kind nicht zu kurz kommen zu lassen, immer seine Liebe zu zeigen. Er hat sich mal gefragt, ob die Dinge für Lotte anders gelaufen wären, wenn er ein anwesender Vater gewesen, wenn sie eine glückliche Vater-Mutter-Kind-Familie geworden wären, aber er hat es sich verboten und damit aufgehört. Bringt ja nichts. War nun mal nicht so, und er hat getan, was er konnte, im Rahmen der Möglichkeiten sein Bestes gegeben. Naturgemäß hat sie zu Martin ein engeres Verhältnis, schließlich hat sie die längste Zeit ihres Lebens mit ihm in einem Haus zusammengelebt, er hat sie aufwachsen sehen, er war ihr Papa, seit sie ein kleines Kind war. Georg der Vater, Martin der Papa. Martin war für Lotte zugegebenermaßen das, was einem Vater am nächsten kam, ein netter Kümmerer, ein lieber Umarmer, der halt da war, der tat und war, was und wie Heidi es wollte.
Georg ist der Meinung, dass er wenig dafür kann, dass es gekommen ist, wie es kam. Es war Heidi gewesen, die Georg und Wien verlassen hatte, als Lotte erst ein paar Monate alt war, sie hatte weggewollt, unbedingt. Sie wollte heim. Sie wollte zurück zu ihrer Mutter, zu ihren Freundinnen, zu ihrer Schwester und zu ihrem Zwillingsbruder, vielleicht, weil sie spürte, dass sie ihn nicht mehr lange haben würde, diesen Bruder. Denn es steckte vermutlich auch in Heidi. Vielleicht konnte sie es nur zähmen, wenn sie sich in äußerster Sicherheit fühlte, eingemauert in der Vertrautheit ihrer kleinen Welt, in ihrer eigenen Übersichtlichkeit. Vielleicht hatte sie Angst, die Stadt würde etwas aus ihr herausschälen, das sie nicht kontrollieren würde können.
Diese Frau, die Georg vielleicht lieben hätte können, war mit seinem Kind, das er liebte, in den Zug gestiegen und davongefahren, er hatte nächtelang geheult und fast jeden Tag angerufen, jedenfalls am Anfang. Er hatte sich ein gebrauchtes Auto gekauft und war sehr oft hingefahren, um seine Tochter in den Arm zu nehmen, sie spazieren zu fahren, mit ihr in den Zoo zu gehen, ihr Geschichten vorzulesen, sie in den Schlaf zu streicheln, was Ferienväter halt so machen, was ihnen halt so übrig bleibt. Heidi hatte ihn in diese Ferienvater-Rolle gedrängt. Das war nicht seine Idee gewesen, er hatte darunter gelitten. Und er hat doch auch tatsächlich und immer wieder überlegt, zu ihr in diese deutsche Kleinstadt zu ziehen, aus der sie stammt, in diesen Vorort, obwohl schon die Vorstellung ein kompletter Horror war. Aber sie wollte das auch nicht so richtig, gar nicht wollte sie es.
Georg hatte sich nicht gewünscht, dass sein Kind ohne ihn aufwächst, aber so war es nun. Er passte nicht in Heidis Herkunft, so viel war klar, und jedes Mal, wenn er kam, um Lotte zu sehen, wurde es wieder klar: Da passte er nicht rein, nicht mal in der Theorie, in dieses System, das Heidi umhüllte wie warmes Badewasser. Er war dort nur fremd, falsch, unpassend, ein Eckiger in etwas Rundem, ein Harter in etwas Weichem, ein merkwürdiger Exot, wie ein streunender Hund, der Heidi zugelaufen war und der nun im schönen, ordentlichen Eigenheim nur störte. Sie hatten von Anfang an nicht zusammengepasst, Heidi und Georg, sie waren nur so unendlich scharf aufeinander gewesen. Das wäre nichts geworden mit der Liebe, er ist sich schon lange sicher. Wäre das Kind nicht gewesen, würde er sich wohl kaum mehr an die Affäre mit ihr erinnern, ein paar geile Nächte, ein paar schöne Tage, länger hätte das nicht gedauert, das war nicht für die Ewigkeit bestimmt, da hätte alles Wollen nicht gereicht. Aber Lotte hatte sie zu lebenslänglich verurteilt, und da waren sie nun, zwei ganz Verschiedene, mit einem gemeinsamen Kind, für immer aneinandergeschraubt.
Georg ist ein entspannter, gutmütiger Mann, aber er ist ziemlich sauer geworden, als Heidi ihm einmal unterstellt hat, er sei gar kein Vater, er sei nur so ein Onkelvater. Das ist er nicht, er ist nur weit weg leider. Nicht seine Schuld. Er hätte es auch gern anders. Es ist aber so, wie es ist, eine Bilanz aus sehr vielen Faktoren, von denen die meisten auf Heidis Seite zu verbuchen sind, wirklich, und er meint das nicht böse. Dass er und Lotte sich nicht so oft sprechen, ist keine große Überraschung, aber auch nicht das, was er will. Früher war sie in den Ferien immer ein paar Wochen bei ihm, jetzt interessiert sie das halt auch nicht mehr so. Er zeigt Interesse, er ist aufmerksam. Sie weiß, dass er sie liebt, er lässt es sie spüren und wissen. Er erkundigt sich nach ihrem Studium, dem Leben in Berlin, ihren Freunden, wie es ihr so geht, und sie antwortet. Meistens. Und immer eher allgemein. Wann hat er ihr zuletzt geschrieben? Schon länger her, ja. Aber ist doch jetzt alles gut, schon lange, oder. War doch alles im grünen Bereich, alles unter Kontrolle. Oder? Jetzt offenbar nicht mehr.
Georg versucht, den Gedanken an Lotte wegzuschieben, die Sorgen mal kurz etwas abseits zu parken. Er muss sich jetzt um das Mittagessen fürs Restaurant kümmern. Er steht am großen Gasherd, er schwenkt eine Pfanne mit schäumender Butter. Sie sind zu dritt in der Küche, er und Steve und Amelie, sein Lehrling. In der Früh hat er im Wald Bärlauch gepflückt, es gibt da so eine Stelle weit hinten, wo der Bach in den Fluss mündet, da wächst der Bärlauch jedes Frühjahr wie Unkraut, ein richtiges Feld, den ganzen Abhang hoch. Die Blätter sind noch ganz klein, gerade eben gesprossen. Einen ganzen Korb hat er gesammelt, frisch, saftig, duftig, superscharf, im Supermarkt in der Stadt verkaufen sie dir das für fünfundzwanzig Euro das Kilo, am Naschmarkt für fünfunddreißig, und es schmeckt dann praktisch nach nichts mehr, kein Waldboden mehr, kein Morgentau. Der hier schon. Mag nicht jeder, aber er liebt diesen Duft. So riecht ein guter Morgen. So gesehen war es ein guter Tag, bis jetzt. Blödes Telefon. Hinter ihm schneidet Amelie unter einer grellen Neonröhre Karotten zu Julienne: Sie macht eine Kochausbildung im Hirschen, seit ein paar Monaten. Sie ist gut. Sie lernt schnell. Georg wirft einen Blick auf die winzigen Streifen, die sie gerade von ihrem Brett in eine große Metallbox streicht, wobei sie das Messer ganz automatisch umgedreht hat, der Messerrücken schabt die Karotten vom Brett, wie es sich gehört, aber manche Lehrlinge schnallen das nie. Oder erst, wenn man sie ein paarmal deswegen zur Schnecke gemacht hat, wobei das nicht Georgs Stil ist. Amelie musste er es nur einmal sagen, und sie konnte es. Gut. Sie hat kurze schwarze Haare, ein Nasenpiercing, wie Lotte früher, und ein paar Tätowierungen, aber im Unterschied zu Lotte damals ist sie ein rundum gesundes, rotbackiges Landkind. Sie hat geschickte Hände und ein Gefühl für Gewürze, sie kümmert sich mit Hingabe um das Kräuterbeet hinter dem Haus, seit Georg es letztes Jahr gemeinsam mit ihr neu bepflanzt hat. Lea ist ja nicht so ein Gartenmensch, sie wühlt nicht gern in der Erde, Dreck unter den Nägeln, das ist nicht ihrs, da bleibt sie der Stadtmensch, der sie früher war. Aber Amelie geht selbst in ihrer Freizeit mit Georg in die Wiesen und in den Wald, um wilde Kräuter zu suchen. Lotte konnte er dazu nie überreden, dabei hätte ihr das so gutgetan: der Wald, die Luft, die Bewegung.
Georg nickt Amelie zu, ein ermunterndes Lächeln, während er an Lotte denkt. Lotte ist eine tolle Frau geworden, ein kluger, lustiger Mensch, er ist sehr stolz auf sie. Er wirft zwei Handvoll von dem Bärlauch in die Butter, ein wunderbarer Duft steigt auf, warm, erdig, melancholisch. Was, wenn jetzt doch was mit Lotte ist? Er hat wirklich schon lange nichts mehr von ihr gehört. Er schabt den Bärlauch aus der Pfanne auf drei Teller mit frischen, dampfenden, knallgelben Eiertagliatelle, lässt mit der Reibe ein bisschen harten Schafkäse drüberregnen, pfeffert mit der Mühle und legt an jeden Tellerrand ein essbares lila Stiefmütterchen. Geile Farben, simpel und perfekt. Die Leute mögen das. Er auch, es riecht so gut, er würde es gern selber essen; später dann.
«Tisch sieben!» Georg stellt die Teller auf das große Tablett in der Durchreiche. Im Augenwinkel sieht er, wie mehrere Gäste ihre Köpfe drehen und gierig auf das Tablett schauen. Die Bärlauchnudeln duften ihm noch ein letztes Mal entgegen, als Ella das Tablett packt. Georg liebt dieses Gericht, alles daran stimmt: die Wucht des Bärlauchs, der Biss der frischen Eiernudeln, die er am Vormittag mit Steve durch die Maschine gedreht hat. Das Mehl und die dunkelgelben Dotter von den Eiern seiner Sulmtaler: alles bio, alles saisonal und aus der Region, alles Handarbeit. Man begreift dieses Gericht unmittelbar. Er mag diese einfachen Bauernessen. Knödel mit Ei und frischen Kräutern: die alten Semmeln zu flaumigen Knödeln verarbeitet, die Knödel vom Vortag in Butter angebraten, die Kräuter aus dem Garten, die Eier von den Hühnern der Bauern aus dem Ort und den eigenen Sulmtalern, deren Freilaufgehege an den Gastgarten angrenzt, was die Gäste aus der Stadt lieben. Sie wollen immer die Tische am Rand, wo man die Hühner und ihr Gewusel, Gepicke und das Geplustere der Hähne beobachten kann, während man auf das Essen wartet. Und wie diese Knödel dann im Mund zergehen … Auch die Bärlauchnudeln scheinen jedenfalls zu munden: Aus dem Gastraum hört er zufriedene Ahs und Gemurmel: Ja, das kommt direkt bei den Leuten an, und das ist nicht immer so.
Er wird nachher Lotte anrufen.
Die Tage davor hat es geregnet. Die Luft in der Früh ist noch winterlich kalt, noch nicht richtig frühlingshaft, trotzdem. Georg hatte sich schon am Abend davor auf den Marsch durch den Wald gefreut. Er hatte am Tisch gesessen, im warmen Licht der Küchenlampe, die Zeitung vor sich, die er immer erst abends las, nach zehn, wenn er die Gasthaus-Küche dem jeweiligen Putzverantwortlichen und die Gaststube Ella oder einer anderen Kellnerin und Hermann überließ und nach oben in die Wohnung ging.
«Morgen schau ich, ob der Bärlauch schon wächst.»
Lea hatte von ihrem Laptop aufgesehen. Sie trägt jetzt eine Brille mit braunem Rand, wenn sie liest.
«Ja?» Es klang ein wenig gelangweilt. Und genervt.
«Ja.»
«Ist es nicht noch zu früh für Bärlauch?»
«Ich werd mal nachsehen.»
«Okay. Gut.»
Lea heftete den Blick wieder auf den Laptop mit der Exceltabelle. Sie kann so was. Er nicht.
«Wieso bist du so genervt?»
«Hast es eh gesehen», sagte Lea. «Der Hermann wieder.»
Ja, er hat es gesehen: Der Hermann hat wieder mit der Thaler Uschi rumgeschmust. Es riecht nach Ärger.
«Ja. Er ist halt so.»
«Ich mag den Hermann, du weißt das. Aber das mit der Uschi ist deppert. Das ganze Dorf redet schon darüber. Es ist ein reines Wunder, dass es der Thaler noch nicht erfahren hat.»
«Ja.»
Lea nimmt die Lesebrille ab und schaut ihn an, ernst.
«Du musst mit ihm reden. Wenn der Thaler da draufkommt, haut er den Hermann zu Mus.»
«Ich weiß. Aber du weißt, dass es keinen Sinn hat, mit dem Hermann zu reden. Der ist halt so. Der und die Frauen …»
«Ja, das weiß ich. Die anderen Frauen sind mir ja auch wurscht. Aber er soll die Finger von den Weibern aus dem Ort lassen. Vor allem von den verheirateten. Vor allem von der vom Thaler. Das ist ein brutaler Schläger. Der ist gnadenlos. Du müsstest das am besten wissen.»
Ja, weiß er. Der Thaler hat ihm einmal die Nase gebrochen, da war Georg vierzehn und der Thaler so siebzehn. Georg hatte es gewagt, sich auf die vor dem Gasthaus abgestellte Zündapp vom Thaler zu setzen, er hatte nur seinen Haxen darübergeschwungen, sich draufgesetzt und die Griffe festgehalten, sonst nichts. Aber mehr hat der Thaler nie gebraucht. Und er ist seither nicht entspannter geworden.
«Ich bin nicht Hermanns Mutter.»
«Aber du bist sein bester Freund. Und er wohnt hier.»
Der Hermann ist ein alter Freund aus Wiener Zeiten, er kam aus Niederbayern, besuchte irgendwen in Georgs Wohngemeinschaft und blieb dann einfach da. Das macht er offenbar immer so, denn irgendwann blieb er auch hier am Land einfach da, nach ein, zwei Wochenenden, an denen er Georg im Wirtshaus besucht hatte. Das war im zweiten Sommer, nachdem Georg und die mit Maya schwangere Lea von Wien nach Flur am Kamp gezogen waren, um das Gasthaus von Georgs Eltern weiterzuführen. Hermann kam zu Besuch, mal schauen, wie Georg jetzt so lebt, und wie sein Kind so ausschaut, und wie es da ist, auf dem Land, und dann noch einmal, und kurz darauf beschloss er, seine Wohnung in Wien aufzugeben und zwei der eh viel zu vielen Gästezimmer bei Lea und Georg konstant zu mieten. In einem wohnt er, im anderen malt er; ob er in Wien oder auf dem Land malt, ist eh egal, und hier ist es billiger, auf Dauer deutlich spürbar billiger. Und Hermann lebt nicht gern allein.
Lea hatte nichts dagegen, ein bisschen fixe Kohle jeden Monat, noch dazu ist Hermann gut mit den Händen. Er reist im Winter in der Welt herum und hilft im Sommer im Gasthaus mit, repariert Sachen im Haus und baut in der alten Werkstatt des Vaters Regale, Bänke, Rankgerüste und anderes Zeug nach Plänen, die er im Internet findet. So was wie das Sechs-Tage-Boot aus Sperrholz, an dem er im Schuppen jetzt schon drei Jahre herumbastelt. Die Gäste fragen immer danach. Manchmal säuft er zu viel und wird dann cholerisch, aber zum Glück nicht oft. Meistens ist er lustig und herzlich. Lea wollte ihn hin und wieder schon auch mal rausschmeißen, aber wenn er nicht zu viel trinkt, ist er ein irrsinniger Charmeur und letztlich zu praktisch und hilfsbereit, als dass sie auf ihn verzichten wollte. Er bringt eine gute Stimmung in das Restaurant, er spricht konsequent dieses breite, teigige Bayerisch und plaudert ungeniert mit den Gästen, ohne sich anzubiedern oder so zu tun, als wär er einer von ihnen.
Die Leute mögen ihn. Er hat so etwas Warmes an sich, Lea weiß nicht genau, was es ist, aber es wirkt auf die Leute. Vor allem auf die Frauen, dabei sieht er nicht mal gut aus, mit seinen schon etwas schütteren grauen Haaren, die ihm in den Nacken hängen und immer geschnitten gehören, mit seinen ausgewaschenen karierten Hemden über seinem imposanten Bauch. Ist den Frauen egal, sie sehen nur sein herzvolles Lächeln, werden eingelullt von seiner sonoren Stimme und dem bayerischen Dialekt. Er hat Humor und ist seinem Gegenüber immer zu hundert Prozent zugewandt: Sie fühlen sich von ihm wahrgenommen, verstanden, was auch immer. Auf Lea wirkt es nicht, aber auf die Thaler Uschi offenbar ziemlich stark.
Um die muss man sich auch Sorgen machen. Wenn das der Thaler herausfindet. So ein Scheiß.
Georg braucht den Hermann auch irgendwie, gerade weil sie, genau wie früher am Küchentisch der WG oder am Tresen vom «Milieu», die meiste Zeit nur über Musik und alte Schallplatten quatschen, die sie wieder auf Flohmärkten und auf irgendwelchen Liebhaberseiten im Netz gefunden haben, Glam Rock und Soul, ganz alter Blues, früher Punk, B-Seiten und Dylan-Bootlegs, solche Sachen. Sie fühlen sich dann wohl wieder jung oder zumindest nicht alt. Mit Lea zusammen macht der Hermann manchmal Musik, mit den E-Gitarren und dem Verstärker, der oben im Flur steht, in letzter Zeit weniger, es geht sich einfach nicht mehr aus. Lea mag ihn ja, auch wenn sie die Frauen nerven, die er oft von seinen Reisen mitbringt, meistens nicht mehr ganz junge Touristinnen, die er irgendwo aufgegabelt hat und die dann zu ihm in sein Zimmer ziehen. Große Liebe immer am Anfang, wildes Gevögel, großes Angehimmel, aber Lea und Georg wissen mittlerweile, dass diese Frauen nicht lange bleiben. Irgendwann merken sie, dass Hermann ein Abenteurer ist, ein Liebhaber auf Zeit, gut mit den Händen, aber nicht mit dem Herz. Kein Lebensgefährte und schon gar kein Heiratsmaterial, ein Kurzstreckenläufer, der sich bald mit ihnen langweilt, dann ziehen sie irgendwann mit verheulten Augen wieder ab.
«Für die gehört der Hermann zu uns», sagte Lea. «Und wenn der Scheiße baut, fällt das auf uns zurück.»
«Die kommen trotzdem.»
«Sei dir da nicht so sicher. Für die sind wir immer noch die gscheerten Wiener.»
«Du vielleicht. Ich nicht. Ich bin einer der Ihrigen. Ein Unsriger sozusagen.»
Jetzt lacht Lea endlich. Endlich.
«Bist du schon lang nicht mehr, Honey. Und bis du es wieder wirst, wird’s noch dauern. Red mit dem Hermann. Bitte.»
«Ich red mit ihm, okay. Aber du weißt, dass es nichts nützen wird.»
«Erzähl ihm doch einfach von deiner gebrochenen Nase», hatte Lea gesagt, «und wer sie dir eingeschlagen hat. Und dass der Thaler bei seiner Frau sicher noch viel weniger Spaß versteht als bei seiner … was war das?»
«Zündapp.»
«Bei seiner Zündapp. Mach ihm das klar.»
«Wird ihm egal sein.»
«Trotzdem», sagte Lea, «mach’s bitte», und: «Kannst du mal nach Maya sehen, das Licht ausmachen? Sie liest sicher immer noch.» Sie hatte sich wieder ihren Exceltabellen zugewandt, ihren langen, dünnen Oberkörper in einem labbrigen Sweatshirt über den Tisch gebeugt, die Haare fielen ihr in die Stirn und über die Brille.
Er hatte ihr einen Kuss auf diese Stirn geschmatzt und war durch den Flur zu Maya gegangen. Sie las nicht mehr, sie war eingeschlafen, das Licht noch an, ein dickes Buch auf dem Bauch. An den Wänden ihres Zimmers hingen Harry-Potter-Plakate und Zeichnungen aus japanischen Zeichentrickfilmen. Nein, gab’s ja nicht mehr. Wie hieß das jetzt? Animation? Anime? Er muss Maya fragen, nur damit sie ihn mit ihrem famosen Kinderlachen verspotten kann. Georg küsste seine Tochter vorsichtig auf die Wange, zog ihr die Decke unters Kinn, machte das Licht aus und schloss leise die Tür. Dann ging er zu den Buben im Flur vis-à-vis, versuchte, in dem dunklen Zimmer die Umrisse ihrer Betten zu finden. Alois schnarchte sanft, Linus hatte sich freigestrampelt. Georg ging leise zu seinem Bett und deckte ihn zu, strich ihm übers Haar. Er ließ das Glück in sich Platz greifen, das diese Kinder, diese Familie ihm verschaffen. Diese Kinder, deren Aufwachsen er jeden Tag miterleben darf. Er ist so gerne Vater. Er hat es nicht gewusst, früher, aber er ist gerne Vater. Es kann so leicht sein. Er ist dankbar, und er sagt es sich in Gedanken vor: Ich bin dankbar. Ich bin dankbar für das alles. Ich bin dankbar für die Abwesenheit von Unglück, von Krankheit, von Krieg, von Armut. So viele Menschen haben dieses Glück nicht. Ich bin dankbar. Man muss die Dankbarkeit spüren, das Glück sehen können. So viele Leute sind von Glück umgeben, eingebettet in Glück, und sie sehen es nicht, spüren es nicht. Georg macht sich sein Glück bewusst, seine Dankbarkeit. Manchmal, an finsteren, schlechten Tagen, summt in ihm ganz leise das Gefühl, dass das eine Lüge ist, dass er sich selbst beschwindelt, dass er sich sein eigenes Glücklichsein einredet, zusammenbaut aus den Glücksindizien um ihn herum, aber er lässt das Gefühl nicht wachsen. Er schneidet es ab, mit der Dankbarkeitsschere. Es geht ihm so gut. Er hat so viel Glück im Leben. Er ist so gerne Vater. Er ist dankbar für das alles. So will er leben, genau so.
Das Dorf, in dem Georg aufgewachsen ist und in dem er jetzt mit seiner Familie wieder lebt, heißt Flur. Flur am Kamp. Vielleicht war Flur früher einmal ein Flur, Freiland, leere Gegend. Sicher nicht das Straßendorf, das Flur jetzt ist, zusammengestückelt aus alten und neuen, dicht aneinandergebauten Häusern auf beiden Seiten einer Straße, auf der Lkws und mächtige Traktoren viel zu schnell durch das Dorf rasen. Die Häuser, in denen kleine Kinder wohnen, haben hohe Zäune und gut gesicherte Gartentüren. Die alten Häuser grenzen ihre Höfe mit hohen Mauern zur Straße hin ab, mit mächtigen, immer wieder neu und meist in einem Grünton gestrichenen doppelflügeligen Holztoren, mit riesigen eisernen Klinken daran. Fast alle Gärten und anderen Grundflächen liegen weiter hinter den Häusern, die meisten kann man von der Straße aus nicht sehen, nichts von den kleinen Pools darauf, den Klettergerüsten und Rutschen, den Carports im Hof, den Hornbach-Gartenmöbeln aus Kunststoffrattan oder Regenwald-Teakholz. Da ist aber auch Gerümpel, das längst auf einen Schrottplatz gehören würde, manche horten völlig verrostete Autowracks, kaputte Reifen, Haufen von alten, zum Teil zerbröselnden Ziegeln. An die meisten Gärten schließen weiter hinten Obstwiesen an, mit Apfel- und Birnbäumen vor allem, ein paar Kirschen dazwischen, für Zwetschgen ist es in dieser Gegend zu kalt. Es gibt immer ein paar Narren, die es versuchen mit den Zwetschgen, und ein paar Jahre später hauen sie die toten Gerippe ihrer Zwetschgenbäume mit der Motorsäge weg und hebeln die zähen Wurzeln aus dem Boden. Georg ist einer davon.
Es ist hier zu kalt für Zwetschgen, auch wenn es ein paar Bauern gibt, die etwas anderes behaupten, und dass sie kräftige, gut tragende Bäume hätten, irgendwo auf einem ihrer Felder. Hat keiner je gesehen, diese Bäume. Die Nussbäume, die über die Häuser ragen, sind in vielen Frühsommern kahl, nach späten Frösten, die ihre Blätter und zarten, jungen Früchte in braunen Matsch verwandeln. Der Hof der alten Pichler steht als einer der wenigen etwas vom Straßenrand entfernt. Ein riesiger Nussbaum kragt über die Straße, und wenn ihn der Frühlingsfrost wieder einmal kahl gefegt und in ein trauriges, kahles Gestrüpp verwandelt hat, liegen die Betrunkenen nachts fluchend auf der Straße im braunen Matsch, auf dem sie ausgerutscht sind.
Der Hirschen, das Gasthaus von Georgs Familie, liegt etwas abseits auf einer sanften, fast idyllischen Anhöhe, dahinter führt ein Treppelweg hinunter zum Fluss. Früher hat nur Georgs Vater diesen Weg benutzt, wenn er zum Fischen ging. Es gibt einen kleinen Schuppen unten am Wasser und einen Steg. Jetzt im Sommer sitzen auch die Gäste an der warmen Schuppenwand und auf dem Steg, an den wenigen heißen Abenden, die das Klima dieser Gegend gönnt, auch wenn es mehr werden, dem Klimawandel sei Dank. Im vergangenen Jahr saßen sie schon im Mai mehrere Abende lang ohne Jacke am Steg, bevor es noch mal kurz kalt wurde, aber der Sommer danach war lang, wie die Sommer überhaupt immer länger werden, nach vorn und hinten. Für die Bauern ist es schwer, es regnet zu wenig, es ist zu trocken, vor allem für den Wald. Für das bissl Tourismus in der Gegend ist es gut. Kurzfristig betrachtet. Die Hirschengäste sitzen auf den Holzplanken oder auf den weichen, grünen Sitzpolstern, die Lea im Schuppen genau dafür lagert, sie kühlen ihre weißen Stadtfüße im kalten, vom Eisen bräunlichen Wasser, mit einem Bier in der Hand oder einem Spritzer. Innen an der Schuppenwand hat Lea ein laminiertes Blatt aufgehängt, eine amtliche Untersuchung der phantastischen Wasserqualität, die Farbe hat keine Bedeutung. Sie erklären es den Gästen immer wieder gern: Das Wasser ist eisenhaltig, und dieses Eisen färbt den Kamp so rostig bräunlich. Die meisten Gäste verlieren ihre Skepsis, wenn sie frühmorgens und abends die Forellen im Wasser springen sehen, im Dutzend. Viele kaufen sich Fischerkarten für einzelne Tage, ein Wochenende oder eine Woche, und stehen früh auf, um die Angel ins Wasser zu halten. Meistens Männer, manchmal mit ihren Söhnen und Töchtern, Frauen eher selten.
In der Früh geht er so oft wie möglich hinaus in den Wald, mit dem Hund, über die Forstwege, die er als Jugendlicher mit dem Moped abschepperte, in die Seitenwege hinein und über die Felder. Bevor die Arbeit in der Küche beginnt, bevor das Tosen der Töpfe anhebt, bevor er wieder den ganzen Tag nicht rauskommt. So hat er es sich irgendwie nicht vorgestellt, als er Wien Servus sagte und nach mehr als zehn Jahren in der Stadt zurück ins Heimatdorf ging, um das Wirtshaus von den Eltern zu übernehmen, nach dem plötzlichen Tod seines Vaters. Jetzt sind diese frühen Märsche vielleicht das Beste am Tag, natürlich außer der Zeit, die er mit seinen Kindern verbringt. Er schleicht sich bei Tagesanbruch aus der Wohnung, bevor Lea aufsteht und die Kinder für die Schule weckt, lange bevor Hermann sein verschlafenes Gesicht in der Gaststube sehen lässt, und optimalerweise bevor die Mutter anfängt, durchs Haus zu geistern. Bevor Ella kommt und Frühstück richtet, für die paar Frühstücksgäste, die sie manchmal haben, meistens an Wochenenden, und die dann früh aufstehen, weil sie wandern gehen oder Rad fahren oder fischen im See oder eine Kajaktour machen, den Kamp runter. Der ganz frühe Morgen, das ist Georgs liebste Zeit: wenn es noch völlig still ist, wenn alle noch schlafen. Nur der Hund wartet meistens schon an der Tür und will raus. Oft, im Winter, ist es stockdunkel, wenn er losgeht, die Holzstiege hinunter in die Gasträume, der Hund flitzt an ihm vorbei, Georg geht durch den dunklen Flur und am Ende durch die Tür hinaus, wo der Hund dann auch schon wieder wartet.
Jetzt ist es nicht mehr so dunkel, man sieht das Licht des Frühlings. Es sind nur zwei Meter bis zum Schuppen, er hat ein paar flache Steine zwischen Haus und Schuppentor in die Erde gesetzt, damit er nicht jeden Morgen in den Gatsch steigen muss. Er öffnet das Holztor, drinnen hängen seine Körbe neben der Hundeleine an einem Eisenhaken, über einer alten Holzbank, unter der seine Wanderstiefel und seine Laufschuhe warten. Die Bank stand früher in der Gaststube. Sie ist schön, Lea liegt Hermann schon länger in den Ohren, er soll sie endlich herrichten, sie will die Bank zurück ins Haus stellen. Hermann, der Gemütliche, sagt, schau dir das an, die Rückenlehne und die Sitzfläche bilden einen rechten Winkel, das ist batzenunbequem. Das stimmt. Georg weiß es, weil er hier jeden Morgen sitzt und die Birkenstock gegen die Waldschuhe tauscht, heute die Wanderstiefel, im Wald wird es nass und schlammig sein.
Der Hund ist unruhig, er schnüffelt durch den Schuppen, die Nase am Boden, wahrscheinlich erschnuppert er eine Maus oder eine der Nachbarskatzen, die es sich manchmal in der Nacht hier gemütlich machen. Auf der einen Seite steht der Schrank mit den Gartengeräten, an der anderen Wand hängen die vier schmalen Plastikkajaks, die sich die Gäste ausborgen können, zwei blaue, ein rotes, ein grünes, dazwischen die Paddel. Hier gehört dringend aufgeräumt. Rasenmäher, Kindertraktoren, Fahrräder in allen Größen und Aggregatszuständen, alles steht unordentlich neben- und übereinander, in einer Ecke sind ein paar Sessel aus dem Gastgarten aufeinandergetürmt, die gehören repariert oder weggeworfen. Rechts hinten steht unter zwei riesigen Blechlampen die Werkbank, an der Hermann arbeitet, dahinter liegt auf drei in die Wand gehauenen Eisenstangen das halbfertige Sechs-Tage-Boot; das ist der einzige Teil des Schuppens, der halbwegs aufgeräumt ist. Hermanns Werkzeug – also, eigentlich das Werkzeug von Georgs Vater – hängt ordentlich an einer Lochplatte an der Seitenwand, noch genauso, wie der Vater es damals angeordnet hat. Neben der Werkbank steht Georgs altes Moped, seine blauweiße, verchromte Puch DS mit der weißen Doppelsitzbank, mit der er als Jugendlicher zur Schule gefahren war und abends durch die Gegend, in andere Orte, andere Gasthäuser, zu anderen Menschen.
Wie man mit einem Moped fahren kann: allein, im kalten Morgenwind, Richtung Gymnasium und zu Mittag wieder zurück, bei Regen und Schnee, in einer zu dünnen, deutschen Bundeswehrjacke, die Georg bei einem Wienausflug in einem Armyladen kaufte und in der er die Jahre darauf praktisch wohnte. An Frühlingsnachmittagen und Sommerabenden in lauer Luft, im T-Shirt, mit einem Mädchen aus der Gegend hinter sich oder einem Freund, dessen eigenes Moped gerade kaputt war. Zu dritt, mit zwei Freunden, um vier Uhr früh in der Sommermorgendämmerung, heim vom See, wo sie die ganze Nacht unter dem Mond am Feuer gesessen und Bier getrunken und sich ins Wasser geworfen und auf Charlies kleinem Ghettoblaster leiernde Rock- und Bluesmusikkassetten gehört hatten; sie machten einen Umweg, um nicht am Haus des Dorfgendarmen vorbeizurattern, der ein Arschloch war und schlaflos. In Wien, mit einer der mageren, stachelhaarigen Kellnerinnen aus dem «Milieu» auf dem Rücksitz, die er nach einer langen, erschöpfenden Arbeitsnacht nach der Sperrstunde nach Hause brachte. Mit Heidi, die sich mit beiden Armen verängstigt und zu fest an Georg klammerte; sie fuhren, kurz nachdem sie sich kennengelernt hatten und er sie noch beeindrucken wollte, in die Idylle der Weinberge auf den Hügeln um Wien, begeilten sich an der Aussicht und knutschten dort auf einer Decke bis in die Nacht hinein: Georg erinnert sich an einen unglaublichen Sternenhimmel, eine vermutlich trügerische Erinnerung, denn der Sternenhimmel in der Stadt ist trüb und mit dem hier auf dem Land nicht zu vergleichen. Heidi behauptet vermutlich heute noch, sie hätten in dieser Nacht Lotte gemacht, und wahrscheinlich stimmt es auch. Als Lotte zur Welt kam, hat er die Puch irgendwann aufs Land zurückgebracht und in den Schuppen gestellt, braucht man nicht, wenn man ein kleines Kind hat; und in irgendeinem Sommer, in dem er damit eine Ausfahrt machte, hat sie auf der Straße zum See den Geist aufgegeben, starb ab, ließ sich nicht mehr starten, er weiß bis heute nicht, warum. Er hat sie schwitzend und keuchend heimgeschoben und hier in den Schuppen gestellt, wo sie seither wartet, unrepariert, staubig und mit Spinnweben überzogen, alt, verbeult und ein bisschen angerostet. Lea wollte das Ding schon lang verkaufen, mehr als ein Gast hatte sich dafür interessiert und war bereit, ordentlich was zu zahlen. Und Alexander, sein Bruder, geht ihm seit ein paar Wochen total auf die Nerven, es sei auch sein Moped, er will es für seinen Buben, der bald fünfzehn wird, er kann und würde es herrichten, bei Georg stehe es doch bloß ungenutzt herum und roste vor sich hin. Aber Georg kann das nicht: Das ist seine alte DS; sein Moped hergeben, das schafft er nicht.
In dieser Morgenstunde mit dem Hund ist er allein, nur für sich. In dieser Stunde hat er keine anderen Verpflichtungen. Der Hund bleibt immer in der Nähe, und wenn Georg ruft oder pfeift, kommt er sofort. Das war seine Bedingung für den Hund, den die Kinder so un-un-unbedingt wollten, Maya zuvorderst: dass er professionell abgerichtet wird.
«Ihr wisst ja, was mit dem Hund von der Pichler passiert ist?»
«Ja!»
«Ein Gasthaus verträgt sich nicht mit einem schlecht erzogenen Hund, der die Gäste ankläfft.»
«Ja!»
«Das geht nicht.»
«Ja, Papa! Wir haben es kapiert.» Maya wollte diesen Hund unter allen Umständen, zu jeder Bedingung.
Der Hund von der Pichler ist immer wieder in den Wald gerannt. Einmal hat er ein Reh gerissen, und ein paar Wochen danach hat der Jäger ihn angeschossen. Die Pichler musste ihn einschläfern lassen. Die Jäger kennen da keinen Pardon. Die ersten Monate hielt Georg den Hund deshalb konsequent immer an der Leine, auch auf der Straße, jetzt lässt er ihn allein laufen, er vertraut ihm, der Hund entfernt sich nie weit und lässt sich auch von Tiergeräuschen oder -gerüchen nicht verleiten. Er läuft ein bisschen voraus, aber nie so weit, dass Georg ihn nicht mehr sehen kann, und wenn er was hört, bleibt er stehen, bis Georg bei ihm ist. Braver Hund.
Pepi heißt er, die Kinder haben ihm den Namen gegeben, schon als sie ihn im Tierheim aussuchten. Der! Der ist so süß! Er war wirklich süß, ein kleiner, braunweiß gefleckter Mischlingswelpe mit spitzer Schnauze, langen Ohren und einem freundlichen Gesicht. Er schien zu lächeln. Er ist längst nicht mehr klein, er geht Georg bis über die Knie, aber er lächelt immer noch. Manchmal läuft Georg auch, mit Stöpseln in den Ohren, aus denen alter, schwarzer Blues klingt oder Soul, der Hund läuft mit. Aber lieber geht Georg. Er geht schnell, er schlendert nicht, und wenn er nicht läuft, hat er auch keine Kopfhörer dabei. Bevor sie den Hund hatten, hatte er beim