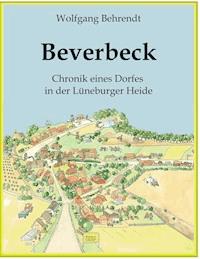
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Anlässlich des 1150-jährigen Bestehens von Beverbeck, einem Dorf in der Lüneburger Heide, ist diese Chronik geschrieben worden. Die Geschichte dieses Dorfes und fast alle Aspekte des dörflichen Lebens finden Erwähnung. Anhand von Karten und Bildern wird das Früher mit dem Heute verglichen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 117
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cora
Linus
Gesa
Ella
Anton
Danke, liebe Karin!
Grußwort der Ortsvorstehers
Im Jahr 2016 kann Beverbeck zusammen mit Grünewald auf eine 1150-jährige Geschichte zurückblicken. Anlässlich dieses Jubiläums gründete sich ein kleiner Arbeitskreis, um das Wissen von der Geschichte unseres Dorfes aus historischen Dokumenten und aus der Erinnerung zusammenzutragen und es damit unserer Nachwelt zu erhalten.
Mein besonderer Dank gilt nicht nur den Mitgliedern dieses Arbeitskreises, sondern auch all denen, die für diesen Zweck ihr Bild- und Textmaterial oder sich selbst für ein persönliches Gespräch zur Verfügung gestellt haben.
Es wird mir eine große Freude sein, mit den Bürgerinnen und Bürgern aus Beverbeck und Grünewald am 22.5.2016 dieses Jubiläum zu feiern.
Ich wünsche unseren beiden Ortsteilen ein langes Bestehen, seinen Einwohnern eine friedvolle Zukunft und ein harmonisches Miteinander.
Alfred Meyer
Ortsvorsteher
Beverbeck,31.März 2016
Vorwort
Das 1150-jährige Jubiläum war ein willkommener Anlass, einen Kreis interessierter Bürger zu finden, der die Geschichte unseres Dorfes aufarbeitet. Bereits im Oktober 2015 trat dieser Arbeitskreis erstmals zusammen. In Zusammenarbeit mit Alfred Meyer, Manfred Harms und Wolfgang Mindt wurden aus privaten Beständen Text- und Bilddokumente gesammelt, sortiert und auf ihre Eignung hin untersucht. Zusätzliches Material, wie Fotos und Texte, stellten Eckhard Meyer, Frieda Hohls, Birgit Jambor, Harald Wulf, Manfred Wulf, Martina Päper und Ilke Lodder zur Verfügung. In Gesprächen mit Frieda Hohls, Hans-Joachim Wessel, Heike Gromeier-Hohls und Martina Päper konnte ich mein Wissen von dem Leben in unserem Dorf vervollständigen. Die Schriftdeutung in der alten Schulchronik (Sütterlin) wäre ohne die Mithilfe von Renate Meyer nur schwer möglich gewesen. Der Arbeitskreis des Gemeindearchivs in Bienenbüttel, namentlich Herr Holger Runne, Herr Dr. Klaus Wedekind und Herr Dieter Holzenkämpfer, hat mir Einsicht in Tabellenwerke gewährt, Bilder und Kartenmaterial zur Verfügung gestellt und mich bei der Vorbereitung der Drucklegung dieser Chronik beraten. Frau Ritter und Frau Dr. Böttger des Kreisarchivs in Uelzen haben mir uneingeschränkten Einblick in die Schulchronik ermöglicht und Kopien für meine Arbeit angefertigt. Herr Dr. Vogtherr, Archivar des Museumsdorfes Hösseringen, gestattete mir Einsicht in die Akten, die über die Landwirtschaft Beverbecks zurzeit des Nationalsozialismus berichten. Allen Genannten sei an dieser Stelle gedankt. Einen besonderen Dank gebührt Alfred Meyer, der stets bereit war, Kontakte für die Recherche zu knüpfen und der wertvolles Bild- und Textmaterial zusammengetragen hat.
In der Literatur, die insbesondere unsere Heimatgeschichte beschreibt, findet unser Ort sehr selten und wenig spektakulär Erwähnung. Dafür können mehrere Gründe genannt werden:
Die Anzahl der Einwohner Beverbecks war immer überschaubar, niemals war sie größer als 200. Die Wahrscheinlichkeit, im 17. Jahrhundert und früher hier Schreibkundige für die Dokumentation des Dorfgeschehens anzutreffen, war bis zur ersten Anwesenheit eines Lehrers sehr gering. Die Anfertigung schriftlicher Dokumente beschränkte sich meistens auf Fälle von Grundstücks-Transaktionen. Zu bedenken ist auch, dass Beverbeck jahrhundertelang abseits wichtiger Verkehrswege lag. Und schließlich wird die "Schattenlage" Beverbecks in Bezug auf Bienenbüttel, dem Sitz der Amtsvogtei, zur relativen Bedeutungslosigkeit unseres Ortes beigetragen haben.
Diese Chronik erhebt nicht den Anspruch der Wissenschaftlichkeit. Viele Details sind dem Online-Lexikon Wikipedia entnommen oder haben sich durch Erzählungen in unsere heutige Zeit hinübergerettet. Einige verwendete Fotos sind undatiert und Landkarten wurden nach bestem Wissen und Gewissen interpretiert. Wenn durch dieses kleine Buch das Geschichtsbewusstsein und weiteres Interesse an Beverbeck geweckt werden konnte, so ist viel erreicht.
Wolfgang Behrendt
Beverbeck, den 31.März 2016
Inhalt
Erste urkundliche Erwähnung Beverbecks
Politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Gegebenheiten zurzeit der Dorfgründung
Erste Ortslage von Beverbeck
Beverbeck und die Amtsvogtei Bienenbüttel
Der Moorteich
Beverbecks Straßenanbindung
Die Landverkopplung
Zusammenlegung von Ortschaften
Die Schule in Beverbeck
Grünewald
Unwetter
Landwirtschaft zurzeit des Nationalsozialismus
Strukturwandel in der Landwirtschaft
Dorfleben
Spielen auf dem Dorf
Das Gasthaus
Freiwillige Feuerwehr Beverbeck-Grünewald
Sportgruppe Beverbeck -Grünewald
Die Jagd
Mia Meyer
Jung und Alt
Beverbeck und Grünewald im Wandel der Zeit
Ansichten von Beverbeck und Grünewald
Statistik
Zeittafeln
Erste urkundliche Erwähnung Beverbecks
... tradidit Folcbertus pro se et pro axore sua XXX jugera in Beverbiki ...
... übertrug/schenkte Folcbert für sich und seine Ehefrau 30 Joch1 in Beverbeck ...
Unser Ort findet bereits erste Erwähnung im Jahr 804 als Besitztum des Stifts Corvey. Historiker in unserer Gemeinde bezweifeln allerdings die Verlässlichkeit dieser Zeitangabe. Die 1. urkundliche Erwähnung Beverbecks fällt in das Jahr 866; sie dokumentiert eine Grundstücks-Transaktion. Beverbeck wird, wie auch die Ortschaft Tellmer, als aus dem Besitz der Grafenfamilie der Bardonen stammend, ausgewiesen. Im Unterschied zu den anderen Orten bardonischen Ursprungs (Barnstedt, Bardenhagen), die sich am nördlichen Rand des Süsings befinden, ist im Falle Beverbecks kein offensichtlicher Bezug zum Namen dieser Familie herzustellen.
Zum Ursprung des Ortsnamens kann aber festgestellt werden:
Für den ersten Teil des Ortsnamens Bever gibt es zwei gleichwertige Herleitungen. So könnte dieser Teil auf das Wort Biber2, aber auch auf beben3 bzw. zittern zurückgehen. Die Moorlandschaft und dessen nähere Umgebung als Lebensraum lässt beide Deutungsmöglichkeiten zu. Die stehenden oder abfließenden Gewässer waren sicherlich der Lebensraum des Bibers. Der moorige und instabile Untergrund hat den Boden bei Schritt und Tritt zittern bzw. beben lassen.
Der zweite Teil des Ortsnamens beck (so wie bek und beke) verweist auf die Lage an einem vorhandenen Bach.
Fest steht, dass Beverbeck bereits existierte, als von Lüneburg und Uelzen weit und breit nichts zu sehen war. Etwa 10 km westlich existierte schon Tellmer, und 25 km nördlich lag Bardowick, der zentrale Umschlagplatz für den Ost-West- und den Nord-Süd-Handel im Reich Karl des Großen.
1 Je nach Region verstand man unter 1 Joch 3000m2 - 5800m2; also wurden hier 9,9ha - 17,4ha transferiert.
2 Otto und Theodor Benecke, Lüneburger Heimatbuch Band 2, Seite →
3 Karl Meyer-Jelmstorf, Geschichte des Kreises Uelzen, Seite →
Politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Gegebenheiten zurzeit der Dorfgründung
Das Jahr 866 wird dem Frühmittelalter, das in etwa die Zeitspanne von 500 bis 1050 n.Chr. meint, zugeordnet. Der bedeutendste Herrscher aus dem Geschlecht der Karolinger, Karl der Große, der das große Frankenreich schuf, war 814 verstorben; ihm folgte als Kaiser der jüngste Sohn Ludwig der Fromme. Die Söhne von Ludwig dem Frommen, Lothar I, Ludwig der Deutsche und Karl der Kahle führten Aufstände zunächst gegen den Vater und dann untereinander. Das von Karl dem Großen geschaffene Frankenreich zerfiel in die Teile Mittelfranken, Ost-und Westfranken. Unser Gebiet gehörte zu Ostfranken mit Ludwig dem Deutschen als König. Da in dieser Zeit immer wieder skandinavische Wikinger, auf Beute und Landeroberung gerichtet, in unser Gebiet einfielen, war Ludwig der Deutsche auch genötigt, sein Heer gegen die Wikinger zu führen.
Im Frühmittelalter lebten etwa 90% der Menschen auf dem Lande und von der Landwirtschaft. Das Land war dünn besiedelt; in ganz Europa lebten weniger als 40 Millionen Menschen. Die allgemeine Lebenserwartung war vor allem in der ärmeren Bevölkerung sehr viel geringer als heutzutage; sie betrug durchschnittlich etwa 35 Jahre. Die Frauen waren im Frühmittelalter formal unmündig. Vater, Ehemann und Vormund waren ihnen übergeordnet.
Die Verfügungsgewalt über den Besitz wurde Frauen abgesprochen. Im adligen Milieu gab es allerdings Beispiele für Frauen, die über Einfluss und politische Durchsetzungskraft verfügten.
Obwohl auch den Eltern im Frühmittelalter sicherlich das Wohlergehen ihrer Kinder am Herzen lag waren körperliche Züchtigung und Kinderarbeit an der Tagesordnung. Aufgrund der allgemein geringen Lebenserwartung endete die Kindheit sehr früh.
In der frühmittelalterlichen Gesellschaft wurde Wissen über geschichtliche, gesellschaftliche und religiöse Ereignisse in der Regel mündlich weitergegeben. Nur sehr wenige Menschen konnten lesen und schreiben; meistens waren es Geistliche. Dokumente wurden meistens in lateinischer Sprache verfasst. Das Volk sprach Althochdeutsch, das je nach Region im "Dialekt" vorkam. In unserem Gebiet wurde Altsächsisch gesprochen. Niederschriften bedienten sich des lateinischen Alphabets, das damals, von wenigen Ausnahmen abgesehen, unserem heutigen Alphabet entsprach. Schriftliche Überlieferungen in althochdeutscher Sprache sind meistens geistliche Texte: Gebete, Taufgelöbnisse, Bibelübersetzungen.
Beispiel (Hildebrandlied):
Ik gihorta dat seggen
Dat sih urhettun aenon muotin ...
Ich hörte das sagen,
dass sich als Herausforderer einzeln mühten ...
Die frühmittelalterliche Gesellschaft war eine Ständegesellschaft, die streng hierarchisch geordnet war. Ein sozialer Aufstieg war nur relativ selten möglich. Der gesellschaftliche Rang einer Person war durch deren Geburt begründet. Der König und der Adel bildeten die Führungsschicht; zusammen mit den Klöstern waren sie die Landbesitzer. Diese Grundherrschaft stellte den Bauern gerade soviel Land für die Bewirtschaftung zur Verfügung wie die Familie bewirtschaften konnte und zum Lebensunterhalt benötigte. Die Flächen mussten zunächst urbar gemacht und kultiviert werden, indem z.B. Waldflächen gerodet wurden. Mit Hilfe von Hakenpflügen, die meistens von Ochsen gezogen wurden, lockerte man die Bodenstruktur auf; dadurch wurde der Boden lediglich aufgeritzt, aber nicht gewendet. Die Ernteerträge waren relativ gering; sie sollen lediglich das 1,6- bis 1,8-fache der Aussaat betragen haben. Eine Verbesserung stellte sich erst mit der verbreiteten Einführung der Dreifelderwirtschaft 4 und dem Einsatz einer Pflugschar ein, die in der Lage war, den Erdboden zu wenden. Bei der Getreideverarbeitung spielten Mühlen, insbesondere Wassermühlen, eine wichtige Rolle; sie setzten allerdings fließende Gewässer mit ausreichender Wassermenge voraus.
Die Bauern erhielten nicht nur Landflächen zur Bewirtschaftung sondern standen auch unter dem Schutz der Grundherrschaft. Diese Wohltat war nicht uneigennützig: zum einen hatten die Bauern Frondienste5 abzuleisten zum anderen mussten sie Dienstgeld zahlen und einen Teil ihres landwirtschaftlichen Ertrages (Zehnt) abführen.
4 Wintergetreide - Sommergetreide - Brache; die ersten Anwendungen gab es im 8. Jahrhundert.
5 Verschiedene Tätigkeiten für eine festgelegte Anzahl von Tagen pro Jahr; in der Regel waren das sogenannte Hand- und Spanndienste.
Erste Ortslage von Beverbeck
Allgemein gilt, dass sich Dörfer nur dann gründeten, wenn deren Bewohner sesshaft wurden. Entweder wurden Jäger und Sammler saisonal oder Ackerbauern dauerhaft sesshaft. Etymologisch ist ein Dorf eine bäuerliche Siedlung. Man ließ sich also nieder, um Landwirtschaft zu betreiben. Die Verfügbarkeit von Anbauflächen und erreichbarem Trinkwasser waren die grundsätzliche Voraussetzung. Eine irgendwie geartete Verkehrsanbindung haben Dorfgründungen sicherlich begünstigt. Die Bodenqualität westlich der Moorlandschaft, die man später Springmoor, Steinmoor und Lütje Moor nannte, war zufriedenstellend, im Süden sogar gut (Kleiboden). Die Nähe zum Moor garantierte einen relativ hohen Grundwasserspiegel. Für den Gütertransport bedurfte es nur noch eines Wegenetzes.
Der älteste Fernverkehrsweg in dem Gebiet, das später Fürstentum Lüneburg genannt werden wird, ist der sogenannte Hessenkarrenweg. In dem Abschnitt von Lüneburg nach Ebstorf hatte er eine hohe verkehrspolitische Bedeutung. Hinweise in älteren Karten und eine fachgerechte Vermessung der oberflächig noch in großen Gruppen vorhandenen Spuren machen es möglich, den Wegeverlauf hinreichend genau nachzuweisen. Der insbesondere durch Wagengespanne durchgeführte Verkehr hinterließ Spuren, deren Tiefe insbesondere von der Topologie des Geländes abhing. War eine Spur vorübergehend unpassierbar geworden, wich man im ebenen Gelände nach rechts oder links aus. Führte der Verkehr allerdings über Anhöhen, so zwangen Täler oder günstigere Wegesteigungen den Verkehr bevorzugt in eine Spur. Mit zunehmender Nutzungsdauer wurden diese immer tiefer. Auf diese Weise entstanden Hohlwege, die eine Tiefe von drei bis vier Meter erreichen konnten. Dagegen bildete sich in der Ebene, wie z.B. südlich von Melbeck, stellenweise ein mehrere Hundert Meter breites Fahrwegbündel. Moderne Erdbewegungsmaschinen haben allerdings an einigen Stellen den Verlauf des Hessenkarrenweges verwischt.
Ein System von solchen Spuren findet man auch im Westteil der heutigen Gemarkung von Beverbeck. Wie die Abbildung auf Seite → oben zeigt, gibt es beidseitig der heutigen L233 Spurenfragmente (1), die den Hauptverkehrsweg markieren. Es ist auch erkennbar, dass eine Bodenerhebung, der Heeresberg mit einer Höhe von 64,4 Meter, eine wohl aus Bardenhagen kommende Gruppe von Spuren um diese Anhöhe herum zwingt. Ein Teil (2) führt östlich, der andere Teil (3) westlich um den Heeresberg herum. Das Spurenbündel (2) wird wieder in den Hauptweg und das Bündel (3) in das zum Hellkuhlengrund führende Spurenbündel (4) einmünden. Gut erkennbar ist, dass die Spuren sämtliche Hügelgräber (siehe 6) umgehen. Diese Tatsache legt die Vermutung nahe, dass bei Beginn des Verkehrs auf diesem Wege die Hügelgräber schon bestanden haben. 6
Hessenkarrenweg: Spuren in der Gemarkung Beverbeck
Der Heeresberg (Höhe 64,4) von Süden aus gesehen
Einige wenige Wegespuren in der Gemarkung Beverbeck sind heute noch zu erkennen.
Wegespur östlich des Hügelgrabes (siehe Karte Position A)
Wegespur westlich der L233, Abfahrt Hellkuhlengrund (siehe Karte Position B)
Eine hinreichende Bodenqualität, ein nicht zu tiefer Grundwasserspiegel, die Verfügbarkeit des Baustoffes Holz und auch die Möglichkeit, der Jagd nachzugehen, fördern die Besiedlung eines Gebietes.
Die Existenz von Hügelgräbern bestätigt eine menschliche Siedlung hier oder aber in nicht zu großer Entfernung. Am Radberg soll diese Siedlung, die unter dem Namen Beverbiki im Jahre 866 ihre erste urkundliche Erwähnung findet, ihren Ursprung gehabt haben. Ob nun allerdings die Gründung Beverbecks an dieser Stelle durch die Existenz des Hessenkarrenweges begünstigt wurde oder aber dieser Verkehrsweg viel später seinen Verlauf entlang bereits bestehender Ortschaften suchte, ist nicht überliefert.
Radberg östlich des Querweges vom Moorteich zur L233
Etwa 700 Jahre hatte diese Ortslage Bestand. Mit dem 30-jährigen Krieg (1618-1648) nutzten auch Horden von Soldaten diesen Verkehrsweg. Die Landsknechte wurden zwar unter Zusage von Sold angeworben, erhielten diesen allerdings oft unregelmäßig und manchmal auch gar nicht. Also nahmen sie sich das, was rechts und links ihres Weges lag. Neben vielen anderen Siedlungen wurde auch Beverbiki von diesen Horden gebrandschatzt, ausgeraubt und viele Bewohner abgeschlachtet. Nachdem dieses wohl mehrfach geschehen war, gaben die Beverbecker ihre Siedlung am Radberg auf und gründeten etwa 1 km weiter östlich jenseits des unzugänglichen Moores eine neue Siedlung, die der heutigen Ortslage Beverbecks entspricht.
6 Museumsverein für das Fürstentum Lüneburg, Lüneburger Blätter 1962, Seite 62f, 69
Beverbeck und die Amtsvogtei Bienenbüttel 7
Um die Herrschaftsrechte eines Fürsten durchzusetzen, war es erforderlich, das Herrschaftsgebiet zu strukturieren und Verwaltungsbezirke zu schaffen. Dieses begann bereits um die Wende des 12./13. Jahrhunderts. Da sich im Zentrum dieser Verwaltungsbezirke meistens ein Schloss oder eine Burg befand war es gebräuchlich, von Vogtei oder Burgvogtei zu sprechen. An oberster Stelle einer Vogtei stand der Vogt; er war von seinem Fürsten eingesetzt. Indem dieser ihm Grund und Boden überließ, befand er sich in einem besonderen Treue- und Abhängigkeitsverhältnis.
Im 14. Jahrhundert war die Einteilung des Fürstentums Lüneburg in Verwaltungsbezirke abgeschlossen. Insgesamt gab es 29 Ämter. Das Amt Celle war flächenmäßig am größten. An zweiter Stelle folgte das Amt Winsen, welches den Rang einer Großvogtei hatte. Ihr Sitz war das herzogliche Schloss. Folgende Unterbezirke waren der Großvogtei angegliedert:
- Vogtei Neuland
- Marschvogtei
- Vogtei Pattensen
- Vogtei Amelinghausen
- Vogtei Bienenbüttel





























