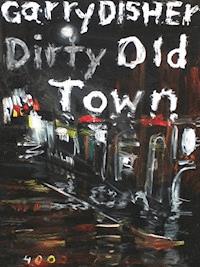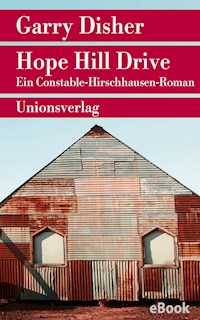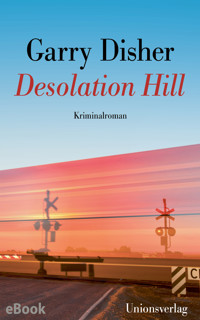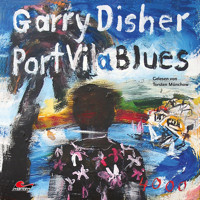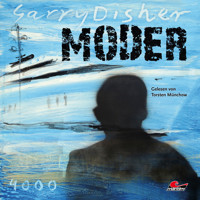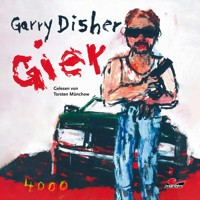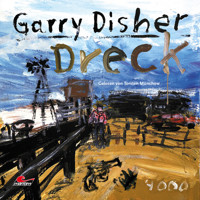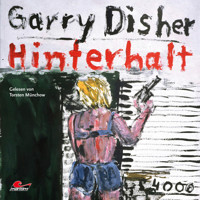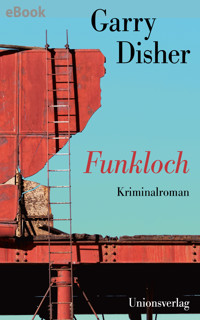9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Frühling erweckt die Halbinsel Mornington zu neuem Leben. Inspector Hal Challis aber ist am anderen Ende von Australien und pflegt seinen schwer kranken Vater. Seine Vertretung Ellen Destry muss einspringen – und sich prompt in einem heiklen Fall behaupten: Eine Vermisstenanzeige landet auf ihrem Schreibtisch, die zehnjährige Katie Blasko ist spurlos verschwunden. Gerüchte über einen Pädophilenring heizen Angst und Verunsicherung auf der Peninsula an. Während Ellen die Suche nach Katie energisch vorantreibt, kann auch Hal Challis das Schnüffeln nicht lassen und begibt sich in seiner Heimatstadt auf Spurensuche nach seinem vermissten Schwager … Ausgezeichnet mit dem Ned-Kelly-Award 2007, dem wichtigsten australischen Krimipreis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 559
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Während Inspector Hal Challis seinen kranken Vater pflegt, muss seine Vertretung Ellen Destry einspringen – und sich prompt in einem heiklen Fall behaupten: Ein Mädchen ist verschwunden, Gerüchte über einen Pädophilenring heizen Angst und Verunsicherung auf der Peninsula an. Da kann auch Hal Challis das Schnüffeln nicht lassen …
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Garry Disher (*1949) wuchs im ländlichen Südaustralien auf. Seine Bücher wurden mit mehreren Preisen ausgezeichnet, darunter zweimal der wichtigste australische Krimipreis, der Ned Kelly Award, viermal der Deutsche Krimipreis sowie eine Nominierung für den Booker Prize.
Zur Webseite von Garry Disher.
Peter Torberg (*1958) studierte in Münster und in Milwaukee. Seit 1990 arbeitet er hauptberuflich als freier Übersetzer, u. a. der Werke von Paul Auster, Michael Ondaatje, Ishmael Reed, Mark Twain, Irvine Welsh und Oscar Wilde.
Zur Webseite von Peter Torberg.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Garry Disher
Beweiskette
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Peter Torberg
Ein Inspector-Challis-Roman (4)
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 2 Dokumente
Die Originalausgabe erschien 2007 unter dem Titel Chain of Evidence bei The Text Publishing Company in Melbourne, Australien.
Die Übersetzung aus dem Englischen wurde unterstützt durch das Australia Council for the Arts.
Originaltitel: Chain of Evidence
© by Garry Disher 2007
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Iain Dainty (Alamy Stock Foto)
Umschlaggestaltung: Peter Löffelholz
ISBN 978-3-293-30353-9
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 17.05.2024, 19:07h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
https://www.unionsverlag.com
mail@unionsverlag.ch
E-Book Service: ebook@unionsverlag.ch
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
BEWEISKETTE
1 – Hier in Victoria firmierte er unter Rising Stars …2 – Freitag war Sergeant Ellen Destrys erster Morgen in …3 – Es war elf Uhr. Ellen wurde erst am …4 – Die Geschworenen zogen sich zur Beratung zurück …5 – Detective Hal Challis war tausend Kilometer weit weg …6 – Kees van Alphen war nach Waterloo zurückgekehrt und …7 – John Tankard saß im Streifenwagen vor dem Haus …8 – Die Abenddämmerung legte sich über Waterloo. Ellen stand …9 – Am frühen Samstagmorgen war Ellen wieder bei Katie …10 – Die Kids aus Seaview Park waren berüchtigt für …11 – Der Tag zog sich in die Länge …12 – Um siebzehn Uhr beendeten Tank und das Team …13 – Tausend Kilometer nordwestlich von Waterloo hatte Hal Challis …14 – Strömender Regen, angekündigt von Blitz und Donner …15 – »Danke, dass Sie alle gekommen sind«, sagte Ellen …16 – Hal Challis kam sich in Mawson’s Bluff langsam …17 – Montag18 – Warum tue ich mir das nur an? …19 – Eddie Tran hatte einen ziemlich abenteuerlichen Lebensweg hinter …20 – Challis verbrachte den Tag mit seinem Vater …21 – Dienstagmorgen lag ein Knistern in der Luft …22 – Katie Blasko war in die Kinderklinik in die …23 – Der Tod von Ted Anderson am Isolation Pass …24 – Operation Visitenkarte25 – Tiefste Dunkelheit, weit nach Mitternacht. Van Alphen und …26 – Als Ellen an diesem Morgen zur Arbeit kam …27 – Eine halbe Stunde später fuhren Ellen und Scobie …28 – Es war Challis zur Gewohnheit geworden, das Haus …29 – Am selben Mittwochnachmittag verzog sich John Tankard nach …30 – Am Donnerstag erfuhr Ellen Destry von einer Psychologin …31 – Im Mittleren Norden von South Australia dachte sich …32 – Die Anschuldigungen der Kinderpsychologin waren schwer, doch Ellen …33 – Challis steckte das Handy in die Hosentasche und …34 – Freitagmorgens kamen die Gemeindeschwester und die Haushaltshilfe der …35 – »Peter Duyker«, sagte Ellen Destry am selben Vormittag36 – Die Zentrale des Tierschutzvereins für den Mittleren Norden …37 – Scobie Sutton musste drei Stunden warten, bis die …38 – »Aber du hattest doch mit ihm zu schaffen« …39 – Ellen Destrys Samstag hatte mit einem einstündigen Spaziergang …40 – Auch Hal Challis hatte eine lange Woche hinter …41 – Am folgenden Montagmorgen war Sasha wieder unterwegs …42 – Es war schon komisch, wieder ein Kind im …43 – Challis beendete sein Telefonat mit Ellen Destry …44 – Dienstagmorgen starrte Scobie Sutton fasziniert den Mann an …45 – Dann traf Duykers Anwalt ein und riet Duyker …46 – Ellen starrte die Leiche an. Blut, Knochensplitter und …47 – Ellen ließ Scobie zurück, damit er die Sache …48 – Bei Hal Challis ging es drunter und drüber …49 – Mittwoch früh wurde Pete Duyker gegen Kaution freigelassen …50 – Der Tag verging, ohne dass Ellen auch nur …51 – Montag zur Mittagszeit stand John Tankard in der …52 – Challis war in der Hauptstelle des regionalen Tierschutzvereins …53 – Scobie Sutton war in der Zwischenzeit zu Hause …54 – Den ganzen langen Montag über wiederholte Ellen wie …55 – Challis schlief schlecht, fuhr am Dienstagmorgen beim ersten …56 – Während Challis beschossen wurde, nahmen Ellen Destry und …57 – Challis wagte einen Blick. Lisa stand hinter der …58 – Ellen schob ihr Essen, das sie kaum angerührt …59 – Als Ellen am Mittwoch zur Arbeit fuhr …60 – Ellen agierte schnell. »Scobie, du fährst zurück nach …61 – Nachdem Scobie Sutton die Leiche von Neville Clode …62 – Es dauerte mehrere Stunden, bis Pam Murphy nach …Mehr über dieses Buch
Über Garry Disher
Garry Disher: Gedanken über die Arbeit am Schreibtisch
Garry Disher: »Ich genieße es, im deutschsprachigen Raum auf Lesereise zu gehen.«
Über Peter Torberg
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Garry Disher
Zum Thema Australien
Zum Thema Spannung
Zum Thema Kriminalroman
Für Crux
1
Hier in Victoria firmierte er unter Rising Stars Agency, oben in New South Wales war es Catwalk Casting gewesen und davor in Queensland Model Miss Promotions. Pete Duyker schätzte, dass ihm wohl noch etwa drei Monate auf der Peninsula bleiben würden, bevor die Bullen und das Oberste Gericht ihm wieder auf die Schliche kommen und ihn dazu zwingen würden, weiterzuziehen.
»Hinreißend«, sagte er und machte ein paar Aufnahmen mit seiner Nikon, in der gar kein Film war, die aber eindrucksvoll groß war und professionell wirkte und all die klickenden und surrenden Geräusche von sich gab, die man von einer solchen Kamera erwartete. Bei seinem anderen Job benutzte er nur Digitalkameras.
Die Mutter lächelte albern. »Fön«, sagte sie, was Pete an einen alten Film erinnerte, wo der Arzt mit seinem Stethoskop sagt: »Bitte freimachen«, worauf die kesse Teenagerin in seiner Praxis erwidert: »Fön, mit dem gröften Vergnügen.« Pete machte noch ein paar Aufnahmen von der fünfjährigen Tochter der Frau. Das strähnige Haar der Kleinen wehte schwach in der Brise, die über Arthur’s Seat strich; hinter dem Kind erstreckten sich malerisch die Bucht und die gebogene Küstenlinie der Halbinsel, die vom Smog vernebelten Wolkenkratzer von Melbourne im Nordwesten waren nur zu erahnen. »Einfach hinreißend«, wiederholte er und knipste weiter.
Nichts an dem Kind war hinreißend. Aber das machte nichts. Viele von ihnen waren hinreißend und hatten im Laufe der Jahre durchaus in sein Konzept gepasst. Dieses Kind hier hatte dürre Beinchen, knubblige Knie, krumme Zähne und trug ein abscheuliches pinkfarbenes Ginghamkleid. Pete hatte nicht lange gebraucht, um herauszufinden, dass Mütter vor Liebe blind sind und der Ehrgeiz für ihre Kinder unerschöpflich.
»Goldig«, sagte Pete jetzt und setzte ein Weitwinkelobjektiv auf die Kamera, das er aus einer seiner Taschen gezogen hatte, die ramponiert und abgewetzt war und bestens zu einem hart arbeitenden Fotografen passte. »Die letzte Aufnahme war einfach goldig.«
Die Mutter, knochig und dürr, in hautengen Jeans und blendend weißem T-Shirt, mit riesiger rauchgrauer Sonnenbrille und hochhackigen Sandalen, strahlte und nickte in den milden Frühling hier auf der Halbinsel hinaus. Sie hatte das hässliche Gesicht einer von Gier zerfressenen Mutter. Sie sah schon ein Portfolio voller schmeichelhafter Fotos von ihrem Kind vor sich, sah die Arbeit beim Fernsehen, die sich daraus ergeben würde, und das alles für nur dreihundertfünfundneunzig Dollar, im Voraus zu entrichten, plus fünfundsiebzig Dollar Anmeldegebühr. In etwa einer Woche würde sie nervös werden und auf seinem Handy anrufen, aber Pete hatte mehrere Handys, die alle nicht zurückverfolgt werden konnten, Wegwerfgeräte.
Pete blickte auf die Uhr. Er hatte der Mutter die Geschichte aufgetischt, dass er zurück nach Melbourne müsse, um die Sedcard einer Klientin aufzufrischen, des Mädchens, das in A Twist in Time, der Soap auf Channel 10, die kleine Bethany spielte.
»Sie hören bis nächsten Freitag von mir«, log er.
»Fön«, lispelte die Mutter, das Kind kratzte sich an der Wade, und Pete Duyker fuhr in seinem weißen Tarago-Van davon und strich die beiden aus dem Gedächtnis.
Es war 14.45 Uhr, ein Donnerstagnachmittag Ende September. Der Unterricht in der Grundschule von Waterloo war um Viertel nach drei zu Ende, er würde es locker schaffen. Zwar blieben ihm immer noch der Freitag und das Wochenende, aber da war es riskant, und außerdem trieb es ihn jetzt dazu, leise und drängend, also musste es heute sein.
Er fuhr weiter in Richtung Westernport, kurvte durch Dörfer und Farmland, an vielen Hügeln erstreckten sich terrassenförmig angelegte Weinberge und Obstgärten. Nicht gerade unberührt, dachte er, als er ein hässliches pseudotoskanisches Anwesen sah; hier und dort standen kleine Gruppen abgestorbener Eukalyptusbäume. Pete grübelte: »Wurzelfäule« nannte man das. Irgend so eine Baumkrankheit. Doch der Gedanke machte ihm nicht zu schaffen, nicht an so einem klaren, ruhigen Tag, an dem die Luft duftgeschwängert und die Halbinsel trunken war vom Frühlingswachstum rings um ihn: Baumblüte, Unkraut, Gras, das neben der Straße in die Höhe schoss, reifte, auch der Zylinderputzer blühte.
Er kam zum Flachland an der Küste und war schon bald in Waterloo. Pete war eine Art Soziologe. Er schaute sich erst gern um, bevor er aktiv wurde, und er wusste bereits, dass Waterloo eine Stadt der Extreme war: reich und arm, städtisch und ländlich, privilegiert und benachteiligt. Die Reichen bekam man nicht allzu oft zu Gesicht. Sie lebten ein paar Kilometer außerhalb der Stadt oder auf Anhöhen, von denen man einen großartigen Blick auf die Bucht hatte, in umgebauten Bauernhäusern oder architektonischen Albträumen. Die Armen wohnten in kleinen Häusern aus Holz und Klinker hinter den paar Einkaufsstraßen von Waterloo oder in neueren, aber genauso deprimierenden Wohnblöcken am Rande der Stadt. Man sah keine Armen, die sich Rasentraktoren kauften, Zaumzeug, Luzernenheu oder den Pinot Noir der Region für dreißig Dollar die Flasche. Nein, die aßen bei McDonald’s, kauften Weihnachtsgeschenke in Ramschläden, tuckerten mit riesigen, alten spritschluckenden Karren mit V-8-Motor durch die Gegend. Sie fuhren nicht Rad, gingen nicht joggen oder ins Fitnessstudio, sondern tauchten in den Arztpraxen mit lange unbehandelt gebliebenen Krankheiten auf, die durch schlechte Ernährung, Alkohol- und Drogenmissbrauch verursacht worden waren, oder mit Verletzungen, die sie sich durch harte körperliche Arbeit in der nahe gelegenen Raffinerie oder auf dem schicken Weinberg eines Reichen zugezogen hatten. Das waren die Extreme. Es gab jede Menge Leute, denen es ganz gut ging, Gott sei Dank, weil sie beim Staat oder der Kommune arbeiteten oder weil Reiche und Arme gleichermaßen auf sie angewiesen waren.
Anfang der Woche war Pete über die Straße, die an den Mangrovensümpfen vorbeiführte, in die Stadt gekommen, doch heute nahm er den direkten Weg durch das Stadtzentrum, fuhr langsam die High Street entlang, dachte nach, bemerkte Veränderungen und Entwicklungen, stellte Verbindungen her. Er hätte darauf gewettet, dass der neue Feinkostladen prächtige Umsätze machen würde, war aber nicht allzu überrascht über die »Zu verkaufen«-Schilder an den Camping- und Elektronikläden; einen Block weiter hatte ein K-Mart eröffnet. Für einen kurzen Moment wurde er stinksauer. Instinktiv stand er aufseiten des kleinen Mannes.
Pete fuhr weiter, kam an ein paar Apotheken vorbei, an einem Reformhaus, einer Bäckerei, der ANZ-Bank, einem Reisebüro, dem Secondhandladen der Heilsarmee, der Bücherei und den Kommunalbehörden. Schließlich weitete sich die High Street hin zum Strandstreifen: ausgedehnte Parkanlagen mit Bäumen, Picknicktische, Skateboardrampen, Mangroven, die einen Ring um die Bucht bildeten, und ein Bereich, der der jährlichen Waterloo Show überlassen worden war. Heute war dort zwar nichts los, aber am Wochenende würden alle Fahrgeschäfte und Sonderausstellungen gut besucht sein.
Pete fuhr an dem Gelände vorbei zum hinteren Ende des Naturschutzgebiets und parkte dort neben einem Toilettenhäuschen, das er schon Anfang der Woche ausgespäht hatte: schmierige Ziegel, verstunken, an seiner Bestimmung ließ es keinen Zweifel. Pete ging hinein, kontrollierte, ob er allein war, und verkleidete sich mit einer grauen Perücke, einem grauen Schnurrbart zum Ankleben, einem weißen Laborkittel und einer schwarzen Hornbrille mit Fensterglas. Dann fuhr er zur Trevally Street und hielt an einer Stelle, wo das Sonnenlicht, das durch die Platanen fiel, Muster auf ihn und seinen Van warf und die Umrisse verzerrte. Er rauchte nicht, aber er hatte an einem Tatort schon die Kippen von anderen Männern weggeworfen, um die Bullen zu verwirren.
Dann wartete er. Er stand neben der offenen Tür des Vans und hielt ein Klemmbrett in der Hand. Die Zeit verging. Vielleicht musste sie nachsitzen, vielleicht war sie im Hort, vielleicht trödelte sie noch auf dem Schulhof herum. Pete ging bis zur Straßenecke und wieder zurück. Sie würde sicher bald kommen, den Fahrradhelm schräg auf den glänzenden Locken, und verträumt vor sich hin radeln, während ihr der Rucksack gegen die mit leichtem Flaum bedeckte Wirbelsäule schlug.
Vielleicht kam sie auch nicht, aber zweimal hatte Pete sie schon dabei beobachtet, wie sie nach der Schule diesen Umweg genommen hatte. Statt auf direktem Weg war sie die Trevally Street entlang bis zum Strandpark gefahren, zu den Verlockungen der Waterloo Show mit ihren Autoscootern, dem Riesenrad, der Verrückten Maus, der Geisterbahn, der Zuckerwatte. Die Kirmes zog alle möglichen Kinder an, aber Pete hatte sich für eines von ihnen entschieden. Er ging auf und ab, die Wagentür war leicht geöffnet, und er lauschte den Bienen, die nicht weit weg in den Rosenbüschen summten.
Dann tauchte sie auf. Genau so, wie er es sich vorgestellt hatte. Er stand da und wartete, als sie näher kam.
Schließlich war sie neben ihm. Er stellte sich ihr in den Weg und sagte: »Deine Mama ist krank geworden. Ich soll dich zu ihr bringen.«
Sie schaute ihn skeptisch an, ganz zu Recht, aber sein Kittel sah nach Arzt aus, nach Krankenpfleger oder Sanitäter, und er setzte auf ihren ureigenen Instinkt, bei ihrer Mutter sein zu wollen. »Ist schon in Ordnung«, sagte er und sah sich nach beiden Richtungen um, »spring rein.« Falls nötig, würde er ihr das Fischputzmesser zeigen.
Sie stieg ganz reizend vom Fahrrad, ihre schlanken Finger spielten an ihrer Halsbeuge, um die Schnalle ihres Helms zu öffnen. Pete war überwältigt. Als sie sich dabei an einem kleinen elektronischen Spielzeug, das ihr an einer Schnur um den Hals baumelte, verhedderte, da juckte es ihm in den Fingern, ihr zu helfen.
»Möchtest du etwas trinken?«, fragte er, nachdem sie sich angeschnallt hatte und Fahrrad, Tasche und Helm auf der Ladefläche lagen. Beide hatten sie das Spielzeug vergessen, das nun auf dem Streifen Gras neben dem krummen Zaun lag. »Limonade«, fügte er hinzu und schüttelte eine alte Isodrinkflasche. »Magst du Limonade?«
Sie nahm die Flasche. Er beobachtete die Schluckbewegungen des Kehlkopfs. »Durstig, hm?«, fragte er wohlwollend.
Dann startete Pete den Wagen. Er wusste, dass das Mädchen unruhig werden würde, bevor das Temazepam Wirkung zeigte. Sie würde wissen wollen, wo ihre Mutter sei und wohin er sie bringen wolle.
Doch diesmal kam es erstaunlicherweise gar nicht dazu. »Ach, was für ein süßes Hündchen«, schwärmte sie.
Hündchen? Was für ein Hündchen? Pete folgte ihrem Blick, und tatsächlich, da lag ein Hund auf dem alten Schlafsack, den er hinten im Wagen liegen hatte, und schaute das Mädchen träge an. Sein Schwanz schlug müde, und er winselte schauerlich.
Muss wohl aufgesprungen sein, als ich gerade nicht hingeschaut habe, dachte Pete. Schnell analysierte er die Lage. Wenn er den Hund jetzt rausschmiss, würde er das Mädchen gegen sich aufbringen. Der Hund beruhigte das Mädchen. Also …
»Wo bringen Sie mich hin?«
»Zu deiner Ma.«
Stirnrunzeln. »Aber die ist nach Melbourne«, sagte die Kleine, als würde ihr das gerade erst wieder einfallen. »Zum Rennen. Sie kommt erst spät nach Hause.«
»Sie hatte auf dem Freeway einen Unfall«, erwiderte Pete.
Das kaufte ihm das Mädchen nicht ab. »Lassen Sie mich raus«, murmelte sie, als das Mittel langsam zu wirken begann.
Sie hatten das Waldstück hinter sich gelassen und waren auf dem Autobahnzubringer. Draußen fuhren Autos, Kinder eierten auf ihren Rädern heimwärts, und auf den Bänken vor dem Laden an der Ecke, dem einzigen in diesem Teil Waterloos, saßen Menschen, schwatzten und aßen Eis. Pete konzentrierte sich. Das Mädchen, das schnell das Bewusstsein verlor, wandte den Blick träge zum Seitenfenster und rief Mrs. Elliott, der Büchereiassistentin ihrer Schule, die gerade einen Liter Milch gekauft hatte, die Worte »Helfen Sie mir« zu. Diese winkte ihr fröhlich und verschwand, genau wie Pete.
Das war am Donnerstag.
2
Freitag war Sergeant Ellen Destrys erster Morgen in Inspector Hal Challis’ Bett. Challis war nicht bei ihr, doch Ellen lag in der Gewissheit da, dass noch irgendeine Spur oder ein Abdruck von ihm vorhanden war.
Sechs Uhr, sagte der Wecker auf dem Nachttisch; draußen war es schon hell genug für ihren üblichen Spaziergang, aber zum Teufel damit. Sie schloss die Augen und gab sich Tagträumen und flüchtigen Eindrücken hin, und die reale Welt trat in den Hintergrund. Challis’ Haus war ein altmodischer Bungalow im kalifornischen Stil auf zwei Morgen Grasland an einer Schotterstraße, ein paar Kilometer landeinwärts von Waterloo. Er hatte sie gebeten, in seiner Abwesenheit das Gras zu mähen, denn in diesem Frühjahr wuchs es besonders üppig. Aber das hatte noch Zeit. Die Plädoyers im Prozess gegen Nick Jarrett vor dem Obersten Gericht sollten heute gehalten werden, aber erst am frühen Nachmittag. Also blieb Ellen Destry liegen und rührte sich kaum.
Das Nächste, was sie wahrnahm, war die Uhrzeit: 8.30 Uhr; sie erwachte aus einem Schlaf voller Träume, von dem sie ganz benommen war. Ihre Gliedmaßen waren schwer, der Kopf wie vernebelt, die Umgebung fremd. Ellen stöhnte. Sie bewegte sich nur schwerfällig und kam nicht dahinter, wie man die Wassertemperatur in der Dusche regelte. Dann döste sie unter dem Wasserstrahl vor sich hin, bis ihr einfiel, dass Challis’ Haus mit Regenwasser versorgt wurde und nicht an einer Wasserleitung angeschlossen war, also beendete sie ihre Dusche. »Haltet die Welt an, ich will aussteigen«, sagte sie dem beschlagenen Spiegelbild. Ihre Wunde am Hals sah böse aus, dabei war es schon Monate her, seit sie die Kugel aus der 9-Millimeter-Browning eines angeheuerten Killers gestreift hatte.
Ihr erstes Frühstück in Challis’ Haus verlief auch nicht einfacher. Der Kaffee kam viel zu schwach aus Hals berühmter Kaffeemaschine, und sie durchschaute die Ordnung nicht, nach der er den Inhalt seiner Schränke und Schubladen sortiert hatte. Und als sie schließlich ihr Müsli löffelte – bio, aus dem High Street Health Shop, zweihundert Meter von der Polizeiwache Waterloo entfernt –, wurde ihr bewusst, wie sehr ihr die Geräusche anderer Menschen fehlten. Als sie noch in Penzance Beach gelebt hatte, dem Ort gleich neben Waterloo, hatte sie Nachbarn gehabt. Und sie hatte mit Mann und Tochter zusammengelebt, um Himmels willen. Stets war da ein behaglicher Hintergrund aus Gemurmel, Türenschlagen und Morgenradio gewesen. Doch nun war das Haus verkauft, die eigene Familie ihr fremd, und sie musste sich damit begnügen, das Haus ihres Chefs zu hüten.
Bei der Arbeit musste sie ihn ebenfalls vertreten. Challis, Leiter der CIU, der Crime Investigation Unit, im Bezirk Ost der Peninsula, war für einen Monat fort, vielleicht auch länger. Familienangelegenheiten. Er schien davon auszugehen, dass sie bis zu seiner Rückkehr wunderbar klarkommen würde, doch in den schlimmsten Momenten ertappte sie sich dabei, wie sie sich auf die Unterlippe biss. Sie spürte eine namenlose, stets präsente Angst. Bei ihrer täglichen Arbeit als Detective bei der CIU hatte sie oft mit bis zu einem Dutzend Fällen gleichzeitig zu tun: manche davon Bagatellen, andere mittelschwere Vergehen, nichts davon außergewöhnlich schwierig, damit konnte sie umgehen. Doch als zeitweilige Leiterin der CIU schien die Aufgabe übermäßig groß. Ellen wusste, dass ihre männlichen Kollegen nur darauf warteten, sie scheitern zu sehen. Vielleicht eine kleine Depression, dachte sie. Sie könnte ja mal mit dem Naturheilkundler sprechen, der im High Street Health kostenlose Beratungen anbot, oder eine Johanniskrautkur machen.
In der Hoffnung, die Reihen unmarkierter Tage würden ihr ein Gefühl von Sicherheit verleihen, warf sie einen Blick auf Challis’ Wandkalender, der neben einer Korkpinnwand hing. Doch vergeblich. Ihr Blick wanderte zu den Fotos, die an der Pinnwand hingen. Darauf war Challis mit dem alten Flugzeug zu sehen, das er restaurierte. Komisches Hobby. Aber immerhin ein Hobby. Welche Interessen hatte sie denn schon außerhalb ihrer Arbeit?
Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die die Welt wieder zurechtrücken. Sie ging mit ihrem Frühstück auf die Terrasse hinaus, wo die Morgensonne sie empfing. Bald drängten sich Enten watschelnd ins Bild, ein Erpel, eine Ente und sieben Küken – von ehemals zehn, ein Fuchs hatte zugeschlagen, so Hal. Sie kümmerten sich nicht um Ellen, sondern suchten im blühenden Gras, das hier draußen, weit weg von der Stadt, als Rasen durchging, nach Futter.
Ein weiterer Grund, noch nicht zu mähen. Sie rekelte sich und überlegte, ob Challis wohl auch gern in der Sonne frühstückte. Sie versuchte, es sich vorzustellen. Sie sah Toast, Kaffee und eine Zeitung vor sich, aber seltsamerweise keine Frau. Es hatte Frauen gegeben, doch er saß allein beim Frühstück, daran dachte sie gerade, als das Telefon klingelte. Scobie Sutton war dran, einer der Detective Constables unter ihrem Kommando. »Ellen? Wir haben ein vermisstes Kind.«
Na und?, wollte Ellen schon sagen. Jeden Tag verschwanden Kinder. Das war eine Aufgabe für die Streifenbeamten, nicht für die CIU. »Wie schlimm ist es?«, fragte sie stattdessen.
»Katie Blasko, zehn Jahre alt, wird seit gestern vermisst.«
»Seit gestern? Wann sind wir informiert worden?«
»Die Streifenbeamten sind vor einer Stunde benachrichtigt worden.«
Ellen schloss die Augen. Sie konnte einfach nicht verstehen, wie sorglos, gemein oder dumm manche Eltern sein konnten. »Ich komme, so schnell ich kann.«
Katie Blasko wohnte in einem Haus an der Trevally Street in Waterloo, ein paar Blocks von den Mangrovensümpfen und dem Jachthafen entfernt. Das Haus war klein, ein gelblicher Klinkerbau mit einem Ziegeldach und verrottetem Dachvorsprung. Ellen traf Scobie am Gartentor. Der Detective trug einen seiner Begräbnisanzüge, die seine Ernsthaftigkeit und seine tollpatschig wirkende, dürre Gestalt noch unterstrichen. Ein paar Häuser weiter klopften zwei Streifenbeamte an Türen, Pam Murphy und John Tankard.
»Was gibt es bisher?«, fragte Ellen.
Scobie klappte sein Notizbuch auf und setzte zu einer langen, monotonen Berichterstattung seiner bisherigen Ermittlungen an. Katie Blasko war am Vortag in der Grundschule gewesen, danach aber nicht mehr gesehen worden. »Es hat da ein Missverständnis gegeben. Eigentlich sollte sie letzte Nacht bei einer Freundin übernachten.«
Ellen notierte sich die wichtigsten Namen, Adressen und Telefonnummern. Dann warf sie einen Blick auf die Uhr. »Du gehst zur Schule. Rede mit Katies Lehrern und Klassenkameradinnen. Ich komme nach, sobald ich hier fertig bin.«
»Alles klar.«
Ellen trat durch das kleine Tor und ging zur Haustür. Die Frau, die auf ihr Klingeln öffnete, war dürr, nervös, trug Jeans und T-Shirt. Sie wirkte völlig erschöpft und flehte Ellen an: »Haben Sie sie gefunden?«
Ellen schüttelte den Kopf. »Noch nicht, aber machen Sie sich keine Sorgen, das ist nur eine Frage der Zeit. Warum gehen wir nicht rein und Sie erzählen mir alles.«
»Ich hab doch der Polizei schon alles gesagt. Einem Typen namens Scobie.«
Ihre Stimme klang mürrisch und verzweifelt, wofür ihr Ellen keine Vorwürfe machen konnte. »Wenn wir das Ganze nur noch einmal durchgehen könnten, Mrs. Blasko«, erwiderte sie sanft.
Da wäre zum Beispiel die Frage, warum Sie so lange gewartet haben, bevor Sie Ihre Tochter als vermisst gemeldet haben.
Das Wohnzimmer der Blaskos war ein winziges Loch, das mit einem überdimensionierten Sofa und einem Widescreen-Fernseher vollgestellt war. Ein sechsjähriges Mädchen lag ausgestreckt auf dem Boden und zog winzige, gummiartige Kleider und Hosen über die leblosen Plastikgliedmaßen von Polly-Pocket-Puppen. Währenddessen sang sie ihnen abwechselnd vor, oder sie sprach mit ihnen. Eine Katze, die auf dem Teppich unter einem klobigen Beistelltisch saß, zuckte mit dem Schwanz. Und wie Scobie schon gesagt hatte, gab es da noch einen Mann, Donna Blaskos Lebensgefährten Justin Pedder. Ellen war nicht im Mindesten überrascht, einen untersetzten, in Jeans und T-Shirt gekleideten Mann anzutreffen, der sich den Kopf kahl rasiert hatte. Wenn man in Australien ein hart arbeitender Mann und zwischen zwanzig und vierzig war, dann kleidete man sich eben so. Ohne jede Fantasie. An der mangelte es wohl auch den Eltern, die einen Justin, Darren oder Brad tauften.
Himmel, hast du schlechte Laune heute, dachte Ellen.
Donna setzte sich neben Pedder und meinte knapp: »Das ist Justin.«
Ellen nickte. Sie hatte seinen Namen durch die Datenbanken gejagt, nachdem sie auf dem Revier eingetroffen war. Und als ob er das in ihrem Blick lesen konnte und sie ablenken wollte, raunte er ihr zu: »Sie sollten lieber draußen nach Katie suchen, statt uns schon wieder zu löchern.«
Etwas anderes hätte sie auch nicht von ihm erwartet. So stand es im Drehbuch. Ellen starrte eine gelbe Lavalampe an, die auf einem leeren Bücherregal stand, und erwiderte: »Meine Leute klopfen gerade in der Gegend an jede Haustür. Also, Constable Sutton zufolge waren Sie gestern Nachmittag in der Stadt, richtig?«
»Das Frühlingsfest«, antwortete Pedder.
Das Pferderennen. »Und, was gewonnen?«
Pedder grinste sie an, nach Lachen schien ihm nicht zumute zu sein. »Sie wollen die Wettscheine sehen, richtig? Um zu beweisen, dass wir da waren?«
Ellen machte weiter. »Und Katie hat ihren eigenen Schlüssel?«
»Sie macht sich was zu essen«, antwortete Donna, »erledigt ihre Hausaufgaben und schaut fern, bis wir nach Hause kommen. Dann wird der Fernseher ausgemacht. Sie darf nachdem Abendessen nicht fernsehen. Sie ist ein anständiges Mädchen.«
Und wir sind auch anständige Eltern, dachte Ellen. »Und gestern Abend?«
»Donna und ich machen donnerstags gern was zusammen«, sagte Pedder. »Shoppen, oben in Southland. Kino. Pferderennen. Wenn wir später kommen, schläft Katie bei einer Freundin. Das ist schon fast wie ihr zweites Zuhause.«
Da kriegt sie bestimmt mehr Liebe zu spüren als hier, dachte Ellen. Sie schaute auf in ihre Notizen. »Die Freundin heißt Sarah Benton?«
»Ja.«
»Und für letzte Nacht haben Sie auch was ausgemacht?«
»Ja.«
»Wann sind Sie vom Pferderennen nach Hause gekommen?«
»Gegen sieben.«
»Sieben Uhr abends. Und warum haben Sie nicht angerufen, um zu erfahren, ob alles in Ordnung ist?«
Die beiden zuckten mit den Schultern, als wollten sie sagen: Warum sollten wir?
»Aber Sie haben heute Morgen angerufen?«
»Ja«, antwortete Donna und schluchzte plötzlich los, ihr Gesicht war tränenüberströmt und zerknittert. »Sarahs Ma meinte, Katie ist nicht bei ihnen, ist auch nicht zu ihnen gekommen, und sie weiß von nichts.«
»Aber ich dachte, Sie hätten was ausgemacht?«
Donna wand sich. »Katie sollte Sarah fragen, ob sie übernachten kann. Muss sie wohl vergessen haben.«
Ellen wechselte gern schnell das Thema. »Leben Sie hier, Mr. Pedder?«
»Ich?«
Ellen sah sich im Zimmer nach anderen Mr. Pedders um.
»Ja.«
»Klar.«
»Aber das hier ist Donnas Haus, richtig?«
Er sah sie ausdruckslos an. »Ich weiß, worauf Sie hinauswollen. Ja, ich hab ne eigene Bude, von der keiner was weiß, und ich hab Katie dort hingebracht und sie umgebracht.«
»Justin!«, heulte Donna auf.
»Tut mir leid, Schatz. Aber das ist wieder mal so was von typisch. Immer sind die Kerle schuld.«
»Wir würden unsere Arbeit nicht richtig machen, Mr. Pedder, wenn wir nicht jede Möglichkeit in Betracht ziehen würden.«
»Ich weiß, ich weiß, tut mir leid, was ich gesagt habe. Hören Sie, ich hatte meine eigene Wohnung, bis ich Donna kennengelernt habe.«
»Und Sie verbringen Ihre Nächte stets hier?«
»Ach, interessieren Sie sich jetzt für mein Sexleben?«
»Beantworten Sie nur meine Frage, Mr. Pedder.«
»Er lebt hier«, betonte Donna. »Er ist jede Nacht hier.«
Ellen wandte sich an Donna. »Hat das Katie gestört?«
»Nein. Warum? Justin ist gut zu Katie, oder, Jus? Er schlägt sie nie oder so was. Keine komischen Sachen, falls Sie darauf anspielen.« Die beiden starrten jetzt wütend Ellen an. »Wir müssen solche Fragen leider stellen«, sagte sie.
Scobies ersten Ermittlungen zufolge hielten die Nachbarn Donna für eine ganz passable Mutter, aber es hatte im Laufe der Jahre schon mehrere Freunde gegeben. Ein paar Mal war die Polizei gerufen worden, um bei lauten Partys einzuschreiten. Sarah Bentons Mutter behauptete, es habe keinen Sinn, die Blaskos nach sieben Uhr abends anzurufen, denn da kippten sich Donna und Justin einen hinter die Binde und gingen nicht mehr ans Telefon. Und wenn man auf den Anrufbeantworter sprach, riefen sie nie zurück. Das Übliche eben, nach Ellens Erfahrung. Keine offene Gewalt, nur Dummheit und wohlwollende Vernachlässigung – dazu Mütter, die ihre Partner den Kindern vorzogen aus Angst, wieder allein zu sein.
»Vielleicht weiß Katies kleine Schwester etwas?«
»Shelly?«, entgegnete Donna überrascht. »Shelly war nebenan, oder, Shelly?«
Das Kind spielte ungestört weiter.
»Nebenan?«, fragte Ellen.
»Bei Mrs. Lucas. Sie passt gern auf Shell auf, aber Katie kann sie nicht ausstehen.«
Ellen beobachtete Pedder. Offenbar entzückt von der niedlichen Kleinen, die da auf dem Boden spielte, streckte er seinen knallbunten Laufschuh aus und stupste ihr gegen die winzige Taille. Das Kind schob den Fuß geistesabwesend fort. Keine Angst oder Unterwürfigkeit, bemerkte Ellen. Das Kind war ihr nicht vorgestellt worden. Ellen hatte ihre Tochter immer vorgestellt, schon als Kleinkind. Das gehörte sich so. Hatte Ellen die guten Manieren von ihren Eltern gelernt? Sie konnte sich nicht erinnern. Andererseits waren gute Manieren doch wohl eine Frage des gesunden Menschenverstands.
Ich bin heute aber auch mal schlecht drauf. Spitz fragte sie: »Als Ihnen klar wurde, dass Katie letzte Nacht nicht bei Sarah geschlafen hat, was haben Sie da gemacht?«
»Ich hab rumtelefoniert.«
»Wen haben Sie denn angerufen?«
»Meine Ma«, antwortete Donna. »Die lebt in Frankston.«
»Sie haben gedacht, dass Katie bei ihrer Oma ist? Warum?«
Pedder warf Donna einen kurzen Blick zu. »Hören Sie«, sagte er, »sie läuft manchmal weg, okay?«
»Ah.«
»Sie kommt immer zurück.«
»Läuft sie vor Ihnen weg?«, wollte Ellen wissen.
»Nein«, antwortete Pedder kurz.
»Wir finden sie meistens bei meiner Ma oder bei einer ihrer Freundinnen, aber diesmal hat sie niemand gesehen«, sagte Donna. Wieder schossen ihr Tränen in die Augen, die sie mit einem feuchten, zerknüllten Taschentuch wegwischte. Neben ihr stand eine ganze Schachtel davon, eine billige, No-Name-Marke aus dem Supermarkt.
»Und dann haben Sie die Polizei angerufen?«
»Ja«, antwortete Pedder.
»Wie oft ist Katie schon weggelaufen?«
»Nicht oft. Ein paar Mal.«
»Streiten Sie sich mit ihr? Schlagen Sie sie, wenn sie was ausgefressen hat?«
»Wir haben sie noch nie geschlagen.«
»Auseinandersetzungen? Streitereien?«
»Nicht mehr als in anderen Familien auch.«
»Und was ist mit Mittwochabend, Donnerstagmorgen?«
»Da ist nichts gewesen.«
»Hat sie jemals Zeit im Internet verbracht?«
»Na ja, für die Hausaufgaben und so«, antwortete Donna.
Pedder war schneller. »Wollen Sie damit sagen, ob sie Zeit in Chatrooms verbracht hat? Glauben Sie, sie ist an einen Kinderschänder geraten, der sie entführt hat?«
»Was glauben Sie?«
»Ich habe Sie gefragt.«
»Wir werden uns alle Computer anschauen müssen, die Sie haben«, meinte Ellen. »Wir geben Ihnen eine Bescheinigung dafür.«
»O Gott«, entfuhr es Donna.
»Wir benötigen außerdem eine Liste von Katies Freunden und Bekannten.«
Donna schluchzte. »Glauben Sie, sie hat im Internet so einen Perversling kennengelernt?«
»Äußerst unwahrscheinlich«, beruhigte Ellen sie. »Ist sie jemals verschwunden?«
»Das haben wir doch schon gesagt.«
»Nicht weggelaufen, meine ich. Ist sie eine Tagträumerin? Vielleicht schlendert sie gern durch Schluchten, am Strand, über Felder, stöbert in verlassenen Häusern.«
»Eigentlich nicht.«
»Auch nicht am Strand? Das hab ich als Kind immer gemacht.«
Sie hatte nichts dergleichen getan. Sie war in den Bergen aufgewachsen. Ihre eigene Tochter war gern am Strand entlangspaziert, als sie noch klein war, als Ellen und ihr Mann und Larrayne noch eine glückliche Familie gewesen waren.
»Vielleicht mit ihren Freundinnen, am Wochenende, aber sie muss erst um Erlaubnis fragen«, antwortete Donna, ganz die verantwortungsbewusste Mutter.
»Glauben Sie, sie ist ertrunken?«, fragte Pedder.
Donna stöhnte auf. Ellen warf Pedder einen Blick zu, der ihn erblassen ließ. »Was ist mit dem Gebiet zwischen hier und dem Highway?«
»Katie hat Angst vor Schlangen«, antwortete Donna.
Die hatte Larrayne auch gehabt.
Sie hatten alles gesagt. Ellen sammelte ihre Notizen zusammen und stand auf.
»Was glauben Sie, ist meinem Baby zugestoßen?«, flüsterte Donna.
Auch das stand im Drehbuch: diese Worte und die Flüsterstimme. »Jeden Tag verschwinden Kinder«, meinte Ellen mit warmer Stimme. »Und sie tauchen immer wieder auf.«
Dabei warf sie Justin Pedder einen Blick zu, um ihn davon abzuhalten, das Offensichtliche auszusprechen.
3
Es war elf Uhr. Ellen wurde erst am frühen Nachmittag im Obersten Gericht erwartet. Sie verabschiedete sich von Donna Blasko und Justin Pedder, rief Scobie Sutton auf dem Handy an und traf sich mit ihm vor Katie Blaskos Grundschule. »Ich muss dir die Angelegenheit für ein paar Stunden überlassen«, sagte sie zu ihm. »Möglicherweise ist Katie einfach nur weggelaufen. Aber warum sollte sie dann so lange wegbleiben? Um sicherzugehen, sollten wir weiter die Häuser abklappern, Krankenhäuser kontrollieren, Familie und Freunde kontaktieren. Ich werde zu Kellock gehen. Wir brauchen noch mehr Streifenbeamte.«
»Danke.« Scobie schauderte. »Ein vermisstes Kind. Ich hasse so was, Ellen.«
Scobie Sutton war ganz vernarrt in seine eigene Tochter Roslyn, ebenfalls zehn. Er konnte einen mit ihr ziemlich nerven. »Melde dich im Laufe des Tages immer mal wieder«, trug Ellen ihm auf. »Ruf mich an, oder schick mir eine SMS, falls du irgendwas herausbekommst.«
Das Polizeirevier lag am Kreisverkehr, wo die High Street begann. Ellen parkte hinter dem Gebäude und ging hinein. Als Erstes ging sie zu ihrem Postfach, aus dem sie einen Stapel Briefe und Memos fischte. Sie traf Kellock, den uniformierten Senior Sergeant, der das Revier leitete, in seinem Büro an. Kellock war ein Bär von einem Mann, sein massiger Kopf mit den Koteletten saß ohne erkennbaren Halsansatz auf dem Rumpf. Er hatte Schnitte an seinen Pranken. Er strich sich verlegen über die Hemdsärmel und brummte: »Hab die Rosen geschnitten.«
Ellen wollte schon erwidern, dass sie Hal Challis’ Rasen eigentlich längst hätte mähen müssen, konnte sich aber noch bremsen. Sie wollte nicht herumposaunen, dass sie in Challis’ Haus wohnte. Kellocks Diensttelefon klingelte. »Einen Augenblick«, sagte er.
Ellen ging ihre Post durch, während Kellock sein Telefongespräch führte. Der Großteil landete im Papierkorb, der Rest im Eingangskorb. Ein Memo machte sie wütend. Es stammte von Superintendent McQuarrie: »Die finanzielle Lage zwingt uns, alle gerichtsmedizinischen Untersuchungen von ForenZics, einem unabhängigen Speziallabor in Chadstone, durchführen zu lassen. ForenZics verlangt nicht nur bedeutend weniger Gebühren, das Labor liegt auch näher, und die versprochene Bearbeitungszeit ist kürzer als im Bundeslabor.« Ellen schüttelte den Kopf. Sie hatte noch nie von ForenZics gehört. Challis und sie hatten stets mit Freya Berg und ihren Kollegen im Bundeslabor zusammengearbeitet.
In diesem Augenblick knurrte Kellock: »Das ist der reinste Abschaum.«
Ellen sah ihn fragend an. Kellock legte eine fleischige Hand auf die Muschel und erläuterte: »Sergeant van Alphen ist dran. Er sitzt gerade im Gericht und sagt, Nick Jarretts Familie habe ständig dazwischengequatscht und gestört.«
»Das überrascht mich nicht«, erwiderte Ellen.
Kellock ging nicht darauf ein und bellte ins Telefon: »Ich will, dass vor ihrem Haus die ganze Nacht ein Wagen steht, verstanden?«
Er hörte sich die Antwort an, legte auf und sagte dann zu Ellen: »Wenn ihn die Geschworenen freisprechen, werden die Jarretts nach Hause fahren und eine Party schmeißen. Wenn sie ihn verurteilen, werden die Jarretts eine Art Totenwache abhalten. So oder so, wir werden keinen großen Spaß daran haben. Also, wie kann ich Ihnen helfen?«
»Katie Blasko, zehn Jahre, wird seit gestern vermisst.«
Ellen war nicht sicher, ob Kellock sie gehört hatte. Sein Gesicht wirkte so reglos wie Granitschotter, doch hinter dieser Fassade war er wahrscheinlich immer noch wütend und rachsüchtig, was die Jarretts betraf. Dann veränderte sich etwas. Kellocks Mundwinkel bewegte sich. Ellen hielt es für ein Lächeln. Bei Kellock konnte man sich da nie ganz sicher sein, erst wenn er etwas sagte. »Und Sie brauchen ein paar Streifenbeamte für die Suche?«
»Falls Sie sie entbehren können.«
»Sie haben schon Murphy und Tankard. Ich könnte noch ein paar abstellen, vielleicht ein, zwei Leute, die auf Probe sind.«
Ellen verzog das Gesicht. Der ständige Mangel an verfügbaren Polizeikräften auf der Halbinsel erschwerte die Arbeit von ihnen beiden. »Danke. Wenn wir sie nicht bald finden, werden wir noch mehr Leute brauchen und müssen noch mehr Überstunden machen.«
Kellock nickte. »Ich mache das dem Boss klar.«
Damit meinte er Superintendent McQuarrie. Man munkelte, dass Kellock als McQuarries V-Mann diente, aber das konnte auch von Vorteil sein, wenn er dafür in der Lage war, im Ernstfall Verstärkung anzufordern.
»Danke, Kel.«
»Wir werden sie schon finden, Ells, machen Sie sich keine Sorgen.«
Kellock war ein Fels und strahlte Zuversicht aus. Ellen fühlte sich gleich ein wenig besser.
Auf ihrem Weg in die Stadt geriet sie in dichten Verkehr. Sie brauchte anderthalb Stunden, um nach Melbourne zu gelangen und einen Parkplatz in der Nähe des Obersten Gerichts zu finden. Als sie den Gerichtssaal betrat, war es bereits vierzehn Uhr, und sie erschrak, als sie dort McQuarrie sah.
»Sie sind spät dran, Sergeant.«
»Entschuldigung, Sir«, murmelte Ellen und rutschte auf die Bank. Dabei wirbelte sie die Luft auf, schwacher Geruch von Bohnerwachs und Möbelpolitur breitete sich aus.
McQuarrie rümpfte die Nase, das konnte er gut, fand Ellen. Er war ein adrett gekleideter, penibler Mann, ohne Sinn für Humor, der sich zu einer trostlosen Form von Christentum bekannte wie so viele Minister der Bundesregierung. Ellen warf einen Blick an McQuarries teurer Paradeuniform vorbei zu Sergeant Kees van Alphen, der zusammen mit Ellen vor vielen Monaten Nick Jarrett verhaftet hatte und dabei behilflich gewesen war, den Fall für die Staatsanwaltschaft zusammenzustellen. Alphen zwinkerte Ellen zu, sie grinste zurück.
Sie schaffte es, sich zu sammeln, und zwang sich zur Ruhe. Schon bald war klar, dass sie noch nicht allzu viel vom Schlussplädoyer des Staatsanwalts versäumt hatte. Der Mann, der alles andere als präsent war, leierte seine Rede monoton herunter, dabei schrie der Prozess gegen Nick Jarrett doch nach allem nur aufzubringenden staatsanwaltlichen Zorn. Er endete mit einem schwachen Schlussappell.
Nick Jarretts Anwalt sprang auf, legte eine Hand auf die Schulter seines Klienten und verkündete: »Es gibt da begründete Zweifel, meine Damen und Herren Geschworenen.«
Ellen schnaubte ungläubig. McQuarrie sah sie verstimmt an, desgleichen der Richter. Ellen kümmerte sich nicht um die beiden. Begründete Zweifel? Nick Jarrett war vierundzwanzig, ein drahtiger, dürrer Speedjunkie, der heute in einem Anzug herumzappelte, der direkt aus dem Laden der Heilsarmee in Waterloo zu stammen schien. Er konnte kaum lesen, war aber ein schlaues Kerlchen, und er wurde eher von Amphetaminen und niederen Instinkten gelenkt als von seinem Verstand. Junge Männer wie Nick Jarrett wurden Tag für Tag durch die Gerichte geschleust. Die Drogen und der Alkohol hatten sie gewalttätig und unberechenbar werden lassen. Sie verletzten Menschen und wurden selbst verletzt. Sie machten dumme Fehler und wurden verhaftet. Aber nicht alle überfuhren zum Spaß Radfahrer.
An einem Tag im Mai waren Nick Jarrett und sein Kumpel Brad O’Connor mit ihrer neuesten Geschäftsidee zugange, Autodiebstahl. Sie hatten bereits im März sechs Autos gestohlen und waren langsam auf den Geschmack gekommen. Man hing einfach auf einem Parkplatz herum, wie zum Beispiel dem staubigen Besucherparkplatz eines Krankenhauses, wo es keine Überwachungskameras gab, bis irgendwann eine Frau aufkreuzen würde, die blind vor Tränen war, weil ihr Mann gerade auf der Intensivstation im Sterben lag, oder blind vor Freude, weil sie gerade Großmutter geworden war, dann hielt man ihr eine mit Blut gefüllte Spritze unter die Nase, bevor sie sich anschnallen konnte. Manchmal nahm man sie nur so noch zum Spaß mit, fuhr in die Mitte von Nirgendwo und setzte sie dann aus.
Die ersten fünf gestohlenen Wagen waren niemals wiedergefunden worden. Nick und Brad hatten sie wohl auf Bestellung geklaut, nahm Ellen an, und dann sofort zum Ausschlachten oder direkt in einen Schiffscontainer gebracht. Aber darum ging es heute vor Gericht nicht. Der Anklagepunkt lautete auf vorsätzliche Tötung mit einem Fahrzeug, und die Polizei hatte den sechsten Wagen beschlagnahmt, der ein paar – zugegeben nicht unbedingt zwingende – gerichtsmedizinische Beweise geliefert hatte.
Der junge Nick Jarrett spielte während der Fahrt mit seinen gestohlenen Autos auch gern Katz und Maus mit Radfahrern und Fußgängern. Er war darin richtig gut geworden, stellte sich mit Bremsen und Lenkrad sehr geschickt an. Um seinen Opfern noch einen besonderen Kick mitzugeben, öffnete er im letzten Augenblick die Fahrertür, schaute zu, wie die Schulkinder und alten Damen sich duckten und auszuweichen versuchten oder sich auf den Asphalt warfen. Nick hatte schon immer gern mit Autos rumgespielt. Er hatte sich nie was Böses dabei gedacht.
Am 13. Mai allerdings hatte er einen Mittelstreifen überfahren und sich ein wenig verschätzt. Na ja, ein wenig mehr als nur verschätzt. Tony Balfour, fünfzehn, war auf dem Heimweg von der Schule gewesen. Er hätte das Leben noch vor sich gehabt, schrieben die Zeitungen, brutal aus dem jungen Leben gerissen, all das. Doch nicht nur das, er war zudem noch der Sohn eines beliebten Zivilangestellten auf dem Polizeirevier Waterloo gewesen.
Ellen und van Alphen wollten ihn wegen Mord drankriegen, doch der Staatsanwalt hatte die Anklage auf grobe Fahrlässigkeit zurückgestuft. Schließlich hätte der süchtige Nick ja beim Fahren unter Drogen- und Alkoholeinfluss gestanden.
Und nun hatte sein Verteidiger die Kaltblütigkeit, auf berechtigte Zweifel zu pochen, und wie Ellen bemerkte, stellte er sich dabei gar nicht dumm an. Sie erstarrte, als sie das nachdenkliche Kopfnicken der Geschworenen bemerkte. Sie hatten während des gesamten Prozesses keine Regung gezeigt, doch nun schien die Aussage von Nicks Kumpel Brad O’Connor auf ziemlich wackligen Beinen zu stehen. Es stimmte schon, Brad hatte gegen seinen Freund ausgesagt, aber hatte er das getan, um sein schlechtes Gewissen zu beruhigen und Gerechtigkeit widerfahren zu lassen? »Ich glaube nicht«, donnerte Nicks Anwalt. »Mr. O’Connor ließ sich dabei von böser Absicht und Gier leiten: böse Absicht, weil seine ihm gesetzlich angetraute Ehefrau ein Verhältnis mit meinem Mandanten hatte, und Gier, weil er es auf die fünfzigtausend Dollar Belohnung abgesehen hatte, die die Familie des Opfers ausgesetzt hat. Wenn wir dazu die Tatsache berücksichtigen, dass es keinerlei gerichtsmedizinische Beweise gibt, dass mein Mandant überhaupt in dem Unfallwagen gesessen hat, mit dem dieser Schlag ausgeführt wurde, dann bleibt Ihnen, meine Damen und Herren Geschworenen, keinerlei Alternative, als festzuhalten, dass es berechtigte Zweifel gibt, und meinen Mandanten freizusprechen.«
»Ich dachte, die Spuren beweisen das«, knurrte McQuarrie aus dem Mundwinkel heraus. »Ich dachte, die Sache sei hieb- und stichfest, Sergeant Destry.«
»Die Spuren bringen das Opfer mit dem Fahrzeug in Verbindung, aber nicht mit Jarrett, Sir, doch selbst unter diesen Umständen …«
McQuarrie bedeutete ihr, den Mund zu halten. Ellen zuckte zusammen. Sie warf einen Blick über die Schulter. Mutter und Schwester des toten Jungen saßen weinend auf der einen Seite des Gerichtssaals, die Jarrett-Sippe belegte drei Reihen auf der anderen Seite. Sie waren während des gesamten Prozesses stets anwesend gewesen, hatten sich lautstark bemerkbar gemacht und grinsten nun die Vertreter der Anklage an. Sie dachten offenbar, dass wirklich berechtigte Zweifel bestünden. Mit einer Ausnahme: der Patriarch der Familie, Laurie Jarrett, fünfzig, steinhart und reglos. Er starrte Ellen an, als habe er in seinem ganzen Leben weder Gedanken noch Gefühle gehabt.
4
Die Geschworenen zogen sich zur Beratung zurück, das Warten hatte begonnen. Stunden. Tage. Ellen verließ das Gerichtsgebäude und warf einen Blick auf ihre Uhr. Später Nachmittag, aber es war Freitag, und der Verkehr dürfte in jede beliebige Richtung die reinste Hölle sein. Ellen biss sich unentschlossen auf die Lippe: zurück nach Waterloo und weiter nach Katie Blasko suchen oder bei der Tochter vorbeischauen?
Sie nahm ihr Handy aus der Tasche. »Scobie, ich bins. Gibts was Neues?«
»Noch nicht. Bei dir?«
»Die Geschworenen beraten sich. Hör mal, ich möchte gern zu Larrayne fahren, wo ich doch schon in der Stadt bin.«
Sutton sagte nichts, Ellen konnte sich sein düsteres Gesicht ausmalen. »Geht in Ordnung, denke ich.«
Ellen wollte erwidern, dass sie seine Erlaubnis gar nicht bräuchte. Dann fragte sie sich, ob er es ihr wohl übel nahm, dass sie nicht sofort zurückeilte, um bei der Suche nach Katie Blasko zu helfen. »Ich bin vor fünf zurück. Ich will noch mal mit den Eltern reden.«
»Alles klar.«
Der Mann machte sie rasend. Ellen wählte eine andere Nummer. »Hallo, Schätzchen. Ich bin in der Stadt. Ist es okay, wenn ich bei dir reinschneie, um Hallo zu sagen?«
Ellens Tochter war neunzehn, studierte seit Kurzem Gesundheitswissenschaften und teilte sich in Carlton ein Haus mit zwei anderen Studentinnen. In letzter Zeit war sie immer kratzbürstig. Sie gab Ellen die Schuld, dass die Familie zerbrochen war. »Ich sollte eigentlich lernen, Ma. Habe bald Examen.«
»Ich bleibe auch nicht lange, versprochen.«
Larrayne seufzte schwer. »Na gut, wenn du unbedingt willst.«
Eine Ohrfeige, die saß. Ellen holte ihren Wagen, fuhr an den gläsernen Bürotürmen im Geschäftszentrum von Melbourne vorbei und kämpfte sich durch den Verkehr bis in den innerstädtischen Vorort Carlton vor. In den prosperierenden Jahren nach dem Goldrausch in den Fünfzigerjahren des 19. Jahrhunderts hatten hier vor allem Arbeiter gelebt. In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts war Carlton größtenteils nur noch verwahrlost gewesen, dann Heimstatt für die Wellen italienischer und griechischer Einwanderer nach dem Zweiten Weltkrieg. Nun war die Gegend besonders bei Yuppies begehrt, die eine halbe Million Dollar für ein kleines Ziegelhäuschen in den Seitenstraßen hinblätterten, um dort zu leben oder es an Studenten wie Larrayne Destry zu vermieten. Ellen wusste, warum die Gegend so beliebt war: Die Universitäten, Chinatown und die Boutiquen und Kinos in der Innenstadt waren gut zu Fuß oder mit der Straßenbahn zu erreichen.
Ellen parkte vor einem Hydranten und hoffte, sich keinen Strafzettel einzufangen. Die Straßen waren auf beiden Seiten von kleinen europäischen und japanischen Automodellen gesäumt, Parkhäuser waren hier Mangelware. Mittlerweile war es schwer zu erkennen, ob die Audis und Subarus den studentischen Mietern oder den Yuppiebesitzern gehörten. Beim Toyota Camry Baujahr 1991 ihrer Tochter war das anders. Das war unzweifelhaft ihr erster Wagen, eine Studentenkarre.
Ellen benutzte den eisernen Türklopfer an der Haustür. Larrayne öffnete erst nach einer ganzen Weile, und Ellen fielen kleine Widersprüche auf. Ihre Tochter wirkte nervös, Strähnen hingen aus dem hochgesteckten Haar, ihr T-Shirt war zerknittert, gleichzeitig aber wirkte sie mit der eleganten Lesebrille, die ihr ein Jahr zuvor verschrieben worden war, wie eine fleißige Studentin.
Mutter und Tochter küssten und umarmten sich kurz. »Ich bleib nicht lange«, wiederholte Ellen.
»Okay.«
Hinter der Fassade des Hauses, die seit der Kolonialzeit unverändert geblieben war und nun durch kommunale Vorschriften unter Denkmalschutz stand, lag ein kurzer Flur mit geschlossenen Schlafzimmertüren, der in einem großen luftigen Wohnzimmer endete. Wie üblich waren ein paar Innenwände entfernt und Oberlichter, ein Zwischengeschoss und hinten eine Sonnenterrasse ein- und angebaut worden. Das Mobiliar bestand aus einem Sammelsurium an Secondhandsesseln, Ikeahockern und hellen, billigen Teppichen und Kissen. Ein Bursche von etwa zwanzig sprang aus einem der Sessel auf. Er war schlaksig, trug Ohrringe und hatte struppiges, kurz geschnittenes Haar. »Hi, Mrs. Destry. Ich bin Travis.«
Freund? Neuer Mitbewohner? Ellen warf Larrayne einen Blick zu, doch die fragte nur ausdruckslos: »Tee? Kaffee?«
»Kaffee.«
Ellen blieb dreißig unerträglich lange Minuten. Ihre Tochter war nicht ansprechbar, was der junge Bursche wieder wettmachte, indem er ununterbrochen schwatzte. Schließlich warf Ellen einen Blick auf die Uhr und meinte: »Ich muss zurück.«
Larrayne sprang auf und brachte sie zur Haustür. »Danke, dass du vorbeigeschaut hast, Ma.«
Freundlich fragte Ellen: »Ist Travis dein Freund?«
»Und wenn es so wäre?«
»War nur so eine Frage, Schätzchen. Wie gehts mit dem Studium voran?«
»Ganz gut so weit.«
»Wenn du Platz und Ruhe brauchst für deine Examensvorbereitungen, dann komm doch ein paar Tage zu mir.«
»Du machst Witze. Ich im Haus deines Lovers?«, entgegnete Larrayne. Ellen erkannte, dass sich nichts geändert hatte. Das Ganze wäre vielleicht noch zu ertragen gewesen, wenn Hal Challis tatsächlich ihr Lover wäre.
Sie spürte, wie ihr plötzlich ganz heiß wurde, und sie wandte sich ab, bevor sie noch etwas sagte, das sie später bereuen würde. Als sie zwanzig Minuten später in südöstlicher Richtung auf dem Freeway in Richtung Waterloo fuhr, kochte sie noch immer. Wenn schon Verbrechern das Recht auf berechtigte Zweifel zugestanden wurde, warum dann nicht auch ihr? Stattdessen hatten ihre Tochter und ihr Mann die »Beweise« gegen sie ausgelegt – sie war einfach davongegangen, sie hatte schon immer eng mit Hal Challis zusammengearbeitet, und nun wohnte sie auch noch in seinem Haus – und hatten sie des Ehebruchs für schuldig befunden.
Schön wärs, dachte sie. Vielleicht.
Der Freeway war voll, der Verkehr bewegte sich im Schritttempo auf einem breiten Streifen zwischen den Fluten der ziegelgedeckten Häuser. Alle voran waren sie auf dem Heimweg ins Mittelschicht-Australien. Die Straßen von und nach Melbourne hatten noch nie ausgereicht und würden es auch nie tun, nicht solange dicht besiedelte Gegenden wie die Peninsula zwar billigen Wohnraum, aber keine Arbeit boten.
Neben ihr heulte eine Sirene auf, ein Streifenwagen der Highway Patrol, geschmückt mit Antennen und Stickern. Die Beamten deuteten auf Ellens Handy. Sie zeigte ihnen durch die Scheibe ihre Dienstmarke. Die beiden zuckten mit den Schultern und schossen über den Seitenstreifen des Freeway davon, immer auf der Suche nach Ganoven, die beim Fahren ohne Freisprechanlage telefonierten.
Unweigerlich musste Ellen, als sie sich mit ihrer Tochter beschäftigte – mit Fragen der Liebe, des Schutzes und der Verantwortung –, an Katie Blasko denken. Eine Zehnjährige, die nun seit – sie schaute auf die Uhr – vierundzwanzig Stunden vermisst wurde. War Katie bei einer Freundin? War sie in Sydney aus dem Bus gestiegen, nur um in den Fleischbeschauen von Kings Cross zu verschwinden? Vierundzwanzig Stunden. Vierundzwanzig Stunden Himmel oder Hölle.
Ihr Handy summte. Eine SMS von einem Angestellten des Obersten Gerichts.
Freispruch für Jarrett.
Ellen hätte jetzt am liebsten Hal Challis angerufen. Sie hatte seine Nummer gespeichert. Doch Hal musste eine Familienkrise meistern. Ein Anruf wäre nicht fair. Ellen musste mit alldem allein fertig werden.
5
Detective Hal Challis war tausend Kilometer weit weg im fernen Mittleren Norden von South Australia. Er fuhr über den sogenannten Isolation Pass, eine gefährliche Serpentinenstrecke, die durch steiniges, hügliges Gelände führte. An diesem Pass waren schon Autofahrer erschossen worden. Challis wusste, dass er es an diesem Freitagnachmittag langsam angehen lassen musste, als er den Anstieg in seinem klapprigen alten Triumph bewältigte, und er bremste, als es bergab ging.
Es dauerte nicht lange, bis Mawson’s Bluff in Sicht kam. Er sah kleine Ansiedlungen, dazwischen Zäune und blanken Fels. Gemischte Gefühle überkamen Challis. Mawson’s Bluff war ein verschlafenes Weizen- und Wollstädtchen auf einer baumlosen Ebene, wo man von allem den Preis, aber von nichts den Wert kannte. Das Städtchen war nach dem Sohn von Governor Mawson benannt worden, der 1841 von Adelaide aufgebrochen war, um die Hügel zu vermessen, die nun dem Städtchen und den Merinozuchtfarmen Schutz boten. Er selbst war nicht wieder heimgekehrt. Ein Jahr darauf hatte man ihn mit einem Speer zwischen den Rippen aufgefunden. So hatte Challis es in der kleinen Grundschule in Mawson’s Bluff gelernt. Nicht gelernt hatte er, dass dies der Beginn des zum Scheitern verurteilten Widerstands der Aborigines gegen Gewehre, Pferde und Schafe war. In Mawson’s Bluff wollte niemand etwas davon wissen. Challis fuhr nach Hause, weil seine Schwester ihn angerufen hatte.
Nach Hause. So sah er das immer noch. Er kam ab und zu wieder zurück, lebte aber schon seit zwanzig Jahren nicht mehr hier.
Als die Straße in die Ebene überging, gab Challis Gas. Kurz darauf sah er auf dem Dach eines Pubs den Schriftzug MAWSON’S BLUFF, ein weithin sichtbares Signal für die Händler, die von den Schafstationen in New South Wales zu den Auktionen angeflogen kamen, um Merinozuchtböcke zu ersteigern. Und dann war da noch der Friedhof, ein staubiges Stück Land mit Eukalyptusbäumen und Grabsteinen auf einer kleinen Anhöhe jenseits der Viehhöfe. Challis musste schlucken. Er war letztes Jahr dort auf einer Beerdigung gewesen, und so wie es aussah, war es bald wieder so weit, und er würde diesen Ort wieder aufsuchen müssen.
Als er den Stadtrand erreichte, fuhr er langsamer. Ein altes Gefühl der Einsamkeit überkam ihn, er kannte es aus Kindheitstagen. Broken Hill lag weit entfernt im Osten, Adelaide tief im Süden, und zwischen beiden Orten gab es nichts. Challis schüttelte das Gefühl ab und schaute sich um. Nichts hatte sich verändert. Die Häuser waren noch immer dieselben, geduckte, verschlafene Gebäude aus Bruchsteinmauern, durch breite Veranden, Eukalyptusbäume und Zypressenhecken vor der Sonne geschützt. Fernsehantennen, die fünfzehn Meter in die Höhe ragten. Die Methodistenkirche, auf einem Platz aus roter Erde, auf der die Ameisen stets geschäftig umhereilten. Daneben der Versammlungssaal der Veteranen, wo Meg und er leere Flaschen für die jährliche Sammelaktion abgeliefert hatten. Die Schule aus Stein mit dem steilen, verblassten roten Wellblechdach. Die alten Frauen, die ihre Geranien gossen und ihm nachstarrten, als er vorbeifuhr. Die mit Puderstaub überzogenen Autos. Der Frühling war trocken, das Jahr war trocken, das Jahrzehnt auch. Nichts hatte sich geändert.
Doch er war wohl etwas vorschnell gewesen. Auf der kleinen Hauptstraße bemerkte er durchaus einige Veränderungen. Jetzt gab es ein Café, einen Kunstgewerbeladen und ein Antiquitätengeschäft. Alle Fassaden waren im spätkolonialen Stil renoviert worden. Dann entdeckte Challis ein Schild an einem Bretterzaun, und er begriff: »Mawson’s Bluff Gemeindeerneuerung und Historische Gesellschaft«.
Doch noch immer erstreckte sich die grasbewachsene Ebene bis in alle Unendlichkeit, die zugigen Steilhänge ragten über dem Städtchen, und darüber wölbte sich der wolkenlose Himmel.
Challis hatte bis auf Schritttempo abgebremst. Die Stadt lag völlig reglos da. Niemand rührte sich. Die Vorhänge waren zugezogen. Schließlich trat ein Farmer aus dem Postamt, nickte Challis zu, so als habe der niemals die Stadt verlassen, und fuhr in einem dieser geschundenen weißen Lieferwagen davon, die das Outback bevölkerten. Challis erkannte ihn, es handelte sich um Paddy Finucane, der aus einer weitverzweigten, im tiefsten Hinterland lebenden Familie stammte, in eine ähnlich sich abmühende Pächterfamilie eingeheiratet hatte und für den kommunalen Bauhof der Stadt als Lastwagenfahrer arbeitete. Als Challis noch klein war, hatte es Dutzende von Finucanes in der Klosterschule und im Footballteam gegeben. Das war schon immer so gewesen und würde auch weiter so bleiben. Einige von ihnen, erinnerte sich Challis, waren eingebuchtet worden, weil sie Schafe, Dieseltreibstoff, Kettensägen und dergleichen gestohlen hatten, alles, was nicht in einem Schuppen weggeschlossen worden war. Paddy war einer von ihnen.
Challis kam an den nördlichen Stadtrand und bog in den mit tiefen Rillen durchzogenen Weg zu einem in jüngerer Zeit gebauten Haus ein. In den Sechzigerjahren hatten die jungen Frauen die alten, kalten Steinhäuser des Mittleren Nordens von South Australia verschmäht und auf verklinkerten Häusern mit Ziegeldächern und dreigliedrig gestalteter Fassade bestanden – Häusern also, die sich in nichts von jenen in den neuen Vororten und Trabantensiedlungen der Großstädte unterschieden. Auch Challis’ Mutter hatte ihr Traumhaus bekommen, sein Vater hatte ihr diesen Traum nur zu gern erfüllt: Die Liebe war da gewesen, das Geld auch. In jenen ersten Jahren war Murray Challis der einzige Anwalt im Umkreis von hundert Kilometern gewesen. Er hatte die Testamente, Verträge und gelegentlichen Scheidungsvereinbarungen für alle aufgesetzt, vom Postzustelldienst bis hin zur örtlichen Oberschicht. Selbst vierzig Jahre später hatte sich das Haus, das er für seine Frau gebaut hatte, noch immer nicht in die Landschaft eingefügt. Nicht anders als bei den alten Steinhäusern in der Gegend war die Zufahrt mit Kiefern gesäumt, es gab einen Rosengarten und Sträucher, Regenwasserzisternen und einen Kelpie, der mit seinem Schwanz Staub aufwirbelte, und doch gehörte das Haus irgendwie nicht hierhin. Die Familie Challis eigentlich auch nicht. Mit zwanzig war Hal Challis dann auf die Polizeiakademie gegangen. Vielleicht hatte ihn der Wunsch getrieben, dazuzugehören, als er nach dem Abschluss um eine Stelle »zu Hause« gebeten hatte. Ganz sicher war das ein Fehler gewesen. Man kann niemals zurück. Ein paar Jahre später verließ er dann den Bundesstaat und war nun Inspector bei der Victoria Police.
Challis bremste am Ende der Zufahrt und lenkte seinen Wagen in den Schatten der Pfefferbäume. Er stieg aus, streckte seinen schmerzenden Rücken und sah nach Norden über die ums Überleben kämpfenden Weizenfelder, die in der Ferne in trockenes Land, eine Halbwüste, übergingen, ein ausgewaschenes Land voll Schotter und Staub, mit niedrigem Buschwerk und tief eingeschnittenen Wasserläufen. Dort draußen hatte schon so mancher sein Leben gelassen. »Untergehen« nannte man das hier. Viele in der Gegend glaubten, dass dies auch das Schicksal von Challis’ Schwager gewesen war. Das war nun fünf Jahr her. Gavin Hursts Wagen war dort draußen verlassen aufgefunden worden. Keine Leiche. Hurst, ein schwieriger Zeitgenosse, war der örtliche Beauftragte des Tierschutzvereins gewesen. Challis hatte ihn nie leiden können, aber seine Schwester hatte ihn nun mal geheiratet, hatte ihn geliebt. Was blieb einem da übrig?
»Der siegreiche Held kehrt heim.«
Challis drehte sich um und grinste. Meg, die zwei Jahre jünger war als er, lächelte ihn müde von der Veranda aus an. Einen Augenblick später drückte sie ihn an ihre runde, behagliche Gestalt. »Fährst immer noch den alten Schrotthaufen, wie ich sehe«, sagte sie zärtlich und schlug mit der flachen Hand auf die Chromfassung der Windschutzscheibe.
»He, mach keine Schramme in meinen ganzen Stolz.«
Sie schnaubte verächtlich und umarmte ihn erneut. »Es tut gut, dich zu sehen. Eine Wohltat für meine müden Augen.«
Als sie ihn wieder losließ, sah er, dass ihre Augen tatsächlich sehr müde wirkten. »Wie geht es ihm?«
»Schätzchen«, erwiderte Meg zärtlich, »er liegt im Sterben.«
Das hatte sie ihm schon letzte Woche am Telefon gesagt, also hatte er sich eilig einen Monat freistellen lassen. Was Meg damit sagen wollte: Was hast du denn erwartet,
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: