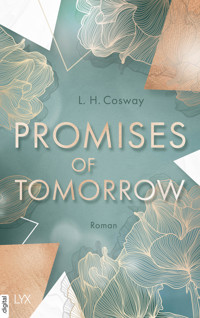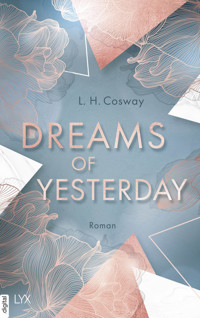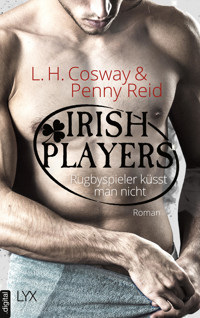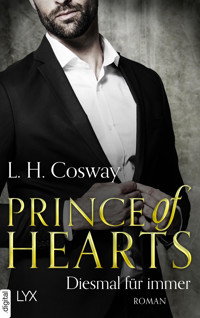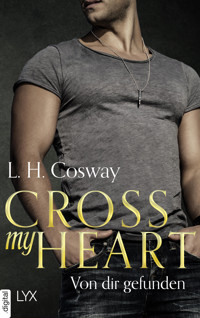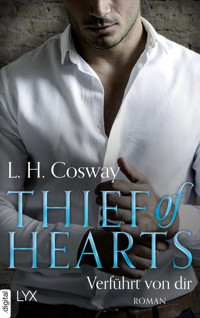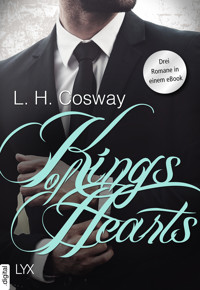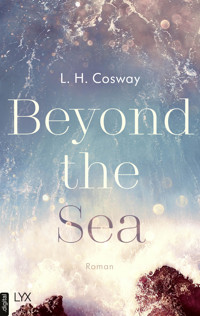
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ich war auf alles vorbereitet - nur nicht auf dich
Seit dem Tod ihres Vaters will die 18-jährige Estella nur ihren Schulabschluss machen und Irland endlich den Rücken kehren. Doch ihre Pläne werden durchkreuzt, als der geheimnisvolle Noah auftaucht. Er ist nicht nur ganz anders als alle Jungen, denen Estella bisher begegnet ist, er gibt ihr das erste Mal seit langer Zeit das Gefühl, nicht ganz alleine auf dieser Welt zu sein. Estella verliebt sich jeden Tag ein kleines bisschen mehr in ihn, doch Noah ist nicht ohne Grund im Ort. Er hat ein Geheimnis, das alles zwischen ihnen zerstören könnte ...
"Wer Jane Eyre mag, wird dieses Buch lieben! Ich habe jede Sekunde davon genossen." SAMANTHA YOUNG
New Adult meets JANE EYRE: der neue Roman von L. H. Cosway an der rauen Küste Irlands
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 540
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
INHALT
Titel
Zu diesem Buch
Leserhinweis
Motto
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
Epilog
Die Autorin
Die Romane von L. H. Cosway bei LYX
Impressum
L. H. Cosway
Beyond the Sea
Roman
Ins Deutsche übertragen von Maike Hallmann
ZU DIESEM BUCH
Seit dem Tod ihres Vaters wünscht die 18-jährige Estella sich nichts mehr, als so schnell wie möglich ihren Schulabschluss in der Tasche zu haben, um ihrem Heimatdorf an der irischen Küste dann ein für alle Mal den Rücken kehren zu können. Ihre Stiefmutter Vee macht ihr das Leben jeden Tag zur Hölle und Ard na Mara, das gespenstische Anwesen, das sie gemeinsam bewohnen, fühlte sich ohnehin noch nie wie ihr Zuhause an. Doch Estellas Pläne werden durchkreuzt, als Noah, der geheimnisvolle jüngere Bruder ihrer Stiefmutter, auftaucht. Mit seinem Motorrad, der verschlossenen Art und dem mürrischen Lächeln ist Noah so ganz anders als alle Jungen, denen Estella bisher begegnet ist. Außerdem liebt er Bücher genauso sehr wie Estella, und er beschützt sie auch vor Vee! Estella verliebt sich jeden Tag ein bisschen mehr in ihn. Doch Noah ist nicht ohne Grund im Ort, er hat ein Geheimnis. Und schon bald muss Estella sich entscheiden: ihren Traum von einem selbstbestimmten Leben zu verwirklichen oder Noah zu vertrauen …
Liebe Leser:innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Deshalb findet ihr hier eine Triggerwarnung.
Achtung: Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch!
Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Leseerlebnis.
Euer LYX-Verlag
I hold a beast, an angel and a madman in me.
Dylan Thomas
1. KAPITEL
Sein Leben lang hat mein Vater geglaubt, er sei verflucht.
Alles fing damit an, dass seine Mutter Krebs bekam, als er zehn Jahre alt war. Dad versprach Gott, Priester zu werden, wenn Er seine Mutter vor dieser heimtückischen Krankheit errettete. Sie erholte sich wieder, und Dads Schicksal war besiegelt. Aber mit sechzehn lernte er meine Mutter kennen, und sein Versprechen geriet in Vergessenheit. Die beiden verliebten sich Hals über Kopf ineinander, und ein Jahr später war meine Mutter schwanger. Neun Monate später starb sie bei meiner Geburt.
Dann kehrte bei Dads Mutter der Krebs zurück, und diesmal ging sie nicht als Siegerin aus dem Kampf hervor.
Der Tod brach meinem Dad also gleich doppelt das Herz, und er war sicher, dass Gott ihn so strafte, weil er kein Priester geworden war. Im Laufe der nächsten Jahre verlor er auch die restlichen ihm noch verbliebenen Familienmitglieder, und auf einmal war niemand mehr da bis auf ihn und ein Kind, das er allein aufziehen und versorgen musste. Lange gab es nur uns beide, bis er schließlich Vee kennenlernte und heiratete. So bekam ich eine Stiefmutter, die meine Gegenwart zwar duldete, aber keinen Funken Liebe für mich empfand.
Als Dads Fluch schließlich zum letzten Schlag ausholte, verwandelte sich ihre Duldung in offene Abneigung: Vor zwei Jahren war er bei einem Zusammenstoß mit einem betrunkenen Autofahrer ums Leben gekommen und hatte mich als eine Art moderne Cinderella zurückgelassen, nur dass ich nicht auf die Hilfe einer guten Feen-Patentante hoffen konnte.
Aber immerhin hatte ich ja schon eine böse Stiefmutter.
»Mein Bruder kommt zu Besuch«, sagte Vee. Sie saß rauchend am abgeranzten Küchentisch, in der Hand einen Zigarettenhalter wie eine rothaarige Cruella de Vil. »Lüfte eins der Gästezimmer und mach’s für ihn fertig.«
Ich war völlig verdattert. »Du hast einen Bruder?«
Sie spitzte die Lippen und pustete eine Rauchwolke in die Luft. »Ja. Jünger als ich. Sylvia hat ihn erst sehr spät bekommen. Er war lange nicht mehr zu Hause.«
Sylvia war Vees Mom, aber sie nannte sie stets beim Vornamen. Nie sagte sie Mam oder Mammy zu ihr, nicht mal ganz förmlich Mutter. Ich empfand das als ziemlich kühl und distanziert, aber so war Vee eben. Eine richtige Eiskönigin. Sylvia tat mir leid, weil sie eine so gleichgültige, herzlose Tochter hatte.
Mich behandelte Vee bestenfalls wie eine unerwünschte, lästige Hausdienerin, aber wenigstens würde das nicht mehr ewig dauern. In wenigen Monaten stand mein Abschluss bevor, und dann würde ich ihrer Tyrannei endlich entkommen.
»Wie heißt er?«, fragte ich leise und achtete darauf, ihr nicht ins Gesicht zu sehen. Das empfand sie nämlich manchmal als Drohung, wie ein wildes Tier. Ich nahm eine Konservendose mit Fertigsuppe, ein Brötchen und eine Banane aus dem Küchenschrank und fing an, mir Mittagessen zu machen. Meinen Schokoriegel-Vorrat hatte ich unter meiner Matratze versteckt, damit Vee ihn nicht fand und schimpfte, ich würde zu viel Mist essen. Meine Stiefmutter hatte es nicht so mit dem Einkaufen oder überhaupt mit der Nahrungsaufnahme. Eigentlich sah ich sie praktisch nie beim Essen, mal abgesehen von den Oliven, die sie manchmal in ihre Martinis warf, also musste ich mich selbst um meine Verpflegung kümmern.
»Wie kommst du darauf, dass ich heute in Stimmung für deine blöden Fragen bin, Estella?«, fragte sie scharf.
»Tut mir leid«, murmelte ich, öffnete die Konservendose und kippte den Inhalt in den Topf, der bereits auf dem Herd stand. Manchmal wünschte ich, es gäbe eine Mikrowelle, aber von dem Wenigen abgesehen, was Dad und ich beim Einzug mitgebracht hatten, schien in diesem Haushalt alles aus einem früheren Jahrhundert zu stammen und war staubig und alt. Das hatte man davon, wenn man in einem großen, knarrenden, gruseligen viktorianischen Haus an der Küste wohnte.
Vee rauchte und beobachtete mich mit zusammengekniffenen grünen Augen. »Deine Uniform sieht ein bisschen schmuddelig aus. Du solltest sie am Wochenende mal bei Foley’s waschen lassen.«
»Mhm.« Ich verkniff mir eine bissige Entgegnung und strich über meine marineblaue und waldgrüne Uniform mit dem Wappen des Loreto-Konvents auf der linken Brustseite. Es zeigte das Kreuz als Symbol der Erlösung, das Herz Jesu, das für seine Liebe zu uns Menschen stand, das Unbefleckte Herz Mariä, um an den Mut zu erinnern, mit dem sie uns leitete, und den Anker, ein Symbol, das uns ermutigen sollte, auf Gott zu vertrauen.
Vee wusste ganz genau, dass ich für Foley’s kein Geld hatte. Das bisschen, was ich von ihr bekam, reichte kaum fürs Essen. Und auch wenn ich nicht die Allerdünnste war, saß meine Schulkleidung nicht wegen meiner Figur so eng, sondern weil ich seit vier Jahren dieselbe Uniform trug.
Mit achtzehn hat man nicht mehr denselben Körper wie mit vierzehn. Es war mir peinlich, optisch das genaue Gegenteil von Vee zu sein: Ihre Brust war flach, die Hüften schmal. Sie hatte die Figur eines Laufstegmodels.
Sobald meine Suppe heiß war, verzog ich mich in mein Zimmer am anderen Ende des Flurs und schloss die Tür hinter mir. Mein Zimmer, der kleinste Raum des Hauses, befand sich im Erdgeschoss und ging eigentlich nicht als richtiges Schlafzimmer durch. Eher wirkte es, als versuchte Vee mir einen alten, nicht benötigten Wandschrank als Schlafzimmer unterzujubeln. Zwischen Bett und Wand war kaum genug Platz, um zu stehen, und es gab nur ein kleines Fenster über dem Bett.
Als Dad noch lebte, hatte ich in einem großen Zimmer im Obergeschoss geschlafen. Aber ein paar Wochen nach seinem Tod hatte Vee behauptet, es gäbe dort ein Schimmelproblem, um mich zu zwingen, in mein jetziges winziges Domizil umzusiedeln. Ich hegte den Verdacht, dass diese kleinen Gemeinheiten einen winzigen Silberstreif Freude in ihr schwarzes Herz zauberten, aber ich beklagte mich nicht. Ich wartete geduldig darauf, dass meine Zeit kam.
Ich war ihr weiblicher Prügelknabe. Noch.
Ich saß auf meiner dünnen Matratze, aß meine Suppe und erledigte die Mathe- und Geografie-Hausaufgaben, ehe ich mich meinem Lieblingsfach widmete: Geschichte. Ich lernte mit großer Begeisterung jedes Detail über die Vergangenheit, die großen Kriege interessierten mich dabei allerdings weniger. Viel spannender fand ich, wie sich Kultur und Technologie im Laufe der Zeit veränderten, das menschliche Verhalten jedoch mehr oder weniger gleich blieb.
In letzter Zeit hatte sich Psychologie bei mir zu einer Art Obsession entwickelt, und je mehr ich lernte, desto mehr wollte ich wissen. Vielleicht lag es daran, dass ich Vee zur Stiefmutter hatte … die Gründe für ihr Verhalten herauszufinden und Theorien und Notizen dazu niederzuschreiben würde wohl selbst den qualifiziertesten Psychologen ordentlich auf Trab halten.
Hätte mein Dad noch gelebt und wäre so krank gewesen wie Sylvia, würde ich jede wache Minute an seiner Seite verbringen, um dafür zu sorgen, dass er alles hatte, was er brauchte. Ich vermisste ihn so sehr, dass ich manchmal kaum Luft bekam. Alles hätte ich gegeben, um ihn zurückzubekommen.
Dad hatte Veronica geheiratet, als ich vierzehn war, also war das Wenige, was er zu vererben hatte, nach seinem Tod in ihren Besitz übergegangen. Wegen des Autounfalls war ihr eine Entschädigung ausgezahlt worden, dazu das Geld aus seiner Lebensversicherung. Eine kleinere Summe war für mich bestimmt, aber auch wenn ich letztes Jahr achtzehn geworden war, würde mir mein Erbe erst ausgezahlt werden, wenn ich mit der Schule fertig war. So hatte Dad es in seinem Testament festgelegt. Das war sehr frustrierend – obwohl ich vor dem Gesetz bereits erwachsen war und ganz ausgezeichnet für mich selbst sorgen konnte, hatte ich ohne eigenes Einkommen keine andere Wahl, als für die restliche Zeit bei Vee zu bleiben.
Ich versuchte, es von der positiven Seite zu sehen. Schon bald würde ich diesem großen Haus, in dem nachts uralte Schreckgespenster ihr Unwesen trieben, endlich den Rücken kehren.
Über die Geschichte Ard na Maras wusste ich nicht viel, abgesehen von dem Namen, der bedeutete: Hochgelegenes Haus, das die See überblickt. Das klang recht hübsch, aber hübsch war nicht viel daran, abgesehen von der Aussicht. Ich spürte die Schlechtigkeit des Gemäuers tief in den Knochen. Schreckliches war hier geschehen. Grauenhaftes. Die viktorianische Residenz mit ihren sechs Schlafzimmern kauerte dicht am Rand einer Klippe an der östlichen Küste und überblickte die weite Irische See. Manchmal träumte ich von einer Frau, die aus dem Haus stürmte und von der Klippe hinunter in ihren nassen Tod sprang.
War der Tod weniger schrecklich als das, vor dem sie floh? Bei dem Gedanken erschauerte ich. Manchmal träumte ich auch von einem Mann, der ertrank. Er kämpfte, versuchte, Luft zu holen, aber starke, körperlose Hände drückten ihn unter Wasser.
Mühsam schob ich den Gedanken an meine verstörenden, regelmäßig wiederkehrenden Träume beiseite und konzentrierte mich wieder auf die Hausaufgaben. Einige Stunden später klopfte Vee im Vorbeigehen an meine Tür. Ihre Stimme klang hoch und dünn wie die einer geisterhaften Banshee: »Vergiss das Gästezimmer nicht, Estella.«
Ich verzog das Gesicht. Das hatte ich tatsächlich vergessen. Gerade war ich am Einnicken gewesen, immer noch in meiner Uniform, das Kinn auf einem Schulbuch.
Mürrisch stand ich auf, rieb mir mit den Fingerspitzen die Augen und holte das Putzzeug. Das Gästezimmer war oben, am anderen Ende des Hauses. Ich schaltete das Licht ein, und es flutete durch den großen Raum mit seinen hohen Decken. Die offenen Vorhänge gaben den Blick auf das dunkle Meer dahinter frei. Ich dachte an meinen Traum von der Frau, die sich von der Klippe stürzte, und mir lief ein Schauer über den Rücken.
Es roch ein bisschen muffig, so wie im ganzen Haus. Ich öffnete das Fenster und ließ die kalte Nachtluft herein. Es klang unheimlich, wie inmitten der Stille die Wellen an die Küste brandeten.
Sicher war Sylvia schon vor Stunden von ihrer Pflegerin Irene ins Bett gebracht worden, und Vee hatte sich vermutlich im Arbeitszimmer eingeschlossen und trank bis zur Besinnungslosigkeit, so wie jeden Abend. Schon als Dad noch gelebt hatte, war sie Alkoholikerin gewesen, aber inzwischen versuchte sie es nicht einmal mehr zu verheimlichen.
Dad hatte immer wieder vorsichtig versucht, ihr zu helfen, aber er war gestorben, ehe seine Bemühungen Früchte tragen konnten. Er war so ein freundlicher, sanfter Mann gewesen. Ein hoffnungsloser Romantiker. Ein gefundenes Fressen für jemanden wie Vee.
Trotzdem spürte ich, dass sie ihn auf ihre seltsame Weise geliebt hatte. Was sie jedoch nicht liebte, war seine Tochter. Eine traurige Ironie, dass am Ende ausgerechnet ich es war, die ihr blieb.
Ich putzte das Gästezimmer bis in den letzten Winkel und bezog das Bett frisch. Während der Arbeit dachte ich über Vees Bruder nach und fragte mich, wie er wohl sein mochte. Sie hatte gesagt, er sei ein Nachzügler gewesen. Hieß das, er war deutlich jünger als Vee? Ich stellte mir eine männliche Vee-Version vor und wäre fast zusammengezuckt.
Tja, wie alt er auch sein mochte – ich ahnte bereits jetzt sehr deutlich, dass es besser war, mich von Vees Bruder fernzuhalten.
»Iieh, da hat jemand seine Periode. Ich kann das riechen«, krähte Sally O’Hare, als ich am nächsten Nachmittag zur Englischstunde in die Klasse trat.
»Dass Sie wissen, wie die Periode riecht, legt nahe, dass Sie unter dem gleichen monatlichen Schicksal leiden«, merkte Schwester Dorothy trocken an, die Schildpattbrille tief unten auf der Nasenspitze. »Also zeigen Sie ein wenig Mitgefühl für ein Mädchen, das gerade aus der Gebärmutter blutet.«
Ich rümpfte die Nase über die plastische Beschreibung und ließ mich auf meinen Platz neben meiner besten Freundin Aoife sinken. Schwester Dorothy war immer sehr direkt, vor allem für eine Nonne, aber ich fand, diesmal war sie ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen.
Sally sah aus, als würde sie gleich das Gurkensandwich auskotzen, das sie zu Mittag gegessen hatte. »Die Gebärmutter, Schwester? Echt jetzt? Wollen Sie etwa, dass mir schlecht wird?«
»Wenn das bedeutet, dass ich mir Ihr widerliches Geschwätz nicht mehr anhören muss, dann vielleicht schon, ja.«
Einige Schülerinnen kicherten. Sally O’Hare starrte sie an.
»Ich melde Sie bei Direktor Hawkins. So dürfen Sie nicht mit mir reden.«
»Ja, so dürfen Sie nicht mit ihr reden«, fiel Claire McBride ein, Sallys beste Freundin und immer an und auf ihrer Seite.
»Ich rede mit Ihnen, wie ich will«, antwortete Schwester Dorothy, und sie hatte recht. Sie würde und durfte mit uns Schülerinnen reden, wie immer es ihr gefiel. Der Loreto-Konvent, eine reine Mädchenschule, war an die hundert Jahre alt, und ich hätte darauf gewettet, dass Schwester Dorothy schon seit mindestens fünfzig Jahren mit von der Partie war. Sie war quasi schon selbst eine Institution. Niemand würde sie feuern. Und wenn jemand es doch täte, so stellte ich es mir vor, würde sie einen glanzvollen Abgang hinlegen, einen Arm aus dem Fenster ihres roten Ford Focus hängend, um uns allen den Mittelfinger zu zeigen. Diese Siebzigjährige ließ sich nichts gefallen.
»Dann schlagen Sie jetzt bitte Seite fünfzig in Ihren Büchern auf. Heute lernen wir alles über mittelalterliche Dichtkunst.«
Mehrstimmiges Stöhnen. Schwester Dorothys Mundwinkel kräuselten sich, und ich fragte mich, ob sie vielleicht eine klitzekleine sadistische Ader hatte.
Später lief ich am Strand entlang nach Hause und hob hier und da ein paar interessante Muscheln auf. Die perlmuttschimmernden Exemplare mochte ich am liebsten. Manchmal, wenn ich Langeweile hatte, fertigte ich Schmuck und anderen Kleinkram daraus. Und als Achtzehnjährige, die ohne Handy oder Internet in einem fast zweihundert Jahre alten Haus lebt, hat man oft Langeweile. Ich besaß eine sehr ansehnliche Sammlung solcher Basteleien.
Irgendetwas anderes blinkte in der Abendsonne, direkt vor unserem Haus. Normalerweise nahm ich immer die Hintertür, aber heute lief ich aus Neugier vorn ums Haus herum. Vor dem Eingang, direkt neben Vees selten benutztem blauem Sedan, stand ein glänzendes schwarzes Motorrad. Ich bewunderte es ausgiebig. An der Seite prangte der Name Yamaha.
Ich schob die Daumen unter die Gurte meines Rucksacks, drehte mich zum Haus um und bekam eine Rauchwolke ins Gesicht. Ein junger Mann lehnte dort an der Wand, einen Fuß gegen die Steinmauer gestützt, und beobachtete mich.
Ich schluckte und musterte ihn. Er war von Kopf bis Fuß schwarz gekleidet, was seine auffallend grünen Augen betonte. Sein Haar war dunkel, die Miene unergründlich. Ganz zweifellos ein interessantes Exemplar, das da plötzlich in meinem Leben aufgetaucht war. Jungs gegenüber – oder Männern – war ich noch nie sonderlich selbstbewusst gewesen, und in diesem Augenblick verschlug es mir völlig die Sprache. Außerdem wurde ich knallrot, nur weil er mich ansah.
»Du bist also das Mündel«, sagte er, hob die Zigarette an den Mund und zog daran.
Eine Weile starrte ich ihn nur stumm an, ehe ich endlich Worte fand. Na gut, ein Wort jedenfalls. »Mündel?«
»Die kleine Obligation meiner großen Schwester«, setzte er hinzu, und endlich begriff ich.
»Du bist Vees Bruder?«
Er lachte, aber es klang nicht ganz echt. »Was anderes erwartet?«
»Ihr seht euch nicht ähnlich.«
»Ich komme nach meinem Vater«, sagte er trocken, schnippte den Zigarettenstummel zu Boden und trat ihn mit dem Stiefel aus. Dann musterte er mich wieder, aber ganz langsam. Fing bei den Füßen an und wanderte aufwärts, bis er endlich bei meinem Gesicht ankam.
Ich zog eine Braue hoch und wiederholte, was er zuvor gesagt hatte, nur dass ich flüsterte. »Was anderes erwartet?«
»Ja«, antwortete er und brummte dann etwas Unverständliches in sich hinein. Das einzige Wort, das ich heraushörte, war Uniform. Scheiße, war es wirklich so schlimm? Ich wusste, dass sie inzwischen echt eng saß, hatte aber eigentlich gehofft, dass es noch bis zum Jahresende gehen würde.
Ich stand ganz still, die Rucksackriemen fest gepackt, da kam ein Taxi und hielt am Straßenrand. Die Haustür öffnete sich, und Vee kam heraus. Sie war ungewohnt gut gekleidet, das kurze rote Haar war ordentlich und frisch gewaschen, und sie trug ein paillettenbesetztes Kleid, in dem sie aussah wie ein Flapper-Girl aus den Zwanzigern.
So herausgeputzt hatte ich sie seit Dads Tod nicht mehr gesehen.
»Ah, du hast Estella bereits kennengelernt«, sagte sie und musterte mich mit leiser Missbilligung. »Wir gehen aus. Irene ist heute früher gegangen, also musst du ein Auge auf Sylvia haben. Ihr Katheter muss gewechselt werden.«
Ich nickte und verzog nur in Gedanken das Gesicht.
»Oh, und wenn du bitte den Ofen sauber machen würdest. Du hast das so lange aufgeschoben, dass inzwischen eine zentimeterdicke Schmierschicht drauf ist.«
Vees Bruder, dessen Namen ich noch immer nicht kannte, betrachtete mich neugierig. Vielleicht fragte er sich, weshalb ich mir wie eine kleinlaute Maus Anweisungen von Vee erteilen ließ. Er konnte ja nicht wissen, dass es sich um eine reine Überlebenstaktik handelte und ich gleich nach dem Abschluss abhauen würde … dann konnten mich Vee und ihre Anweisungen mal gernhaben. Vielleicht würde ich ihr sogar noch ein ganz klein wenig die Meinung geigen, ehe ich von hier verschwand.
»Freut mich, dich kennenzulernen, Estella«, sagte er und sah mich immer noch an, während Vee schon auf das Taxi zulief. »Ich bin Noah.«
»Wie in Arche Noah?«, fragte ich. Oje, wieso hab ich das gesagt?
Wieder lachte er, und wieder klang es nicht ganz richtig. »Ja, nur dass ich meine Zeit nicht damit verschwenden würde, Tiere zu retten.«
Vee lachte laut auf, als wäre es das Lustigste, was sie je gehört hätte, und verschwand im Taxi. Ich stand da und fragte mich, was daran witzig sein sollte, und Noah wandte sich ab und folgte Vee.
»Vee ist ausgegangen. Wird bestimmt schön, das Haus ganz für uns zu haben«, sagte ich zu Sylvia, während ich ihren Katheterbeutel wechselte. Sie starrte mich mit ihren klugen grünen Augen an, denselben Augen wie bei Vee und Noah. Aber sie sagte kein Wort. Sie sagte in letzter Zeit fast gar nichts mehr, seit sie solche Schwierigkeiten mit dem Sprechen hatte. Um einen ganzen Satz herauszubekommen brauchte sie viel länger als andere Leute.
Als ich fertig war, machte ich uns etwas zu essen. Meine Portion stellte ich im Ofen warm und fütterte erst einmal Sylvia. Soweit ich wusste, war die MS zum ersten Mal in ihren Fünfzigern in Erscheinung getreten und nahm sie seitdem Stück für Stück auseinander. Manchmal hatte sie Schübe, in denen ihre Hände extrem zittrig wurden, und dann war sie beim Essen auf Hilfe angewiesen. Ich ermuntere sie trotzdem immer, es selbst zu versuchen, weil ich in ihren Augen zu sehen glaubte, dass sie es demütigend fand, mit dem Löffel gefüttert zu werden.
Da es aussah, als würden Vee und ihr Bruder den ganzen Abend wegbleiben, nutzte ich die Gelegenheit und machte es mir im Wohnzimmer gemütlich. Ich wollte Sylvia nicht dazu nötigen, etwas anzusehen, das sie nicht mochte, also hielt ich nacheinander DVDs hoch, bis sie etwas sah, das ihr gefiel. Witzigerweise war das ausgerechnet Buffy – Im Bann der Dämonen, aber darüber würde ich mich sicher nicht beschweren. Ich hatte schon immer eine Schwäche für Spike gehabt.
Ich verschwand rasch noch mal in dem Badezimmer, das an Vees Zimmer angrenzte – das einzige im ganzen Haus, das über eine Dusche verfügte, die ich nicht benutzen durfte. Dann schlüpfte ich in meinen Pyjama, kuschelte mich aufs Sofa und schaltete die DVD ein. Wir hatten ungefähr vier Folgen gesehen, da hörte ich, wie sich der Schlüssel im Schloss drehte.
Ich erstarrte.
Lachen wehte herein und kündigte Vee und Noah an. Ich blickte Sylvia an. Seltsamerweise schien sie ähnlich unglücklich über die frühe Rückkehr der beiden zu sein wie ich.
Ich trug einen Pyjama mit aufgedruckten Pandas darauf, um Himmels willen.
Die Geschwister taumelten förmlich ins Wohnzimmer, beide waren betrunken. Ich schlug die Beine unter und konzentrierte mich auf den Bildschirm. Am liebsten wäre ich in mein Schlafzimmer geflohen, aber ich gönnte Vee den Triumph nicht, zu sehen, dass ich Angst vor ihr hatte.
»Was für einen Mist guckst du denn da, Estella?«, fragte sie, gerade als sich jemand neben mir aufs Sofa setzte. Noah. Er roch nach Whiskey und salzigem Meerwasser. So komisch das klingt, aber die Mischung hatte einen eigenartigen Reiz. So wie Chili und Schokolade. Oder Chicken Nuggets und Eiscreme.
Vielleicht war er ja ein Meermann, der an die Küste geschwommen war, um sich als Vees jüngerer Bruder auszugeben …
Verstohlen warf ich ihm einen Blick zu. Seine durchdringenden grünen Augen ruhten auf meinem Profil, und mir schoss das Blut ins Gesicht.
»Buffy«, murmelte ich leise und verlagerte mein Gewicht.
Irgendwas an Noah machte mich nervös. Wie alt er war, wusste ich nicht, aber ich vermutete, dass er auf Mitte zwanzig zuging.
»Ja, na ja, mach jetzt aus. Für dich ist längst Bettzeit.«
»Es ist fünf nach halb zehn.«
»Keine Widerworte. Geh ins Bett.«
»Lass sie bleiben, Vee«, bat Noah, und ich versteifte mich, als ich den Alkohol in seinem Atem roch.
»Ich sollte jetzt sowieso besser mal Sylvia ins Bett bringen«, flüsterte ich und stand auf.
Bei ihrer Erwähnung hörte Noah endlich damit auf, mich anzustarren, und richtete seine Aufmerksamkeit auf seine Mutter. Er sagte kein Wort, aber Sylvia wirkte angespannt unter seinem unverwandten Blick. Sie kam mir fast vor, als … hätte sie Angst vor ihm. Was zum Teufel? Ich legte die Hände auf die Griffe ihres Rollstuhls und wollte sie Richtung Tür schieben, da schlug Vee meine Hände beiseite, die Zigarette locker im Mundwinkel.
»Lass sie hier. Ich kümmere mich später drum.«
»Du kümmerst dich darum?«, fragte ich misstrauisch. Seit ich hier wohnte, hatte ich noch nie erlebt, dass Vee ihre Mutter zu Bett brachte, das machte immer ich oder Irene.
»Ja«, zischte sie. »Jetzt verpiss dich. Ich bin es leid, mir deine dumme, hässliche Fratze anzusehen.«
Noah zog die Brauen hoch, als würde ihre Giftigkeit ihn überraschen. Ich wusste nicht, wie Vee gewesen war, als er mit ihr zusammengelebt hatte, aber inzwischen war sie auf jeden Fall keine angenehme Gesellschaft mehr. Beim schroffen Klang ihrer Stimme wurde mir die Kehle eng, und ich spürte, wie mir Tränen in die Augen stiegen. War ich hässlich? Nein, war ich nicht. Vee wollte mich nur niedermachen, weil sie eine bösartige Giftspritze war. Ich hasste sie.
Stur legte ich die Hände wieder auf die Griffe des Rollstuhls. »Lass mich das erledigen, Vee.«
»Geh nicht zu weit, Estella, ich meine es ernst. Du willst nicht, dass ich wütend werde.«
Was ich wirklich nicht wollte, war, die arme Sylvia der Gnade dieser beiden zu überlassen, aber in Vees Augen blitzte Streitlust, und ich fühlte mich ihr nicht gewachsen. Mit einem letzten Blick zu Noah, der mich ausdruckslos beobachtete, drehte ich mich um und verließ das Wohnzimmer.
Am nächsten Morgen stand ich beim ersten Weckerklingeln auf, wusch mich und zog mich an, dann ging ich den Flur hinunter. Öffnete die Haustür, holte die Zeitung herein und legte sie für Vee auf den Tisch in der Diele, so wie jeden Morgen. Als ich danach am Wohnzimmer vorbeikam, sah ich Sylvia dort sitzen, ihr Rollstuhl stand noch genau an derselben Stelle wie gestern, und sie trug auch noch immer dieselben Sachen. Wut kochte in mir hoch.
Diese widerwärtige, bösartige Hexe!
Vee hatte keine Sekunde lang vorgehabt, Sylvia ins Bett zu bringen. Im Gegenteil. Ich hätte mein letztes Hemd darauf verwettet, dass sie ihre Mutter absichtlich die ganze Nacht hier hatte stehen lassen.
»Ich bringe sie um«, sagte ich, als ich das Wohnzimmer betrat und in Sylvias schmerzerfüllte Augen blickte. »Alles in Ordnung bei dir? Es tut mir so leid. Ich hätte dich nicht mit ihr allein lassen dürfen.«
Sylvia stieß die Luft aus, ihr Mund war vor lauter Erschöpfung und Schmerz nur noch ein dünner, gekrümmter Strich. »Alles … okay«, antwortete sie leise, aber ich wusste, dass sie log. Sie wollte nur keinen Wirbel machen, obwohl das, was Vee getan hatte, wirklich jenseits von Gut und Böse lag.
Als ich Sylvias Rollstuhl gerade in ihr Zimmer schieben wollte, wurde die Haustür geöffnet, und Irene kam herein. Als sie mich ansah, wäre ich fast in Tränen ausgebrochen.
»Estella, was ist los?« Ganz sicher fragte sie sich, was Sylvia hier tat – normalerweise holte Irene sie morgens aus dem Bett.
»Vee hat sie die ganze Nacht im Wohnzimmer stehen lassen, Irene. Ich wollte sie gestern ins Bett bringen, aber Vee hat es mir verboten, und dann hat sie sie einfach hiergelassen.«
»Oh, Liebes«, sagte Irene und eilte zu uns, um nach Sylvia zu sehen. »Du musst zur Schule. Ich kümmere mich um die arme Sylvie.«
Ich nickte und stemmte, immer noch wütend, die Hände in die Hüften. »Normalerweise lässt sie sie nur links liegen, aber jetzt wird sie richtig grausam. Wenn sie das noch mal macht, melde ich sie bei der Gesundheitsbehörde.«
»Ach, tust du das?«, fragte eine Männerstimme, und als ich aufblickte, sah ich Noah die Treppe herunterkommen. Er trug eine schwarze Jeans und ein schwarzes T-Shirt und war barfuß. Sein Haar war so wirr, als wäre er gerade erst aufgestanden.
»Ja, das tu ich«, sagte ich standhaft. »Und du bist auch nicht besser. Wie konntet ihr das eurer eigenen Mutter antun? Jetzt wird sie tagelang furchtbare Schmerzen haben, und dabei hat sie durch ihre Krankheit sowieso schon ständig welche.«
Noah starrte mich eine halbe Ewigkeit lang an. Kurz wanderte sein Blick zu Sylvia, dann wieder zu mir zurück. Über sein Gesicht glitt ein finsterer Schatten, aber im nächsten Moment war er wieder fort. Als er schließlich etwas sagte, ging er kein Stück auf das ein, was ich gerade gesagt hatte, sondern stellte nur fest: »Du bist morgens aber temperamentvoll.«
»Und du bist widerlich. Wenn du und deine Schwester ausgehen und euch betrinken wollt, ist das völlig in Ordnung. Nur lasst nicht andere Leute darunter leiden.« Ich stampfte Richtung Küche davon.
In tausend Jahren würde ich nicht so mit Vee reden. Vielleicht war ich mutig, weil er ein Fremder für mich war. Ich steckte Brot in den Toaster und nahm die Erdnussbutter aus dem Regal. Eigentlich hatte ich gar keinen Appetit, aber ich war nicht bereit, mich von Vees Verhalten fertigmachen zu lassen. Als ich gerade den Kessel aufsetzte, um Wasser für den Tee zu erhitzen, kam Noah herein.
Ich hörte, wie er sich einen Stuhl zurechtzog und sich an den Tisch setzte, aber ich sah ihn nicht an. Ich hatte schon immer gewusst, dass Vee irgendwas fehlte, etwas ganz Entscheidendes, das eigentlich zum Menschsein gehört, aber so langsam fragte ich mich, ob das vielleicht in der Familie lag.
»Ich trinke meinen mit Milch und ohne Zucker, danke«, sagte Noah, und am liebsten hätte ich die Schüssel mit dem Zucker genommen und ihm ins Gesicht geworfen. Aber das tat ich nicht. Stattdessen ließ ich meine Wut in mir gären, bis sich meine Wangen knallrot färbten und sich mein Magen in einen festen Knoten verwandelte. Um mich zu beruhigen, stellte ich mir vor, wie Dads Stimme einen Bibelvers rezitierte.
Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da Tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, aber ungestraft lässt er niemand …
Vielleicht stand es mir nicht zu, wütend auf Vee und Noah zu sein. Vielleicht würde sich Gott der Sache annehmen und sie dafür bestrafen, dass sie die arme Sylvia so misshandelt hatten. Aber es fiel mir schwer, meine Wut loszulassen. Ich stand am Küchentresen, kaute zornig auf dem Toast herum und machte meinen Standpunkt klar, indem ich mich nicht zu Noah an den Tisch setzte. Er streckte die langen Beine aus und lehnte sich zurück, dann legte er die Arme auf die Rückenlehnen der beiden Stühle neben ihm.
»Wie alt bist du?«, fragte er, und ich warf ihm aus schmalen Augen einen Blick zu, antwortete aber nicht. Er lachte leise. »Redest wohl nicht mit mir, was?«
»Ich rede nicht mit Leuten, die Freude am Schmerz anderer Menschen haben.«
»Dann solltest du wirklich nicht mit mir reden.« Irgendetwas in seiner unbeirrbaren, selbstzufriedenen Miene brachte mich ernstlich aus dem Konzept.
Ungläubig erwiderte ich seinen Blick. »Dir macht es wirklich Spaß, anderen wehzutun?«
Er zuckte mit einer Schulter. »Nur wenn sie es verdient haben.«
Na, die Antwort war ja zum Glück überhaupt nicht beunruhigend. Meine Augenbrauen schossen in die Höhe. »Sylvia leidet schon genug, sie hat auf keinen Fall noch mehr Schmerz verdient.«
Als er nichts darauf erwiderte, kniff ich die Augen zusammen. »Was willst du überhaupt hier? Wieso kommst du nach all den Jahren wieder nach Hause?«
Er schnalzte missbilligend. »Beantworte meine Frage, und ich beantworte deine.«
Ich seufzte. Am besten wäre ich einfach weggegangen, aber ich war nicht nur wütend, sondern auch fasziniert. Ich wollte mehr über Vees Bruder erfahren, auch wenn ich ums Verrecken nicht hätte sagen können, weshalb. »Ich bin achtzehn«, antwortete ich schließlich. »Auch wenn ich nicht weiß, warum dich das interessieren sollte.«
Noah lachte. »Nennen wir es morbide Neugier.«
Ich starrte ihn an und kapierte nicht, was daran lustig sein sollte. Er grinste übers ganze Gesicht, sein Blick klebte förmlich an mir. Sein Lächeln wirkte irgendwie unecht. Es reichte nicht bis in die Augen. Am Ende verlor ich das Blickduell und sah rasch aus dem Fenster. Seine Augen brachten mich völlig durcheinander. Ich konnte mich nicht entscheiden, ob ich sie schön oder verstörend fand. Die Wimpern waren sehr dunkel, was das ungewöhnliche Grün umso stärker leuchten ließ. Vee hatte viel hellere Wimpern und einen sehr hellen, fast kreidigen Teint, deshalb wirkten ihre Augen nicht halb so beeindruckend.
»Du hast meine Frage noch nicht beantwortet«, sagte ich. »Weshalb bist du nach Hause gekommen?«
»Weil es an der Zeit war«, antwortete er kryptisch.
»Tja, das sagt mir jetzt so ungefähr genau gar nichts«, sagte ich trocken, und wieder verriet das Zucken von Noahs Mundwinkeln seine Belustigung. »Was machst du beruflich?«, fragte ich weiter und hoffte, die Antwort würde meine Befürchtungen zerstreuen. Ehrlich gesagt, sah er aus wie ein Drogendealer oder was ähnlich Finsteres.
Er hob ganz sachte eine Braue. »Ich bin Location-Scout. Für Filme.«
Ich kaute auf einem Bissen Toast herum. »Echt?«
Er schnaubte, als hielte er mich für unfassbar leichtgläubig. »Nein.« Sein Blick wanderte zum Wappen meiner Uniform hinunter. »Gehst du gern aufs Loreto?«
Ich schluckte den Bissen runter und wandte kurz den Blick ab. »Ja und nein. Ich lerne gern, aber es ist manchmal ein bisschen beklemmend, wenn man immer nur Mädchen um sich hat.« Ich spekulierte darauf, dass er sich ebenfalls ein bisschen öffnete, wenn ich damit anfing, und hoffte, meine Taktik würde aufgehen.
»Ich glaub, ich hab mal einen Film mit dem Titel gesehen«, sagte er nachdenklich.
Ich verdrehte die Augen. »Sehr witzig. Wo lebst du normalerweise?«
»Nirgendwo. Ich ziehe viel rum.«
»Wie ein Vagabund?«
Er schüttelte den Kopf. »Ich bevorzuge Hotels.«
»Ich war noch nie in einem Hotel«, gab ich zu. Wenn Dad und ich im Urlaub gewesen waren, hatten wir immer im B&B oder in Ferienwohnungen übernachtet. Viel Geld hatte uns meist nicht zur Verfügung gestanden, und außerdem hatte er es gern entspannt gehabt.
»Wirklich nicht?«, fragte er, zog ein Päckchen Zigaretten aus der Hosentasche und zündete sich eine an. »Ich mag diese kleinen Pfefferminzbonbons, die sie immer aufs Kopfkissen legen. Kennst du die? Dann fühlt man sich wie jemand Besonderes. Wart mal ab, eines Tages schläfst du auch in einem Hotel, und dann siehst du den kleinen Bonbon und sagst zu dir selbst: Noah hatte recht, ich fühle mich wirklich wie was Besonderes.«
Ich betrachtete ihn und zog eine Braue hoch. »Du bist schon ein bisschen schräg drauf, oder?«
Er nahm einen Zug und atmete aus, der beißende Rauch drang mir im selben Moment in die Nase, als er Daumen und Zeigefinger hob. »Nur ein ganz klein wenig.« Seine Lippen zuckten kaum merklich.
Kurz herrschte Stille. Noah rauchte, und ich aß mein Frühstück. Dann hörte ich Geräusche aus Vees Zimmer direkt über unseren Köpfen und zog eine Grimasse. Das Ungeheuer ist erwacht. Vee schlief kaum, höchstens vier, fünf Stunden pro Nacht. Deshalb hatte sie immer diese grauen Säcke unter den Augen.
»Du magst meine Schwester nicht besonders, was?«, stellte Noah fest, und ich sah ihn blinzelnd an.
Eine Weile überlegte ich, was ich antworten sollte, dann entschied ich mich für Ehrlichkeit. »Wenn mein Leben ein Märchen wäre, dann wäre deine Schwester die böse Königin, die alles daransetzt, mich unglücklich zu machen.«
Noah neigte den Kopf, in seinem Blick flackerte Neugier auf. Ich bereute meine Worte augenblicklich. Würde er es Vee verraten?
»Bitte sag das nicht Vee. Sonst zwingt sie mich zu irgendwas Widerlichem. Dazu, ihre Zehennägel zu schneiden oder den Kamin zu putzen«, bat ich ihn mit weit aufgerissenen Augen.
Noah legte den Kopf schief. »Machst du das nicht eh schon?«, fragte er spöttisch. Was er damit sagen wollte, musste er nicht aussprechen: Du bist Vees Fußabtreter. Ich bin gerade mal seit einem Tag hier, und sogar ich sehe das.
Die Implikation, dass ich schwach war, gefiel mir nicht. Etwas tief in mir schauderte unwillkürlich vor dem Gedanken zurück. Aber es stimmte – ich war Vees Lakai, und solange ich noch zur Schule ging und ein Dach überm Kopf brauchte, blieb mir keine andere Wahl, als weiter mitzuspielen. Ich drehte mich um und kippte den restlichen Tee in den Ausguss.
»Erzähl es ihr einfach nicht, okay? Mein Leben ist eh schon völlig im Arsch. Ich brauche niemanden, der es noch tiefer reinschiebt, vielen herzlichen Dank auch.«
Sein Blick folgte mir, als ich meine Schultasche nahm und zur Hintertür ging. »Du hast ein ganz schönes Schandmaul.«
Ich antwortete nicht. Er hätte sonst nur irgendwas Blödes gekontert. Stattdessen verließ ich das Haus und machte mich auf den Weg zur Schule, wie gewohnt am Strand entlang, Noahs belustigtes Lachen im Kielwasser.
2. KAPITEL
»Meine Mutter hat erzählt, dass Vee gestern Abend mit irgendeinem jungen Stecher in die Bar gekommen ist und fast zweihundert Euro für Drinks ausgegeben hat«, sagte Aoife auf dem Weg zu Bio, die Augen tellerrund.
Aoifes Mutter war die Managerin vom O’Hares-Pub in der Stadt, der Matt O’Hare gehörte, dem Vater der widerwärtigen Sally O’Hare. Über Vees hohe Ausgaben war ich nicht besonders überrascht. Beim Alkohol bevorzugte sie die teure Sorte, und sie konnte einiges vertragen.
»Das war nicht ihr Stecher, sondern ihr Bruder. Er heißt Noah.«
»Ich wusste gar nicht, dass sie einen Bruder hat.«
Ich zuckte mit den Schultern. »Ich auch nicht, die Neuigkeit hat sie mir erst gestern eröffnet. Er wohnt bei uns. Und natürlich war ich es, die das Gästezimmer geputzt und für ihn vorbereitet hat.«
»Du musst damit aufhören, alles für sie zu erledigen, Stells. Es macht mich echt wütend, wie sie dich behandelt.«
»Mich macht es auch wütend, aber ich weiß nicht, ob sie überhaupt weiß, wie Nettsein geht. Wahrscheinlich ist sie schon Befehle keifend und mit finsterem Blick zur Welt gekommen«, witzelte ich halbherzig.
Aoife sah mich mitfühlend an und wechselte das Thema.
»Wie ist ihr Bruder denn so?«
»Die Jury hat noch nicht entschieden. Er ist ein bisschen rätselhaft.« Das eigenartige Gefühl tief unten im Bauch, das mich in seiner Gegenwart befiel und von dem ich nicht zu sagen vermochte, ob es was Gutes oder Schlechtes war, erwähnte ich nicht.
»Wie sieht er aus? Mam hat gesagt, ziemlich gut.«
»Das stimmt. Er sieht ganz anders aus als Vee. Das einzig Ähnliche sind ihre Augen«, antwortete ich, just in dem Moment, als Sarah O’Hare mitsamt ihrer Clique an uns vorbeikam.
Sobald sie mich entdeckte, trat ein hungriger, grausamer Schimmer in ihre Augen, und ich wusste, ich war fällig. Also schluckte ich schwer und wappnete mich für die Kränkung, die sie heute für mich in petto haben würde. Als nichts passierte, war ich überrascht, aber im nächsten Augenblick begriff ich, weshalb, denn ich stolperte und knallte hin, landete auf Händen und Knien auf dem kalten Linoleum. Sie hatte mir eine leere Wasserflasche zwischen die Füße geworfen, um mich zum Stolpern zu bringen. Claire McBride, ihre beste Freundin, lachte entzückt auf, und das Grüppchen entschwand den Flur hinunter. Ich schluckte die Tränen hinunter, einen dicken Kloß in der Kehle. Aoife half mir auf, das Gesicht vor Zorn verdunkelt.
»Sie ist der Antichrist, ich schwör’s dir.«
»Ja. Ich frag mich, ob sie und Vee irgendwie verwandt sind«, stimmte ich mit zittriger Stimme zu und rieb mir das Knie, das später bestimmt blau sein würde.
»Würde mich nicht überraschen«, sagte Aoife.
Als wir ins Klassenzimmer kamen, kicherten Sally und Claire und tuschelten miteinander. Ich wurde jedoch von Mr Kennedy abgelenkt, der meinen Namen rief.
»Estella, ich gratuliere dir, du hast letzte Woche beim Photosynthese-Test die Bestnote erreicht.« Er strahlte mich an. Mr Kennedy war ein kleiner Mann mit hellbraunem Haar und Brille, und er war mein Lieblingslehrer, denn er hatte ein freundliches Gesicht und immer ein aufmunterndes Lächeln für seine Schüler übrig. In meinem Leben war Freundlichkeit ein seltenes Gut.
»Gut gemacht, Stells.« Aoife stupste mich mit dem Ellbogen an.
Ich räusperte mich, immer noch mitgenommen von der Demütigung, mich im Flur auf die Schnauze gelegt zu haben. »Danke«, erwiderte ich und brachte ein Lächeln zustande.
Mr. Kennedy reichte mir meine Arbeit und klopfte mir auf die Schulter, ehe er die anderen Arbeiten austeilte. Ich setzte mich auf meinen Platz neben Aoife, der sich direkt vor Sallys Tisch befand.
»Streberin«, schnaubte Sally, aber ich drehte mich nicht um. Aoife bedachte sie mit einem unfreundlichen Blick und sagte zu mir, ich solle sie einfach ignorieren.
»Die hält sich für was Besseres.« Sally gab nicht auf. »Beschissene Intelligenzbestie.«
Ich biss die Zähne zusammen und packte meinen Stift fester. Sie war meinen Zorn gar nicht wert, auch wenn ich Visionen hatte, wie ich mich umdrehte und ihr meinen Stift ins Auge rammte.
Aber nein, es gab Wichtigeres, was nach meiner Aufmerksamkeit verlangte, zum Beispiel das nächste Kapitel meines Biobuchs, das ich lesen sollte. Als Sally begriff, dass sie mir keine Reaktion entlocken konnte, gab sie schließlich auf, und ich atmete auf, erleichtert, dass sie endlich ihr Lästermaul hielt.
Nach der Schule ging ich allein nach Hause und bereitete in Gedanken mehrere Vorträge vor, die ich Vee halten wollte, weil sie Sylvia gestern so übel mitgespielt hatte. Zwar war mir insgeheim klar, dass ich am Ende kein Wort sagen würde, aber schon die Vorstellung, ihr gründlich die Meinung zu geigen, tat mir gut.
Mein Leben segelte haarscharf am Abgrund entlang, und ich musste die Füße stillhalten, bis ich mit der Schule fertig war. Wenn ich jetzt auf einmal den Aufstand probte und versuchte, Vee zur Rechenschaft zu ziehen, konnte es gut sein, dass sie mich rauswarf und ich auf einmal mittellos auf der Straße stand.
Bei dem bloßen Gedanken zog sich mein Magen zusammen.
Ich schloss die Hintertür auf, betrat die leere Küche und ließ die Schultasche auf den Boden fallen. Dann trat ich ans Waschbecken, um mir ein Glas mit Leitungswasser zu füllen; nach dem langen Weg war ich durstig. Mein Knie schmerzte noch immer, und nachdem ich das Wasser runtergestürzt hatte, stellte ich den Fuß auf einen Stuhl und zog meinen Rock hoch, um den Schaden zu begutachten. Auf dem Knie bildete sich ein dunkelvioletter Bluterguss, und auf den Handflächen hatte ich auch ein paar Abschürfungen.
»Da kommt wohl jemand aus dem Krieg«, sagte plötzlich jemand, und ich schrak zusammen. Rasch schob ich den Rock wieder runter und richtete mich auf.
Noah stand mit verschränkten Armen und undurchschaubarer Miene in der Tür. Kurz sah er mir in die Augen, dann wanderte sein Blick zu der feingliedrigen Goldkette, die ich um den Hals trug. Fasziniert betrachtete er das kleine Kruzifix, das daran hing. Die Kette war ein Geschenk von Dad, und ich nahm sie praktisch nie ab. Bei der Eindringlichkeit, mit der Noah den Anhänger betrachtete, standen mir die Härchen im Nacken zu Berge.
Während er mich musterte, nutzte ich die Gelegenheit, ihn ebenfalls zu betrachten, und mit einem Mal wurde mir klar, wie attraktiv er war. Dass er gut aussah, war mir natürlich auch schon vorher aufgefallen, aber er war tatsächlich ungewöhnlich attraktiv, auf eine dunkle, eindringliche Weise. Groß und breitschultrig und mit einem Selbstbewusstsein, das ihn fast gefährlich erscheinen ließ. Als wüsste er sich auch in einem Kampf gut zu behaupten.
»Lass mich raten, heute war Sportstunde?«, fragte Noah.
Mit finsterer Miene schüttelte ich den Kopf und fragte mich, weshalb ihn das interessierte. »Nein. Ein Mädchen aus meiner Klasse hat mich zum Stolpern gebracht.«
Er legte den Kopf schief. »Warum?«
Ich zuckte mit den Schultern. »Sie hatte schon immer irgendein Problem mit mir.« Kurz verstummte ich und sah ihn an, dann fügte ich hinzu: »Außerdem ist sie ein Riesenmiststück.«
Seine Mundwinkel zuckten, als fände er das amüsant. Er kam herein und lehnte sich gegen den Tisch. »Wie hast du es ihr heimgezahlt?«
»Ich habe es ihr heimgezahlt, indem ich sie ignoriert habe. Sie ist meine Zeit nicht wert.«
»Feigling.«
Ich riss die Augen auf. »Wie bitte?«
»Weißt du, was ich gemacht hätte?«, redete er weiter, als hätte er mich nicht gehört. »Ich hätte meinen Zirkel genommen, sie irgendwo allein abgefangen und ihr die Spitze ins Fleisch gejagt. Danach hätte sie sich nicht mehr getraut, jemandem ein Bein zu stellen.«
»Du bist ja gestört«, sagte ich und musterte ihn misstrauisch.
»Ich bin kreativ. Und ich bin hier nicht derjenige, der sich bis zum Ende des Schuljahrs mit einer Mobberin rumschlagen muss. Mach was, um ihr zu zeigen, dass du es ernst meinst, dann hört sie auf. So funktionieren solche Leute.«
Ich zog einen Stuhl unter dem Tisch heraus, setzte mich und dachte darüber nach. Vielleicht sollte ich mir wirklich was überlegen, um Sally Angst einzujagen. Andererseits wurde ich bei meinem Glück wahrscheinlich erwischt und flog von der Schule.
»Bist du in der Schule auch gemobbt worden?«
Noahs Blick verfinsterte sich. »Jemand hat’s versucht.«
»Was ist passiert?«, fragte ich und beugte mich vor, seltsam begierig darauf, es zu erfahren.
Er setzte sich auf den Tisch, stellte die Füße auf einen Stuhl und sah auf mich herunter. In seinem Blick lag etwas Wildes, Ungezähmtes, das mich in den Bann schlug. »Da gab es diesen Typen, der hat das Gerücht verbreitet, ich würde gegen Bezahlung Schwänze lutschen«, sagte er, und mir blieb der Mund offen stehen.
Ich blinzelte, Hitze stieg mir in die Wangen. »Und hast du?«, fragte ich.
Er erwiderte meinen Blick ausdruckslos, kein Stück beleidigt von meiner Frage. »Nein.«
»Und was hast du gemacht?«
»Du kennst die Bath-Siedlung, wo überall diese kleinen Gassen zwischen den Häusern sind?«
Ich nickte. »Das ist wie ein Labyrinth.«
Fast hätte Noah gelächelt. »Dieser Junge also, der ist immer quer durch diese Gassen gelaufen auf dem Weg nach Hause. Eines Abends bin ich ihm gefolgt, hab ihn im Dunkeln erwischt und dafür gesorgt, dass er aufhört, diese Lügen über mich zu verbreiten.«
»Wie?«, fragte ich so leise, dass es kaum zu hören war. Es dauerte lange, bis Noah antwortete, und ich fragte mich schon, ob er in Gedanken seine Antwort zensierte, weil er dachte, die Wahrheit wäre für mich zu krass. Aber als er dann antwortete, war gar nichts zensiert.
»Ich hab ihm damit gedroht, ihm den Griff einer Machete anal reinzurammen.«
Ich zuckte zurück, keuchte auf und schlug erschrocken eine Hand vor den Mund. Mein Magen schlug einen Salto. »Das ist fürchterlich!«
»Es hat funktioniert«, sagte Noah, und da lag etwas in seinem Blick, bei dessen Anblick sich mir die Eingeweide verknoteten. Ich fragte mich, ob er es vielleicht wirklich getan hatte, statt es nur anzudrohen. Aber ich verwarf den Gedanken gleich wieder, weil nur ein Psychopath so etwas täte, und ich wollte mir nicht vorstellen, im selben Haus zu schlafen wie ein Psychopath.
Als ich antwortete, wusste ich selbst nicht, weshalb ich es ihm erzählte, ich wusste nur, dass der Drang, es ehrlich auszusprechen, mich am Kragen gepackt hatte und nicht mehr losließ. »Ich wollte Sally einen Stift ins Auge rammen«, gestand ich ihm, und sofort fühlte ich mich schuldig.
Eine seiner dunklen Brauen hob sich ganz leicht, als hätte ich ihn überrascht. »Warum hast du es nicht getan?«
Ich stieß die Luft aus und wiederholte, was er zuvor über mich gesagt hatte: »Weil ich ein Feigling bin.«
Wir sahen einander in die Augen, und der Augenblick schien sich zu einer Ewigkeit auszudehnen. »Ich glaub nicht, dass das der Grund ist«, sagte Noah schließlich.
»Tust du nicht?«
»Nein. Ich glaube, dass du deine Mobberin nicht verletzt hast, weil es nicht in deiner Natur liegt, gewalttätig zu werden, ganz egal, wie es in deiner Fantasie aussieht.«
Es beunruhigte mich, dass er mich so mühelos durchschaute. »Du weißt nichts über meine Natur. Du kennst mich doch kaum.«
»Aber ich sehe dich«, sagte er, und der Ernst in seinen Augen ließ meinen Atem stocken. Tiefe Stille breitete sich aus. Was meinte er damit, dass er mich sah? Ohne jeden Grund füllte sich mein Bauch randvoll mit einem summenden Schwarm Bienen.
Ich war so sehr mit dieser Frage beschäftigt, dass ich kaum bemerkte, wie Vee hereinkam. Sie trug einen mit Blumen bedruckten Bademantel über dem Pyjama und Schaffellpantoffeln an den Füßen. Sie blickte zwischen Noah und mir hin und her und kniff ganz langsam die Augen zusammen. »Ich hoffe, du belästigst nicht meinen Bruder, Estella.«
Ich spannte die Muskeln und verteidigte mich: »Nein, tu ich nicht.«
»Ich hab ihr gerade eine Geschichte aus meiner Schulzeit erzählt«, sagte Noah. »Erinnerst du dich an Adam Fowler?«
Vee runzelte die Stirn, band den Bademantel zu und setzte den Wasserkessel auf. »Sollte ich?«, fragte sie desinteressiert.
Noah stieß die Luft aus. »Wahrscheinlich nicht. Du warst zu der Zeit nicht viel da.«
»Was meinst du denn damit? Ich war immer da.«
Noah bedachte sie mit einem bedeutungsvollen Blick, und seine Stimme wurde überraschend sanft. »Warst du das?«
Vee wirkte gereizt, drehte sich von ihm weg und hantierte mit den Teetassen herum. »Ich weiß nicht, wovon du da redest.«
Kurz herrschte Schweigen, dann sagte Noah einfach so: »Estella wird von einem Mädchen an ihrer Schule gemobbt.«
Entsetzt starrte ich ihn an. Ich hatte unsere Unterredung für eine Privatsache gehalten. Ich Idiotin mal wieder.
Vee drehte sich um und musterte mich, ihre rötlichen Brauen schoben sich zusammen. »Ist das so?«
Ich nickte wortlos.
»Von wem?«
Mir fiel kein Grund ein, die Antwort zu verweigern. Es war ja nicht so, als bestünde die Gefahr, dass Vee zur Schule marschieren würde, um zu verlangen, dass Direktor Hawkins Sally dafür bestrafte, wie sie mich behandelte. Um ehrlich zu sein, wäre ich im Gegenteil nicht besonders überrascht, wenn Vee sie aufsuchen und ihr zu der guten Arbeit gratulieren würde. Immerhin war es die drittgrößte Freude ihres Lebens, mich fertigzumachen. Ihre zweitgrößte Freude war es, Sylvia fertigzumachen, und ihre größte, sich Nacht für Nacht halb ins Koma zu saufen.
»Sally O’Hare«, sagte ich, und mir fiel auf, wie Noahs Augen bei dem Namen aufflammten. Kannte er sie?
Vee schürzte die Lippen und musterte mich. »Unternimmst du was dagegen?«
»Was soll ich schon machen? Sie hat mehr Freunde als ich. Das ist eine verlorene Schlacht.«
»Die O’Hares sind ein Haufen unterbelichteter Neandertaler. Du hast deinen Verstand, Estella, und der ist dem einer Sally O’Hare weit überlegen. Setz Worte als Waffe gegen sie ein, und du gewinnst.«
Ich blinzelte, fassungslos, dass Vee mir gerade ein Kompliment gemacht hatte, ganz zu schweigen davon, dass sie mir einen fast mütterlichen Rat gab. Ich öffnete den Mund, brachte aber kein Wort heraus. Vee öffnete den Hängeschrank und fluchte, als sie feststellte, dass keine Teebeutel mehr im Haus waren.
»Nimm etwas Geld aus der Schublade im Flur und lauf rasch zum Laden rüber, Estella«, befahl sie verärgert und knallte die Schranktür zu. »Jedes Mal, wenn ich einfach nur eine verschissene Tasse Tee will, haben wir entweder keine Milch, keine Teebeutel oder keinen Zucker mehr im Haus, oder gar nichts von allem.«
Stumm gehorchte ich und verließ eilig die Küche. Im Flur blieb ich stehen, weil ich einen Knall hörte, als hätte jemand mit der flachen Hand auf den Holztisch geschlagen. Es war so laut und unvermittelt, dass das Haus erzitterte. Das musste Noah gewesen sein.
»Warum gehst du denn nicht einkaufen, wenn ständig alles fehlt, Schwester? Du siehst aus, als hättest du seit 2008 nichts mehr gegessen.«
Leise keuchte ich auf, weil er so mit ihr zu reden wagte. Mit klopfendem Herzen wartete ich auf Vees Reaktion. Ich ging davon aus, dass sie ihn anschreien, durchdrehen würde, aber das tat sie nicht. Stattdessen wurde ihre Stimme dünn und schwächlich.
»Ich esse«, behauptete sie. »Du weißt doch, dass die Frauen in unserer Familie von Natur aus dünn sind.«
»Du bist nicht dünn, du bist ein Skelett. Traue ich mich, das auszusprechen? Ja, verflucht. Du tust so, als wäre es völlig normal, aber ich kriege bei deinem Anblick Angst, dass ich dich bald mit diesen Spezialrationen füttern muss, die sie hungernden Kindern in Afrika geben.« Das war beleidigend und gemein, aber es klang, als wäre er wütend, weil sie nicht besser auf sich achtgab.
»Du hast nicht das Recht, so mit mir zu reden«, antwortete Vee mit bebender Stimme.
»Du gehörst zu meiner Familie. Ich habe jedes Recht der Welt, dir zu sagen, wenn du dich selbst unnötig kaputtmachst.«
Vee antwortete nicht. Stattdessen floh sie aus der Küche. Ich drückte mich an die Wand und hoffte, dass sie mich nicht bemerkte und ihre Gefühle an mir abreagierte.
Aber sie rannte an mir vorbei, jagte die Treppe hinauf und knallte oben ihre Schlafzimmertür zu. Vorsichtig spähte ich in die Küche. Noah stand am Tisch, zusammengesunken und den Kopf in die Hände gestützt, seine Reue war offensichtlich. Offenbar spürte er meinen Blick, denn er sah auf und mir in die Augen. Mit wild hämmerndem Herzen machte ich kehrt, schnappte mir im Flur das Geld und verließ hastig das Haus.
Ungefähr fünf Minuten vom Konvent entfernt gab es eine öffentliche Schule, und das bedeutete vor allem eins.
Jungs.
Ich war noch nie mit einem Jungen befreundet gewesen, mal abgesehen von Aoifes Freund Jimmy, also hatte es natürlich auch nie einen festen Freund in meinem Leben gegeben. Vielleicht rief Noah deshalb dieses verwirrende Gefühlschaos in mir hervor. Mit Ausnahme von meinem Dad hatte ich in meinem bisherigen Leben mit dem anderen Geschlecht kaum etwas zu tun gehabt.
Manchmal kamen ein paar Jungs von der Öffentlichen rüber und hingen bei unserem Schultor rum, um Mädchen anzuglotzen, wenn wir Schulschluss hatten und nach Hause gingen. Claire McBride war nicht nur Sallys bösartige Verbündete, sondern außerdem widerlich hinreißend, sie erntete viel Aufmerksamkeit seitens der Jungs. Bei einem Schönheitswettbewerb wäre sie ganz klar die Gewinnerin gewesen, auch wenn ich den Verdacht hegte, dass sie bei einer größeren Konkurrenz einfach nur als niedlich gegolten hätte.
Das war das Problem daran, in einer Kleinstadt zu leben: Man wusste nie, ob man außergewöhnlich war oder einfach nur alle anderen sehr gewöhnlich, sodass jedes noch so kleine Talent überdeutlich zur Geltung kam.
»Hey, Süße«, rief einer der Jungs, und ich zog den Kopf ein und eilte durchs Tor, so schnell ich nur konnte. Sie meinten nicht mich, sondern die Mädchen hinter mir, unter denen sich auch Claire befand. Eine Schande, dass Aoife heute Basketballtraining hatte. Mit ihr an meiner Seite wäre ich nicht so nervös gewesen.
»Zeig uns deine Titten«, schrie ein anderer Junge, und ich beschleunigte meine Schritte. Unwillkürlich warf ich einen Blick in ihre Richtung und erkannte Kean Riordan. Er lebte von Vees Haus aus gesehen nur ein kleines Stück die Straße hinunter. Aber im Gegensatz zu Vees Haus war das der Riordans gut gepflegt. Seine Eltern hatten Geld, seinem Vater gehörte eine Rohrleitungsfabrik in der Gegend.
Kurz trafen sich unsere Blicke, und er lächelte mir zu, ehe ich mich abwandte und weiterlief. Wie eigenartig. Hatte er mich gerade wirklich angelächelt? Kean war ein heißer Typ, viele Mädchen aus der Stadt schwärmten für ihn. Vermutlich hätte mich sein Lächeln viel mehr begeistert, wenn nicht all meine Gedanken um Noah gekreist wären. Ich könnte nicht aufhören, seine Worte von gestern immer und immer wieder in meinem Kopf abzuspielen.
Aber ich sehe dich.
Ich wünschte, ich hätte aufhören können, an ihn zu denken, aber das war eine verlorene Schlacht. Als ich zu Hause ankam, ging ich durch die Hintertür hinein. Im Haus war es still. Wie immer ließ ich meine Tasche auf den Boden fallen, nahm mir ein Glas aus dem Regal und füllte es mit Wasser. Gerade als ich einen Schluck trank, hörte ich jemanden im Wohnzimmer sagen: »Jede Geschichte hat zwei Seiten.«
»Wie dem auch sei – deine Mutter ist eine liebenswerte Frau, und sie hat es nicht verdient, dass man so mit ihr redet.« Das klang nach Irene.
Stirnrunzelnd stellte ich das Glas ab. Als ich ins Wohnzimmer kam, sah ich Sylvia in ihrem Rollstuhl, daneben auf dem Sofa Irene. Noah saß vornübergebeugt im Sessel drüben am Fenster, den beiden zugewandt, die Ellbogen auf die Knie gestützt. Um seine Mundwinkel spielte ein spöttisches Lächeln. Der Fernseher war aus, und im Raum herrschte völlige Stille. Ich sah von Noah zu Irene. Die Spannung war mit Händen zu greifen.
»Ah, du bist zu Hause. Gut. Ich hab auf dich gewartet.« Noah stand auf und kam auf mich zu.
Ehe ich etwas darauf erwidern konnte, nahm er meine Hand und zog mich mit sich in den Flur. Ich gestattete mir nicht, der Frage nachzuspüren, wie sich die Berührung unserer Handflächen anfühlte, sondern riss mich los. »Was machst du denn da?«
»Ich nehme dich mit.«
»Ich gehe mit dir nirgendwohin.«
»Willst du lieber hier rumhängen?«
»Am liebsten würde ich hören, was da gerade zwischen dir und Irene vorgefallen ist.«
»Eine Meinungsverschiedenheit. Nichts, worum du dir Gedanken machen müsstest. Komm mit.«
Misstrauisch musterte ich ihn. »Mitkommen wohin?«
»Ich treffe mich mit einem Mann. Wegen einem Hund.«
Ich verschränkte die Arme vor der Brust. »Und wozu brauchst du mich?«
Er zögerte. »Für den Gesamteindruck.«
Ich starrte ihn an und kapierte gar nichts. Um ehrlich zu sein, sagte Noah eine Menge, was ich nicht verstand. »Na logisch. Ich hab Hausaufgaben.«
Als ich mich abwandte, packte er mich am Ellbogen. »Na, na, nicht so eilig. Was, wenn ich dich dafür bezahle?«
Das wurde ja immer verrückter, aber … nun, Geld konnte ich immer gebrauchen. »Wie viel?«
»Einen Fünfer.«
»Zwanzig.«
Er grinste über meine Dreistigkeit. »Fünfzehn.«
Ich seufzte. »Okay. Aber lass mich erst mal die Uniform loswerden.«
Ich kam nur einen Schritt weit, ehe er mich aufhielt. »Nein. Lass sie an.«
Fast hätte ich ihm gesagt, wie eigenartig er sich aufführte, aber dann schüttelte ich nur den Kopf und spielte mit. »Na schön.«
Draußen zog er Veronicas Autoschlüssel aus der Tasche.
»Vee wird sauer, wenn sie mitbekommt, dass du ihren Wagen nimmst.«
»Meine Schwester ist gerade damit fertig, eine Flasche Wodka in sich reinzukippen. Die nächsten ein, zwei Stunden macht sie gar nichts, außer tief in den Abgrund zu starren«, antwortete er.
Nachdenklich sah ich zu, wie er zur Beifahrertür ging, sie öffnete und mir bedeutete, ich solle einsteigen. Ich ging zum Auto, setzte mich hinein und fragte: »Macht es dir keine Sorgen?«
»Macht mir was keine Sorgen?«
»Dass deine Schwester mitten am Tag Alkohol trinkt.«
Er warf mir einen raschen Blick zu. »Sie trinkt auch nachts.« Mit diesen Worten schlug er die Tür zu und ging um den Wagen herum zur Fahrerseite.
Mit zusammengekniffenen Augen und Lippen musterte ich ihn, als er sich neben mich setzte. »Du solltest dir mehr Sorgen um sie machen.«
»Wer sagt denn, dass ich das nicht tu?«
»Du wirkst nicht so«, sagte ich, aber da erinnerte ich mich an gestern. Daran, wie er ausgesehen hatte nach seinem Streit mit Vee über ihr Gewicht. Traurig hatte er gewirkt, als würde er bedauern, wie das Gespräch verlaufen war. Vielleicht ging ich zu hart mit ihm ins Gericht. Immerhin hatte auch ich nicht gerade viel unternommen, um Vee am Trinken zu hindern. Na klar, sie hatte auch nicht gerade viel dafür getan, sich meine Hilfe zu verdienen, aber das hieß ja nicht, dass ich es nicht trotzdem hätte versuchen sollen. Immerhin hatte ich aus der Bibel gelernt, dass Geben seliger war denn Nehmen.
Noah musterte mich von der Seite. »Worüber denkst du gerade nach?«
»Ich hab mich nur gefragt, weshalb Vee dich nie erwähnt hat. Ich habe erst einen Tag vor deiner Ankunft erfahren, dass sie überhaupt einen Bruder hat.« Das war zwar nicht das, was ich wirklich gerade gedacht hatte, aber ich hegte den Verdacht, dass Noah es nicht zu schätzen wüsste, wenn ich ihm Textstellen aus der Bibel zitierte.
Sein Griff ums Lenkrad wurde fester. »Das liegt daran, dass ich das schwarze Schaf der Familie bin.«
»Ich würde trotzdem meinen, dass sie dich eigentlich hätte erwähnen müssen. Wenigstens irgendwann mal.«
»Es ist leichter, so zu tun, als hätte es mich nie gegeben«, sagte er, und ich zog die Stirn kraus und sah zu, wie er den Schlüssel einsteckte. Der Motor erwachte brummend zum Leben, und er schlug das Lenkrad ein und steuerte den Wagen auf die Straße. Das Haus stand an der Bowery Street, die direkt am Meer entlangführte. Eine alte viktorianische Treppe ermöglichte es, die Straße zu umgehen und direkt zur anderen Seite zu gelangen, wo ein paar weitere kleine Stufen zum Strand hinabführten.
»Hast du schon mal die Geschichte über die Treppe der Lady Maeve gehört?«, fragte Noah, nachdem er eine Weile schweigend gefahren war.
Ich blickte in den Rückspiegel und sah darin die entschwindende Treppe, und mir rann ein Schauer über den Rücken. »Na klar. Die Geschichte kennt hier jeder.«
Aber ich dachte gar nicht gern daran. Bei der Erzählung von der reichen Adligen, die freiwillig in den Tod gegangen war, drehte sich mir stets zuverlässig der Magen um. Ich war ziemlich sicher, dass einer meiner immer wiederkehrenden Träume von ihr handelte, und ich befürchtete, dass ihr Geist immer noch auf Vees Grundstück spukte.
Man sagte, dass die Adlige mit einem kalten und gewalttätigen Großgrundbesitzer verheiratet worden war und nirgendwo Trost gefunden hatte außer auf der Treppe, die zum Strand neben ihrem Schloss führte. Doch eines Nachts war ihr alles zu viel geworden, und sie hatte beschlossen, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Viele Leute behaupteten, dass man in den frühen Morgenstunden manchmal sehen konnte, wie ihr Geist die Treppen hinaufrannte und dann zu der Klippe hinunter, von der sie sich ins Meer geworfen hatte.
Das Schloss gab es immer noch, aber es hatte schon bei meiner Geburt leer gestanden und war dem Verfall anheimgefallen. Manchmal brachen Teenager dort ein, um sich zu betrinken und zu rauchen.
»Du siehst ganz ängstlich aus«, bemerkte Noah. »Erzähl mir nicht, du glaubst an Geister.«
Ich sah ihn an. »Tust du es?«
»Nicht wirklich. In der echten Welt gibt es eine Menge echter Schrecken, da brauch ich keine unsichtbaren Schreckgespenster obendrauf.«
Meine Handflächen wurden schwitzig. »Also glaubst du nicht, dass es in Vees Haus spukt?«
»Genau genommen ist es Sylvias Haus. Und ja, dort spukt es, aber nicht so, wie du denkst.«
»Was meinst du damit?«
»Wie gesagt, die echte Welt hat viele Schrecken zu bieten«, wiederholte er.
Kurz herrschte Schweigen, dann bohrte ich weiter: »Was ist mit deinem Vater? Manchmal frage ich mich, ob sein Geist ebenfalls noch hier herumspukt.«