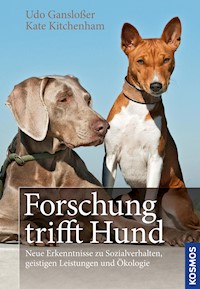24,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 24,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Franckh-Kosmos Verlags-Gmbh & Co. KG
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Hundehalter sehnen sich nach einer festen Bindung zu ihrem Hund. Wie kann dieses Band geknüpft werden? Udo Gansloßer und SPIEGEL Bestseller Autorin Kate Kitchenham begeben sich auf Spurensuche: Sie durchstreifen die Gebiete der Entwicklungs- und Neuropsychologie, zeigen mit Hilfe von aktuellen Studien und spannenden Fallbeispielen wie Gefühle, Hormone und Erlebnisse die Innigkeit des Zusammenseins beeinflussen und wie stark sich unser Verhalten auf die Persönlichkeitsentwicklung des Hundes auswirken kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Dieses E-Book ist die digitale Umsetzung der Printausgabe, die unter demselben Titel bei KOSMOS erschienen ist. Da es bei E-Books aufgrund der variablen Leseeinstellungen keine Seitenzahlen gibt, können Seitenverweise der Printausgabe hier nicht verwendet werden. Stattdessen können Sie über die integrierte Volltextsuche alle Querverweise und inhaltlichen Bezüge schnell komfortabel herstellen.
Vorwort von Marc Bekoff
Vorwort von Marc Bekoff
Zu meinen Studienzeiten in den 70ern galten Tiere und sogar neugeborene Menschen als „Reflex-Maschinen“, die simpel auf verschiedene Arten von Stimuli reagieren. Emotionen wurden nicht-menschlichen Lebewesen nicht zugesprochen, denn schließlich, so die Argumentation der „Behavioristen“, sei die Existenz von Gefühlen experimentell nicht nachzuweisen. Ich sage immer: Solange wir nicht die Abwesenheit von Gefühlen beweisen können, sollten wir davon ausgehen, dass viele nicht-menschliche Tiere Liebe und Freude empfinden können.
Heute erleben wir eine überwältigende Anzahl von internationalen Studien, die Fähigkeiten wie Einfühlungsvermögen bis hin zu Empathie, Moral und sogar Bewusstsein und Denkstrukturen im Tierreich erforschen. Eines der populärsten Forschungsobjekte in diesen detaillierten empirischen Forschungsarbeiten sind Hunde. Warum gerade der Hund? Hunde leben seit 15.000, vielleicht sogar 30.000 Jahren an unserer Seite. Sie sind Experten darin, unser Verhalten zu analysieren, sie wissen, wann wir traurig, glücklich, aufmerksam oder abgelenkt sind, und sind in der Lage, ihr Verhalten dieser Geistesverfassung und unseren unterschiedlichen Persönlichkeiten anzupassen. Hunde leben schon so lange so eng mit uns zusammen, dass sie wahrscheinlich sogar den Menschen gegenüber einem Artgenossen als Bindungspartner bevorzugen, wie Studien vermuten lassen.
In den 70er Jahren hat die Psychologin Dr. Mary Ainsworth ihre sehr wichtigen Bindungsstudien mit Kleinkindern durchgeführt. Hier wurde untersucht, an welchen Anzeichen man eine stabile Bindung zwischen Eltern und Kindern erkennen konnte. Diese Studie wurde in den letzten Jahren mit Hunden wiederholt und das erstaunliche Ergebnis dieser und ähnlicher Forschungsprojekte war, dass Hunde wie Kleinkinder ihre Besitzer als „sicheren Hafen“ ansehen. Die Beziehung zwischen Hund und Mensch gleicht also der Eltern-Kind-Beziehung.
Forschung, die soziale Bindungen im Fokus hat, konnte zeigen, dass verschiedene Persönlichkeiten von Menschen und Hunden unterschiedliche Arten von Beziehungen und sozialen Bindungen entwickeln – alles sehr ähnlich zu der Art und Weise, wie wir soziale Bindungen und Beziehungen zu anderen Menschen pflegen und entwickeln. Diese Ergebnisse können uns helfen, einen passenden Weg zu finden, die Bedürfnisse unseres Hundes zu erkennen und eine natürliche, aber feste Bindung zu entwickeln.
In diesem Buch präsentieren die beiden Autoren Udo Gansloßer und Kate Kitchenham das Wissen aus Hunderten von verschiedenen wissenschaftlichen Studien. Diese Erkenntnisse führen uns die wunderbare Freundschaft vor Augen, die zu Hunden möglich ist. Mit diesem Hintergrundwissen können wir das generelle Phänomen „Bindung zwischen Hund und Mensch“ verstehen und bekommen gleichzeitig eine Hilfestellung, wie wir die Erkenntnisse mit unserem ganz besonderen, individuellen Hund für eine starke, gegenseitige Bindung umsetzen können. Und Hunde, die eine sichere Bindung erleben dürfen, sind bereit, an unserer Seite die Welt zu erkunden. Sie führen ein aktives, fröhliches Leben und sind hochinfektiöse Überträger von Authentizität und Lebensfreude!
© Debra Bardowicks
Voraussetzungen, Grundlagen und die Mitgift
Voraussetzungen, Grundlagen und die Mitgift
© Sabine Stuewer/Kosmos
Warum ist Hund nicht gleich Wolf?
Bei der Suche nach Erklärungsmodellen für Hundeverhalten wird häufig der Vergleich zum Wolf bemüht und entsprechend „abgeschaute“ Erziehungstipps erteilt. Doch diese Vergleiche sind nicht nur oft falsch, sondern auch unangebracht.
Ob es um die Ernährung des Hundes geht, um die sogenannte Alpha-Position, allgemein die Rangordnung, oder um die Frage des Jagdverhaltens als sozialer Klebstoff bei der Gruppenbildung – ständig wird der Wolf als Grundlage zitiert. Diese Bezugnahme auf den Wolf ist jedoch nur bedingt berechtigt.
Zum einen beruhen viele der Vorstellungen über „das, was Wölfe so tun“, schlichtweg auf veralteten, unter beengten Gehegebedingungen erhobenen Daten. Freilandstudien an Wölfen, in verschiedenen Teilen der Welt, haben ganz andere Zustände gezeigt, z. B. eine vernetzte Familienstruktur anstelle einer linearen Rangordnung (Bloch und Radinger 2011, siehe auch hier).
Auch, dass die Gruppenjagd die wichtigste Voraussetzung für ein funktionierendes Sozialsystem bei Wölfen wäre, ist nach neueren Erkenntnissen nicht haltbar. Entsprechend muss die oft empfohlene „symbolische Jagd“ mit dem Hund als Bindunskatalysator kritisch hinterfragt werden. Nicht die gemeinsame Jagd, sondern die gemeinsame Verteidigung von Ressourcen (speziell Revier und Nahrungsquellen) sind es, die den sozialen Zusammenschluss von Hundeartigen zu Gruppen oder manchmal auch zu Rudeln fördern. Näheres dazu hat David MacDonald in seiner Ressourcen-Verteidigungs-Hypothese (MacDonald 2006) dargelegt. Nach neuesten Erkenntnissen der Hirnforschung zeigt sich, dass die Gehirne der Vorfahren der Hundeartigen sich bereits zu einer Zeit weiterentwickelt haben, in der höchstwahrscheinlich noch keine Gruppenjagd in offenen Grasländern möglich war. Stattdessen wird vermutet (Marshall-Pescini und Kaminski 2014), dass der entscheidende Anstoß für die Vergrößerung der sozial-relevanten Teile im Gehirn der Hundeartigen durch die Ausbildung von Bindungen und komplizierten sozialen Beziehungen erfolgte.
Veränderungen im Erbgut
Eine vergleichende Untersuchung des Erbgutes von Wölfen und Haushunden, mit modernen, molekularbiologischen Methoden (Aelson 2013, Arendt 2014, Freedman et al. 2014) zeigte, dass es eine ganze Reihe von Veränderungen im Erbgut und in der Genstruktur zwischen Wolf und Haushund gibt. Diese betreffen zum einen eine Reihe von Genen, die mit sozialen Funktionen im Gehirn befasst sind. Zum anderen betreffen sie aber auch Genabschnitte, die für die Produktion von Stärke spaltenden Verdauungsenzymen notwendig sind. Das Amylasegen, das Stärke spaltende Verdauungssäfte produzieren lässt, ist auf dem Weg vom Wolf zum Haushund vermehrt worden. Mehrere Kopien des Amylasegens ermöglichen es dem Hund, Stärke spaltende Verdauungssäfte in größeren Konzentrationen herzustellen, als Wölfe dies tun.
Damit ist belegt, dass Kohlenhydrate in der Nahrung von Haushunden bereits seit sehr langer Zeit vorhanden sind. Es handelt sich also keineswegs um die finsteren Machenschaften der Futtermittelindustrie, sondern Hunde sind als Müllräumer und Abfallbeseitiger entstanden (siehe auch Coppinger und Coppinger 2001). Dies bedeutet nun nicht, dass man seinen Hund ausschließlich mit Müll und Abfällen ernähren sollte. Aber der Aufstand und Aufwand, der in bestimmten Kreisen von Hundehaltern/innen wegen der Ernährung des Hundes und speziell der angeblich biologisch artgerechten Fütterung mit rohem Fleisch betrieben wird, ist dadurch nicht mehr fundiert.
Arendt et al. (2014) und Freedman et al. (2014) haben gezeigt, dass innerhalb der Haushunde, rasse- und individuenabhängig, große Unterschiede in der Kopienzahl des genannten Amylasegens vorliegen. Im Gegensatz zum Menschen, bei dem diese unterschiedlichen Kopienzahlen auch vorkommen, gibt es bei Hunden aber keinen Zusammenhang mit der Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Diabetes mellitus, weder rasse- noch individuentypisch.
Toleranz gegenüber Fremden
Über die Unterschiede im Verhalten von Wolf und Hund wurde in der letzten Zeit eine Reihe von guten Zusammenstellungen veröffentlicht. Bradshaw (2011) zeigt deutlich, anhand einer Datenzusammenstellung über verwilderte oder anderweitig weitgehend menschenunabhängig lebende Haushunde, dass die Aggressivität im Umgang mit unbekannten Artgenossen bei Haushunden wesentlichen geringer scheint als bei Wölfen. Gerade in der Begegnung mit fremden Artgenossen, auch Reviernachbarn oder „Durchreisenden“, findet sich im Gegensatz zum Wolf bei verwilderten oder anderweitig selbstständig lebenden Haushunden kaum eine Beschreibung über wirklich schwere bis tödliche Verletzungen. Meist geht man eher freundlich miteinander um, imponiert vielleicht etwas, und geht dann nach kurzem Informationsaustausch wieder seiner Wege. Auch im Innergruppenzusammenhang sind Haushunde in der Regel, laut Bradshaw und der von ihm zusammengestellten Literatur, weniger aggressiv. Hier gibt es durchaus gegensätzliche Auffassungen, etwa zusammengetragen von Kaminski und Marshall-Pescini 2014. Diese beschreiben unter anderem Befunde zur aggressiven Kommunikation, z. B. aus der Arbeitsgruppe von Feddersen-Petersen (2008), wonach Haushunde gröber aggressiv kommunizieren als Wölfe das tun. Jedoch sind eine Vergröberung des aggressiven Kommunikationsrepertoires, und evtl. auch eine schnellere Eskalationsbereitschaft in der aggressiven Kommunikation, nicht unbedingt gleichbedeutend mit dem „Wunsch“, den Artgenossen gleich endgültig und in drastischer Art und Weise zu entsorgen. Die Befunde beider genannten Zusammenstellungen müssen nicht unbedingt widersprüchlich sein.
Hunde zeigen sich gegenüber fremden Artgenossen toleranter als Wölfe. Doch der Spaß hört auf, wenn wertvolle Ressourcen verteidigt werden müssen.
© Katja Krauß/Kosmos
Verstehen und verstanden werden
Wichtige Unterschiede auf dem Weg vom Wolf zum Hund betreffen zum einen die Kommunikationsfähigkeit mit dem Menschen. Die Fähigkeit zum Verfolgen von Blickkontakt und Zeigegesten entsteht beim Haushund wesentlich früher, auch wenn Wölfe in jüngster Zeit dieses Verhalten unter identischen Versuchsbedingungen ebenfalls zeigten. Augenkontakt wird von Wölfen auf jeden Fall weniger hergestellt als von Haushunden. Wölfe sind scheuer gegenüber unbekannten Menschen, auch wenn sie handaufgezogen sind, und sie passen sich weniger schnell an geändertes menschliches Ausdrucksverhalten an. Wird ein Haushund von einem Fremden zunächst in einem Versuch bedroht und der Mensch geht dann zu einer freundlichen Begrüßung über, sind Haushunde sehr schnell bereit, diesen Verhaltenswechsel mitzumachen. Wölfe, auch handaufgezogene, sind in diesem Fall sehr viel starrer in ihrer Reaktion. Sie generalisieren offensichtlich auch Menschen als Typ nicht so schnell, wie Haushunde dies tun. In Testsituationen suchen Hunde bei unlösbaren oder schwierigeren Problemen sehr viel schneller die Hilfe des Menschen, Wölfe tun dies kaum. Und auch die Fähigkeiten zur Ausbildung von individuellen und emotionalen Bindungen gegenüber dem Menschen sind beim Haushund wesentlich besser ausgebildet.
Agieren mit Menschen
Bräuer (2014), Viranyi und Range (2014) stellen eine Reihe von Voraussetzungen zusammen, die Hunde offensichtlich mitbringen, um sehr schnell und angepasst in sozialen Situationen mit dem Menschen zu agieren. Sie sind sehr aufmerksam und interessieren sich ständig dafür, was Menschen so tun. Sie haben eine sehr gute Lernfähigkeit, sind flexibel und können schnell Verknüpfungen herstellen und in der bekannten menschlichen Umgebung auch sehr schnell verallgemeinern. Sie können feine und unauffällige Hinweise des menschlichen Verhaltens, z. B. den Augenkontakt, sehr gut lesen und interpretieren, und sie haben mit verschiedenen Kommunikationssituationen viel Erfahrung.
Auch wenn Hunde nicht unbedingt unsere Gedanken lesen können, so sind sie doch sehr gut darin, unser Verhalten zu verstehen. Sie können das Verhalten eines Menschen in völlig neuen Situationen nicht unbedingt vorhersagen, aber in einer bekannten Situation sehr gut verallgemeinern, was der Mensch in ähnlichen Situationen getan hätte. Sie wissen, wann Kommunikation für sie beabsichtigt ist, etwa, wenn man sie vorher anspricht oder einen Blickkontakt herstellt. Sie verstehen die Absicht des Menschen auch in neuen Zusammenhängen. Sie verstehen also viel von Menschen und sind sehr erfolgreich darin, soziale Probleme in der menschlichen Umgebung zu lösen. Und sie können aus ihrem Blickwinkel heraus vorhersagen, wie sich der Mensch wohl verhalten würde. Ebenfalls beeindruckend ist die Fähigkeit der Verknüpfung von menschlichen Worten mit Objekten und deren Bedeutung, die als „fast mapping“, als schnelle Verknüpfung im Gehirn, bezeichnet wird. Legt man einem Hund eine Reihe von bekannten Gegenständen vor, und dazu einen, den er nicht kennt, und beauftragt ihn dann, mit einem gesprochenen Signal „Nimm das Nashorn“ (Nashorn ist der unbekannte Gegenstand, und das Wort Nashorn kennt er bislang nicht), so wird er sofort das unbekannte Objekt holen. Er hat also die Verknüpfung zwischen dem Gegenstand und dem unbekannten Wort im Signal selbstständig hergestellt. Auch wenn man ein zweites Plüschnashorn hochhält, wird er sofort aus dem Stapel der Spielzeuge das Nashorn heraussuchen und bringen oder anzeigen, je nachdem was man ihm beigebracht hat.
Hunde sind begnadete Verhaltensforscher. Sie haben uns ständig im Blick und kennen uns bald so gut, dass sie wahrscheinlich vor uns wissen, was wir als Nächstes tun werden.
© Kathrin Jung/Kosmos
AUS DER PRAXIS
Wie Hunde uns lesen lernen
Hunde sind feinsinnige Beobachter. Studien belegen, dass sie viel Zeit ihres Lebens darauf verwenden, uns im Alltag zu beobachten, und daraus viel lernen über uns als Individuen, unsere Stärken, Schwächen und Gewohnheiten. Sie wissen schnell, wie leicht wir zu manipulieren sind, und können nach einer bestimmten Zeit an unserem Verhalten ablesen, was wir als Nächstes tun werden.
Versuch
Untersucht hat diese besondere Fähigkeit des Hundes z. B. die amerikanische Verhaltensforscherin Sharon Smith. Für ihre Studie „Pet Dogs as Family Members: an Ethological Study“ hat sie 10 Familien für je 20 – 30 Stunden besucht und sich zu ihnen ins Wohnzimmer gesetzt. Sie verhielt sich passiv und beobachtete das Interaktionsverhalten der Menschen mit dem Hund.
Ergebnis
Die Hunde waren die meiste Zeit damit beschäftigt, aktiv zu beobachten. Dadurch waren sie in der Lage, das Verhalten und die Stimmung der Familie zu interpretieren und angemessen mit eigenem Verhalten darauf zu reagieren. Dieses Beobachten geht so weit, dass Hunde lernen, Alltagsgeräusche oder häufig gesprochene Sätze bestimmten Situationen zuzuordnen.
Sprachgenie Hund
In der Abschlussarbeit „Lebensbegleiter Hund. Motivation zur Hundehaltung“ hatte sie mit verschiedenen Hundehaltern Interviews geführt und dadurch viel über die Beziehung und Bindung der Menschen zu ihren Hunden erfahren. Eine Dame erzählte ihr, dass ihre Pinscher-Mix-Hündin Lisa ein Sprachgenie sei: Sie müsse sich ständig neue Floskeln zum Verabreden mit Freundinnen einfallen lassen, wenn sie telefoniere. So würde der Hund bei Verabredungsformeln wie „bis gleich“ sofort zur Tür rennen und auf Besuch warten oder darauf, dass sie die Leine zum Ausgehen vom Haken nimmt. Der Hund sei dann „sehr nervig und schwer zu ertragen“, bis zu dem Moment, in dem der Besuch kommt oder das Haus verlassen wird. Die Dame war sich sicher, dass die Hündin anhand der Stimmen am Telefon sogar unterscheiden konnte, wer kommt – bei beliebten Menschen war ihre Vorfreude viel größer als bei Personen, die bei ihr nicht so beliebt waren. Während der Essenszeit gab es die Regel, dass der Hund außerhalb der Küche zu warten hatte. Der Pinscher-Mix konnte schon als Jungspund anhand der Kratzgeräusche der Gabel auf dem Teller hören, wann die Mahlzeit beendet war – und guckte immer pünktlich zum Essensende um die Ecke des Türrahmens.
Verstärkung im Alter
Da der Mischling im Alter erblindete, verschärfte sich ihr ausgezeichneter Hörsinn weiter. Die Dame war tief beeindruckt, wie treffsicher die Hündin Informationen aus Alltagsgeräuschen wahrnehmen konnte.
So reichte z. B. der Gedanke ans Zubettgehen aus – anscheinend verbunden mit einer typischen Bewegung im Fernsehsessel – und die alte Hündin marschierte voraus ins Schlafzimmer und legte sich in ihr Körbchen.
Toleranz und Kooperation
Zusammenfassend kann man feststellen, wie Kurt Kotrschal immer wieder betont, dass Haushunde dem Menschen gegenüber weniger nachtragend sind, sie haben eine größere Fehlertoleranz und sind auch schneller bereit, sich auf Verhaltensänderungen des Menschen einzustellen (2012, Kotrschal et al. 2014). Zugleich erklärt diese hohe Fehlertoleranz des Haushundes evtl. auch, warum selbst Menschen mit sozialen Problemen und Fehlverhalten in der Erziehung oft (nicht immer!) gute Beziehungen zu Hunden entwickeln können. Wölfe, mit denen es sich ein individueller Mensch einmal verdorben hat, sind mit diesem fertig. Sie werden mit ihm nicht mehr oder erst nach sehr langer Zeit wieder kooperieren. Dies gilt auch für handaufgezogene Wölfe. Ebenso betont Kotrschal, dass Wölfe, wenn sie mit dem Menschen kooperieren, in der Regel eine Absicht dahinter verfolgen. Hunde dagegen tun es, um dem Menschen zu gefallen. Sie haben einfach Spaß daran, etwas für den Menschen zu tun und mit ihm zu kooperieren. Belohnungen (egal welcher Art) sind für sie in diesem Zusammenhang ganz sekundär.
Der Hund, ein Egoist?
Gerade diese Aussage, dass Hunde mit dem Menschen kooperieren, weil es ihnen Spaß macht, uns zu gefallen, steht im Widerspruch zu sehr vielen, immer noch lautstark vertretenen Trainermeinungen. Dort wird der Hund häufig als gnadenloser Egoist dargestellt, der nur dann etwas tut, wenn er dafür etwas bekommt. (Egoismus und Kooperation sind übrigens keine Widersprüche, denn Beziehungen sind auch funktional und haben einen Nutzen für uns, siehe hier).
Auch das ist ein Teil des wölfisch gefärbten Bildes, das für Haushunde nicht, für Wölfe in ihrer Beziehung zum Menschen aber gilt.
Den individuellen Hund im Blick
Der Bezug auf den Wolf als Stammvater führt nur unter wenigen Bedingungen wirklich zu einer sinnvollen Art des Umgangs mit dem Hund. Wenn, dann sollte man sich die Hundeartigen allgemein als Erklärungsmodell vornehmen, z. B. im Zusammenhang mit bei ihnen auftretenden Formen von sozialen Beziehungen (siehe hier). Ansonsten aber wird man mit einer auf den Haushund abgestimmten, möglichst auch noch nach seinem individuellen Typ, seiner Persönlichkeit, seiner Rasse ausgerichteten Form des Umgangs wesentlich mehr erzielen.
Die Grenzen des Schimpansenforschers in der Kindererziehung sind sehr schnell erreicht. Babys und Kleinkinder werden oft durch die Ratschläge von Kinderpsychologen wesentlich schlechter behandelt, als dies durch die Ratschläge von Schimpansenforschern geschehen würde. Sobald das Kind anfängt zu sprechen, wird jedoch eine andere Form des Umgangs mit ihm sinnvoll sein. Ähnliches gilt für den Hund. Auch hier sind zwar die grundlegenden Bedürfnisse nach Nähe und Zugehörigkeit zu einer Gruppe, vor allem im Welpen- und jungen Junghundestadium, der des Wolfes und anderer Wildkaniden sehr ähnlich. Doch je mehr der Hund in unsere Familie hineinwächst, je differenzierter die Sozialisation wird, desto mehr wird er zum Hund, und desto weniger können wir rein mit Bezug auf sein wölfisches Erbe noch erreichen. Doch um zu verstehen, was sich heranwachsende Hunde von uns Menschen wünschen würden, folgt zunächst ein Blick in die Kinderstube der Hundeartigen.
Wurfhöhle, Rendezvousplatz und Lehrzeit im Rudel
Gerade in den ersten Lebenswochen und Monaten unterscheidet sich die physische und auch soziale Entwicklung eines Haushundewelpen offensichtlich nur wenig von der seiner wilden, nicht domestizierten Verwandten wie Schakal, Kojote oder Wolf. Die wichtigsten Informationen, die wir brauchen, wenn wir unseren Haushund möglichst ideal in unsere Familie einpassen wollen, lassen sich kurz zusammengefasst darstellen.
1. – 8. Woche Spielen, Kontakte, die Welt entdecken
Die ersten Lebenswochen sind für einen Welpen zunächst sehr stark mit häuslicher Umgebung verknüpft. Er verbringt die ersten drei Wochen nur mit der Mutter und den Wurfgeschwistern in der Wurfhöhle. In dieser Zeit wird auch bei wildlebenden oder verwilderten Hundeartigen kein Kontakt anderer Artgenossen durch die Mutter zugelassen. Selbst der Vater legt das Futter nur an der Höhle ab. Im menschlichen Umfeld kann der Züchter, der gewissermaßen die Rolle eines verständnisvollen Großelters hat, auch in dieser Zeit die Welpen besuchen, wiegen und sollte auch sonst mit ihnen Umgang haben. Eine Hündin, die so etwas nicht zulässt, ist für die Zucht von kompetenten und sozial ausgereiften Familienhunden nicht geeignet.
Kontakt zur Außenwelt
Nach ca. drei Wochen verlassen die Welpen normalerweise die Wurfhöhle. Auch die Zuchthündin wird nun erlauben, dass sie sich bereits im Welpenzimmer, in der Umgebung der Wurfkiste, aufhalten. In dieser Zeit beginnen die ersten Sozialkontakte mit anderen Familienmitgliedern. Bei Wölfen und anderen Wildkaniden, aber auch bei verwilderten Haushunden sind dies der Vater, die Tanten oder andere Mitglieder der Gruppe. Der Aufenthalt ist jedoch immer noch auf die Umgebung der Wurfhöhle beschränkt. Doch nun werden bereits erste Erfahrungen gemacht: Man kann nicht nur mit den Wurfgeschwistern spielen (was bereits in den ersten drei Lebenswochen begann), sondern nun auch erste Umweltreize erkunden.
Bekommen Welpen schon beim Züchter kontrollierten Kontakt zu netten Kindern, sind gute Grundlagen für eine harmonische Kind-Hund-Beziehung gelegt.
© Janka Lockermann
8. – 14. Woche Orts- und erste Menschenbindung
Ab der achten bis ca. zur 14. Woche leben Kaniden-Welpen auf dem Rendezvousplatz. Der Rendezvousplatz ist ein besonderes Gebiet im Territorium der Familiengruppe, ein meist geschütztes, und von allen Seiten gut abgeschirmtes Areal. Dort kommt gewissermaßen die Welt zu Besuch, die Welpen erleben nun zunehmend immer mehr Neues.
Gleichzeitig beginnt eine Phase intensiver, vor allem auch spielerischer Sozialkontakte mit den Wurfgeschwistern, den Babysittern und anderen Mitgliedern der Familiengruppe. In dieser Zeit wird offensichtlich auch die Persönlichkeitsachse „Geselligkeit“ besonders geformt (siehe hier). Von Bedeutung ist, dass in dieser Zeit (beginnend mit der sechsten bis achten Woche, bis zur 14. Woche) die wichtigste strukturierende Verhaltenseigenschaft der Welpen eine intensive Ortsbindung ist. Die Welpen sind nun weniger individuell gebunden, sie lassen sich z. B. relativ leicht an neue Menschen gewöhnen. Wichtig ist für sie in dieser Zeit der bevorzugte Aufenthalt an diesem, für sie bekannten und damit auch heimeligen, Ort. Dieser gibt ihnen, in Kombination mit freundlichen, verlässlichen Bindungspersonen, Sicherheit.
AUS DER PRAXIS
Fred möchte noch nicht nach draußen
Golden-Retriever-Mischling Fred kam mit 10 Wochen in sein neues Zuhause, in dem sich neben der vierköpfigen Menschenfamilie eine neunjährige Hündin befand. Diese musste natürlich jeden Tag mehrfach ausgeführt werden, und so kam es, dass der Welpe mit zur Gassirunde kommen musste. Die Überforderung des jungen Hundes war deutlich zu spüren: Der ansonsten recht selbstbewusste Rüde wollte in unbekanntem Gebiet, abseits des heimeligen Gartens, sofort auf den Arm genommen werden. Die Aufregung stieg besonders bei den ersten Runden mit jedem Meter, den man sich vom vertrauten Zuhause entfernte. Fred jaulte und drängte sich auf dem Arm eng an seinen Menschen. In gleichem Maß war die Erleichterung bei der Annäherung an das Haus zu spüren. Hier wurde er zappelig, wollte auf den Boden gesetzt werden, rannte das letzte Stück mit fliegenden Ohren zurück zum vertrauten Ort und legte sich jedes Mal mit deutlicher Erleichterung unter einen Fliederbusch, gleich neben der Gartentür.
Dieses „Ritual“ wurde in den ersten drei Wochen beibehalten, und löste sich dann langsam auf. Anstelle der Unsicherheit außerhalb des eingezäunten Gartens trat bei Fred mit etwa 14 Wochen eine große Neugierde und Erkundungsfreude für alle Abenteuer des Lebens, die von Jenseits des Gartenzauns herüberwehten.
Erkennen der Verwandtschaft
In Bezug auf die Erkennung der Verwandtschaft hat der britische Hundeforscher Peter Hepper (1992) in seiner Dissertation einige interessante Befunde erhoben. Das Erkennen der Mutter funktioniert bei Hundewelpen bereits dann, wenn sie nur wenige Tage mit ihr zusammen waren, selbst wenn sie hinterher von ihr getrennt wurden. Das Erkennen von Geschwistern dagegen funktioniert nur, wenn mindestens drei Welpen bis zur fünften Lebenswoche zusammen waren und auch soziale Kontakte, insbesondere auch die ersten Spielkontakte hatten.
Die Zeit zwischen der 10. und 14. Woche sollte für die Sozialisierung intensiv genutzt werden. Die Welpen lernen ihre Menschen und die Umgebung kennen.
© Vivien Venzke/Kosmos
Zweibeiner im Visier
Sozialisation mit Kindern
Besonders wichtig ist, dass Hunde auch mit Kindern sozialisiert werden. Menschenkinder riechen anders, bewegen sich anders, klingen anders, und es gibt viele Belege dafür, dass sie offensichtlich nicht automatisch von Hunden auch als Menschen erkannt werden. Daher ist es wichtig, ganz besonders, wenn unser Hund später in eine Familie mit Kindern kommen soll, dass bereits beim Züchter Kinder als positive Sympathieträger vorhanden sind.
Das bedeutet aber nicht, dass zu viele und vor allem unkontrollierte Kontakte mit Kindern vorherrschen. Eine Untersuchung von Tiira (2013) hat gezeigt, dass mehrere Kinder im Haushalt des Züchters einer der Risikofaktoren für das Entstehen von Bewegungsstereotypien wie Schwanzjagen in späterem Alter bei Hunden sind. Ideal ist es, wenn Kinder einfach nur da sind, spielen und sich hin und wieder zu den Welpen setzen. So haben die jungen Hunde die Möglichkeit, „kleine Menschen“ kennenzulernen. Hat der Züchter keine eigenen kleinen oder jüngeren Kinder, dann müssen Nachbars- oder befreundete Kinder eingeladen werden.
Kinder werden nicht automatisch von Hunden als „kleine Menschen“ erkannt. Das muss gelernt werden.
© Janka Lockermann
Ab der 14. Woche Bindung an uns und die Welt entdecken
Ungefähr mit Beginn der 14. Woche ändert sich in vielfältiger Weise das Sozialverhalten unseres Hundes. Die Hunde sind gewachsen, sind kräftiger, es beginnt bei wilden Kaniden die Zeit, in der Hundewelpen das Rudel auf der Wanderschaft begleiten. Sie lernen dadurch den Außenbereich des Familienterritoriums kennen und werden von den Rudelmitgliedern langsam in Jagdmethoden, Futtertraditionen und andere, für das kooperative Zusammenleben in der Gruppe wichtige Dinge eingewiesen.
Die Ortsbindung lockert sich, der Rendezvousplatz war gestern. Beim Haushund, und das zeigen erneut die Untersuchungen der Budapester Zoologin Marta Gacsi (Topal und Gacsi 2013), beginnt nun die Fähigkeit, sich an Menschen individuell zu binden. Etwa ab der 16. Lebenswoche sind die ersten Hinweise auf eine solche Bindung nachweisbar. Welche Auswirkungen dies auf das Verhalten unseres Hundes hat, wird später näher dargelegt (siehe hier).
Bereits aus diesen einfachen Darstellungen lassen sich jedoch einige wichtige Voraussetzungen für einen später gut sozialisier-, erziehungs- und bindbaren Familienhund auflisten.
Vorsicht vor Überforderung
Fördern und Fordern in der Welpenzeit sind wichtig, aber es sollte keine Überforderung daraus werden. Nur, wenn der Welpe selbstständig entscheiden kann, wann und wie viele und welche aufregenden Reize er sich im Augenblick verschaffen möchte, wird er auch den Eindruck haben, sein Leben und sein Schicksal kontrollieren zu können. Wir Menschen neigen als Primatenart dazu, unsere Lieben immer und überall mit hinzuschleppen, allerdings entspricht dies nicht unbedingt dem Kanidenbedürfnis. Da wir jedoch unsere Alltagsgeschäfte trotz Welpe erledigen müssen, sollten wir versuchen, einen Kompromiss zu finden: Ein Ausflug, eine spannende Neuentdeckung – zeitlich kurz gehalten – pro Tag reicht aus. So kann der Hund in den ersten Tagen den Weg zum Park oder die Feldwege rund ums Haus an unserer Seite erkunden und sich hier durch die Wiedererkennung von Tag zu Tag immer sicherer fühlen. Und er kann sich danach von diesen Eindrücken in seinem vertrauten Zuhause erholen. Später kann er an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen z. B. lernen, in der sicheren Transportbox im Fußraum des Autos mitzukommen, wenn die Kinder zum Musikunterricht gebracht oder Pakete bei der Post abgeholt werden. Die Einladung zum Grillen bei den Nachbarn stellt später eine Herausforderung dar, der erste kurze Ausflug in die Stadt sowieso. Das ruhige Kennenlernen der Welt an unserer Seite, langsam und mit großer Behutsamkeit und ohne den Hund mit zu großer, passiver Reizüberflutung zu belasten, die er nicht selber kontrollieren kann, stärkt die Persönlichkeit, Stressresistenz und Belastbarkeit.
Kinder fassen Hunde oft ungeschickt an. Züchter sollten einen kritischen Blick bewahren, damit keine negativen Erfahrungen gemacht werden.
© Janka Lockermann
Prägung
Die Prägung des Hundes erfolgt normalerweise auf beide Arten, den Menschen und den Hund. Daher ist der Umgang mit Menschen und Hunden wichtig, nur dann wird auch ein Lebewesen entstehen, das in der Zukunft mit beiden Arten im Alltag zivilisiert umgehen kann.
Auch beim Spielen sind beide, der Mensch und der Hund, gleichermaßen wichtig. Besonders für Welpen gehören zum Spielen in jedem Fall auch gleich oder ähnlich alte Kameraden, und nicht nur erfahrene Althunde (siehe hier).
Spielerisches Lernen
Leider neigen viele Menschen dazu, ihrem kleinen Hund zu früh sehr viel beibringen zu wollen. Tatsächlich lernen Welpen schnell – doch sollte das erste Erziehungsprogramm frei von Ehrgeiz und Druck, sondern spielerisch stattfinden. So lernt ein kleiner Hund am besten „nebenbei“ und mit viel Spaß erste kleine Lektionen wie „Aus“ oder „Komm“. Ungeeignet ist ein Training, das den Welpen zu sehr fordert, ständig die Aufmerksamkeit nur auf den Menschen lenkt und ihm kaum Ruhe und Raum lässt, die Welt auf eigenen Pfoten zu entdecken. Die ersten Lebensmonate sind durch die Sozialisation an unseren Alltag aufregend genug. Wir sollten deshalb unseren Ehrgeiz zügeln und uns auf „Basics“ beschränken, um den Hund nicht zu überfordern und damit Hyperaktivität zu fördern.
AUS DER PRAXIS
Eine Herausforderung für Rupert
Rupert kam in mein Leben (KK), ohne sich vorher angemeldet zu haben. Ich war jung, studierte, jobbte im Tierheim und für eine Zeitung und war viel unterwegs. Rupert musste deshalb von Anfang an überallhin mit, in die U-Bahn, das Studentencafé, auf eine Party, zum Fototermin. Über Stressbelastung für ihn habe ich mir wenig Gedanken gemacht. Wichtig war mir, ihn immer überallhin mitnehmen zu können. Seine Reaktion: Er hat von Anfang an alles mitgemacht und blieb bis an sein Lebensende auch in merkwürdigen Situationen ruhig und hat sich an mir orientiert. Diese „relative Gedankenlosigkeit“ bei der Sozialisation ist sicher nicht für jeden Hund und Menschen das Richtige. Allerdings glaube ich, dass viele Menschen sich oft zu viele Gedanken um das Seelenwohl ihres jungen Hundes machen und ihn dadurch zu lange von den Unternehmungen des Alltags fernhalten. Generell gilt: Egal wie sanft oder spontan wir den Hund mit neuen Herausforderungen des Alltags konfrontieren, wichtig ist letztendlich unser eigenes Auftreten in unbekannten, aufregenden Situationen. Wir vermitteln Welpen durch Ruhe und entschlossenes Auftreten Souveränität in komischen Momenten. Reden in unaufgeregter Stimmlage sowie eine entspannte, lockere Körperhaltung betont zusätzlich, dass es an Ort und Stelle nichts zu befürchten gibt. Mit dieser Basiserfahrung lernt ein Hund, dass er sich in jeder Situation auf uns verlassen und entspannen kann.
Abgabezeitpunkt des Welpen
Wegen der erst spät in der Welpenzeit beginnenden Bindungsfähigkeit ist auch die Frage des Abgabezeitpunkts der Welpen sehr viel differenzierter zu sehen, als dies leider heute immer dargestellt wird. Aus verhaltensbiologischer Sicht gibt es kaum etwas, das für eine Abgabe von Welpen weit vor der 10. Woche spricht, aber sehr viel, was gegen eine Abgabe in der achten oder gar noch früheren Zeit spricht.
Solange es möglich ist, die genannte Sozialisierung auf den Menschen, die Prägung auf das soziale Umfeld des Züchters, einschließlich möglichst einer Reihe von ruhigen und mit dem Hund gut umgehenden Kindern im Züchterhaushalt zu ermöglichen, kann der Hundehalter zunächst einmal getrost diese Aufgabe den erfahrenen Profis überlassen.
Betreuung des Hundekindes
Direkt danach sind wir an der Reihe: Ab der Abholung vom Züchter müssen wir uns selbst einbringen in die Beziehungs- und Bindungsentwicklung. Kein Welpe kann alleine gelassen werden, deshalb muss ab jetzt immer jemand im Haus sein. Das muss nicht immer die gleiche Person sein, aber die Betreuung des Hundekindes sollte durch vertraute Familienmitglieder erfolgen.
Wenn sich die Familie für die erste Zeit mit Hund Urlaub nehmen möchte, dann am besten im Zeitfenster zwischen der 14. – 17. Lebenswoche, denn hier bauen Hunde enge individuelle Bindungen auf. So kann dieser „Welpen-Urlaub“ für die tiefe Bindung an uns optimal genutzt werden.
Alles geht – alles fließt? Die Junghundeentwicklung
Ein kleiner Hund zieht bei uns ein – und wir möchten alles dafür tun, dass der Start ins Hundeleben gelingt und wir eine feste, gegenseitige Bindung entwickeln. Die beste Voraussetzung für eine gute Bindungsfähigkeit an Menschen sind entspannte Elterntiere und ein freundliches, professionelles Züchterzuhause. Hier und in der ersten Jugendzeit finden entscheidende Prägungen statt, die im Folgenden erklärt werden.
Was ist eine „Prägung“?
Immer wieder hört man von Welpenbesitzern die Erklärung, sie wollten einen Welpen, weil „dieser sich dann auf sie prägen würde“. Hier wird der Begriff der Prägung mit Bindung verwechselt, denn „Prägungen“ finden viel früher statt und sind eine Sonderform von biologischen Lernprozessen und durch eine Reihe von Eigenheiten gekennzeichnet:
Im Wesentlichen gehört dazu (Ten Cate 2001), dass ein Prägungsprozess in einer sensiblen Phase erleichtert stattfindet. Allerdings wurde die frühere Vorstellung, dass Prägungsprozesse ausschließlich in dieser sensiblen Phase stattfinden können, zugunsten einer größeren Plastizität aufgegeben. So ist es z. B. durchaus möglich, einen Junghund, der ohne direkten Kontakt zu Menschen gelebt hat, mit viel Einfühlungsvermögen noch an ein Zusammenleben im Haus gewöhnen zu können.
Prägungsprozesse sind, sobald sie einmal stattgefunden haben, langzeitstabil – oft sogar lebenslang – aber nicht irreversibel, was früher häufig behauptet wurde.
Prägungsprozesse sind des weiteren belohnungsfrei. Ein Tier nimmt den Prägungsreiz auf und speichert ihn ab, auch wenn es dazu keine besonderen Bestätigungen durch seine Umwelt erfährt. So lohnt es sich, zu einem Menschen zu rennen und zwischen den Beinen Schutz zu suchen, ohne dass dieses Verhalten bestätigt wird. Der Mensch bietet in diesem Moment ein Gefühl der Sicherheit, das sich dem Welpen einprägt.
Und letztlich, so haben Untersuchungen auch an Hunden gezeigt, gibt es so etwas wie „biologische Schablonen“, also wahrscheinlich genetisch vorgegebene „Vorstellungen“ von geeigneten Sozialpartnern für das Tier. Biologisch sinnvolle Prägungsreize werden also leichter und erfolgversprechender abgespeichert. Man kann zwar ein Hühnerküken auf einen roten Gummiball prägen, wenn es noch nie eine Henne gesehen hat. Stellt man dieses Küken jedoch vor dem Prägungsprozess bereits vor die Wahl, sich etwa einer ausgestopften Henne oder einem roten Gummiball anzuschließen, werden die meisten prägungsnaiven Küken die ausgestopfte Henne bevorzugen. In Bezug auf den Haushund haben Untersuchungen in der Budapester Arbeitsgruppe, damals noch unter Leitung von Vilmos Csanyi (2002) gezeigt, dass schon acht Wochen alte Haushundewelpen sich mehr für einen unbekannten Menschen als für einen unbekannten Hund interessieren. Handaufgezogene Wölfe, im gleichen Alter tendenziell eher umgekehrt. Dies zeigt, dass Hunde wahrscheinlich bereits genetisch auf den Phänotyp Mensch als bevorzugten Bindungspartner disponiert sind.
Prägungsprozesse
„Hunde werden nicht mit einer Freundlichkeit gegenüber Menschen geboren. Sie werden geboren mit der Fähigkeit, freundlich zu Menschen zu werden (John Bradshaw).“
Prägungsprozesse finden im Lauf der Jungtierentwicklung vieler Wirbeltierarten statt. Die Nahrungsprägung, oftmals überwiegend auf Geruch und Geschmack, beginnt auch beim Hund bereits vor der eigenen Aufnahme von fester Nahrung. Über die Muttermilch, sogar über den Nabelschnurkreislauf während der Trächtigkeit, und wohl auch über den Mundgeruch der Mutter während der vielfältigen Verhaltensweisen von Brutpflege und Jungtierbetreuung, nehmen die Welpen Informationen über die von der Mutter zu dieser Zeit gefressenen Futterarten auf. Kommt dann später die eigene erste, feste Nahrung hinzu, werden diese Vorabinformationen bestätigt und der Prägungsprozess geht sehr schnell vonstatten. Wie langanhaltend dieser sein kann, zeigen immer wieder die Beispiele von geretteten Auslandshunden, die oft noch nach zehn Jahren Aufenthalt in Deutschland das Futter ihrer Herkunftsländer im Zweifelsfall jeder hier angebotenen, fertigen oder auch selbst zubereiteten Nahrung vorzogen (in einem Fall war das Döner und Weißbrot bei einer Hündin aus der Türkei, im anderen Fall Spaghetti bei einem Tierschutzhund aus Italien). Deshalb ist es auch so wichtig, Mutterhündin und Welpen von Anfang an zwar bedarfsgerecht und ausgewogen aber ideologiefrei zu füttern.
Ein vertrauensvoller Umgang und eine enge Bindung zwischen Mensch und Hund sind das Ergebnis einer guten Prägung und umsichtigen Erziehung, die eine hohe soziale Kompetenz von uns erfordert.
© Stefanie Michels
5. bis 12. Woche Artgenossenprägung
Von besonderer Bedeutung für unser Thema Beziehungs- und Bindungsaufbau ist die Frage der Artgenossenprägung und der anderen sozialen Erkennungsmechanismen in der Jungtierentwicklung von Hunden. Während die Mutter bereits in den ersten drei Lebenstagen erkannt und ihre Eigenschaften auf Dauer abgespeichert werden, wie der britische Hundeforscher Peter Hepper (1992) zeigte, ist die eigentliche Artgenossenprägung erst zwischen der 5. und der 12. Woche zu beobachten. In dieser Zeit werden aber nicht nur Hunde, sondern auch Menschen und unter bestimmten Voraussetzungen auch andere Tierarten in das Artgenossenschema des Welpen aufgenommen.
Hunde, die in diesem Zeitraum mit Menschen, Katzen oder mit Nutztieren in regelmäßigem Kontakt waren, werden diese auch später als „Pseudoartgenossen“ erkennen und ihr Sozialverhalten entsprechend ausrichten.
Beispiel von Pseudoartgenossen
Ein beeindruckendes Beispiel dieser Prägung auf Pseudoartgenossen stellt der erwachsene, massige Herdenschutzhund dar, der sich einem Schaf unterwirft und versucht, mit Mundwinkellecken und anderen Verhaltensweisen der Submission dieses Schaf von einem möglichen Angriff abzuhalten. Bei Herdenschutzhunden, die später ihr Leben in der Herde verbringen und diese beschützen sollen, ist dieses System noch besonders wirkungsvoll. Bei ihnen beginnt erst ab der 20. Lebenswoche ganz langsam das Beutefangverhalten, wenn die Artgenossenprägung (einschließlich Pseudoartgenossen wie Schaf oder Ziege) längst abgeschlossen ist.
Die Kehrseite der Medaille ist jedoch, dass Hunde, die bis zur 12. Lebenswoche keinen oder kaum Menschenkontakt hatten, sich später sehr schwer tun, Menschen unvoreingenommen entgegenzutreten.
Die Attraktivität des Menschen in dieser Zeit betrifft jedoch, wie schon erwähnt (siehe hier), mehr den Typus und weniger ein Individuum. Wichtig ist, dass der Welpe Menschen generell als freundliche Wesen abspeichert, denen er vertrauen kann und die ihm Sicherheit geben können.
Sexuelle Prägung
Die Entscheidung, mit wem man sich später paaren und Nachkommen zeugen möchte, wird als „sexuelle Prägung“ bezeichnet. Sie findet erst lange nach der 12. Woche statt. Bei allen Tierarten, die daraufhin untersucht wurden, ist die sexuelle Prägung mit dem Beginn der Pubertät abgeschlossen. In diesem Zeitraum wird dieser Prägungsvorgang überwiegend am Modell der vorhandenen, gleich- oder ähnlich alten Spielkameraden getroffen. Es müssen nicht unbedingt sexuell motivierte Spiele sein, wie vergleichende Untersuchungen z. B. an Affen, Laborratten, aber auch an handaufgezogenen Rinderkälbern und Rehkitzen zeigen. Der soziale Umgang reicht bereits aus.
Lebensraumprägung
Letztlich bleibt noch eine Sammelkategorie, die meist als Lebensraumprägung bezeichnet wird. Diese umfasst so ziemlich alles: von den Gerüchen, Geräuschen und dem Tastempfinden des Bodens, auf dem sich die Welpen befinden, bis hin zur räumlichen Aufteilung durch Landschaftsfaktoren und Pflanzenwelt. Auch diese Prägung ist nicht irreversibel, sondern kann durch spätere Erfahrungen teilweise ausgeglichen werden.
Epigenetik – Prägung der Gene?
Ein zweiter Begriff, der derzeit in der Diskussion über die optimale Entwicklung von Hundewelpen verwendet wird, ist der der Epigenetik. Es zeigt sich nämlich, dass Erfahrungen, die ein Tier sehr früh in seiner eigenen Jugendentwicklung macht, teilweise sogar Erfahrungen, die von der Mutter während der Trächtigkeit oder während der Jungtieraufzucht gemacht wurden, offensichtlich dauerhafte Veränderungen im Ablesen und Umsetzen des Erbgutes dieses Tieres hervorrufen. Man kann sich das etwa so vorstellen, als wenn jemand bei der ersten Benutzung eines Lexikons (z. B. eines Technikhandbuches, mit dessen Hilfe er gerade irgendein Gerät zusammenbaut) handschriftliche Randbemerkungen und Klebezettel an den betreffenden Textpartien anbringt. Kopiert dann später ein Kollege diesen Absatz aus dem Buch, wird er auch die Klebezettel und handschriftlichen Randbemerkungen mit kopieren. Auch solche in der Umgebung des Erbgutes, – und nicht am Erbgut selbst! –, angebrachten chemischen Veränderungen können das Verhalten des Tieres beeinflussen. So können z. B. Umwelteinflüsse, soziale Gegebenheiten, aber auch Ernährung, Stressfaktoren und vieles andere während der Trächtigkeit und der frühen Jungtierentwicklung dauerhaft programmierend für den Rest des Lebens dieses Tieres sein. Studien an Labortieren, Affen und auch einigen anderen Organismen, haben das bereits experimentell bestätigt.
Auswirkung von Stress auf die Persönlichkeit
Untersuchungen von McMillan et al. (2011, 2013) zeigen, welche großen Unterschiede im gesamten Verhalten von Hundewelpen und Zuchthunden vorliegen, die in den Händen von Billigvermehrern, den sogenannten Welpenfabriken, unter reizarmen und nicht optimalen Lebensbedingungen aufwachsen müssen. Diese Welpen, wie auch ihre Eltern, haben zeitlebens z. B. Probleme mit Stressbelastbarkeit, Freundlichkeit, Trainierbarkeit und Anschlussbereitschaft an den Menschen. Abgesehen von den oft grausamen Haltungsbedingungen für die Muttertiere sollte man sich aus diesem Grund dringend überlegen, ob man nicht einige Euro mehr investiert und sich einen Hund aus guter Zuchtstätte, statt von Billigvermehrern nimmt. Auch die Einflüsse der Trächtigkeit und die ersten Lebenswochen können das spätere Verhalten des erwachsenen Hundes beeinflussen. So zeigen mehrere Studien (u.a. von Tiira et al. 2013), dass die Entstehung von Stereotypien und anderen Verhaltensstörungen bei Hunden im Alter zwischen sechs und 10 Monaten zwar zunimmt, die Ursachen dafür aber bereits in der Nervosität und Stressanfälligkeit der Mutterhündin, einer zu frühen Trennung von der Mutter oder allgemein instabilen Lebensbedingungen im Züchterhaushalt begründet liegen. Im letzteren Fall wundert sich der Hundehalter plötzlich, warum sein Hund ein Verhaltensproblem entwickelt, obwohl er sich selbst (in diesem Fall oft sogar zu Recht) keiner Schuld im Sinne einer unzureichenden oder gar problematischen Haltung bewusst ist. Tröstlich war in den Untersuchungen von McMillan, dass Hunde, die aus qualitativ schlechten Billigvermehrungsanstalten stammen und anschließend ein gutes und sinnvolles Training (leider wurde hier nicht zwischen Training und Erziehung unterschieden) erfuhren, sich in ihrem Verhaltensprofil wesentlich verändern und verbessern konnten.
Die Welt kann auf Hundenasenhöhe manchmal bedrohlich wirken. Besonders, wenn der Lebensraum fremd ist.
© Katja Krauß/Kosmos
Trotzdem bleibt, wie neue Untersuchungen (Messam et al. 2013, Casey et al. 2014) zeigen, auch ein Risiko bestehen. Hunde, die von Billigvermehrern stammen, zeigen im späteren Leben ein höheres Potential gegenüber eigenen Familienmitgliedern, fremden Menschen oder Hunden aggressiv oder sogar bissig zu reagieren. Sie sind in jedem Fall mit sehr viel Sachkenntnis und Einfühlungsvermögen zu betreuen, um diese frühen Nachteile wieder auszugleichen. Das gilt auch für Tierheim- und Tierschutzhunde, die mit sehr viel Geduld und Zeit in ihr neues Leben geführt werden müssen. Besonders in Fällen, in denen ein Hund bestimmte Anforderungen erfüllen muss (Umgang mit kleinen Kindern, Therapiehund), sollte man daher möglichst keine vorbelasteten Hunde wählen.
AUS DER PRAXIS
Castella – Huch, ein Zug!
Mit neun Wochen zog die Maremmano-Abruzzese-Herdenschutzhündin in ihr neues Zuhause, ein ländlich gelegenes Neubaugebiet in Niedersachsen. Sie wurde an alle Umweltreize langsam gewöhnt, sodass sie mit sechs Monaten fremden Menschen und aufregenden Ereignissen mit aufmerksam-offener, neugieriger Haltung begegnete. Jeden Tag lief die Besitzerin eine Runde um die Felder, an deren einer Seite Bahngleise entlangführten. Regelmäßig raste an dieser Stelle während des Spazierganges ein Zug vorbei – was die Junghündin nach der ersten Gewöhnung als Welpe überhaupt nicht mehr interessierte: Ratternde Züge gehörten von nun an zu ihrem gewohnten Alltag.
Und plötzlich ängstlich!
Mit ungefähr neun Monaten änderte sich dieser Gleichmut von einem Tag auf den anderen: Plötzlich erstarrte die Hündin beim Anblick und Geräusch des herannahenden Zuges wie beim ersten Mal, sprang in Panik entsetzt zur Seite, um dann zitternd das Vorbeirasen zu erdulden. Mit viel Ruhe und klarer Körpersprache seitens ihrer Besitzerin lernte sie, das tosende Objekt wieder als ungefährlich wahrzunehmen. Sie musste in ihrer zweiten Prägungsphase den Zug erneut als zwar laut aber ungefährlich abspeichern.
Ab sechs Monaten Die zweite Prägungsphase
Beim Hund gibt es die sogenannte zweite Prägungsphase, die etwa in der zweiten Hälfe des ersten Lebensjahres liegt. In dieser Zeit müssen die in den verschiedenen Prägungsprozessen der Welpen- und frühen Junghundezeit bereits gemachten und abgespeicherten Erfahrungen nochmals bestätigt werden, sonst sind sie weg (siehe hier). Das gilt ebenso für die Artgenossenprägung, wie auch für die Sozialisierung auf Umweltreize und andere Außenfaktoren.
Risiko Verlassensangst
Gerade in diesem Zeitraum, in der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres, spielen sich noch andere wichtige Prozesse für die spätere psychische Stabilität unseres Hundes ab. So haben Untersuchungen in der Arbeitsgruppe des britischen Hundeforschers John Bradshaw (Bradshaw et al. 2002) gezeigt, dass Hunde, die in der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres unter stabilen, sozial optimalen und anderweitig befriedigenden Bedingungen lebten, später ein sehr viel geringeres Risiko für die Entstehung von Verlassensängsten und Trennungsstörungen hatten als Hunde, bei denen in dieser sensiblen Phase eine Unruhe oder andere unzureichende Sozialisierungsbedingungen vorlagen.
In ähnlicher Weise wirken sich auch oftmals Krankheiten, verstärkte, d. h. übertriebene, mit Fieber verbundene Impfreaktionen, Verletzungen, Operationen oder andere medizinische Probleme später im Leben des Hundes aus. Untersuchungen an Patientendaten der Tierklinik in Edinburgh zeigen (Serpell und Jago 1995), dass Welpen mit medizinischen Problemen im Zeitraum zwischen der 8. und 14. Lebenswoche, erst viel später, oft in der Pubertät ab der 30. bis 35. Lebenswoche, Verhaltensprobleme wie Trennungsängste, Angstaggression, Neigung zu stereotypem Bellen, Kläffen oder Probleme mit Kindern entwickeln.
Prägung auf Kinder
Gerade der Umgang mit Kindern ist für Hunde ein ganz besonders wichtiges Thema. Wer seinen Hund mit den eigenen Kindern später in einer entspannten und für beide Seiten erfreulichen Familiensituation halten möchte, tut gut daran, darauf zu achten, dass beim Züchter auch eigene oder Besucherkinder im Haushalt anwesend waren. Ganz offensichtlich erkennen Hunde, die nur mit Erwachsenen aufgewachsen sind, Kinder nicht als Menschen. Sie riechen anders, bewegen sich anders, haben ein ganz anderes Lautrepertoire, sind also ganz offensichtlich ein anderer Typ Lebewesen als Erwachsene. Nur Hunde, die auch Kinder im Zeitraum der sensiblen Phase ihrer Artgenossenprägung als positive Sympathieträger oder zumindest als neutrale, harmlose Bestandteile ihrer Umwelt kennengelernt haben, werden später auch in der eigenen Familie Kinder wie Erwachsene als Pseudoartgenossen betrachten. Zu den vielfältigen Vorteilen, aber auch zu den wichtigen Faktoren, die es beim Umgang von Hund und Kind zu beachten gibt, siehe z. B. das Buch von Manuela van Schewick (2013).
„Ziemlich beste Freunde“ – das funktioniert nur mit Eltern, die aufmerksam und einfühlsam Kind und Hund aneinander gewöhnen.
© Kate Kitchenham
Einfluss früher Lebensbedingungen
Wie im Abschnitt der Epigenetik (siehe hier) gezeigt wurde, können schon während der Trächtigkeit Faktoren wie die Belastbarkeit des Hundes, seine spätere Geselligkeit und andere positive oder auch negative Verhaltenseigenschaften beeinflusst werden. Gestresste Mütter bekommen stressanfällige Kinder, sichere und souveräne Mütter bekommen Töchter, die sich ebenso sicher und souverän geben. Stress für Mütter sind z. B. unzureichende Ernährungsbedingungen, die Anwesenheit von vielen Feinden oder das Leben in anderweitig gefährlichen Lebensräumen. Diese Faktoren können dazu führen, dass stressanfällige, krankheitsanfällige und bisweilen in Bezug auf ihren Körperbau sogar asymmetrisch schräge Nachkommen zur Welt kommen. Gerade die Asymmetrie in der Ausbildung von Skelettelementen, die sich später in einer erhöhten Anfälligkeit für Gelenkerkrankungen äußern kann, wurde bei Tierarten experimentell mit gefährlichen oder unzureichenden Lebensumständen der Mutter während der Trächtigkeit in Verbindung gebracht.
Erfahrungsberichte
Auch in unserer Beratungstätigkeit kommen immer wieder Hunde vor, die mit schwereren Gelenkveränderungen zu kämpfen haben. Diese Hunde sind häufig entweder ehemalige gerettete Straßenhunde, stammen von Billigvermehrern oder sind von anderer, oftmals nicht tierschutzkonformer Herkunft. Auch hier handelt es sich jedoch keinesfalls um eine schicksalhafte, nicht veränderbare Programmierung. Vielfach sind diese Faktoren nur im Sinne als Dispositionen, also „Risikofaktoren“, zu bewerten.
Tierschutzhunde
Wenn man weiß, dass ein Hund aus tierschutzwidrigen Haltungs- und Zuchtbedingungen stammt oder seine Herkunft unklar ist und man sich darauf einstellt, mit einem intensiven Programm von Psycho-, Physio- und allgemeiner Verhaltenstherapie diesen Hund zu resozialisieren und ihm eine zweite Chance im Leben zu geben, hat man sehr oft auch Erfolg. Wenn man jedoch erwartet, dass sich dieser Hund aus Dankbarkeit zu einem tollen Hund entwickelt, oder ihm, da er ja als sehr junger Welpe „gerettet“ wurde, noch alle Wege des Lebens offen stünden, wird meist eine Enttäuschung erleben. Die psychische Belastung für die Menschen, die solche Hunde im guten Glauben an die Formbarkeit des Verhaltens übernehmen, wird oft unterschätzt.
AUS DER PRAXIS
Greta – ein Online-Date
Familie Johannson aus Hamburg wollte schon lange einen Hund – aber keinen Welpen vom Züchter. Sie hatten sich fest vorgenommen, einem Straßenhund aus dem Ausland ein gutes, neues Zuhause zu schenken. Im Internet entdeckten sie eine Plattform, die dazu aufrief, Hunde innerhalb weniger Stunden zu adoptieren, da die Tiere in einer Tötungsstation ansonsten in ein paar Tagen eingeschläfert werden würden. Unter Zeitdruck entschied man sich für eine kleine Hündin mit freundlichem Gesicht, die ein paar Wochen später am Hamburger Flughafen von der aufgeregten Familie in Empfang genommen wurde. Die Familie hatte Glück: Greta kannte anscheinend Kinder, war nett und freundlich zu allen – aber absolut unabhängig. Den Sinn von Wörtern wie „Komm“ und „Sitz“ begriff sie zwar schnell, gehorchte aber nur, wenn nichts Interessantes in ihrer Umwelt ihre Aufmerksamkeit erregte.
Ein Hund mit Jagdpassion
Besonders ausgeprägt war ihre Jagdpassion: Kaum von der Leine gelassen, war sie stundenlang alleine in den Wäldern unterwegs, oft mit Jagderfolg. Menschen blieben für sie freundliche Zeitgenossen, Hausregeln beachtete sie deshalb nur aus Nettigkeit und nur, solange sie gerade nicht besonders hungrig war. Gleichzeitig akzeptierte sie es niemals, von der Familie alleine gelassen zu werden: Sie schrie in absoluter Panik und geriet derart in Stress, dass sie Möbelstücke mit den Zähnen bearbeiten musste.
Für die Familie begann eine Odyssee durch sämtliche Hundeschulen der Umgebung, bis sie schließlich ihren Frieden mit den Eigenarten dieser Hündin schlossen. Sie akzeptierten sie, schätzten sie für ihre Kinderfreundlichkeit, aber konnten sie nie von der Leine lassen und nur mit Hundesitter aus dem Haus gehen. Doch für sie war klar, dass sie sich nach der Erfahrung mit Greta nie wieder einen Hund zu sich holen würden.
Einfluss auf das Verhalten
Nicht nur Wachstums- und andere Lebensprozesse des Hundewelpen beginnen bereits mit der Zeugung bzw. der ersten Zellteilung im Mutterleib. Gerade die Einflussfaktoren auf Gehirn, Hormonsystem und damit auch auf das spätere Verhalten sind in diesen frühen Entwicklungsabschnitten durchaus bereits vorhanden.
Den wichtigen Einfluss der frühen Lebensbedingungen auf das spätere Verhalten von Hunden haben Studien aus der ganzen Welt belegt (Belgien, Haverbeke et al. 2010, Ungarn, Mirko et al. 2012 und Australien). In all diesen Ländern wurden Hunde, die mit vollständigem Familienanschluss gehalten und in einer menschlichen Familie den größten Teil oder sogar den ganzen Tag integriert waren, verglichen mit solchen, die im Zwinger, im Hinterhof oder in anderen, außerhalb des menschlichen Familienumfeldes angesiedelten Bereichen gehalten wurden.
Wer als Hund die ersten zwei Jahre mit vollständigem Familienanschluss verbringt, hat ein wesentlich geringeres Risiko, später bissig gegen Menschen zu werden. Dieser Einfluss übertönt sogar den Einfluss der Rasse. Gerade die Studie von Erika Mirko und Co-Autoren aus Budapest macht dies besonders deutlich. Dort wurden zwei Hunderassen näher betrachtet, die sich in ihrer Haltung, in ihrem Verwendungszweck und auch in ihrem Umgang mit Menschen erheblich unterscheiden: Der Deutsche Schäferhund, der früher ein Allround-Arbeitshund für Schäfer war und heute überwiegend im Dienst- und Schutzhundebereich eingesetzt wird, und der Magyar Viszla, früher ein Jagdhund, heute auch in Ungarn überwiegend ein Familienhund. Selbst da kam man zum gleichen Ergebnis: Viszlas, die im Hof oder Zwinger aufgewachsen waren, hatten ein sehr viel höheres Beißrisiko als Deutsche Schäferhunde mit vollständigem Familienanschluss. Viele Probleme im Umgang mit angeblich aggressiven Hunden entstehen dann, wenn diese mangels Erfahrung aus Furcht oder anderen Stressemotionen heraus mit einer vorbeugenden Attacke reagieren. Wie Anuk Haverbeke in ihrer Arbeit zeigte, bezieht sich dieses Problem überwiegend auf den Zusammenhang zwischen Furchtsamkeit, Stressanfälligkeit und der Gewöhnung an den Menschen.
Was bedeutet all das für den Hundehalter und seine zukünftige Erziehungsarbeit? Nun, die Antwort ist vielfältig. Genau wie bei unseren eigenen Kindern und Jugendlichen kommt es darauf an, sich individuell mit dem jeweiligen Hund, seinen Bedürfnissen, seinen Ansprüchen und Nöten auseinanderzusetzen.
© Sabine Stuewer/Kosmos
Pauschalrezepte sind kontraproduktiv
Nur wer die Vorgeschichte kennt oder zumindest erahnt und sich daraus ein gutes Konzept für die zukünftige Erziehung des Hundes zurechtlegt, wird auch Erfolg haben. Pauschalrezepte und unbiologische Behauptungen sind hier fehl am Platz. Und auch hier gilt die Aussage des großen Philosophen Kant, wonach nichts so gut anwendbar ist, wie eine breit abgestützte Theorie. Je mehr Wissen über die Prozesse vorhanden ist, die während der Trächtigkeit, in der frühen Welpenentwicklung und in der Jugend unseres Hundes abgelaufen sind, desto besser können wir uns darauf einstellen und für diesen Hund ein individuell optimiertes Betreuungsprogramm entwickeln. Sicher kann man einen Hund auch gut erziehen und in eine gute und auch für beide Seiten erfreuliche Bindung bringen, ohne mit vielen Hormonnamen, Hirnarealen und anderen Fachausdrücken zu jonglieren. Aber nur, wer ein sehr gutes Bauchgefühl hat, wird seinen eigenen Hund ohne die Kenntnis dieser Zusammenhänge zu einem sozialverträglichen und für alle Beteiligten erfreulichen Familienmitglied heranziehen können. Für alle anderen ist es besser, über Prägungsprozesse Bescheid zu wissen.