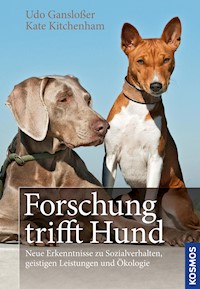35,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Franckh-Kosmos Verlags-Gmbh & Co. KG
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Der Hund steht im Fokus der Wissenschaft. Weltweit wird über sein Wesen geforscht, denn Hundehalter möchten wissen, wie ihr vierbeiniger Freund denkt und fühlt. Privatdozent Dr. Udo Gansloßer und Kate Kitchenham stehen in Kontakt mit führenden Wissenschaftlern und haben die neuesten Forschungsergebnisse in diesem Buch zusammengefasst. Sie beschäftigen sich mit der Genetik und Zucht, dem Sozial- und Lernverhalten, der Intelligenz und den ganz besonderen Sinnesleistungen, die Hunde zu Helden machen. Eine Fundgrube zum besseren Verständnis unserer Hunde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 777
Ähnliche
Dieses E-Book ist die digitale Umsetzung der Printausgabe, die unter demselben Titel bei KOSMOS erschienen ist. Da es bei E-Books aufgrund der variablen Leseeinstellungen keine Seitenzahlen gibt, können Seitenverweise der Printausgabe hier nicht verwendet werden. Stattdessen können Sie über die integrierte Volltextsuche alle Querverweise und inhaltlichen Bezüge schnell komfortabel herstellen.
ZU DIESEM BUCH
LIEBE LESER,
seit mehreren Jahrzehnten wird der Hund intensiv erforscht, hunderte von empirischen Verhaltensstudien und genetischen Untersuchungen, aber auch Fragestellungen der Zoologie und Funktionsmorphologie über Hunde sind verfasst worden. Wenn wir all die verschiedenen Ergebnisse zusammenfassen, dann können wir uns vielleicht auf diesen größten gemeinsamen Nenner einigen: Hunde nehmen im Tierreich und besonders in ihrer Beziehung zum Menschen eine Sonderstellung ein.
Ihr natürliches Lebensumfeld ist unser Haus, unser Alltag, unser Leben. Wir teilen ein gemeinsames Habitat, das sich im Laufe der Evolution und Domestikationsgeschichte stark verändert hat, aber an das sich Mensch und Hund gemeinsam immer wieder optimal angepasst haben.
Heute sind Hunde in der Lage, mit uns Menschen genauso gut am Nordpol wie im New Yorker Stadtgetümmel zu leben. Entscheidend für ein erfülltes Leben scheint für sie wie für uns weniger der Wohnort, als vielmehr eine gute, feste soziale Beziehung zu einem verlässlichen Bindungspartner zu sein. Doch wen wir Hundehalter bei unserem Nachdenken über das „Wesen des Hundes“ häufig vergessen, sind die 85 Prozent der Welthundepopulation, die nicht gemütlich mit uns in einer Wohnung sitzen, sondern ihr Dasein unter Artgenossen allein bestreiten müssen. Die soziale Organisation der Streunerhunde und ihr spezieller Bezug zum Menschen sind in den letzten Jahren vermehrt in den Forscherfokus gerückt und hat uns mit neuen und faszinierenden Einblicken in das Wesen der Hunde beschenkt.
© Susan Schmitz/Shutterstock
Hunde bereichern unser Leben! Zu verstehen, wie sie und ihre besonderen Fähigkeiten entstanden sind, ist von großem Interesse.
IM FOKUS ZAHLREICHER FORSCHUNGSGEBIETE
Diese enorme soziale Flexibilität und besonderen sozial-kognitiven Fähigkeiten der Hunde unter unterschiedlichsten Lebensumständen haben das Interesse der Forscher am Hund geweckt: Erst zaghaft, dann immer stärker haben sich Wissenschaftler für diese besondere Spezies zu interessieren begonnen. Mittlerweile gibt es kein anderes Studienobjekt, das so intensiv, vielschichtig und international untersucht worden ist.
Wie wir in unserem ersten Buch „Forschung trifft Hund“ zeigen konnten, beschränkt sich die wissenschaftliche Arbeit nicht mehr nur auf die Verhaltensforschung. Auch Gelehrte anderer Fachbereiche sind auf den Hund gekommen, Psychologen, Genetiker, Kulturwissenschaftler, Soziologen und natürlich auch Evolutionsbiologen. Sie alle untersuchen den Hund an sich als Studientier, nicht nur die Beziehung zwischen Hund und Mensch, und liefern damit spannende Erkenntnisse für unser Leben mit Hund.
Sieben Jahre sind seit unserer letzten Zusammenfassung der aktuellen Forschungserkenntnisse vergangen und die Zeit drängt, ein neues Buch auf den Markt zu bringen, für alle wissenshungrigen Hundeprofis und Hundehalter. Denn in dieser Zeit ist weiter eine derart erkenntnisreiche Kanidenforschung betrieben worden, dass eine Überarbeitung der ersten Ausgabe nicht nötig war. Viel wichtiger war uns, dass ein völlig neues und eigenständiges Buch geschrieben wird, das wieder aktuelle Erkenntnisse für den Leser gut verständlich und übersichtlich zusammenfasst. Wir haben deshalb über die letzten Jahre Studien und Ideen gesammelt, und auch wenn wir hin und wieder auf alte Studien aus dem ersten Forschungsbuch verweisen müssen, kann dieses Buch doch ohne den Besitz von „Forschung trifft Hund“ (künftig im Text abgekürzt mit FTH) gut gelesen und verstanden werden!
In diesem Sinne hoffen wir, dass Ihnen auch unsere neue Sammlung wissenschaftlicher Erkenntnisse viele gute Impulse für ein glückliches Zusammenleben mit Ihrem Hund liefert!
Dank schulden wir den vielen ForscherInnen und AutorInnen der Informationskästen, die uns einen Blick in ihre Werkstatt von Forschung und Praxis gewährt und damit dieses Buch sehr bereichert haben.
Herzlichst,
PD Dr. Udo Gansloßer & Kate Kitchenham
DOMESTIKATION— Neue Erkenntnisse aus der Forschung
© Heike Schmidt-Röger/Kosmos
PAPA WOLF IST TOT – ES LEBE „PROTODOG“!
Sieben Jahre ist es her, dass unsere letzte Zusammenfassung zum Thema Domestikationsgeschichte des Hundes erschienen ist. Damals galt noch als ziemlich sicher, dass alle Hunde vom Grauwolf abstammen. Sieben Jahre sind in der Wissenschaft eine lange Zeitspanne –, besonders, wenn wir uns wie bei diesem Thema in einem Forschungsgebiet bewegen, in dem Zusammenhänge auf molekularer Ebene untersucht werden. Hier sind nämlich durch neue Techniken feinere Analysen der genetischen Verwandtschaftsverhältnisse möglich geworden, die immer mehr Licht in die noch große Dunkelheit der Domestikationsgeschichte des Hundes werfen. Spannend sind die Studien, die in aller Welt durchgeführt wurden, allesamt. Bevor einige hier präsentiert werden, sei vorangestellt, welche drei der wichtigsten Hypothesen aktuell in der Domestikationsforschung diskutiert werden:
Hypothese 1 Hunde und Menschen leben mutmaßlich viel länger zusammen, als bislang vermutet wurde.
Hypothese 2 Hunde stammen wohl doch nicht vom Wolf ab – sie sind nur am engsten mit ihm verwandt.
Hypothese 3 Hunde sind vermutlich zweimal entstanden – in Asien und Europa.
In Anbetracht dieser neuen Hypothesen wird deutlich, dass die bisherigen Annahmen zum Ablauf der Domestikationsgeschichte überdacht werden müssen. Doch wie immer in der Wissenschaft, ergeben sich mit jeder neuen These viele weitere, offene Fragen.
Daraus entbrennen Diskussionen zwischen den Fachleuten und neue Studien stellen alles wieder auf den Kopf. Das ist Wissenschaft und so soll sie sein! Denn nur durch stetiges Hinterfragen und Weiterarbeiten werden Hypothesen zu Thesen und irgendwann zu neuen Erkenntnissen. Der Weg dorthin ist mühsam – aber spannend, wie uns dieses Gebiet der Kanidenforschung deutlich vor Augen führt.
ZUSAMMENLEBEN MENSCH – HUND
Unsere Vorfahren, das steht fest, zeigten eindeutig schon ziemlich früh ein Interesse für diese Kaniden, die sich in ihrer Nähe aufhielten und keine echten Wölfe mehr waren. Auch wenn dieses Interesse an der anderen Spezies mit Sicherheit deutlich andere Motive hatte als unsere heutige Zuneigung zum Familienmitglied Hund, das Leben mit dem Protohund hatte bestimmt Folgen für die Entwicklung neuer Fähigkeiten – bei Hunden und eventuell sogar bei uns Menschen. Ein spannendes Thema, das insbesondere Verhaltensbiologen mit Ideen für immer neue Studien infiziert:
Wie haben Hunde all diese Talente entwickelt, die es ihnen ermöglichen, heute sogar zum „Blindenführhund“ ausgebildet zu werden? Und welchen Einfluss hatte die Domestikation unseres ersten Haustieres auf unsere eigene Zivilisierung?
GENETIK UND ARCHÄOZOOLOGIE
Genetiker analysieren – wie der Name schon vermuten lässt – Genmaterial, um neue Erkenntnisse über die Abstammungsgeschichte unserer Hunde zu gewinnen.
Dazu verwenden sie das Erbgut heute lebender Hunde und anderer Kanidenarten und vergleichen dieses miteinander und mit den Genen, die aus fossilen Knochenfunden alter Hunde und Wölfe isoliert werden konnten.
An die Überreste alter Kanidenknochen kommen Genetiker nur durch eine enge Zusammenarbeit mit Archäozoologen.
Um den Zeitpunkt, den Ort (oder die Orte) und die Abstammungsverhältnisse von Wolf und Hund eindeutiger bestimmen zu können, ist es hilfreich, wenn Archäozoologen und Genetiker engmaschig zusammenarbeiten. Dass diese Zusammenarbeit zum Glück immer wieder erfolgreich praktiziert wird und für beide Seiten viel Sinn macht, zeigt die Geschichte des „Altai-Hundeschädels“.
DER HUNDESCHÄDEL VON ALTAI
Der relativ gut erhaltene Schädelknochen wurde bereits 1975 bei archäologischen Ausgrabungen in Höhlen des Altai-Gebirges in Kasachstan gefunden. Archäozoologen identifizierten an dem Schädel hundetypische Merkmale wie eine verkürzte Schnauze (siehe Kasten „Schädelmerkmale“).
SCHÄDELMERKMALE
– Forscher vermessen Schädelmerkmale, um Wolf und Hund zu unterscheiden.
Finden Archäozologen bei Ausgrabungen an steinzeitlichen Lagerstätten einen Kaniden-Schädel, dann vermessen sie als Erstes die Schädelhöhe, Länge und das Verhältnis der Schnauzenlänge im Vergleich zur totalen Schädellänge. Durch diese recht zuverlässigen Kriterien zur Unterscheidung von Wolfs- und Hundeschädeln lässt sich identifizieren, ob es sich bei dem gefundenen Skelettteil bereits um einen domestizierten Hund handeln könnte. Grundsätzlich ist die Gesichtsregion von Haushunden verkürzt, sodass es zu einem engeren Stand der Zähne kommt. Genetische Untersuchungen können die Identifikation „Hund oder Wolf“ zusätzlich bestätigen.
Diese Veränderung in der Schnauzenregion, so die Vermutung der Archäozoologen, kann nur durch Anpassung an eine neue Lebensweise – in diesem Fall: weg vom Räuber hin zum Restefresser – erklärt werden. Durch die Radiokarbonmethode wurde der Schädel auf ein Alter von 33000 Jahren datiert.
Doch viele Forscher bezweifelten, dass der Schädel bereits von einem Hund stammte – sie vermuteten, dass es sich um eine ausgestorbene Wolfsart handeln müsse. Erst durch eine genetische Analyse der Knochenüberreste durch ein internationales Forscherteam um den finnischen Genetiker Olaf Thalmann (Thalmann et al., 2013, siehe Studie hier) konnte der Schädel eindeutig als Artgenosse unserer heutigen Hunde identifiziert werden. Die Hypothese der Archäozoologen scheint damit bestätigt: Der einzigartige Haplotyp des „Altai-Hundes“ ist sogar enger mit modernen Hunden und prähistorischen Hunden Amerikas verwandt als mit den Wölfen der damaligen Zeit. Somit war der Nachweis erbracht, dass die Domestikation des Hundes schon im frühen Pleistozän, vor mehr als 30000 Jahren, ihren Anfang genommen hat.
AUF SPURENSUCHE IM ERBGUT
Fossile Knochenfunde früher Hunde dokumentieren durch die Jahrtausende eine stete Veränderung der Größenverhältnisse und der Schnauzenregion. Durch die wechselnden Zeitepochen können Archäozoologen auf diese Weise viel über die Geschichte der „Hundwerdung“ erfahren. Genetiker begeben sich dann mit Hilfe dieses Ausgangsmaterials und der gewonnenen Informationen auf Spurensuche der im Erbgut „verborgenen“ Geschichten: Durch den Vergleich des in den alten Knochen enthaltenen genetischen Materials auf Verwandtschaftsverhältnisse mit heutigen Hunden, dem Wolf sowie mit anderen prähistorischen Knochenfunden von Wölfen und frühen Hunden, entsteht ein Szenario, wie die Entwicklung zum Haushund abgelaufen sein könnte. Die aktuelle Forschung ermöglicht uns, an der Entstehungsgeschichte der Hunde teilzunehmen, die eng mit der unseren verbunden ist. Dass sich dabei Ergebnisse teilweise widersprechen zeigt, wie lebendig der Forschungsprozess aktuell ist.
© bzdurynn/Shutterstock
© Wlad74/istock
Wolfs- und Hundeschädel: die Schnauze ist beim Hund kürzer im Vergleich zur Schädellänge, der Zahnabstand enger.
RADIO-KARBONMETHODE
Unser Leben lang lagern wir in unseren Knochen radioaktive 14C-Atome an, die natürlich in der Umwelt vorkommen. Das ist für uns nicht schädlich, aber gut für die Wissenschaft. Denn nach dem Tod eines Organismus nimmt diese Menge an gebundenen, radioaktiven 14C-Atomen kontinuierlich ab. Aus diesen Zerfallszahlen können Archäologen deshalb ziemlich genau bestimmen, wie lange ein Lebewesen schon verstorben ist oder, anders formuliert, zu welcher Zeit es gelebt haben muss.
Mitochondrien-DNA als Indiz für Abstammung
Bei der Suche nach Abstammung sind für Genetiker besonders die Zellorganellen Mitochondrien interessant, denn sie verraten ziemlich genau, wie sich die Stammesgeschichte einer Art entwickelt hat.
© Designua/Shutterstock
Mitochondrien
Mitochondrien sind Zellorganellen, die fast nur in der mütterlichen Linie, über die Eizelle, weitervererbt werden. Das Erbgut der Mitochondrien, die sogenannte „mitochondriale DNA“, hat eine sehr konstante Mutationsrate, sodass man durch die Anzahl der Veränderungen im Erbgut ziemlich genaue Berechnungen anstellen kann, wann sich zwei Stammeslinien getrennt haben. Mutationen passieren durch Fehler beim Kopieren von DNA oder Schäden an der DNA. Über Zeiträume verändert sich auf diese Weise mit konstanter Rate die mitochondriale DNA und getrennt verlaufene Stammeslinien lassen sich immer besser voneinander unterscheiden.
Mitchondriale DNA wird bei der Zeugung nicht zwischen mütterlicher und väterlicher Herkunft geteilt, wie das beim Erbgut anderer Chromosomen der Fall ist. Hier wird bei jeder Verpaarung Erbmaterial neu kombiniert und Mutationen dadurch gleich mit durchmischt. Durch die Eizellen-gebundene Vererbung geschieht dies bei der mitochondrialen DNA nicht. Sie bleibt als besondere Sequenz immer zusammen und zieht sich dadurch wie eine mütterliche Unterschrift durch alle Individuen dieser Abstammungslinie.
HYPOTHESE 1
Hunde und Menschen leben viel länger zusammen, als bislang vermutet wurde.
Mit einem Alter von 33000 Jahren ist der Altai-Schädel bis heute einer der frühesten archäologischen Hinweise für die Existenz von hundeartigen Kaniden. Gesellschaft hat er bekommen durch weitere Funde fossiler Hundeknochen, z.B. aus Belgien in der Nähe von Andenne. Dort wurde ebenfalls ein Schädel gefunden, der Veränderungen in der Schnauzenpartie aufweist. Er wurde auf ein Alter von 31700 Jahren datiert. Dies bedeutet, dass diese beiden „Protodogs“ zusammen mit dem Cro-Magnon-Menschen gelebt haben müssen. Die ersten phänotypischen Unterscheidungsmerkmale zum Wolf könnten durch die veränderte Lebensart erklärt werden: Während ein Teil der ursprünglichen Wolfspopulation – vielleicht die scheueren Exemplare – es vorzog, weiter vom Menschen unabhängig zu leben und ein Territorium zu besetzen, könnte ein anderer, eher zutraulicherer Teil der Ursprungspopulation das Leben an der Seite des Menschen vorgezogen haben. So könnte man die Veränderungen in der Schädelform erklären, denn die „Menschen-bezogenen“ Wölfe werden sich zunehmend von Abfällen des Menschen ernährt haben, während die „freien“ Wölfe weiter selbstständig auf die Jagd gingen (Spekulationen von Robert Wayne, Video: www.ucsd.tv/search-details.aspx?showID=28895).
Mit der Zeit wird es wahrscheinlich zu einer Verringerung der Distanz zwischen unseren Vorfahren und diesen „Protohunden“ gekommen sein, bis sie vielleicht gemeinsam durch ein Jagdgebiet zogen und eventuell schon Vorteile bei der Beutesuche in Gegenwart der jeweiligen anderen Art finden konnten, was eine weitere optische Veränderung der ersten Hunde nach sich gezogen haben könnte. Diese Veränderungen werden durch Knochenfunde aus Steinzeitlagerstätten und später ersten Siedlungen deutlich dokumentiert (siehe „Entstehung der ersten Schläge“ hier, speziell die Studie auf Zhokhov Island, Pitulko et al., 2017). Um den Zeitpunkt und Ort der Hundeentstehung noch präziser erforschen zu können, sind weitere Untersuchungen durchgeführt worden. Hierzu hat sich z.B. der finnische Forscher Olaf Thalmann in einer weiteren Studie auf den Vergleich von Haplotypen (siehe Kasten „Aus der Forschung“ und hier) konzentriert. Dazu wurden die Haplotypen 18 prähistorischer Kaniden aus Amerika und Eurasien mit den Haplotypen heutiger Hunde und Wölfe verglichen (Thalmann et al., 2013).
FORSCHUNG: Kanidenschädel
AUS DER FORSCHUNG
— DNA-Analyse identifiziert den 33000 Jahre alten Kanidenschädel als „Hund“
Vorgehensweise
Mit der Absicht, die genetische Beziehung eines der ältesten Knochenfunde von Hunden richtig einzuordnen, wurde von den amerikanischen Wissenschaftlern Mitochondriale DNA aus den prähistorischen Schädelknochen isoliert. Dazu wurden 413 Nucleotide untersucht (Druzhkova et al., 2013).
Ergebnisse
Der Vergleich mit anderen prähistorischen Hundefossilien und modernen Hunden und Wölfen eurasischen und amerikanischen Ursprungs konnte drei Dinge zeigen:
Der über 30000 Jahre alte Schädel war bereits ein Hund, denn der einzigartige Haplotyp des „Altai-Hundes“ ist enger mit modernen Hunden und prähistorischen Hunden aus Amerika verwandt, als mit gegenwärtigen Wölfen.
Hunde sind wahrscheinlich in Europa entstanden, denn es gab eine starke Beziehung der Gen-Sequenzen moderner Hunde mit alten europäischen Hunden und Europäischen Wölfen, aber keine Assoziation moderner Wolf-Gensequenzen aus dem mittleren Osten oder Ostasien mit modernen Hunden.
Der Vorfahre von Hunden war eine Wolf-Spezies, die heute ausgestorben ist.
Das Ergebnis dieser aufwändigen Vergleichsstudie scheint u.a. den frühen Startschuss für den Beginn der Hunde-Domestikation zu bestätigen:
Der Ursprung der Hunde-Domestikation könnte in Europa seinen Anfang genommen haben, ausgehend von einer Wolfspopulation, die heute ausgestorben ist.
Die erste Domestikation des Hundes könnte in einem Zeitrahmen von vor 32100 bis 18800 Jahren stattgefunden haben.
Ein weiteres Indiz für das Auftauchen des Hundes als Jagdgehilfe der Menschen könnten die Mammut-Gräber sein, die man überall in Europa finden kann. Die frühzeitlichen Massengräber der ausgestorbenen Elefantengattung wurden auf eine Zeitspanne von 40000 – 15000 Jahren datiert, das ist ein Zeitraum, der aktuell auch für das Auftauchen der ersten Hunde diskutiert wird. Aus den Knochen der Mammuts wurden wohl Unterschlupfe gebaut, an manchen Überresten findet man Nagespuren von Kanidenzähnen. Forscher wie die amerikanische Anthropologin Pat Shipman von der Universität Pennsylvania spekulieren sogar, dass das Aussterben der Mammuts mit dem Beginn des gemeinsamen Jagens von Mensch und Hund in Zusammenhang zu bringen sein könnte. Sie vermutet, dass der plötzliche und enorme Jagderfolg bei großen Säugern nur durch eine veränderte, neue Jagdstrategie erklärt werden könne. Die Hypothese lautet hier, dass die gemeinsame Jagd von Protohund und Mensch derart erfolgreich verlief, dass Großsäuger wie das Mammut diesem Druck nicht standhalten konnten und ausgelöscht wurden (Shipmann, 2015). Für diese Annahme spricht, dass erste Hunde zu dieser frühen Zeit für diese Region ebenfalls nachgewiesen werden konnten (Germonpréz et al., 2009, 2012). Deutlich wird bei all diesen Spekulationen, dass ein Zusammenarbeiten von Protohund und Mensch vielen Forschern bereits in dieser frühen Phase der Menschwerdung möglich erscheint.
WER IST DIESER „HAPLOTYP?“
Im Zellkern befindet sich die DNA, die sich aus einer Kette von vielen Nucleotiden zusammensetzt. Eine Spezies teilt sich bestimmte Nucleotidsequenz-Varianten, die von Genetikern als „Haplotypen“ bezeichnet werden. Ein „Haplotyp“ ist also kein Persönlichkeitsmerkmal, sondern die spezielle Version einer Nucleotidsequenz auf ein- und demselben Chromosom im Genom. So kann von Genetikern durch entsprechende Analyseverfahren festgestellt werden, ob ein Teil von Individuen eine gemeinsame Abstammungsgeschichte verbindet und wie eng dieser Grad der Verwandtschaft ist.
HYPOTHESE 2
Hunde stammen wohl doch nicht vom heutigen Wolf ab – sie sind nur am engsten mit ihm verwandt.
In den letzten Jahren wurde mit diesem Verfahren von den Genetikern nicht nur intensiv nach einem Zeitfenster der Hundeentstehung geforscht, auch die Abstammung vom heutigen Wolf und Verwandtschaft der Hunderassen untereinander stand im Fokus. Immer häufiger wurde dabei die Annahme formuliert, dass es einen gemeinsamen Vorfahren von Hund und Wolf gegeben haben muss, der heute ausgestorben ist.
Diese Ansicht wird durch eine 2014 publizierte Studie weiter unterstützt. Eine internationale Forschergruppe um Adam Freedman von der Universität von California, Los Angeles (UCLA), untersuchte die DNA von drei unterschiedlichen Grauwolfpopulationen aus Gegenden, die als Ursprungsort der Hunde-Domestikation diskutiert werden, nämlich aus Europa, dem mittleren Osten und Ost-/Südasien. Diese Genom-Sequenzen wurden untereinander und mit den Genomen von Dingos und Basenji verglichen, die als sehr ursprüngliche Hundevertreter gelten. Als Vergleichsgruppe dienten die Gene eines Goldschakals. Die gefundenen Daten zeigten, dass keine Wolfspopulation enger mit Hunden verwandt war als andere, dass sie aber jeweils untereinander eine starke Ähnlichkeit aufwiesen (Freedman et al., 2014).
Aus diesen Ergebnissen schließen die Forscher, dass es im Zuge der Wolfsevolution zu einer starken Reduzierung von Individuen gekommen sein muss, aus der sich die bis heute andauernde, enge Verwandtschaft der unterschiedlichen Grauwolfpopulationen aus aller Welt erklären lässt.
© Jeannette Katzir Photog/Shutterstock
Hunde und Wölfe haben sich vermutlich aus wenigen Ursprungsindividuen weiterentwickelt.
Gleichzeitig zeigt die Untersuchung, dass sich der gemeinsame Weg von Hunden und Wölfen vor ungefähr 15000 Jahren endgültig getrennt haben könnte. Danach waren auch die Ur-Hunde durch den Flaschenhalseffekt (siehe Kasten) von einer starken Reduktion der Populationsgröße betroffen, was Mutationen für besondere Körpermerkmale bei Hunden zum Siegeszug verholfen haben könnte.
FLASCHENHALSEFFEKT
Besteht eine Population, z.B. durch einen massiven Populationseinbruch, nur noch aus wenigen Individuen, dann kann es zu einer starken, genetischen Verarmung kommen. Diese äußert sich z.B. darin, dass Allele nicht mehr in der ursprünglichen Vielfalt auftreten und dadurch Erbkrankheiten oder auch Mutationen eine größere Wirkung entfalten können. So gehen alle heute lebenden Hunde auf wenige Individuen zurück, was unter anderem durch diese Studie gezeigt werden konnte.
Hund und Wolf haben sich anschließend zwar immer wieder durchmischt, aber ansonsten unabhängig voneinander aus relativ wenigen Ursprungsindividuen weiterentwickelt. Auch Wölfe haben sich genetisch weiterentwickelt und vom gemeinsamen Vorfahren beider Kaniden entfernt – nur hat diese Veränderung durch das Leben in relativ konstanten Umweltverhältnissen nicht so extreme, sichtbare Ausmaße angenommen wie bei unseren Hunden, die sich immer mehr in unsere Obhut begeben haben (siehe „Soziale Ökologie“ von Friederike Range und Sarah Marshall-Pescini, hier). Letztlich sind an den auffälligen Unterschieden der Rassen jedoch nur wenige Gene beteiligt, die sich durch die künstliche Selektion des Menschen massiv ausbreiten konnten, wie eine andere aktuelle Studie zeigt (siehe hier, Studie zur Kleinwüchsigkeit).
FORSCHUNG: Entstehungsgeschichte
AUS DER FORSCHUNG
— Neue Erkenntnisse zur Entstehungsgeschichte der Hunde
Ist der heutige Wolf der Urahn unserer Hunde? Oder haben beide nur einen gemeinsamen Verwandten? Bei der Rekonstruktion der frühen evolutionären Geschichte unserer Hunde hilft die Untersuchung von qualitativ hochwertigen Genomsequenzen aus den Mitochondrien von Hunden und Wölfen. Sie machen es möglich, genetische Veränderungen zu identifizieren, die der Domestikation des Hundes zugrunde liegen.
Vorgehensweise
Es wurden gezielt Wolfsindividuen gewählt, die aus drei Gebieten stammen, die als wahrscheinliche Ursprungsorte für die Domestikation des Hundes diskutiert werden. Dazu gehören: der mittlere Osten, Ostasien und Europa. Außerdem wurden die Genome von drei als ursprünglich geltenden Hunderassen (Basenji, Husky und Dingo) analysiert. Als Vergleichswert diente das Erbgut eines Goldschakals.
Ergebnisse
Analysen dieser Sequenzen unterstützen ein Modell, nach welchem Hunde und Wölfe sich nicht abrupt, sondern in einem dynamischen Prozess getrennt haben. Nach einer langen Phase der schrittweise verlaufenden Entfernung, wie sie durch die Funde der Archäozoologen gezeigt werden können, wurde die Entstehung der Unterart Hund rapide durch den Flaschenhalseffekt beschleunigt, der vor ungefähr 14900 Jahren aufgetreten sein muss.
Flaschenhalseffekte können bei der Populationsentwicklung einer Art eine wichtige Rolle spielen (siehe Info hier). Hier gilt dies für beide Arten, Hunde wie Grauwölfe. Zusätzlich gab es anschließend an die starke Trennung wieder einen Genaustausch in beide Richtungen („Admixture“). Bei Grauwölfen kam es zur starken Populationsreduzierung mit einhergehendem genetischen Flaschenhalseffekt, kurz nach der Trennung von Hunden. Daraus kann geschlossen werden, dass die Vielfältigkeit des Genpools, aus dem Hunde entstanden sind, von der Substanz her größer war, als er heute von modernen Wolfspopulationen repräsentiert wird.
Amylase-Gen als Indikator
Der Initialmoment der Hunde-Domestikation wird normalerweise von Forschern auf ein Intervall von 11000 –16000 Jahren begrenzt gesehen. Das ist ungefähr die Zeit der Entstehung von Ackerbau und damit der sesshaften Lebensweise unserer Vorfahren.
Angesichts dieser Ergebnisse haben die Forscher andere Arbeiten mit einbezogen, die das Auftreten des Amylase-Gens als Indikator für die Hunde-Domestikation gewertet hatten. Die Forscher dieser Studien interpretierten den Anstieg der Amylase-Gene in Hundepopulationen, die eine Verdauung von Stärke erst möglich machen, als Nachweis für eine Domestikation zu Beginn der Sesshaftwerdung, die mit dem Aufkommen des Ackerbaus einherging. Dabei mussten Hunde sich ernährungsbedingt vermehrt mit Stärke in ihrer Nahrung auseinandersetzen, Hunde mit Mutationen für die Herstellung des Amylase-Enzyms hatten dadurch einen Vorteil bei der Umstellung der Ernährung.
Gleichzeitig konnte das internationale Forscherteam um Adam Freedman (2014) viele Variationen finden, besonders was die Kopienanzahl des Amylase-Gens bei Grauwölfen betraf. Hingegen gab es keinen bis wenig Anstieg bei der Kopieanzahl bei Dingo- und Huskylinien. Daraus schließen die Forscher, dass die Fähigkeit zur Stärkeverdauung schon bei Wölfen vorhanden war und Rassen wie der Husky, die als Begleiter von Jägern und Sammlern gezüchtet wurden und bis heute hauptsächlich von tierischen Proteinen ernährt werden, dieses Gen bis heute kaum ausgebildet haben. Diese Variation in der Fähigkeit zur Stärkeverdauung spricht für die Hypothese, dass die Domestikation des Hundes schon vor dem Ackerbau begonnen haben kann (Variation des Amylase-Gens, siehe hier).
Folgerung
In Verbindung mit der erwarteten Zeit für Hunde-Domestikation bescheren diese Ergebnisse erneut Unterstützung für archäologische Funde, wonach die ersten Hunde nicht erst während des Ackerbaus, sondern bereits als Begleiter für Jäger und Sammler auf der Bildfläche der Menschheitsgeschichte erschienen sind. In Bezug auf die geographische Herkunft der Hunde konnte überraschenderweise festgestellt werden, dass keine der erhaltenen Wolfslinien aus den möglichen Domestikationszentren enger mit dem Hund verwandt ist als die anderen. Im Gegenteil, die untersuchten Wölfe haben eher einen Schwesternzweig gebildet.
Dieses Ergebnis zeigt in Kombination mit der Rückvermischung von Wolf und Hund während der Domestikation, dass wir eine neue Bewertung alter Hypothesen zur Hunde-Domestikation benötigen.
© Kjetil Kolbjornsrud/Shutterstock
Wir müssen uns von vielen Annahmen lösen und alte Domestikationsstudien neu analysieren.
HYPOTHESE 3
Hunde sind vermutlich zweimal entstanden – in Asien und Europa
Die Theorie eines relativ abrupten stammesgeschichtlichen Wendepunktes bei Hunden und Wölfen vor ungefähr 15000 Jahren hat aktuell Gesellschaft bekommen durch eine neue Studie zur Hunde-Domestikation, die eine ganz neue Facette in die Entstehungsgeschichte des Hundes bringt (Frantz et al., 2016). Sie könnte dabei helfen, anscheinend widersprüchliche Ergebnisse und daraus resultierend eine jahrelang andauernde wissenschaftliche Meinungsverschiedenheit zum Ursprungsort der Hunde zu klären.
Besonders kontrovers diskutiert wurde im letzten Jahrzehnt nämlich, wo genau die „Wiege der Hunde“ liegt. Auch wenn die ersten Funde aus dem frühen Paläolithikum stammen (36000 Jahre Belgien, 33000 Jahre Altai-Gebirge), so kommen die ersten Knochenfunde mit deutlichen Hundemerkmalen aus Europa und sind meistens um die 15000 Jahre alt. Vergleichbare Knochenfunde aus Asien sind „nur“ 12500 Jahre alt. Auch wenn Archäologen vermuten, dass Hunde mehr als einmal entstanden sein könnten, haben die meisten genetischen Studien einen Ursprung entweder im ostasiatischen oder europäischen Raum vermutet. Besonders zwei Lager waren sich durch scheinbar widersprüchliche Ergebnisse genetischer Vergleichsstudien viele Jahre lang uneinig darüber, ob der Startschuss für die Domestikation in Europa oder in Ostasien gefallen sei (siehe FTH, S. 14 ff.).
© Kharlamov Igor Viktorovich/Shutterstock
Wo liegt die „Wiege der Hunde“? Europa oder Ost-Asien? (Foto: Altai-Gebirge)
Rückblick: Streit um den Ursprungsort der Domestikation
Der amerikanische Genetiker Robert Wayne und sein Team gingen bislang davon aus, dass die Hunde aufgrund genetischer Abstammung europäischen Ursprunges sein müssen (Leonard, 2002). Eine andere Forschergruppe um Peter Savolainen sieht die Herkunft des Hundes in Südostasien (Savolainen et al., 2002). Das internationale Forscherteam um Laurent Frantz von der Universität Oxford hat jetzt die Gensequenz eines vor 4800 Jahren verstorbenen Hundes aus Irland mit den Genen von 59 Hundefossilien aus Europa und Asien verglichen (Frantz et al., 2016).
Nach diesem genetischen Vergleich prähistorischer hündischer Knochenfunde blieb für die Forscher nur ein Schluss übrig: Noch vor 14000 – 6400 Jahren gab es eine tiefe genetische Spaltung zwischen asiatischen Hunden und Hunden europäischen Ursprungs.
Eine neuere Studie scheint diese Hypothese der „Zweifachentstehung“ von Hunden und ihrer anschließenden Vermischung zu bestätigen (Wang et al., 2015).
Das internationale Team von Genetikern sammelte mit Hilfe von Blut- und Speichelproben Genmaterial von 58 Kaniden aus aller Welt, darunter 12 Grauwölfe vom eurasischen Kontinent, 11 Hunde, die aus ostasiatischen Regionen stammen, 12 aus dem Norden stammende, ostasiatische Hunde, vier nigerianische Dorfhunde und eine Sammlung von 19 unterschiedlichen Hunderassen aus Europa und Amerika. Die Forscher halten in ihrer Diskussion das Szenario der Ausbreitung und Migration von Asien nach Europa aufgrund der gewonnenen Daten ebenfalls für möglich. Die starke Präsenz der ostasiatischen Gene erklären sich diese Wissenschaftler damit, dass sie den frühen europäischen Hund als „primitiv“ bezeichnen. Nach den genetischen Berechnungen entstanden die ersten Hunde im ostasiatischen Raum vor ungefähr 30000 Jahren und wanderten von dort vor rund 15000 Jahren von Asien in den Mittleren Osten. Von dort aus, so die Hypothese der Genetiker, eroberten die Hunde erst Afrika und erreichten dann vor ungefähr 10000 Jahren Europa. Dort kam es zu einer genetischen Verdrängung, sodass heute die Gene ostasiatischer Hunde in der weltweiten Hundepopulation stärker vertreten sind.
Doch die Wanderbewegungen der Hunde über die Erde waren noch nicht beendet: Die Genetiker schließen aus ihren Genproben, dass manche der Asien-Linien wieder den Rückweg angetreten haben und Richtung Osten gewandert sind. Dort kam es zu Rückvermischungen mit den ursprünglichen asiatischen Linien in Nordchina, bevor weitere Hunde aufbrachen, um die neue Welt zu besiedeln. Sollte diese Studie bestätigt werden, könnte damit die außergewöhnliche Ausbreitungsgeschichte entdeckt worden sein, die der Hund über die Erde unternommen und die zur Entstehung der heutigen Hunde geführt hat.
FORSCHUNG: Doppelte Entstehung
AUS DER FORSCHUNG
— Genetische und archäologische Funde sprechen für eine doppelte Entstehung von Hunden.
Material und Methode
Die britischen Forscher analysierten Gensequenzen aus der mitochondrialen DNA, die aus 59 Knochenfunden von europäischen Hunden (14000 – 3000 Jahre alt) stammt, und zusätzlich ein komplettes Genom eines Hundes aus dem späten Neolithikum (ungefähr 4800 Jahre alt) aus Irland. Diese altertümliche Sammlung wurde ergänzt durch 80 vollständige Genomsequenzen von 605 modernen Hunden aus 49 Rassen und Dorfhunden.
Ergebnisse
Die Analysen offenbarten eine frühe und tiefe genetische Trennung zwischen ostasiatischen und westeurasischen Hunden. Die Forscher erklären sich diese Ungleichheit mit der Hypothese, dass es zwei genetisch unterschiedliche Wolfspopulationen in Ost- und Westeurasien gegeben haben muss, die noch vor der Sesshaftwerdung des Menschen unabhängig voneinander domestiziert wurden und irgendwann ausgestorben sind. Die östliche Hundepopulation hat sich dann in einem Zeitraum von vor 14000 bis 6400 Jahren Richtung Westeuropa ausgebreitet, wahrscheinlich an der Seite von Menschen. Dort haben sie die ansässige, paläolithische Hundepopulation ersetzt. Diese Hypothese könnte von anderen genetischen Studien unterstützt werden, die eine Herkunft des Hundes in Ostasien oder Europa lokalisiert und sich damit scheinbar widersprochen hatten. Die kombinierten Studien aus der Genetik und Archäozoologie lassen vermuten, dass Hunde – ähnlich wie Schweine – unabhängig voneinander doppelt entstanden sind und sich erst später vermischt haben.
ODER: SIND HUNDE DOCH NUR EINMAL DOMESTIZIERT WORDEN?
Ganz neue Daten lassen jetzt wiederum vermuten, dass sich Hunde und Wölfe vor 20000 und 40000 Jahren getrennt haben. Danach haben sich vor 17000 bis 24000 Jahren zwei genetisch verschiedene Hundegruppen in Europa und Asien gebildet. Dies bedeutet, dass die Domestikation doch nur an einem Ort stattgefunden haben könnte – im Gegensatz zur Hypothese, dass Hunde getrennt voneinander in Europa und Asien entstanden sind und die europäischen anschließend von den asiatischen Hunden genetisch „überrannt“ wurden. Nach dieser neuen Studie ist die „Wiege des Hundes“ in Südostasien beheimatet und von dort aus haben sich Hunde ausgebreitet (Saey, 2017; Botigué et al., 2017). Erst danach kam es zu einer deutlichen Trennung europäischer und asiatischer Hunde. Die Daten konnten gewonnen werden, weil Forscher das komplett erhaltene Genmaterial aus verschiedensten fossilen Knochenfunden früherer Hunde miteinander verglichen. Mit dabei war ein 7000 Jahre alter Hund aus Herxheim, ein 4700 Jahre alter Hund aus der Kirschbaumhöhle in Deutschland und der 4800 Jahre alte Hund aus Newgrange in Irland, der bereits für die Studie untersucht worden war, die zwei Domestikationsherde festgestellt hatte.
Amylase-Gen bei Hunden
Die Ergebnisse der Genanalyse haben ebenfalls die relativ neu propagierte Hypothese zur Stärkeverdauung bestätigt (Ollivier et al., 2016; Axelsson et al., 2013; siehe hier). Die Genetiker hatten die Theorie aufgestellt, dass Hunde parallel zur Sesshaftwerdung und mit Beginn des Ackerbaus die Fähigkeit entwickelt haben, Stärke besser verdauen zu können als Wölfe, und dadurch in der Lage waren, sich auch von den Körnerabfällen der ersten Bauern zu ernähren. Ermöglicht wird diese Stärkeverdauung durch ein Amylase-Gen AMY2B, von dem die meisten Hunde mehrere Kopien besitzen. Dieses Gen kodiert wiederum ein Enzym, das dabei hilft, Stärke zu verdauen. Wölfe besitzen von diesem Gen nur zwei Kopien, sie sind deshalb auf eine fleischlastige Ernährung angewiesen. In der vorliegenden Studie konnte festgestellt werden, dass die beiden altertümlichen deutschen Hunde ebenfalls nur zwei Kopien dieses Amylase-Gens besaßen, während der jüngere „Newgrange-Hund“ bereits drei Kopien des Gens in seinem Erbgut hatte (Saey, 2017). Da diese Hunde viele tausend Jahre nach der Domestikation als Begleiter von Jägern und Sammlern lebten, lassen diese Studien vermuten, dass die ersten domestizierten Hunde genetisch noch keinen Polymorphismus des Amylase-Gens benötigten und dadurch noch nicht darauf vorbereitet waren, Stärke besser zu verdauen als Wölfe. Die genetische Veränderung hat sich erst als Anpassung an die neue, sesshafte Lebensweise des Menschen mit der Zeit als erfolgreich erwiesen und durchgesetzt. Frühzeitliche Hunde hatten bereits andere genetische Variationen, die sie darauf vorbereitet haben, später auf die sich verändernde Lebensweise zu reagieren.
WIE ES GEWESEN SEIN KÖNNTE!
Fasst man all diese Ergebnisse der Genetik und Archäozoologie zur Domestikationsgeschichte des Haushundes zusammen, könnte sich folgendes Szenario abgespielt haben:
1. Trennung in sesshafte und migrierende Wölfe Mehrfach im europäischen und asiatischen Raum könnten heute ausgestorbene, ostasiatische und europäische Wolfsarten auf die Idee gekommen sein, sich in der Nähe eines jagdlustigen Volkes von Zweibeinern, den Cro-Magnon-Menschen, aufzuhalten, eventuell um gemeinsam zu jagen und Reste zu fressen. So teilte sich die jeweilige Wolfspopulation in zwei Lebensweisen auf – ein eher scheuer Teil behielt die territoriale, vom Menschen unabhängige Lebensweise bei, der andere Teil begann, mit den Menschen umherzuziehen und in deren Nähe Junge aufzuziehen.
2. Der Protohund entsteht Über die Jahrtausende kam es so zu einer ersten genetischen Trennung der beiden Populationen, die durch die veränderte Nahrungsaufnahme und Lebensweise zu einer Veränderung im Aussehen führte. Diese erste Abweichung des Phänotyps ist an der abgewandelten Form der Schädel erkennbar, wie wir sie z.B. am 33000 Jahre alten „Altai-Hundeschädel“ aus Kasachstan finden können.
3. Rückvermischung (Admixture) Diese ersten „Protohunde“ waren wahrscheinlich, außer durch ihre an den Menschen orientierte Lebensweise, äußerlich auf den ersten Blick kaum von Wölfen zu unterscheiden. Gleichzeitig kam es wohl auch immer wieder zur Vermischung mit der territorialen Schwesternart.
4. Flaschenhalseffekt Erst durch eine massive Verkleinerung der Populationsgröße vor etwa 15000 Jahren konnten sich Mutationen in den ersten „Protohunden“ plötzlich sehr gut durchsetzen, und die beiden Gruppen trennten sich deutlich in zwei unterschiedliche Spezies.
5. Zunehmende Differenzierung Besonders das Aussehen der Ur-Hunde wird sich durch die neue ökologische Nische „Mensch“ mit der Verringerung der Distanz zum Menschen verändert haben, und der optische und genetische Unterschied zwischen Wolf und Hund wurde immer größer.
6. Einfache oder doppelte Entstehung Eine relativ neue Hypothese der Genforscher lautet, dass Hunde nur einmal in Südostasien, eine andere behauptet, dass sie zweimal entstanden sind, in Europa und Ostasien. Hunde ostasiatischen Ursprungs hätten dann durch Einwandern an der Seite von Menschen die europäischen Hunde „überschwemmt“. So könne es gekommen sein, dass heute das asiatische Erbe „dominant“ in den Genen unserer modernen Hunderassen repräsentiert wird, während das genetische Erbe der frühen paläolithischen Hunde Europas beinahe zurückgedrängt wurde. Welche der beiden Hypothesen letztendlich Bestand haben wird, werden zukünftige Studien zeigen.
So weit zur genetischen und archäozoologischen Spurensuche zurück in die Anfänge der Hundwerdung. Doch nicht nur das äußere Erscheinungsbild hat sich verändert –, damit einhergehend gab es eine starke Veränderung der Fähigkeiten und Lebensweise des Hundes, bedingt durch das zunehmend enge Zusammenleben und -arbeiten mit dem Menschen. Deshalb muss parallel zur genetischen Geschichtsanalyse das Verhalten der Tiere verglichen werden, um Rückschlüsse auf die Domestikationsgeschichte ziehen zu können.
© Priamvada Mangal/Shutterstock
Was war der Vorteil für Hunde: gemeinsam jagen oder Reste fressen?
HUNDE IN DER FRÜHEN MENSCHHEITSGESCHICHTE
DAS WELLENMODELL DER DOMESTIKATION
Wenn es „Ur-Hundetypen“ also bereits als Begleiter der Jäger und Sammler im frühen Pleistozän gegeben hat, dann müssen wir die Entstehung des Hundes und damit die Anfänge der Hund-Mensch-Beziehung weit nach vorne datieren. Dies wirft natürlich Fragen auf, welche Rolle die Hunde in dieser frühen Zeit der Menschheitsgeschichte gespielt haben könnten. Die neuesten Hypothesen gehen davon aus, dass die Domestikation zunächst vom „Ur-Hund“ initiiert wurde und sich in drei Wellen vollzogen hat:
1. Selbst-Domestikation Ganz am Anfang steht die Trennung von der territorialen Lebensweise hin zur migrativen in der Nähe der Jäger und Sammler.
2. Selektion nach Verhalten Die nächste Stufe war erreicht, als der Mensch einen Nutzen in der Nähe der Tiere erkannte. In der Folge fingen die Menschen an, künstliche Selektion zu betreiben, indem zahme und friedfertige Exemplare immer näher am Menschen leben und sich fortpflanzen durften.
3. Selektion nach Funktion Die dritte Stufe stellte die Zucht bestimmter Hundetypen für die Verrichtung spezieller Aufgaben dar – ein Prozess, der wahrscheinlich bereits vor über 9000 Jahren seinen Anfang nahm.
1. WELLE DER DOMESTIKATION
„Protowolf“ wird zu „Protodog“ als Begleiter der Jäger und Sammler.
In den letzten Jahrzehnten gab es viele Theorien, wie die Trennung vom gemeinsamen Wolfsvorfahren und die „Selbst-Domestizierung“ abgelaufen sein könnte. Forscher wie Robert Wayne vermuten, dass die erste Isolation der Wölfe und Hundepopulation durch eine veränderte Lebensweise einer „Protowolfsgruppe“ entstanden sein könnte: Normalerweise bilden Wölfe Territorien, in denen sie sesshaft ihr Leben verbringen und ihren Nachwuchs aufziehen. Einige dieser „Vorwölfe“ könnten Gefallen darin gefunden haben, sich in der Nähe menschlicher Lagerstätten aufzuhalten, weil hier Abfall zu finden war. Dadurch gaben diese Tiere das sesshafte Leben auf und bewegten sich an der Seite der Jäger und Sammler stetig fort – eine erste Trennung der Reproduktion mit den anderen, sesshaften Wölfen, und damit der Beginn der Entstehung einer neuen Art, könnte so möglich geworden sein.
© Laszlo Mates/Shutterstock
Ursprüngliches, vertrautes Zusammeleben findet sich noch in vielen Kulturen.
Diese ersten „Protohunde“, so vermuten Forscher, hatten einen Selektionsvorteil, wenn sie weniger furchtsam waren und sich dadurch von den Nahrungsresten der frühen Menschen ernähren konnten (Zimen, 1992; Coppinger, 1998; Clutton-Brock, 1995; siehe FTH S. 18) oder bereits bei der Jagd kooperierten (Pörtl und Jung, 2017; siehe auch hier).
2. WELLE DER DOMESTIKATION
Selektion nach Zahmheit und Friedfertigkeit
Frauen könnten ihren Anteil an der Initialzündung zur Mensch-Hund-Beziehung haben, wie manche Forscher vermuten: Sie spekulieren, dass Mütter verwaiste Protohundewelpen adoptiert und aufgezogen haben, indem sie die noch tauben und blinden Tiere gestillt haben (Zimen, 1992). Das Aufziehen von Tieren durch Menschenmütter kann man z.B. bei den Aborigines beobachten (Savishinsky, 1983; FTH S. 19).
Da unsere Vorfahren von Prägungsvorgängen in der frühen Welpenphase wahrscheinlich wenig wussten, werden die ersten Aufzuchten von „Protohundekindern“ diesen Hypothesen nach also eher zufällig passiert sein.
Im weiteren Verlauf dieses Gedankenspiels durften von den ausgewachsenen Tieren sicher nur die weniger aggressiven und furchtsamen Individuen weiterleben. Sie dienten der Unterhaltung, halfen bei der Bewachung und Säuberung der Lagerstätten und waren eventuell bereits bei der Jagd auf Wild hilfreich – auf diese Weise könnten unsere Vorfahren weitere Vorteile im Zusammenleben mit der anderen Art erkannt haben.
So entwickelte sich über Jahrtausende hinweg eine neue Unterart der Wolfsfamilie, die fortschreitend zahmer, toleranter und besser darin wurde, menschliche Gesten und Verhaltensweisen zu lesen, sich angepasst zu verhalten und durch ein immer freundlicheres und kooperatives Wesen glänzte.
Doch damit sich die Beziehung zwischen den unterschiedlichen Arten weiterentwickeln konnte, musste am Anfang ein gewichtiger Grund für beide Spezies vorliegen, denn eigentlich besetzten sie die gleiche ökologische Nische und hätten sich auch als Nahrungskonkurrenten sehen können. Dieser Grund lag wahrscheinlich in einer vereinfachten Futtersuche und damit deutlichem Erfolg beim Nahrungserwerb.
3. WELLE DER DOMESTIKATION
Beginn der Mensch-Hund-Kooperation: Eher Jagdbegleiter als Restefresser?
Der Jagderfolg erhöht sich massiv, wenn Jäger mit Hunden zusammenarbeiten – das hat eine finnische Studie aus dem Jahr 2004 erneut zeigen können (Ruusila und Pesonen, 2004, siehe hier). Kaniden gehen Jagdgemeinschaften mit anderen Arten ein (siehe hier), für die Protohunde war der Zusammenschluss also keine neue Erfindung. Doch für die frühen Menschen schon, und zwar eine mit wahrscheinlich durchschlagendem Erfolg. Denn beim gemeinsamen Jagen in einer Gruppe von 10 Menschen erhöhen die Hunde den Jagderfolg um bis zu 50 Prozent, hat die Studie von Ruusila und Pesonen zeigen können – der Effekt war umso stärker, wenn es wenig Wild gab. Hunde spüren Wild durch ihre herausragenden Sinne sicher auf und halten es so lange fest, bis der Mensch kommt und die Beute tötet. Auch wenn die Studie in der Gegenwart erhoben wurde – die Variationen der gemeinsamen Jagd und die Arbeitsteilung werden sich seit der Frühzeit bis heute kaum geändert haben. Dieser verbesserte Jagderfolg könnte z.B. erklären, warum die Cro-Magnon-Menschen überhaupt gewillt waren, Hunde im gleichen Territorium zu tolerieren und sogar ihre Beute zu teilen. Unterstützung erfährt diese Hypothese durch das plötzliche Auftreten von Mammut-Massengräbern aus der Zeit um 40000—15000 vor Gegenwart. Wie schon erwähnt (siehe hier), vermuten Forscher wie die amerikanische Anthropologin Pat Shipmann, dass der plötzliche Jagderfolg an großen Säugern wie Mammuts nur durch eine neuartige Jagdstrategie erklärt werden könne. Da die Schädelfunde erster Hunde für den gleichen Zeitraum datiert werden konnten, vermutet die Forscherin der Universität Pennsylvania, dass Hunde maßgeblich am erhöhten Jagderfolg beteiligt gewesen sein könnten (Shipmann, 2015).
Dieses Szenario wird weiter glaubhaft durch archäologische Knochenfunde an prähistorischen Lagerfeuerstätten. Der Paläobiologe Gary Haynes hat bereits 1983 Knochen der Beutetiere auf Kauspuren von Raubtieren untersucht. Carnivoren hinterlassen sehr charakteristische Zahnspuren beim Nagen an Knochen. Entsprechend konnten an einigen der archäologischen Fundstellen nicht nur über 30000 Jahre alte Überreste der ersten Hunde entdeckt werden, sondern auch hundetypische Nagespuren an den Skelettteilen der erbeuteten Tiere. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass die „Protodogs“ mitjagten und Reste der erjagten Beutetiere fressen durften (Haynes, 1983).
Höhlenmalerei
Einen weiteren Hinweis auf die frühe Nutzung von Hunden als Jagdgefährten liefern Höhlenmalereien, die 2017 von Wissenschaftlern des Max-Planck-Institutes für Menschheitsgeschichte in Jena und Evolutionäre Anthropologie in Leipzig näher untersucht wurden. Diese Zeichnungen bieten zum allerersten Mal einen Einblick in die frühe Beziehung zwischen Mensch und Hund, denn sie dokumentieren, wie Hunde für das Hüten von Nutztieren und die Jagd eingesetzt und wahrscheinlich auch ausgebildet wurden. Die Zeichnungen befinden sich auf Felsen auf der arabischen Halbinsel Saudi Arabiens und zeigen verschiedene Alltagsszenen mit Haus-, Beute- und Raubtieren. Deutlich wird aber vor allen Dingen, dass Hunde schon vor 9000 Jahren eine herausragende Rolle im Leben der Menschen spielten.
Anders als bei Malereien in europäischen Steinzeithöhlen scheint es sich dabei nicht nur um eine symbolische Darstellung von Tieren zu handeln, sondern hier wurde auf fast 150 Zeichnungen realistisch dargestellt, wie Menschen und Hunde gemeinsam auf die Jagd gehen. Die Malereien sind damit die frühesten menschengemachten Zeugnisse einer kooperativen Zusammenarbeit von Mensch und Hund. Deutlich ist zu sehen, wie Hunde unterschiedlich eingesetzt wurden, je nachdem, welche Tiere bejagt worden sind: kleinere Beutetiere wurden von den Hunden gestellt und auch erlegt, bei großen Tieren halfen die Hunde beim Einkreisen mit, getötet wurden die Beutetiere dann vom Menschen mit Speeren. Die Jäger nutzten die Hunde also wahrscheinlich gezielt für unterschiedliche Aufgaben. Dies wird auch in der großen Zahl der abgebildeten Hunde deutlich. Die Forscher vermuten, dass diese Vielfalt an Szenen zeige, dass Hunde von den frühen Menschen in Saudi-Arabien gezielt gehalten und ausgebildet wurden. Dafür spricht, dass auf manchen Zeichnungen zu sehen ist, wie Hunde an Leinen gehalten werden. Die Forscher interpretieren es so, dass die Hunde entweder noch jung waren und das Jagen lernen mussten, oder die strichförmigen Verbindungen zwischen Mensch und Hund sollten eine besondere Beziehung symbolisieren.
© Giampaolo Cianella/Shutterstock
Diese Höhlenmalerei in den Acacus-Mountains in Lybien zeigt Menschen, die gemeinsam mit Hunden auf der Jagd sind.
Noch ist nicht sicher nachgewiesen, aus welcher Zeit diese Zeichnungen stammen, aber anhand anderer Funde und Ausgrabungen aus der Region schließen die Forscher für die Entstehung der Malereien auf einen Zeitraum von 9000 Jahren (Guagnin et al., 2017). Diese Malereien unserer Vorfahren schenken uns einen einzigartigen Einblick in die frühe Bedeutung von Hunden für den Menschen. Ähnliche Einblicke gewähren ansonsten vielleicht nur die Bestattungsrituale für Hunde, die ebenfalls eine bereits besondere Beziehung zwischen Mensch und Hund vermuten lassen können. Erstmals sind solche „Hundegräber“ bei Ausgrabungen 1200 Jahre alter europäischer Siedlungen gefunden worden (siehe FTH, S. 13), die auf eine Zeit um 12000 v. Chr. datiert wurden.
RABE-WOLF-BEZIEHUNG
Ein ähnlich kooperatives Verhalten, wie man es bei frühen Hunden und Jägern vermutet, kann man heute noch zwischen Raben und Wölfen beobachten (siehe auch hier).
Raben nisten häufig in der Nähe der Rendezvousplätze von Wölfen, über Jahre scheint sie eine soziale Beziehung zu verbinden. Durch Beobachtungen vermuten Ethologen, dass die Tiere sich individuell zu erkennen scheinen, denn sie lassen einander regelrecht am Familienleben teilhaben. So sieht man Raben und Wölfe an den Rendezvousplätzen häufig interagieren, Raben picken Wölfe in die Ruten, necken die Kaniden, diese gehen freundlich darauf ein, lassen eine geringe Distanz sogar zu ihrem Nachwuchs zu (Heinrich, 1999; Bloch, 2010).
© P.Kawecki789/Shutterstock
Die Fähigkeit, sich auf Interaktionen mit einer anderen Art einzulassen, zeigen u.a. Wölfe und Raben.
Werden die Wölfe hungrig, strecken sie sich, werden unruhig und brechen schließlich zur Jagd auf. Diese Stimmung springt dann auf die Raben über: Sie beteiligen sich an den Spielen, flattern irgendwann auf, fliegen voraus. Lautstark weisen die Vögel dann auf potentielle Beute hin, leiten dadurch die Wölfe schneller zum Ziel.
Die Fähigkeit, sich auf ein enges Zusammenleben mit einer anderen Art einzulassen, ist Wölfen also in die Wiege gelegt und wird vermutlich bei der Selbst-Domestizierung der ersten „Protohunde“ eine Rolle gespielt haben. Alle diese Erkenntnisse sprechen dafür, dass sich Protohunde im frühen Pleistozän nicht nur in der Nähe der Menschen aufhielten, sondern mit ihm bereits auf die Jagd gingen, wenn sich unsere Vorfahren auf die Suche nach Beutetieren machten.
FORSCHUNG: Jagderfolg durch Hunde
AUS DER FORSCHUNG
— Hunde erhöhen den Jagderfolg.
Vorgehen
Die Forscher verglichen die Anzahl von Elchen (Alces alces), die von vier Jagdgruppen in Finnland erlegt werden konnten. Die Jagdgruppen unterschieden sich in der Größe und darin, ob sie in Hundebegleitung jagen gingen oder nicht (Ruusila et al., 2004).
Ergebnisse
Die Gruppen mit Hund hatten einen größeren Jagderfolg, egal wie groß die Gruppe war.
Den größten Jagderfolg hatte dabei die kleinste Gruppe (< 10 Jäger) in Begleitung von Hunden – sie erlegten 56 % mehr Beute als die Gruppen ohne Hund.
In den größeren Gruppen war der Jagderfolg gleich gut, unabhängig davon, ob ein Hund anwesend war oder nicht. Erst als die Anzahl der Hunde erhöht wurde, hatte auch die Gruppe mit mehr als 10 Jägern einen gesteigerten Jagderfolg. Das heißt, die Anzahl der erlegten Tiere korrelierte mit der Anzahl der Hunde. Der Vorteil des Jagens mit Hunden hatte ein dichteabhängiges Muster: Der Nutzen steigt an, wenn die Elchdichte niedrig ist.
Fazit
Diese Ergebnisse stützen die Hypothese, dass kooperatives Jagen von Mensch und „Protohund“ ein wichtiger Faktor war im Prozess der Domestikation des Haushundes.
VERÄNDERUNG IM WESEN UND AUSSEHEN
Voraussetzung für gemeinsames Jagen ist eine relativ geringe räumliche Distanz – und das erfordert Vertrauen. Deshalb ist im Prozess der Domestikation davon auszugehen, dass es eine gezielte Selektion auf Zahmheit gegeben hat. Genau an diesen Zeitpunkt der Domestikation dockt die Hypothese der Zuchtauswahl nach Zahmheit an („Silberfuchsstudie“ von Trut et al., 2009; Hare und Tomasello, 2005; genauer in FTH ab S. 23), die in der Folge zu weiteren morphologischen und Wesensveränderungen bei Tieren führen kann.
Protodogs, die weniger furchtsam waren, hatten einen Selektionsvorteil. Dieses veränderte, zutrauliche Wesen tritt nach dieser Theorie gekoppelt mit morphologischen Veränderungen in Körperbau und Fellfarbe auf. Eine Studie französischer Wissenschaftler wollte mehr über das Aussehen steinzeitlicher Hunde erfahren und hat sich auf die Untersuchung von Genen konzentriert, die Fellfarben bestimmen. Dazu analysierten die Genetiker um Morgane Ollivier von der Universität Lyon das Genmaterial in altertümlichen Kanidenknochen gezielt nach entsprechenden Hinweisen (siehe hier). Das Ergebnis: Bereits vor 11000—8000 Jahren trugen die „Protohunde“ kein schlichtes grau als Fell mehr, sondern hatten bereits ein mehrfarbiges Haarkleid (Ollivier et al., 2013).
Verschiedene Farben, hängende Ohren oder geringelte Ruten können ein Hinweis auf Domestikation und damit ein verändertes Sozialverhalten sein. Nach dieser Hypothese (Trut et al., 2009; Hare und Tomasello, 2005) führt die Zucht auf Zahmheit parallel zu einer Veränderung des Erscheinungsbildes und öffnet die Türen für die Entwicklung weiterer neuer Fähigkeiten (siehe hier), so wie wir das auch bei anderen domestizierten Tieren beobachten können.
FORSCHUNG: Fellfarben
AUS DER FORSCHUNG
— Fellfarben prähistorischer Hunde
Die verschiedenen Fellfarben prähistorischer Hunde könnten ein Hinweis auf frühe Domestikationsprozesse sein.
Vorgehen
Die Forscher nutzten in dieser Studie eine paläogenetische Annäherung, um die Vielfalt der Fellfarben-Variationen in alten, eurasischen Hunde- und Wolfspopulationen ermitteln zu können (Ollivier et al., 2013). Dazu konzentrierten sie sich auf die Analyse von DNA-Fragmenten, die aus Knochenfunden von 15 prähistorischen Hunden und 19 Wölfen extrahiert werden konnten.
Die Kanidenfossilien stammten von 14 unterschiedlichen archäologischen Ausgrabungsstätten aus Europa und Asien und waren zwischen 12000 (Ende des oberen Paläolithikums) und 4000 Jahre (Bronzezeit) alt. Im Fokus der Analyse standen dabei zwei Gene, die Fellfarben kontrollieren: Mc1r (Melanocortin-1-Rezeptor) und CBD103 (canine-β-defensin).
Ergebnisse
Dabei konnten die Forscher schon für diese frühe Phase der Domestikation die Präsenz der Beta-defensin-melanistin-Mutation (CDB103-K-locus) nachweisen. Sie konnten zeigen, dass ein dominantes Allel, das für Schwarzfärbung verantwortlich ist (CBD103), aber auch die Variante, die die helle Farbe verleiht, bereits am Anfang des Holozäns, also vor 10000 Jahren, bei den frühen Hunden vorkamen.
Fazit
Die Ergebnisse unterstreichen die genetische Vielfalt, die prähistorische Hunde bereits gehabt haben müssen. Diese Diversität, so vermuten die Forscher, stammt nicht nur aus dem Genpool des Wolfes. Die Vielgestaltigkeit könnte auch dem bekannten Effekt zugrunde liegen, der eintritt, wenn Tiere aus dem Prozess natürlicher Selektion herausgenommen werden. Durch eine kleinere Population und die veränderten Lebensbedingungen bekommen Genmutationen wie „Weiß“ in der Fellfarbe die Chance, sich durchzusetzen, ein Merkmal, das in „freier Wildbahn“ meist von Nachteil für das Individuum wäre.
UNTERSCHIEDE VON WOLF UND HUND
Einige Institute haben in den letzten Jahren Hunde und Wölfe unter vergleichbaren Bedingungen mit der Flasche aufgezogen und dann in verschiedenen Lebensphasen mit gleichen Aufgabenstellungen konfrontiert. Dabei wurde erforscht, wie die beiden nah verwandten und doch so unterschiedlichen Spezies Probleme lösen. Kerninteresse dieser vergleichenden Studien ist immer, eine Veränderung im Verhalten wissenschaftlich zu erfassen, zu dokumentieren und sich dadurch den Ablauf der Domestikation besser vor Augen zu führen.
© Heike Schmidt-Röger/Kosmos
Wölfe sind mehr mit sich selbst zufrieden, für Hunde ist die Zuwendung durch den Menschen sehr attraktiv.
Die Tradition der vergleichenden Verhaltensforschung auf diesem Gebiet geht viele Jahrzehnte zurück; Eberhard Trumler (Trumler, 1984) und Erik Zimen (Zimen, 1987) hielten Wölfe und Hunde in Gehegen und studierten das gezeigte Verhalten. Dabei konnten durchaus spannende Beobachtungen gemacht werden, was jedoch in verstärkter Weise bei beiden Spezies auftrat, war – wie wir heute wissen – eine erhöhte Aggressionsbereitschaft in der Gruppe. Durch eine strikte Hierarchie von oben nach unten und sehr häufigen agonistischen Auseinandersetzungen in den Gehegen, führten diese Studien leider auch zu der Annahme, dass Hunde gern die Herrschaft im Rudel an sich reißen und deshalb mit Härte nach dem „Dominanzmodell“ unterdrückt, erzogen und dem Menschen strikt unterworfen werden müssen. Heute wissen wir unter anderem durch Langzeit-Freilandstudien von David Mech (vgl. Mech, 2000) oder Günther Bloch (vgl. Bloch, 2012), wie selten ernsthafte, aggressive Auseinandersetzungen bei Wölfen innerhalb der Gruppe stattfinden. Das Familienleben ist eher geprägt von Harmonie und Gelassenheit; die Eltern haben es schlicht nicht nötig, beständig ihre gehobene Stellung deutlich zu machen. Wer mit einer untergeordneten Rangposition ein Problem hat, wandert ab und gründet eine eigene Familie. So einfach ist das, wenn keine Gehegezäune einen am Weglaufen hindern. Im Institut für Haustierkunde in Kiel untersuchte Dorit Feddersen-Petersen viele Jahrzehnte lang das abweichende Verhalten von Hunden und Wölfen in Kleingruppen. Dabei war der Kontakt zum Menschen bei beiden Spezies limitiert. Trotzdem zeigten sie ein sehr unterschiedliches Verhalten, insbesondere in Bezug auf den Menschen: Die Hunde unterbrachen sofort jede Interaktion untereinander, sobald ein Pfleger oder wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zaun zu sehen war, und versuchten, zum Menschen Kontakt herzustellen. Wölfe hingegen zeigten in vergleichbaren Situationen kaum Reaktion – sie waren eher mit sich selbst zufrieden (vgl. Feddersen-Petersen, 2007). Die Erkenntnisse aus Kiel wurden von Studien aus Amerika ergänzt, in denen Wölfe mit der Flasche aufgezogen und ihre Fähigkeiten mit denen von Hunden verglichen wurden (vgl. Frank, Hasselbach und Littleton, 1989). Allerdings wurden diese Untersuchungen immer nur mit einzelnen Individuen durchgeführt, sodass keine statistisch relevanten Aussagen getroffen werden konnten. Anfang 2000 griffen Forscher aus Budapest deshalb die Vergleichsstudien wieder auf (Gácsi et al., 2005). Sie ließen dieses Mal 13 Wolfs- und 11 Hundewelpen mit der Flasche aufziehen und unter identischen Bedingungen in der menschlichen Umgebung sozialisieren. Ab dem frühen Alter von drei bis vier Wochen wurden mit den Hunden und Wölfen Vergleichstests durchgeführt, um zu sehen, wie unterschiedlich die beiden Spezies in seltsamen Situationen reagierten und wie wichtig für sie der Mensch als Bindungspartner in diesen Versuchen ist. Dabei wurde geschaut, wie sich die Welpen beider Spezies im Alter verschiedener Lebenswochen gegenüber neuen Objekten, fremden Menschen und Hunden verhielten. Das Ergebnis: Hundewelpen zeigten weniger Meideverhalten und Aggression gegenüber Menschen, gleichzeitig stieg die Anzahl der Kommunikationssignale wie Vokalisation, Schwanzwedeln und Ansehen – dies könnte eine Basis für positives Feedback in der interspezifischen (zwischenartlichen) Mensch-Hund-Beziehung bewirkt haben (Gácsi et al., 2005; Topál et al., 2005). Interessanterweise konnte auch in der Silberfuchsstudie gezeigt werden, dass mit dem Grad der Zahmheit das Schwanzwedeln und Beobachten menschlicher Handlungen vermehrt gezeigt wurde (Hare et al., 2005).
DOMESTIKATIONSBEDINGTE FÄHIGKEITEN
Diese Verhaltensunterschiede wurden in den letzten Jahren intensiv von vielen Forschern, besonders in Budapest (https://familydogproject.elte.hu/) und Wien (https://www.wolfscience.at/) untersucht (siehe auch FTH ab S. 20).
Eine Domestikationshypothese der Biologen ist, dass Menschen bestimmte Fähigkeiten selektiert haben:
eine reduzierte Angst- und Aggressionsbereitschaft im Umgang mit Menschen (Hare et al., 2005),
ein zahmeres Temperament (Hare et al., 2012),
ein erhöhtes Interesse am Menschen (Miklósi et al., 2003),
Menschen als soziale Partner zu akzeptieren (Gácsi et al., 2009).
Diese abweichenden Verhaltensweisen zwischen Hund und Wolf werden vor allen Dingen auf den Einfluss von Selektion im Zuge der Domestikation zurückgeführt und haben letztendlich zu dem geführt, was das Hund-Mensch-Team heute so erfolgreich macht: Hunde zeigen eine erhöhte soziale Toleranz und Bindungsbereitschaft an den Menschen (Miklósi und Topal, 2013) und tragen das Potenzial für Kooperation mit uns auf sehr hohem Niveau in sich (Range und Viranyi, 2015). Doch besonders eine neue, bislang unbeachtete Verhaltensveränderung könnte für die „Hundwerdung“ von entscheidender Bedeutung gewesen sein: das Sozialspiel mit dem Menschen. Eine Forschergruppe um Christina Hansen Wheat (2018) von der Universität Stockholm hat sich den Verhaltensveränderungen gewidmet, die im Zuge der Domestikation aufgetreten sein könnten. Dazu verglich sie das Verhalten von Hunden mit Wolf-Hund-Hybriden in standardisierten Verhaltenstests. Interessanterweise konnten keine großen Unterschiede in den Bereichen Geselligkeit und Aggressionsverhalten festgestellt werden. Stattdessen wurde deutlich, dass Hunde, wie vermutet, weniger Furcht in merkwürdigen Situationen zeigten, aber – und das wurde in diesem Ausmaß nicht erwartet – viel mehr Freude an der spielerischen Interaktion mit Menschen hatten als die Hybriden. Die Ergebnisse der Studie machen deutlich, dass nicht nur ein reduziertes Furchtverhalten in merkwürdigen Situationen, sondern besonders auch das Spielverhalten mit Menschen ein wichtiger Selektionsfaktor im Zuge der Domestikation des Hundes gewesen sein könnte.
Hunde haben sich im Zuge ihrer Stammesgeschichte also nicht nur äußerlich stark verändert. Einhergehend damit hat auch ein Wandel der kognitiven und sozialen Fähigkeiten in der Interaktion mit Artgenossen und Menschen und im Problemlöseverhalten stattgefunden, in denen sich Wolf und Hund heute teilweise sehr deutlich unterscheiden.
© Anna Auerbach/Kosmos
Auch beim Kontaktverhalten mit Artgenossen hat es auf dem Weg zur „Hundwerdung“ eine Veränderung gegeben: Fremden Artgenossen gegenüber zeigen sich Hunde meist sehr viel toleranter als Wölfe.
GENETISCHE GRUNDLAGEN FÜR UNTERSCHIEDE
In den letzten Jahren haben sich Genetiker auf die Teile der genetischen Ausstattung der beiden Kanidenarten Wolf und Hund konzentriert, die sich zwischen den beiden Spezies unterscheiden. Dabei wurden Abweichungen in Genregionen gefunden, die das Verhalten beeinflussen und eine eindeutige Trennung von Wolf und Hund erkennbar machen. So entdeckte eine österreichisch-ungarische Gruppe um Zsofia Banlaki, dass es im epigenetischen Code von Hundezellen Veränderungen gibt, die das Temperament beeinflussen. Diese Regionen standen also eindeutig unter dem Einfluss des Domestikationsprozesses (Banlaki et al., 2017).
Auch Daniela Pörtl und Christoph Jung sehen in der genetisch bedingten Veränderung des Stresshaushaltes einen wesentlichen Grund für die Annäherung zwischen Wolf und Mensch. Wolfclans mit niedrigerem Cortisolpegel war es laut der Autoren möglich, ihre sozialen Fähigkeiten auf Interaktion mit Menschen auszuweiten (Pörtl und Jung, 2017). Andere Studien zeigen, dass sich Erbregionen verändert haben, die die Anzahl von Oxytocin-Rezeptoren und die Umsetzung von Dopamin im Gehirn beeinflussen und dadurch entscheidende Verhaltensveränderungen im sozialen Verhalten Menschen gegenüber bewirken (siehe auch hier und hier). Aber die Suche offenbarte auch die Erhöhung einer Anzahl von Genvariationen, die Stärkeverdauung und Nutzung von Fetten ermöglichen. Die Variationen in diesen beiden Bereichen (Verhalten und Verdauung) scheinen entscheidend dazu beigetragen zu haben, dass Hunde mit Menschen zusammenleben können.
© Anna Auerbach/Kosmos
Wahrscheinlich wurde auch die Freude am Sozialspiel mit dem Menschen im Zuge der Domestikation selektiert.
FOLGEN DER GENVERÄNDERUNG
Der „hypersoziale Hund“
Die meisten Hunde freuen sich nicht nur über ihre eigenen Menschen, sondern auch über Besuch von Fremden. Diese extreme Freundlichkeit vieler Rassen mag manch einen nerven, aber sie gehört zum Wesen von Labrador & Co. und unterscheidet den Hund damit deutlich vom Wolf, der fremden Artgenossen und Menschen oder neuen Situationen eher skeptisch gegenübersteht. Wir wissen bereits einiges über die Zusammenhänge zwischen Zahmheit und morphologischen Veränderungen in Fellfarbe, Schnauzenform oder Ohrenstellung (siehe hier). Doch die genetischen Grundlagen für die Verhaltensunterschiede zwischen Wolf und Hund lagen bislang noch weitgehend im Dunkeln.
Einige Studien haben untersucht, wie die Vielgestaltigkeit des Gens, das die Oxytocin- Rezeptorzellen kodiert, die Bindung an Menschen oder Veränderungen im Polymorphismus des Dopamin-Gens das Lernverhalten beeinflussen könnte. Eine neue Studie der Princeton Universität rund um die amerikanische Forscherin Bridgett vonHoldt hat sich mit genetischen Veränderungen beim Hund befasst, die extremes, soziales Verhalten auslösen (vonHoldt et al., 2017). Denn diesesfür Hunde typische, „überfreundliche“ Verhalten kommt manchmal auch bei Menschenvor: Das sogenannte „Williams-Beuren-Syndrom“ programmiert das Sozialverhaltender betroffenen Menschen derart, dass dieseextrem freundlich auftreten. Die Genträger kennen keine Angst vor Fremden, sind sehr fürsorglich und vergeben sofort jeden Streit. Diese „Hypersoziabilität“ sorgt dafür, dass diese „Patienten“ pathologisch freundlich sind. Ein Charakteristikum, das bei entsprechender Sozialisierung auch auf viele Hunderassen zutrifft. Bridgett vonHoldt hat nach genau dieser Genveränderung gezielt im Genom bei Hunden gesucht, um zu überprüfen, ob das extrem freundliche Verhalten von vergleichbaren Genen ausgelöst wird. VonHoldt verglich zunächst die Freundlichkeit und soziale Aufgeschlossenheit von 18 Hunden mit der von 10 Wölfen, die unter vergleichbaren Bedingungen von Menschen aufgezogen worden waren. Wie schon in anderen Studien gezeigt werden konnte (Gácsi et al., 2005, S. 29), verbrachten Hunde mehr Zeit damit, einen ihnen fremden Menschen anzusehen und mit ihm zu interagieren, als Wölfe. Das zeigte, laut der Forscher, dass Hunde sozialer gegenüber den Menschen handelten als Wölfe. Parallel dazu analysierten die Wissenschaftler die DNA dieser Tiere und weiterer Hunde und Wölfe. Dabei wurde deutlich, dass es drei Gene gab, die mit den gegenüber Menschen gezeigten sozialen Verhaltensweisen in Verbindung gebracht werden konnten: BSCR17, GTF2I und GTF2IRD1. Alle drei Gene sind Genetikern durch das „Williams-Beuren-Syndrom“ beim Menschen gut bekannt. Das hypersoziale Wesen der Patienten kommt durch das Löschen eines Abschnitts auf dem Chromosom Nr. 7 zustande, davon sind insgesamt 29 Gene betroffen. Das Resultat der genetischen Vergleichsstudie im Hundegenom: Auf dem Hunde-Chromosom Nr. 6 findet sich das gleiche Phänomen wieder! Die Genetiker schließen daraus, dass nur wenige Gene für die Veränderung im Verhalten verantwortlich sind und die Wesensveränderung des Hundes neu betrachtet werden müsste: Demnach könnte das erhöhte freundliche Verhalten dafür gesorgt haben, dass Hunde mehr Zeit in der Nähe von Menschen verbracht haben und sich bevorzugt miteinander verpaaren durften – und damit munter die Genveränderung an ihre Nachkommen weitervererbt haben.
Verdauung von Stärke
Im Zuge der Domestikation sind weitere Gen-Mutationen für Hunde von Vorteil gewesen. So scheint eine wichtige Fähigkeit zu sein, Kohlenhydrate verdauen zu können. Eine Energiequelle, die Wölfe fast gar nicht, die meisten Hunde ohne Probleme nutzen können.
Die Umstellung vom Dasein als Jäger und Sammler zu einer sesshaften Lebensweise war ein revolutionärer Entwicklungsschritt in der Geschichte der Menschheit und hatte viele weitere Entwicklungen und Umwälzungen der Lebensweise und sozialen Organisation zur Folge. Hunde erlebten diese massive Veränderung an der Seite der Menschen und mussten sich anpassen. Ein wesentlicher Schritt dabei war die Fähigkeit, sich der verändernden Ernährungsweise des Menschen anzupassen, denn mit der Entstehung des Ackerbaus nahm der Stärkeanteil in der Nahrung des Menschen rapide zu. Der Hund als Abfallverwerter musste ebenfalls in der Lage sein, Stärke zu verdauen – die Folge war wahrscheinlich ein starker Selektionsdruck auf Hunde, die genetisch darauf vorbereitet waren. Nur Hunde, die in der Lage waren, ihre Ernährungsweise von fleischlastig zu Pflanzenkost umzustellen, konnten sich weiterhin in der Nähe von Menschen aufhalten und sich zu den Hunden weiterentwickeln, die wir heute an unserer Seite haben.
© Capuski/istock
Die Fähigkeit, Stärke zu verdauen, war ein wichtiger Schritt in der Domestikation.
In jüngeren Studien haben sich Genetiker besonders dafür interessiert; sie untersuchten die genetischen Unterschiede zwischen Hunden und Wölfen in Bezug auf die Verdauung. Der schwedische Evolutionsgenetiker Erik Axelsson analysierte dazu die DNA von 60 Hunden aus 14 verschiedenen Rassen und 12 Wölfen aus aller Welt auf die Existenz eines „Stärke-Gens“ (Axelsson et al., 2013).
Das Ergebnis: Hunde sind optimal an die Nutzung einer kohlenhydratreichen Nahrung angepasst. Sie haben mehr Kopien des Amylase-Gens AMY2B, welches ein Enzym produziert, das Stärke in leicht verdauliche Zucker umwandelt. Andere genetische Varianten ermöglichen die Herstellung von Enzymen, die es ihnen ermöglichen, die Zuckerform Maltose in die von Zellen leicht in Energie umsetzbare Glukose umzuwandeln. Hinzu kommt, dass Hunde durch weitere genetische Veränderungen in der Lage sind, diese Glukose in ihre Zellen aufzunehmen.
Es waren also zwei Schlüsselqualifikationen,die dafür sorgten, dass Wölfe zu Hunden werden konnten: die Selbst-Domestikation durch die zunehmende Zahmheit und die Anpassung an die stärkereiche Ernährungzur Zeit der Sesshaftwerdung des Menschen.
SOZIALE ÖKOLOGIE
Verhaltensdifferenzen und abweichende Fähigkeiten zwischen Wolf und Hund wurden bislang meist als ein Ergebnis der menschlichen Selektion auf bestimmte Anlagen erklärt, wie z.B. hypersoziales Verhalten, Zahmheit oder eine Zunahme der Aufmerksamkeit gegenüber Menschen.
Diese Herangehensweise kritisieren zwei der führenden Kanidenforscherinnen unserer Zeit, Friederike Range und Sarah Marshall-Pescini (2017), in einer Stellungnahme in der Zeitschrift „Behavioural Sciences“. Sie fordern dazu auf, besonders die veränderten Lebensbedingungen der beiden Arten zu untersuchen, um die veränderten Verhaltensweisen voll und ganz verstehen zu können.
Denn nicht nur in ihrem Verhalten gegenüber Menschen unterscheiden sich Hunde und Wölfe. Besonders auffällige Unterschiede gibt es im sozialen Verhalten mit Artgenossen und bei der Nahrungssuche. Range & Marshall-Pescini stellen die Hypothese auf, dass nicht nur die Selektion das Verhalten von Hunden verändert hat, sondern auch die veränderte Lebensweise Einfluss auf Hundeverhalten nimmt. Diese Aspekte sollten deshalb immer bei der Analyse oder der Erstellung neuer Forschungsstudien berücksichtigt werden.
Nur so könnten die Unterschiede im Verhalten gegenüber Artgenossen und in der sozialen Organisation vollständig verstanden werden, die sich mittlerweile zwischen Wolf und Hund ergeben haben.
Genau das macht die vergleichende Verhaltensforschung nämlich normalerweise: Sie untersucht Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen Arten, indem sie besonders auch die Ökologie, also Lebensraumnische, und die soziale Organisation der Tiere vergleicht.
Genau diese Lebensraumnische hat sich beim Hund im Zuge der Domestikation stark verändert –, was starke Veränderungen in seiner sozialen Organisation nach sich gezogen hat. Um erkennen zu können, warum sich die Lebensweise von Hunden, und dadurch ihre sozialen Fähigkeiten, so stark verändert haben könnte, analysierten und verglichen die Forscherinnen aktuelle Studien rund um die Ökologie des Hundes. Besonders hilfreich waren dabei neue Studien zum Leben von Streunerhunden, die verschiedene, wahrscheinlich ursprünglich anmutende Nahrungserwerbsstrategien an den Tag legen und lockere soziale Gruppen bilden. Dabei konnten die Forscherinnen deutliche Wechselwirkungen zwischen Futtererwerb und verändertem Sozialverhalten sichtbar machen, die sie als „soziale Ökolgie“ der Hunde bezeichnen.
© Svetlanais/istock
Studien an Streunerhunden bringen neue Erkenntnisse.