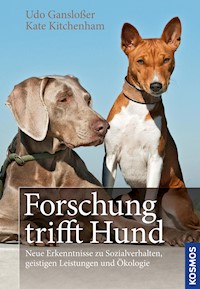36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Franckh-Kosmos Verlags-Gmbh & Co. KG
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Bindung, Dominanz, Prägung und Rangordnung – was sagen diese Begriffe eigentlich aus und welche Verhaltensweisen stecken dahinter? Der Zoologe Dr. Udo Gansloßer gibt Einblicke in die faszinierende Welt der Verhaltensforschung. Leicht verständlich erklärt er verhaltensbiologische Zusammenhänge anhand der neuesten Forschungen zu Affen, Elefanten oder Meerschweinchen und zeigt, dass viele davon auch für Hunde gelten. Trainer und Halter finden hier wertvolles Wissen, um die Hundeerziehung optimal zu gestalten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 627
Ähnliche
Dieses E-Book ist die digitale Umsetzung der Printausgabe, die unter demselben Titel bei KOSMOS erschienen ist. Da es bei E-Books aufgrund der variablen Leseeinstellungen keine Seitenzahlen gibt, können Seitenverweise der Printausgabe hier nicht verwendet werden. Stattdessen können Sie über die integrierte Volltextsuche alle Querverweise und inhaltlichen Bezüge schnell komfortabel herstellen.
ZU DIESEM BUCH
Im Jahr 2007 erschien der Vorläufer dieses hier vorliegenden Buches unter dem Titel „Verhaltensbiologie für Hundehalter“, im Privatjargon sehr schnell als „Schweinchenbuch“ bekannt. Seitdem hat sich in der Hundeforschung sehr viel getan, die Zahl der Veröffentlichungen rund um verhaltensbiologische und verwandte Themengebiete des Haushundes nimmt von Woche zu Woche zu.
Zugleich wurde, vor allem auf Veranstaltungen für Hundetrainer/innen, immer wieder der Mangel eines einschlägigen Lehrbuches thematisiert. Daher erschien es naheliegend, aus der ursprünglichen „Verhaltensbiologie für Hundehalter“ ein vertieftes und möglichst alle relevanten Bereiche der Verhaltensbiologie umfassendes Lehrbuch für Hundetrainer zu erstellen.
UNTERSUCHUNGEN, NICHT NUR AM HUND
Der Hund ist zunächst ein Säugetier, sodann gehört er zur Ordnung der Carnivora, also der Beutegreifer, und dann ist er Angehöriger der Familie der Canidae. Daraus folgt bereits, dass die zoologische Verhaltensforschung ausgesprochen wichtig ist, wenn wir sein Verhalten verstehen und gegebenenfalls auch trainerisch oder erzieherisch beeinflussen wollen.
Wegen der bereits angesprochenen schnellen und bisweilen auch geradezu explosiven Entwicklung unseres Wissens über das Verhalten des Haushundes, erschien es deshalb auch wichtig, Kapitel und Befunde in das Buch einzubringen, über die es derzeit noch keine aktuellen Erkenntnisse speziell aus der Hundeforschung gibt. Möglicherweise kann nämlich bereits in der nächsten Woche eine Veröffentlichung erscheinen, die auch solche Aspekte an Haushunden untersucht und/oder sogar bestätigt.
Dementsprechend ist dieses Buch nach wie vor keine Verhaltensbiologie des Hundes, sondern eine Verhaltensbiologie, die mit möglichst vielen Hundebeispielen die allgemeinen Grundsätze der genannten Wissenschaft umreißt und umschreibt. Dort, wo es eben keine Hundebeispiele gibt, ist es aber für Hundetrainer genauso wichtig, allgemeine Gesetzmäßigkeiten zu kennen, auch wenn diese bisher nur an anderen Säugetieren untersucht wurden.
Ein Schwerpunkt des Buches liegt auch auf den verhaltensökologischen und evolutionsbiologischen Betrachtungen. Gerade diese kommen nämlich meistens in der sonst eher lernpsychologisch orientierten Trainerliteratur zu kurz.
© Shutterstock/dezy
Große und kleine Hunde können durchaus in einer Familie unterschiedliche Rollen und damit unterschiedliche Tätigkeiten erfüllen.
MODERNE ERKENNTNISSE?
In den letzten Jahren ist, nicht zuletzt im Zusammenhang mit der insgesamt doch sehr unglücklichen Trainerzertifizierung, sehr viel von moderner wissenschaftlicher Erkenntnis die Rede, auf der Hundetraining und Hundeerziehung aufbauen muss, um den Genehmigungsvoraussetzungen zu entsprechen. Leider verstehen viele unter diesen sogenannten modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen letzten Endes Erkenntnisse, die vor 50 Jahren im Zusammenhang mit sehr streng reglementierten Laborexperimenten gewonnen wurden. Der enormen Komplexität sozialen Verhaltens, aber auch anderer höherer geistiger Leistungen, sowie den emotionalen Voraussetzungen, über deren Existenz auch im Hundegehirn wir heute Bescheid wissen, werden diese einfachen, mechanistischen Lernmodelle einfach nicht gerecht. Niemand würde doch einen Ernährungsplan, der nur auf Reagenzglasversuchen zur Enzymaktivität beruht, oder gar eine nur darauf basierende Therapie komplexer Verdauungsbeschwerden als „auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhend“ akzeptieren!
Deshalb möchte ich mit diesem Buch das Bewusstsein für die Komplexität der Verhaltensbiologie wecken, die viel stärkere Einflüsse auf die Ergebnisse von Trainings- oder gar Erziehungsprozessen hat. Die Zusammenhänge mit Lebensweise, Lebensgeschichte und Haustierwerdung sollten immer im Blick behalten werden.
Fürth,
Udo Gansloßer
MODERNE VERHALTENSBIOLOGIE
— Grundlagen und neue Ansätze
© Shutterstock/dezy
ÜBERPRÜFUNG EINES VERHALTENS
Verhalten zu definieren, mag trivial erscheinen. Kappeler (2006) zitiert einige Versuche dazu, am besten finde ich noch Folgendes:
„Verhalten ist das, was tote Tiere nicht mehr tun.“
Weniger leicht zu umreißen ist, was die Verhaltensbiologie oder Ethologie tut. Denn es gibt eine ganze Reihe von Wissenschaften, von der Psychiatrie bis zur Soziologie, die sich mit dem Thema Verhalten beschäftigen. Das spezifisch Biologische an der Ethologie muss also schon genauer beschrieben werden. Richtungsweisend dafür war eine Arbeit von Nico Tinbergen (1963), in der er erstmals seine inzwischen berühmt gewordenen vier Fragen als Forschungsrahmen der Verhaltensbiologie aufstellte (siehe hier).
Erst wenn alle vier Fragen von Tinbergen fürein Merkmal, sei es Verhalten, Organ oder Aussehen eines Tieres beantwortet sind, könnte man dieses als erklärt betrachten.
BESCHREIBUNG EINES PHÄNOMENS
Vorausgehen muss jedoch eine ganze Menge an Vorarbeit: Zunächst gilt es, das zu erklärende Phänomen exakt, umfassend und so interpretationsarm wie möglich zu beschreiben. Diese Beschreibung ist eine notwendige Voraussetzung für die wissenschaftliche Erklärung. Doch allein durch Beschreiben und Begriffsbildung ist noch nichts erreicht.
Schon die Beschreibung des Verhaltens ist ausgesprochen schwierig, wenn man es wirklich exakt definieren will. Das sichtbare Verhalten sollte in messbare Einheiten zerlegt werden. Es ist nicht nur die Struktur jedes Verhaltens zu erfassen, sondern auch die Latenz (Zeitabstand zu vorherigem Verhalten des äußeren Ereignisses), die Dauer, die Häufigkeit und wenn möglich die Intensität (Kappeler, 2006; Wehnelt und Beyer, 2002). Und schließlich gibt es, sobald man diese Beschreibungen für jedes erkennbare Verhalten erstellt hat, verschiedene Aufzeichnungsmethoden.
BESCHREIBEN, NICHT INTERPRETIEREN!
Elemente sollten bei Beschreibungen immer neutral sein („Kopf hoch bei gespitzten Ohren“), nicht interpretierend („Überlegenheitsgeste“).
Erst wenn z. B. die Statistik zeigt, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Hund B, nachdem Hund A dieses Verhalten gezeigt hat, jenen Platz verlassen oder sonstige eigene Interessen nicht ausüben wird, darf man festlegen, dass dieses Verhalten die Überlegenheit von A auszudrücken scheint. Der statistische Wahrscheinlichkeitswert sowie die Stichprobe, also auf wie vielen Beobachtungen meine Aussage beruht, sollten angegeben sein! Ich überlasse es den Lesern, mit Hilfe dieser Qualitätskriterien die einschlägigen Hundeverhaltenstheorien genau zu überprüfen.
Die eingehende Beschreibung der Verhaltenselemente, die eine Tierart zum Besten gibt, wird als Ethogramm bezeichnet (siehe hier). Hat man diese Beschreibungen ausführlich und wertneutral erstellt, kann im nächsten Schritt die Einteilung in die sogenannten Funktionskreise erfolgen. Die Häufigkeit und die Richtung der Verhaltensweisen festzuhalten und hinterher statistisch auszuwerten, ist noch vergleichsweise einfach, wenn auch zeitaufwendig. Ein nahezu vollständiges Ethogramm des Hundes findet sich z. B. bei Barbara Handelman (2010).
ETHOGRAMM
Ein Ethogramm ist die vollständige Beschreibung aller Verhaltenskategorien, die eine Tierart zeigt, und muss daher zu der Erstellung mit einer langwierigen Beobachtung möglichst vieler Individuen, unter möglichst vielen verschiedenen Bedingungen bearbeitet werden.
Beispiele für ein Ethogramm
Anstupsen (ANST) (Nose Nudge) (E) Ein relativ sanfter aufwärts gerichteter Schubser mit der Nase gegen einen Menschen oder einen anderen Hund. Dies kann an verschiedenen Körperteilen geschehen. Schnell ausgeführte Stupsbewegungen mit der Schnauze haben einen hohen Spielaufforderungscharakter.
Mäuselsprung (MS) (Pounce) (E) Plötzlich auf ein sich bewegendes kleines Beute-tier stürzen. Es kann auch auf ein Geraschel außer Sicht gesprungen werden. Typisch für diesen Bewegungsablauf ist der 45°-Sprung bei der Mäusejagd. Das Ergriffene wird häufig mit dem Maul festgehalten.
FUNKTIONSKREISE NACH TEMBROCK
Schwieriger wird es, wenn es darum geht, den Verhaltensweisen Bedeutungen, also Funktionen z. B. im Zusammenleben der betreffenden Tiere, zuzuordnen. Hier helfen uns nur ein hoher Arbeitsaufwand und die Statistik. Der erste Schritt besteht darin, Verhaltenselemente aus dem Katalog herauszusuchen, deren Bedeutung unbestritten ist. Zum Beispiel ein ganz heftiges, ungehindertes Zubeißen, das man sicher als „aggressiv“ bezeichnen darf (oder eben im Zusammenhang des Beutefangs). Im nächsten Schritt werden Verhaltenselemente, die sich in der unmittelbaren Umgebung dieser eindeutig zuzuordnenden Zentralelemente immer wieder finden lassen, der gleichen Bedeutung zugeordnet. So kann ein Gesichtsausdruck, der immer vor diesem Zubeißen im sozialen Zusammenhang stattfindet, als Drohsignal, und ein lautes Kreischen, das ein Tier immer dann äußert, wenn es vor einem Artgenossen schnell wegläuft, als submissive Vokalisation interpretiert werden. Durch das Heraussuchen von nicht zufälligen, sondern häufiger als statistisch zu erwartenden Koppelungen und Aneinanderreihungen von Verhaltenselementen, kann eine gemeinsame Bedeutung identifiziert werden.
Der Begriff der Funktionskreise, im verhaltensbiologischen Sinn, wurde von dem früheren Berliner Verhaltensforscher Günter Tembrock eingeführt (Tembrock, 1982). Tembrock unterteilt die Verhaltensweisen innerhalb der Funktionskreise noch weiter. Er geht davon aus, dass die Grundlage der Funktionskreise das motivierte Verhalten ist, das mit inneren Ungleichgewichten zusammenhängt. Die Motivationen führen dann zum Auftreten arttypischer Verhaltensmuster, die jedoch durchaus auch individuelle Züge tragen können. Im Idealfall wird mit dem Vollzug dieser Verhaltensmuster das innere Ungleichgewicht eingeschränkt oder behoben, und das innere Gleichgewicht wieder hergestellt. Der Handlungsvollzug selbst, oder die Wirkung der Handlung, liefern eine negative Rückkopplung zur Motivation. So ist zumindest die allgemeine Überlegung. Jedoch gibt es, wie wir gerade im Bereich des aggressiven Verhaltens sehen werden, durchaus auch Fälle, in denen der Vollzug der Handlung zu einer Steigerung der Motivation führen kann (siehe hier).
© Shutterstock/corbac40
Die Abbildung, aus Tembrock 1982, zeigt verschiedene Elemente des aggressiven Verhaltens als Beispiel für zeichnerische Darstellung eines Verhaltenskreises bzw. einzelner Ethogrammelemente.
DREIPHASIGES MODELL
Im Allgemeinen findet die Ausführung der Verhaltensweisen, so Tembrock, in einem dreiphasigen Modell statt:
Zunächst erfolgt das orientierende Verhalten, das auch als Appetenzverhalten I bezeichnet wird.Danach folgt das von Tembrock als Appetenzverhalten II bezeichnete orientierte Verhalten.Schließlich folgt die Endhandlung, die, so das Tembrocksche Modell, das Verhalten dann auch beendet.AUFSTELLEN VON FUNKTIONSKREISEN
Nehmen wir an, Sie interessieren sich dafür, in welcher Reihenfolge die Menschen in unserem Kulturkreis normalerweise die verschiedenen Arten von Speisen zu sich nehmen. Sie setzen sich also mit einer Strichliste in ein Restaurant, in die jedes Mal eingetragen wird, wenn ein Mensch eine bestimmte Speise bestellt. Im Laufe der Zeit füllt sich die Liste z. B. dort, wo zunächst eine Suppe, dann ein Fischgericht, dann ein Fleischgericht und schließlich eine Süßspeise bestellt werden. Nur selten wird ein Mensch zunächst die Süßspeise und dann die Suppe bestellen. Durch eine statistische Auswertung, die als Sequenzanalyse bezeichnet wird, kann man schließlich berechnen, wie häufig welche der verschiedenen Speisen, nach welcher anderen bestellt wurde und daraus eine statistische Koppelung errechnen. Sobald diese statistische Koppelung häufiger als vom Zufall zu erwarten auftritt, können die beiden Elemente einer gemeinsamen Funktion zugeordnet werden. Auch Speisen, die einander gegenseitig ersetzen, z. B. Schweinebraten, Schnitzel oder Rinderroulade, können dann in eine gemeinsame Überkategorie „Fleischgericht“ einsortiert werden.
Streng genommen kann eine wissenschaftliche Untersuchung eines tierlichen Verhaltens erst dann beginnen, wenn das Ethogramm, oder zumindest ein für die betreffenden Bereiche aufgestellter Verhaltenskatalog, vorliegen. Danach beginnt die Überprüfung der eigentlichen Forschungsfragen, deren Zielrichtung wir im Folgenden noch besprechen werden. Aus statistischen Gründen sollte man sich bemühen, möglichst viele Verhaltensweisen mit Zeitdauer, oder mit einer genauen Festlegung des Abstandes zwischen den beiden Tieren festzuhalten, und nicht einfach nur als sogenanntes Ereignis in einer Strichliste.
AUFSTELLEN VON HYPOTHESEN
Hat man das Phänomen, etwa ein bestimmtes Verhalten („männliche Hunde heben zum Pinkeln meist das Bein, weibliche selten“), exakt beschrieben (das heißt, wie genau tun beide Geschlechter das), dann geht es darum, testbareHypothesen aufzustellen, also Erklärungsversuche, die überprüfbar sind. Auch das Aufstellen von Hypothesen und Spekulationen ist noch keine Wissenschaft, behaupten lässt sich schließlich viel. Eine gute Hypothese muss daher mehrere Anforderungen erfüllen:
Sie muss allgemeingültig für das zu erklärende Phänomen sein,
sie muss testbar sein,
sie muss einen biologischen Sinn ergeben,
sie muss eine Gegenhypothese haben, das heißt, es muss möglich sein, durch die folgende Datensammlung zwischen ihr und einer alternativen Erklärungsmöglichkeit zu unterscheiden.
VON DER HYPOTHESE ZUR THEORIE
Meist stellt man seine Hypothese (H1) einer Alternativhypothese (H2) gegenüber, die ein anderes Erklärungsmodell zur Grundlage hat, oder eine Nullhypothese (H0), die besagt, dass der behauptete Effekt meiner Überlegung über das zu erklärende Phänomen nicht bestätigt werden kann.
Durch die Zusammenführung vieler bestätigter Hypothesen und durch eigene Daten, sowie die Kenntnis und Auswertung bereits veröffentlichter Literatur zum gleichen Thema, kann schließlich eine Theorie aufgestellt werden. Im Gegensatz zum allgemeinen Sprachgebrauch, ist eine Theorie keineswegs nur eine nutzlose und realitätsferne Überlegung. Eine Theorie im wissenschaftlichen Sinn, ist eine möglichst schlüssige, widerspruchsfreie Erklärung, die alle bisher bekannten Tatbestände zusammenfasst und daraus eine gemeinsame Erklärung formuliert. Eine Theorie muss mit allen oder der Mehrzahl der beschriebenen und beobachteten Phänomene am besten im Einklang stehen, einen gemeinsamen roten Faden zwischen diesen Phänomenen herstellen, und mit möglichst wenig bis keinen unbelegbaren oder in sich widersprüchlichen Hilfsannahmen gestützt werden.
DAS SPARSAMKEITSPRINZIP
Zu den gängigen wissenschaftlichen Standardverfahren gehören noch einige weitere, einschränkende Aspekte. So ist es ein seit Jahrhunderten gepflogenes Verfahren, das sogenannte „Sparsamkeitsprinzip“ oder „Prinzip der sparsamsten Erschließung“ walten zu lassen. Dieses besagt, dass im Zweifelsfall von mehreren alternativen Erklärungen diejenige zu bevorzugen ist, die mit den wenigsten (vor allem den wenigsten derzeit nicht testbaren) Hilfsannahmen auskommt.
Das Sparsamkeitsprinzip wurde bereits im Mittelalter von dem Mönch John Occam formuliert, im Bereich der Verhaltenswissenschaften hat am Ende des 19. Jahrhunderts Lloyd Morgan diese Regel formuliert. Eine Verhaltensweise immer auf der einfachsten möglichen Erklärungsebene zu erklären und höhere oder gar unerklärliche Phänomene nur dann ins Spiel zu bringen, wenn die Erklärung auf der unteren Ebene nicht funktioniert, ist durchaus kein schlechter Arbeitsansatz. Gerade beim Umgang mit vielen, eher populär bis emotional formulierten Hundeerziehungskonzepten und Verhaltensbeschreibungen, wäre eine stärkere Anwendung dieses wissenschaftstheoretischen Kernprinzips sicher sehr hilfreich. Jedoch hat gerade das Morgan-Prinzip auch den strikten Behaviorismus vorangetrieben, der sich in Folge der Untersuchungen von Skinner und seiner Schule entwickelte. Verhalten wird hier nur als Reaktion auf äußere Reize und auf der Reflexebene beschrieben, und jeglichem Verhalten wird nur das Ergebnis frühester Lernprozesse und Erfahrungen zugestanden. Begriffe wie Motivation, Kognition und Emotion werden nicht beachtet. Gerade in diesen Bereichen werden wir jedoch sehen, dass die neuere Forschung auch und gerade an Hunden uns etwas anderes lehrt.
Hier muss nochmals in die Wissenschaftsgeschichte zurückgegriffen werden: Lloyd Morgan hat nämlich die Existenz solcher höher geistiger Leistungen im Verhalten keineswegs verneint. Er hat in einer zweiten, weniger beachteten Arbeit durchaus darauf hingewiesen, dass solche Phänomene als Erklärung herangezogen werden dürfen, wenn sie in anderen, unabhängig veröffentlichten und validierten Studien bereits bestätigt sind. Wenn also aus anderen Untersuchungen die Existenz von Emotionen bei Hunden nachgewiesen ist, kann durchaus in einer von uns durchgeführten Betrachtung einem Hund eine Emotion zugestanden werden. Auch darüber werden wir im Laufe des Buches immer wieder stolpern. Dies gilt z. B. für die Annahme sogenannter höherer geistiger Leistung. Außerdem ist, und das gilt für die Verhaltensbiologie ganz besonders, die Biologie in weiteren Bereichen eine sogenannte probabilistische Wissenschaft, also eine, die mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten muss, im Gegensatz etwa zur klassischen Physik, deren Ergebnisse als Naturgesetze von Zeit und Raum unabhängig sind. Zwar folgen auch Lebewesen den Naturgesetzen, aber durch die biologiespezifischen Einflüsse der Vorgeschichte jeden Tieres einerseits und hierarchische Organisation und ihre Wechselwirkungen (zwischen Zellen, von Zellen zu Organen, von Organen zu Organkomplexen, zu ganzen Tieren, die wieder in ein Sozialsystem, dann eine Population und schließlich ein Ökosystem eingebunden sind) andererseits, kommt es hier zu mehr Variabilität. Deshalb sind die Aussagen der Verhaltensbiologie grundsätzlich nur mit Hilfe analysierend-schließender Statistik zu überprüfen und dazu bedarf es vor allem größerer Datenmengen. Wer sich genauer zu diesen wissenschaftstheoretischen Aspekten und dem methodischen Vorgehen informieren will, dem sei Lamprecht (1999) zur Methodik und Mayr (2000) empfohlen. Ich habe diese Zusammenhänge als kleinen Umweg an den Anfang gestellt, weil gerade im Bereich des Hundeverhaltens viele sogenannte Konzepte mit viel Erfolg verkauft und angeboten werden, die diesen simplen Anforderungen einer wissenschaftlichen Arbeit überhaupt nicht gerecht werden.
© Shutterstock/thak
Über Langzeitbeobachtungen einer Hundegruppe kann man die Gruppendynamik genauer verstehen.
VERSUCHE UND EXPERIMENTE
Hat man die Hypothesen testbar gemacht, geht es an die Überprüfung durch systematische und unabhängige Datensammlung, sei es durch Versuche, Langzeitbeobachtungen oder Experimente.
Am Ende steht die Annahme oder Zurückweisung bzw. Nichtbestätigung der Hypothese(n). Erst dann, wenn die Hypothesen zweifelsfrei bestätigt werden, kann man die Sache als in diesem Aspekt erklärt betrachten.
Mit welcher Forschungsmethodik man die jeweiligen Untersuchungen durchführen möchte, ist der Fragestellung und den Möglichkeiten der Untersuchenden überlassen. Im Bereich der Verhaltensbiologie bieten sich im Wesentlichen drei Vorgehensweisen oder deren Kombinationen an:
Gerade bei der Betrachtung von Persönlichkeitstypen und ähnlichen, allgemein auf großer Individuenzahl zu bestimmender Verhaltensmerkmale, können gut gestaltete, und unabhängig statistisch überprüfte
Fragebögen
eine wichtige Rolle spielen. Diese Fragebögen werden zunächst auf der Basis der Erfahrungen und der Literaturkenntnis des jeweiligen Untersuchers erstellt, dann von einer Testgruppe, z. B. Hundehaltern, bearbeitet und anschließend durch statistische Ähnlichkeitsanalysen untersucht („Welche der betreffenden Fragen lassen sich in bestimmte Überkategorien einsortieren“). Diese Überkategorien können dann den noch zu besprechenden Persönlichkeitsachsen, unterschiedlichen Bindungs- oder Beziehungstypen, oder sonstigen Verhaltenskategorien zugeordnet werden.
Durch
Versuche
, oder in manchen Fällen auch durch
exakt standardisierte Experimente
, kann der Versuchsleiter alle Faktoren, die ihn nicht interessieren, konstant halten, und nur einen, der ihn interessiert, verändern. Beispielsweise kann in einem solchen Versuch herausgefunden werden, ob sich die Futterbevorzugung eines Hundes vom Verhalten seines Halters ableiten lässt oder nicht. Wichtig ist, dass der Begriff „Versuch“ keineswegs gleichbedeutend mit einem tierschutzwidrigen oder quälerischen Eingreifen in das Wohlbefinden des Tieres sein muss.
Unter Versuch versteht man lediglich das Vorgehen, möglichst alle derzeit nicht interessierenden Umwelt
bedingungen konstant zu halten, und nur
eine Bedingung, die einen interessiert,
zu verändern.
Dies zu betonen ist deshalb wichtig, weil gerade die Untersuchung an unseren Hunden oder auch Katzen immer noch darunter leidet, dass viele tierschutzmotivierte Menschen glauben, einen Versuch aus ethischen Gründen grundsätzlich ablehnen zu müssen. Der berühmte Schweizer Verhaltensbiologe Hans Kummer hat einmal in einem Gespräch gesagt: „
Ein Versuch ist dann gut, wenn Versuchstier und Versuchsleiter ein
gemeinsames Interesse an der Lösung des betreffenden Problems haben
.“ Mit dieser Richtschnur sollte es tierschutzmotivierten Menschen einfacher möglich sein, wissenschaftliche Untersuchungen mit ihren Hunden, Katzen oder anderen Kumpantieren zu unterstützen.
Langzeitbeobachtungen
an möglichst wenig beeinflussten Tiergruppen sind die dritte, wenn auch zeitaufwendigste Möglichkeit der Datensammlung. Diese Langzeitbeobachtungen ermöglichen uns z. B. die Gruppendynamik einer Hundegruppe genauer zu verstehen, die Entwicklungsprozesse in einem Wurf Welpen bis zum Pubertätsalter zu verfolgen, oder die Streifgebietsnutzung verwilderter Haushundgruppen zu studieren.
In der Regel werden alle diese Maßnahmen und Möglichkeiten parallel, oder in unterschiedlichen Teilprojekten angewendet, wenn man ein möglichst vollständiges Verständnis eines biologischen Problems im Verhalten haben möchte.
Unabhängig davon, mit welcher Forschungsmethodik man sich dem Problem nähert, am Ende steht immer die Statistik.
Nur dann, wenn wir mit Hilfe von einschlägigen Berechnungen zeigen können, dass die von uns gefundenen Effekte nicht vom Zufall, sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit wirklich von den von uns aufgestellten und angenommenen Zusammenhängen beeinflusst sind, können wir ein Ergebnis als wissenschaftlich fundiert betrachten.
ZUFALLSWAHRSCHEINLICHKEIT UND EFFEKTSTÄRKE
Es hat sich in biowissenschaftlichen Untersuchungen eingebürgert, nur solche Ergebnisse als statistisch bedeutsam zu betrachten, deren Zufallswahrscheinlichkeit unter 5 % liegt. Dies ist der häufig zu findende p-Wert: p kleiner 0,05, also kleiner 5 %, sagt uns, dass mit mindestens 95 % Wahrscheinlichkeit die von uns angenommenen Zusammenhänge, und nicht der Zufall, für das Zustandekommen dieser Datenverteilung verantwortlich sind.
Ein zweites, vor allem in Untersuchungen an größeren Tierzahlen häufig errechnetes Maß, ist die Effektstärke. Diese sagt uns, ob die gefundenen Zusammenhänge auch wirklich eine biologische Bedeutung haben. Wer behauptet, es gäbe „da eine Studie“, die seine Überlegungen unterstützt, der sollte zumindest auf Nachfragen und Nachsuchen auch die notwendigen p-Werte und eventuell die Effektstärken dafür liefern können. Es gibt mehrere Formen der wissenschaftlichen Studien, die mit unterschiedlicher Aussagekraft belegt sind:
Die sozusagen edelste Form ist die sogenannte
Metaanalyse
, eine Untersuchung, bei der die Ergebnisse vieler verschiedener Studien nochmals mit einschlägigen statistischen Methoden miteinander verglichen und bewertet werden. Solche Metaanalysen liegen z. B. im Zusammenhang mit der Erblichkeit des Verhaltens, mit Persönlichkeitsunterschieden oder Rasseunterschieden bei Hunden vor.
Die unter der Metaanalyse angeordneten Ebenen einer Studie sind diejenigen, bei denen auf
Zufallsbasis
Versuch- und Kontrolltiere ausgewählt, und dann jeweils der Versuchsbehandlung unterzogen wurden. Dies ist das häufigste Vorgehen in klinischen Studien in der Medizin, wird jedoch oftmals in verhaltensbiologischen Untersuchungen nicht realisierbar sein, vor allem wenn man es mit kleineren, seltenen oder wertvollen Tieren zu tun hat.
Hier ist oftmals die nächste Ebene der wissenschaftlichen Qualität, eine sogenannte
Kohortenstudie
angebracht. Bei der Kohortenstudie vergleicht man verschiedene Versuchsgruppen, die ohnehin in ihrer Alltagssituation einer der beiden zu untersuchenden Bedingungen angehören. Anstatt in einer klinisch randomisierten Studie z. B. auszuwürfeln, welche Hunde kastriert werden und welche intakt bleiben, um dann die Verhaltens- und medizinischen Unterschiede der beiden Versuchsgruppen vergleichen zu können, nehmen wir bei den Kohortenstudien Hunde, die ohnehin schon kastriert sind, und vergleichen ihre Verhaltenseigenschaften oder auch die medizinischen Auswirkungen mit denen einer zweiten Gruppe von unkastrierten Hunden gleicher Rasse, gleichen Alters oder sonst wie vergleichbarer Bedingungen (vgl. Kaufmann et al. 2017).
Manchmal sind aber auch einfache
Fallstudien
wichtig, vor allem, wenn es um seltenere und nur ab und an zu beobachtende Verhaltenseigenschaften geht. Es wird kaum möglich sein, in einer Kohortenstudie hinreichend viele Beobachtungen zu sammeln, die z. B. die Trauer nach dem Verlust des Paarpartners dokumentieren. Der amerikanische Verhaltensbiologe Marc Bekoff hat in diesem Zusammenhang von der
episodischen Ethologie
gesprochen, wenn eine Vielzahl solcher Einzelbeobachtungen sich zum Schluss zu einer gemeinsamen wahrscheinlichen Erklärung zusammenfügen lässt.
TINBERGENS VIER BERÜHMTE FRAGEN
Die ersten beiden der vier Fragen von Nico Tinbergen befassen sich mehr mit den geschichtlichen bzw. mit den evolutionsbiologischen Aspekten. Frage drei und vier befassen sich mit den Mechanismen, die das Verhalten steuern.
© Anna Auerbach/Kosmos
Hunde sind an das Leben mit uns Menschen bestens angepasst.
FRAGE 1 – „WOHER?“
Die erste Frage ist die nach dem stammesgeschichtlichen „Woher?“ Dabei wird untersucht, wie sich das betreffende Merkmal, z. B. ein Verhaltenskomplex, von den Vorfahren der betreffenden Art her weiterentwickelt hat und welche gemeinsamen Vorstufen dieses Verhalten im Laufe der stammesgeschichtlichen Entwicklung von unseren heute zu betrachtenden Tieren angenommen hat.
Diese Frage nach dem stammesgeschichtlichen „Woher?“ ist zugegebenermaßen für Verhaltensmerkmale schwerer zu beantworten als z. B. für Organe oder andere Merkmale des äußeren Aussehens. Schließlich lassen sich Verhaltensmerkmale nur in seltenen Fällen als Fossilien finden. In Bezug auf den Haushund haben wir hier, übrigens auch bei der Hauskatze, eine etwas glücklichere Situation: Die wilde Stammform lebt nach wie vor und kann in Freilandstudien und, wie z. B. die Wiener Arbeitsgruppe oder früher auch die Budapester Kollegen/innen gezeigt haben, mit verschiedenen Versuchsfragestellungen im Labor gegenüber den Haushunden getestet werden. Trotzdem muss gerade in diesem Zusammenhang betont werden, dass Hunde eben keine degenerierten und zivilisationsgeschädigten Couchwölfe sind, sondern eine eigenständige Lebensform, deren ökologische Nische das Leben bei und mit dem Menschen darstellt. Dass sie dabei verschiedene Verhaltensunterschiede zum Wolf aufweisen, ist durchaus als Anpassung an das Leben bei und mit dem Menschen zu verstehen. Hunde sind nicht dümmer oder träger als Wölfe, sie sind einfach anders. Beispiele dafür und die Ableitung in Kurzform finden sich bei Ádám Miklósi (2018) oder Kurt Kotrschal (z. B. 2012).
HOMOLOGIEMETHODE
In der Biologie gibt es eine ebenso erprobte und akzeptierte Methode, wie man stammesgeschichtliche Vergleiche anstellen kann, nämlich die sogenannte Homologiemethode. Hierbei werden die Ausprägungen bestimmter Merkmale bei nahe verwandten Arten verglichen. Aus den Gemeinsamkeiten bzw. Unterschieden dieses betreffenden Merkmals bei den verwandten Arten wird auf die wahrscheinlichen Vorstufen bei den Vorfahren im Laufe der Stammesgeschichte zurückgeschlossen. Mit diesem Verfahren kann man z. B. Lautgebungen oder komplexe Verhaltensmuster des Werbe- oder Drohverhaltens, aber auch Bewegungsmuster in anderen Zusammenhängen vergleichen. Wenden wir diese Methode auf das Verhalten der Hundeartigen an, so stellen wir z. B. fest, dass innerhalb der Untergruppe der Wolfsartigen (Canini) das Hervorwürgen von Nahrung an die Jungtiere entstanden ist, während die Füchse (Vulpini) dieses Verhalten nicht zeigen. So kann auf eine Trennung der beiden großen Entwicklungslinien vor dem stammesgeschichtlichen Entstehen dieses Futterhochwürgeverhalten geschlossen werden (Gansloßer, 2006).
FRAGE 2 – „WOZU?“
Die zweite Frage ist derzeit in der Verhaltensbiologie besonders interessant, nämlich die Frage nach dem „Wozu?“ Hier wird letzten Endes nach der Bedeutung des betreffenden Merkmals für den Fortpflanzungserfolg gefragt. Denn nur der Fortpflanzungserfolg zählt als Erfolgskontrolle der evolutionsbiologischen Prozesse. Die dabei stattfindenden Prozesse führen im Laufe vieler Generationen zu einer zunehmend besseren Anpassung einer Art an ihren jeweiligen Lebensraum. Nur dann, wenn ein Verhaltensmerkmal zumindest einen gewissen Anteil von Erblichkeit aufweist, kann die Selektion wirken, und dieses Merkmal im Laufe vieler Generationen besser, das heißt wirkungsvoller, angepasst werden. Verhaltensmerkmale, die keine erbliche Komponente aufweisen, können auch nicht im Laufe der Selektion verändert werden. Das bedeutet aber nicht, wie wir noch sehen werden, dass Verhaltensmerkmale unmittelbar und in ihrer vollständigen Ausprägung von den Genen abhängig sind. Gene bedingen immer nur bedingte Eiweißstoffe, die dann als Hormone, andere Botenstoffe, Bindungsstellen für Botenstoffe oder sonstige biochemische Wirkfaktoren im Organismus tätig werden. Das daraus entstehende Verhalten ist immer die Konsequenz, und nicht etwa der Inhalt des Gens!
INDIVIDUALSELEKTION
Diejenigen Mitglieder der Art, die besonders gut mit den vorhandenen Umweltbedingungen klarkommen, werden durchschnittlich mehr Nachkommen in die nächste Generation bringen als ihre Konkurrenten, deren Anpassungsfähigkeit nicht so vorteilhaft ist. Sind diese Anpassungsfähigkeiten zumindest erblich verankert, so wird im Laufe der Generationen der Erbanteil der besser Angepassten größer und die weniger gut Angepassten der Population sterben nach und nach aus.
Dieser Prozess wird als natürliche Auslese oder natürliche Selektion bereits von Darwin beschrieben. Die Selektion wirkt hier zunächst einmal auf das Individuum. Jedes einzelne Tier muss sich mit seiner Erbausstattung und seinen Eigenschaften bewähren.
© Shutterstock/Derek R. Audette
Wölfe leben in Familienverbänden – die gemeinsame Kooperation bringt viele Vorteile für den Einzelnen.
ARTERHALTUNG?
Eine positive Wirkung auf die Arterhaltung ist stets nur eine Konsequenz, aber nie eine Ursache des jeweiligen Verhaltens. Insofern ist die Aussage „dieses oder jenes Verhalten dient dem Arterhalt“ als Erklärung wertlos. Der sogenannte „Kampf ums Dasein“ besteht normalerweise nicht aus direkten und blutigen Auseinandersetzungen, sondern eher aus einem Wetteifern um „Marktanteile“. Dabei darf man jedoch nicht den Fehler machen, anzunehmen, dass alle Merkmale, die wir bei einem Lebewesen finden, auch adaptiv, also vorteilhaft sein müssen. Es genügt, wenn sie keine Nachteile haben. Viele Merkmale, die Tierarten in den Genen verankert haben, sind neutral. Das bedeutet, dass sie den Fortpflanzungserfolg ihres Trägers weder positiv noch negativ beeinflussen.
Bisweilen wird auch immer noch von der Gruppe, also einer größeren Zahl an Individuen, als gemeinsame Ebene der Selektion ausgegangen. Dies ist jedoch in vielen Fällen rechnerisch und auch evolutionstheoretisch schwer begründbar. Möglicherweise stellt aber ein Wolfsrudel in gewisser Weise eine Ausnahme von dieser Regel dar. Denn das Zusammenwirken aller, manchmal auch nicht verwandter Angehöriger dieser Gruppe, kann gemeinsam den Fortpflanzungserfolg der Elterntiere steigern, und damit eventuell wirklich einen individuellen Beitrag verbessern. Hier sind jedoch die theoretischen Überlegungen noch nicht weit genug fortgeschritten. Wir sollten uns also darauf beschränken, das Individuum, oder wie gleich noch zu sehen ist, die Verwandtschaftsgruppe als die Basis der Selektion zu betrachten. Auch hier gibt es selbstverständlich wieder Wechselwirkungen. Wenn ein Individuum, vor allem gegenüber einem langjährigen Sozialpartner, sich altruistisch, also diesen unterstützend verhält, kann nach dem Gegenseitigkeitsprinzip durchaus das individuelle Überleben des Betreffenden verbessert werden. Kooperation ist also keineswegs durch diese individualselektionistische Betrachtung ausgeschlossen. Die Kooperation muss nur, zumindest über die lange Lebensgeschichte des Betreffenden hinweg, auch Vorteile bringen. Kurzfristig kann man dann auch einmal Nachteile in Kauf nehmen (siehe hier).
VERWANDTSCHAFTSSELEKTION
Zusätzlich zur Individualselektion gibt es die Verwandtenselektion, denn jeder hat ja auch einen gewissen Anteil seiner Erbeigenschaften mit seinen Verwandten gemeinsam (z. B. 50 % mit Vollgeschwistern, 25 % mit Neffen/Nichten). Über diese indirekte Selektion ist z. B. erklärbar, dass man evolutiv gesehen mehr Vorteile hat, wenn man drei Neffen/Nichten aufzieht als ein eigenes Kind. Durch diese Verwandtschaftsselektion werden z. B. die Brutpflegehelfersysteme der Hundeartigen (siehe hier) begründbar.
GRUNDBEGRIFFE DER EVOLUTIONSBIOLOGIE
Fitness
Der Fortpflanzungserfolg wird als die sogenannte Fitness eines Tieres bezeichnet. Wobei man unter Fitness den Anteil des eigenen Erbgutes am gesamten Genpool der nächsten Generation, also den Anteil eigener Erbeigenschaften im Vergleich zu denen, die von Konkurrenten vererbt wurden, gesehen wird. Hier muss nochmals darauf hingewiesen werden, dass der Begriff „Fitness“ im evolutionsbiologischen Sinn eben nicht das darstellt, was man im allgemeinen Sprachgebrauch darunter versteht. Fitness ist nicht die körperliche Kondition, auch nicht die geistige Wendigkeit oder andere Fähigkeiten, sich im Alltag zu behaupten. Das ist vor allem das Missverständnis, das von evolutionskritischen Kreisen immer wieder an der Darwinschen Theorie geäußert wird. Wenn man den Fitnessbegriff so versteht, dass eben derjenige der Fitteste ist, der seine eigenen genetischen Eigenschaften am besten in die nächste Generation platzieren kann, dann ist „Survival of the Fittest“ nicht das Überleben des Überlebensfähigsten. Stattdessen ist das langfristige, in den vielen Generationen der Evolutionslinie stattfindende Ausbreiten von Merkmalen, die ihrem Träger zur verbesserten Platzierung seines Erbguts in der nächsten Generation verhelfen, gemeint. Betont werden muss außerdem, dass bei diesen sogenannten funktionalen Erklärungen, also bei Erklärungen, die den Fortpflanzungserfolg und die Anpassungsfähigkeit einer Art betreffen, Begriffe verwendet werden, die aus der Wirtschaftsmathematik und Wahrscheinlichkeitsrechnung stammen, etwa der Begriff der Strategie oder das Optimierungsprinzip. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die betreffenden Tiere sich der zugrundeliegenden Prozesse und Entscheidungen bewusst sein müssen. Es genügt, wenn sie sich richtig verhalten, auch wenn das „richtige“ Verhalten „nur“ im Erbgut verankert ist, anstatt dass es durch bewusste oder rationale Entscheidungen ausgewählt wurde. Betrifft das betrachtete Verhalten nur ein einzelnes Individuum, z. B. bei der Nahrungssuche oder sonstigen Auseinandersetzungen mit der nichtsozialen Umwelt, so können einfache Optimierungsmodelle herangezogen werden. Ist z. B. bekannt, wie viel Energie ein Tier zur Nahrungssuche pro gelaufenem oder geflogenem Kilometer verbraucht, dann kann errechnet werden, für welchen Nahrungsbrocken es sich lohnt, wie weit zu laufen. Sind jedoch zwei oder mehr Individuen an der Entscheidung beteiligt, so müssen die Entscheidungen der jeweils anderen Artgenossen mitberücksichtigt werden. Dies ist dann das Feld der evolutionären Spieltheorie, auf die wir im Kapitel über Kampf und Aggressionsverhalten noch näher eingehen werden (siehe hier).
© Shutterstock/Erni
Gemeinsam kann man seine Beute viel schneller verschlingen, bevor sie die Konkurrenz findet.
Strategien
Strategien sind im Sprachgebrauch der Verhaltensökologie solche Entscheidungen, die durch genetische Vorgaben fixiert sind und nach dem Motto „wenn Situation A, dann tue X, wenn Situation B, dann tue Y“ ablaufen. Die Strategien, die sich im Laufe der Evolution durchsetzen und erhalten bleiben, werden als evolutionär stabile Strategien (ESS) bezeichnet (siehe Kappeler, 2012).
ESS müssen nicht jeweils den individuellen Vorteil jedes Beteiligten an der Auseinandersetzung maximieren, sie sind vielmehr häufig auch Kompromisse zwischen den Anforderungen verschiedener Mitbewerber.
EVOLUTIONÄR STABILE STRATEGIEN
Evolutionär stabile Strategien sind solche Strategien, die unter den Lebensbedingungen der Population durch keine andere denkbare Alternative ersetzt werden können, weil jede andere denkbare Alternative für die beteiligten Individuen weniger Vorteile oder mehr Nachteile bringen würde.
Kosten-Nutzen-Analyse
Bei allen Betrachtungen zur Frage nach dem „Wozu?“ werden Kosten-Nutzen-Analysen angestellt, die den Ausgang einer möglichen Entscheidung oder die Folgen einer Verhaltensentscheidung berücksichtigen müssen. Dies ist das Arbeitsgebiet der Verhaltensökologie, bzw. wenn Sozialverhalten dabei betrachtet wird, spricht man auch von Soziobiologie. In neuester Zeit werden die Erkenntnisse der Verhaltensökologie insbesondere durch Artvergleiche von nahe verwandten Arten in anderen Lebensräumen oder nahe verwandten Arten mit unterschiedlichen Sozialsystemen noch weiter überprüft. Verhaltensökologische Betrachtungen erlauben z. B. eine Aussage über den Anpassungswert der Rudelbildung, der gemeinsamen Jungenaufzucht oder der gemeinsamen Revierverteidigung bei Hundeartigen (siehe hier; sowie Macdonald, 2006). Diese Untersuchungen haben z. B. starke Zweifel an der häufig geäußerten Meinung aufkommen lassen, dass die gemeinsame Jagd oder die gemeinsame Jungenaufzucht die Fortpflanzungserfolge und damit die evolutionsbiologischen Antriebsmotoren der Rudelbildung bei Hundeartigen beeinflusst hätten. Vielmehr erscheint die gemeinsame Revierverteidigung oder das schnellstmögliche Fressen der einmal geschlagenen Beute, ein wichtigerer evolutionsbiologischer Antrieb zu sein. Die Rudelbildung wäre also eher eine Anpassung an Revier und Nahrungsverteidigung.
FRAGE 3 – „WIE?“
Die Fragen drei und vier werden häufig als die beiden proximaten Fragen zusammengefasst, um den ultimaten, den evolutionsbiologisch-evolutionsgeschichtlichen Fragen gegenübergestellt zu werden.
Bei Frage drei geht es um die beteiligten Mechanismen, die die Ausprägung eines bestimmten Verhaltensmerkmals steuern. Ob es sich dabei um beteiligte Sinnesorgane, Hirnregionen, Nerven oder Hormonimpulse handelt, ob es um auslösende Reize und auslösende Situationen geht, immer wird die Frage nach dem „Wie funktioniert das Tier in dieser Situation?“ gestellt. Auch Fragen nach dem Einfluss von Jahreszeiten, Sonneneinstrahlung, Temperatur und anderen Klimafaktoren sind hier zu nennen.
Gerade in diesem Bereich sind in den letzten Jahren durch die neueren und verfeinerten Analysemethoden der Laboranalytik erhebliche Fortschritte erzielt worden. So ist es heute möglich, Hormone, seien es Stress- oder Fortpflanzungshormone aus Kot, Urin, Speichel und sogar Haaren zu bestimmen, ohne dass eine Blutabnahme erfolgen muss. Solche Verbesserungen haben erheblich dazu beigetragen, die Frage nach den Verhaltensmechanismen aus der „Black box“ der frühen Verhaltensbiologie zu überarbeiten und wiederum in eine testbare und damit dem wissenschaftlichen Erforschen zugängliche Form zu überführen. Umso wichtiger ist es, die Begriffe in diesem Zusammenhang exakt zu definieren und der wissenschaftlichen Analyse im hier geschilderten Sinne zugänglich zu machen.
Eine weitere, in den vergangenen Jahren von mehreren Arbeitsgruppen (z. B. Gregory Berns an der University of Georgia, oder die Gruppe von Ádám Miklósi in Budapest) angewendete physiologische Methode ist die fMRI-Untersuchung von Gehirnaktivitäten. Hierbei wird die Aktivität von Gehirnregionen aufgrund der dort stattfindenden Stoffwechselvorgänge und der daraus entstehenden Temperaturänderungen gemessen, und die Stoffwechselaktivität dann in einem dreidimensionalen Gehirnbild dargestellt. Man sieht also buchstäblich, wo und wie das Gehirn arbeitet. Die Hunde werden völlig freiwillig, mit Hilfe von Beobachtungs- und Nachahmungslernen, dazu gebracht, sich ruhig in den Hirnscanner zu legen, und bekommen dann akustische, geruchliche oder optische Signale präsentiert. Die Reaktion der Hunde auf diese Signale, eventuell sogar in Abhängigkeit davon, wer sie sendet, kann dann z. B. im Studium der emotionalen Bewertung dieser Signale im Hundegehirn herangezogen werden. (Näheres siehe Gansloßer und Kitchenham, 2019).
MOTIVATIONSANALYSE
Begriffe wie Trieb oder auch Motivation sind überdies so verwaschen und schwammig, dass sie kaum einer messbaren und damit exakt quantifizierbaren Analyse zugänglich sind.
Die sogenannte Motivationsanalyse galt früher als die Königsdisziplin der klassischen Ethologie. Sie war mit sehr großem methodischem Aufwand, sehr viel Arbeit und mit einem sehr guten Gespür für das Verhalten der zu untersuchenden Tierart verbunden. Man musste versuchen, das zu untersuchende Verhalten in möglichst vielen verschiedenen Situationen mit genau quantifizierbaren Außenreizen in Verbindung zu bringen, um durch diese Außenreize unterschiedliche Ausprägung auszulösen.
Wenn heute vorschnell von Motivation oder sogar von Trieb gesprochen wird, so hat sich fast niemand die Mühe gemacht, auch nur ansatzweise diese Aufwände zu betreiben. In der Grundlagenforschung der Verhaltensbiologie wird der Motivationsbegriff ohnehin fast nicht mehr verwendet. Die gängigen Lehrbücher der Verhaltensbiologie versuchen ganz ohne ihn auszukommen. Hogan (2005) ist einer der wenigen Autoren in einem grundlegenden Lehrbuch der Verhaltensbiologie, der ein ganzes Kapitel über das Motivationsproblem verfasst hat. Wir werden diese Thematik noch ausführlicher behandeln (siehe hier).
© Shutterstock/Bachkova Natalia
Jungtiere sind keine passiven Empfänger von Umwelteinflüssen. Sie sind Mitgestalter ihrer eigenen Umwelt.
FRAGE 4 – „WODURCH?“
Die vierte und letzte Frage wendet sich an das „Wodurch?“, an die Frage nach der individualgeschichtlichen Entwicklung eines Merkmals. Hier werden vor- und nachgeburtliche Reifungs- und Lernprozesse, genetische Einflüsse und Umweltfaktoren auf das Verhalten, sowie das Zusammenwirken mehrerer Faktoren des sozialen und nichtsozialen Umfeldes analysiert. Die sogenannte Ontogenese, also die Individualentwicklung des betreffenden Merkmals, soll nicht nur beschrieben werden. Sondern es soll auch untersucht werden, welchen Einfluss welcher Faktor auf die Ausbildung des betreffenden Merkmals hat.
Dieser Frage nach dem „Wodurch?“ werden wir noch nachgehen (siehe hier), so dass wir an dieser Stelle nicht weiter darauf eingehen müssen. Es sollte jedoch schon hier betont werden, dass diese Faktoren in einem sehr komplexen wechselseitigen Zusammenwirken das zukünftige Individuum formen.
Stamps (2003) hat betont, dass Jungtiere keineswegs passive Empfänger der einschlägigen Umwelteinflüsse seien. Jungtiere suchen und formen vielmehr die Umwelt, die dann wiederum in einem nächsten Schritt die Lern- und Sozialisationseinflüsse auf das Jungtier, sein Nervensystem und seine Verhaltensausstattung prägt. In der Ökologie wurde für die Erklärung dieser Wechselwirkungen der Begriff der ontogenetischen Nische geschaffen (Gansloßer, 1998), das heißt, man betrachtet jedes Entwicklungs- und Altersstadium so, dass es den in diesem Alter herrschenden Anforderungen und Bedingungen möglichst optimal angepasst sein sollte. Jungtiere sind keine unfertigen Erwachsenen, sondern sie sind Tiere, die mit den Anforderungen des momentanen Alters- und Reifezustandes möglichst optimal zurande kommen. Nur dann kann bereits während der ontogenetischen Entwicklung auch die Anpassung und damit die Fitnessmaximierung vorbereitet werden. Die Durchgangsstadien der Entwicklung sind also immer zugleich auch Stadien der momentanen Optimierung. Diese Doppelanforderung ist es, die die Interpretation von Jungtierverhalten so schwer macht.
GRUNDLAGEN DER „KLASSISCHEN ETHOLOGIE“
Im Laufe ihrer Geschichte hat die Verhaltensbiologie eine Reihe von Stadien durchlaufen, die jeweils mit bestimmten Konzepten und theoretischen wie methodischen Eigenmerkmalen verbunden waren (Hinde, 1982; Kappeler, 2012). Nach einer Frühphase, die überwiegend von Vogelbeobachtern und Ornithologen bestimmt war (O. Heinroth hat damals z. B. den Prägungsbegriff geschaffen), folgte eine getrennte Entwicklung in Europa und Nordamerika. Die nordamerikanische Richtung, die überwiegend psychologisch/lerntheoretisch ausgerichtet war, betonte die Bedeutung der Umwelt. In der Extremform des Behaviorismus wurde sogar angenommen, jedes Lebewesen käme als weißes Blatt auf die Welt und müsste alles lernen.
In Europa entwickelte sich die sogenannte klassische Ethologie, die in den 1930er Jahren vorwiegend von Lorenz und Tinbergen vorangetrieben wurde. Hier wurde sehr stark der angeborene Teil des Verhaltens sowie die innere Verursachung (Lorenz schuf dafür den Begriff der „reaktionsspezifischen Energie“) betont. Viele Extrempositionen, sowohl in der Gegenüberstellung des angeborenen im Gegensatz zum erworbenen Verhalten wie in der Betonung der inneren Antriebe, sind vorwiegend als gezielte und teilweise überspitzte Gegenreaktionen gegen die Behavioristen zu verstehen.
ETHOLOGIE NACH KONRAD LORENZ
Wer die Denkweise und die wichtigsten Konzepte der traditionellen, vorwiegend bei uns auf Lorenz beruhenden Ethologie verstehen möchte, dem sei das Buch von Konrad Lorenz „Vergleichende Verhaltensforschung – Grundlagen der Ethologie (1978)“ empfohlen. Dort wird unter anderem auch auf die Wichtigkeit der Verhaltenselemente in der stammesgeschichtlichen und zoologisch- systematisch orientierten Verhaltensbiologie hingewiesen. Auch Verhaltensweisen können, wie Lorenz darstellt, z. B. zur Rekonstruktion von zoologischen feinsystematischen Beziehungen zwischen verschiedenen Tierarten herangezogen werden, in ähnlicher Weise, wie das Merkmale der Anatomie oder des äußeren Köperbaus ermöglichen. Auch dies ist ein wesentliches Merkmal der Lorenzschen Ethologie, wenn auch eines, das in der heutigen Zeit weniger Beachtung findet. Andere Bestandteile seines wissenschaftlichen Konzeptes werden wesentlich stärker diskutiert, und auch viel stärker in der Öffentlichkeit berücksichtigt.
Hierzu gehört z. B. die Frage nach den in der Koordination unveränderlichen, leicht wiedererkennbaren Bewegungsfolgen, die er als Erbkoordinationen bezeichnet, und den dazugehörigen angeborenen Auslösemechanismen. Für Lorenz war klar, dass diese als Instinktbewegungen bezeichneten Abläufe bei verschiedenen Erregungsgraden in unterschiedlicher Intensität ablaufen können. Die sogenannte Intentionsbewegung wurde bei geringer Motivation nur angedeutet, der volle, dann auch zielführende Bewegungsablauf wurde nur bei stärkerer Intensität der inneren Handlungsbereitschaft und der äußeren Reize gezeigt. Konstant, so sagt Lorenz, blieben aber die Phasenbeziehung und die Größenrelation der verschiedenen Bewegungsabläufe zueinander. Dass die verschiedenen Intensitätsstufen aber auf einer gemeinsamen, von ihm als Instinktbewegung bezeichneten Handlung und nicht einer Reihe von aufeinander folgenden kettenartig hintereinander geschalteten Reflexen beruhe, zeigt sich nach seiner Ansicht darin, dass der gleiche Auslösemechanismus je nach Intensität die unterschiedlichen Abstufungen hervorrufen kann.
© Shutterstock/Rudmer Zwerver
Welches Verhalten ist angeboren, welches erworben? Diese Frage beschäftigte schon früh Ethologen wie K. Lorenz.
Ein wesentlicher Teil seiner Überlegungen war, dass die von ihm als reaktionsspezifischeEnergie bezeichnete innere Komponente durch das erfolgreiche Abhandeln der Bewegung erst einmal abnähme, und dadurch auch bei jeder Instinktbewegung nach ihrem einmaligen Zeigen ihre Ermüdungsreaktion einsetzen würde. Die Bereitschaft zur Ausführung, so schreibt er, wäre also nach jedem Ablauf abnehmend, ohne dass dabei der Organismus als Ganzes ermüdet wird, oder die Bereitschaft zu anderen Instinktbewegungen abnimmt (Lorenz, 1978, S. 119). Ebenso schreibt er im Folgenden, „… die aktionsspezifische Ermüdbarkeit der Instinktbewegungen unterscheidet sich von gewöhnlicher Ermüdung darin, dass bei längerem, experimentell erzwungenem Nicht-Gebrauch, der Schwellenwert auslösender Reize bis tief unter das beim freilebenden Organismus durchschnittliche Maß absinkt. Die Reaktion kann dann durch inadäquate Ersatzobjekte ausgelöst werden“ (Lorenz, 1978, S. 119). Dadurch wird die von ihm immer wieder beschriebene Leerlaufaktion erklärt.
Ebenso gibt er an, dass beim längeren Nicht- Gebrauch einer Instinktbewegung sich nicht nur die Schwellenwerte verändern, sondern der Organismus als Ganzes in Unruhe käme und aktiverweise nach den auslösenden Reizsituationen suchen würde. Dieses Verhalten, so schreibt er weiter, könnte im einfachsten Fall aus motorischer Unruhe bestehen, im komplexesten aber die höchsten Lernleistungen und einsichtsvolles Handeln in sich schließen, die Wallace Craig als Appetenzverhalten bezeichnet. Lernen durch Belohnung, so schreibt Lorenz, kommt nur im Rahmen von Appetenzverhalten vor.
APPETENZVERHALTEN
Unter Appetenz versteht man das Verlangen nach Trieb- und/oder Bedürfnisbefriedigung. Appetenzverhalten ist die Bezeichnung für erblich angelegte Verhaltensweisen, die auch ohne einen Schlüsselreiz (Auslöser) ablaufen können, z. B. Suchverhalten in der Brunftphase (Instinkt). Das Appetenzverhalten ist ein spezifisches Suchverhalten nach dem auslösenden Schlüsselreiz. Das Suchverhalten endet, wenn die angestrebte Handlung beginnt. Beispiel: Das Suchverhalten ist beendet, wenn die Paarung zwischen den Tieren beginnt.
ECKPUNKTE DER ORGANISMISCHEN VERHALTENSBIOLOGIE
Viele dieser Überlegungen sind heute, wie wir im Folgenden sehen werden, nicht mehr auf der Höhe der derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnis. Trotzdem hat Konrad Lorenz mit seiner Theorie eine wesentliche Grundlage für die zoologische Untersuchung tierlichen Verhaltens geliefert. Zwei wesentliche Eckpunkte seines Konzeptes sind es denn, die auch heute noch die organismische Verhaltensbiologie kennzeichnen:
Die Betonung des
systemischen Zusammenhangs
, wonach Verhaltensweisen innerhalb eines Organismus, auch wenn sie unterschiedlichen Funktionskreisen angehören, immer in einer Wechselwirkung miteinander und auch mit unterschiedlichen Verhaltenssystemen stehen, um das Tier als Ganzes in seinem Alltagsverhalten zu steuern.
Überlegung, dass Verhalten durchaus einem Zweck dient, nämlich dem evolutiv bedingten Überleben des jeweiligen Lebewesens. Diese
Zweckgerichtetheit des Verhaltens
wird von Lorenz überwiegend im Arterhalt gesehen, während, wie wir noch sehen werden, heute das Überleben des Individuums, oder noch besser die Weitergabe seiner genetischen Eigenschaften in die nächste Generation als Zweck des Verhaltens und anderer Anpassungsleistungen gesehen werden.
© Shutterstock/Victoria Antonova
Zwischenartliche Beziehungen sind durchaus spielerisch und, wie der Gesichtsausdruck dieses Hundes zeigt, von lässiger Entspanntheit gekennzeichnet.
Die an vielen Stellen, durchaus auch zu Recht formulierte Kritik an dem Lorenzschen Gedankengebäude darf also nicht darüber hinwegtäuschen, welche wichtigen Ansichten in das Funktionieren des tierlichen Organismus und seiner Verhaltensleistungen durch die letztgenannten zentralen Bestandteile seiner Theorie entstanden sind. Ein modernes Beispiel dafür, wie Lorenzsches Gedankengut und Lorenzsche Forschungsansätze uns gerade zum Verständnis von doch recht komplizierten Bewegungs- und Verhaltensabläufen bei Hunden verhelfen können, sind die von Ray Coppinger (Coppinger und Feinstein, 2015) durchgeführten Untersuchungen über die Steuerung des Hüteverhaltens und andere Bewegungsabläufe rund um die Arbeit von Hütehunden, Herdenschutzhunden und anderen, dem Hirten zuarbeitenden Hundetypen.
Seit den 1950er Jahren kam es langsam zu einer Annäherung beider Extrempositionen und es wurde zunehmend klar, dass Begriffe wie „angeborener Auslösemechanismus“, „Erbkoordination“ oder „xy-Trieb“ viel zu grobe Vereinfachungen darstellten. Als gegen Ende der 1960er Jahre die sich auf Fortpflanzungsoptimierung und Individualselektion beziehenden Theorien der Verhaltensökologie und Soziobiologie zunehmend Anerkennung fanden, war zugleich der Streit um die Existenz angeborenen Verhaltens entschieden. Nur wenn Verhaltenzumindest eine erbliche Komponente hat, kann Selektion wirken und Anpassungsprozesse beeinflussen.
NEUE FORSCHUNGSMETHODEN
KOGNITIONSFORSCHUNG
Die neuesten Entwicklungen der Verhaltensbiologie betreffen einerseits neuere und präzisere Verfahren zur Auswertung der Daten, sowie verbesserte Berechnungsmethoden für stammesgeschichtlich-evolutionsbiologische Fragen, die konsequente Anwendung von Kosten-Nutzen-Analysen und Optimierungsmodellen und die Aufdeckung von lebensgeschichtlichen Strategien, das heißt die Frage, mit welchen Entscheidungsmöglichkeiten die Tiere in einem jeweiligen Lebensabschnitt konfrontiert werden.
Ein anderer stark beachteter Bereich betrifft die sogenannten kognitiven Aspekte, das heißt komplexere Prozesse der Informationsgewinnung und -verarbeitung im Gehirn. Die Erkenntnis, dass Lernprozesse auch bei anderen Tieren, außer unserer eigenen Art, auf Einsicht, Vorausplanung, episodischem Gedächtnis, Verallgemeinerungen etc. beruhen können, hätte, wenn sie denn weiter verbreitet würde, enorme Bedeutung für die Ausbildung von Tieren, gerade weil bei Hunden solche Erkenntnisse besonders stark sind (Miklósi et al., 2018; Horowitz, 2014; Kaminski und Marshall-Pescini, 2014; u. a.).
UNTERSUCHUNGEN IM FMRI
Die methodischen Fortschritte beziehen sich hier durchaus sowohl auf die Verfahren zur Datengewinnung als auch zur Datenauswertung. Erhebliche Beiträge zum besseren Verständnis des Verhaltens eines Hundes oder anderen Säugetieres haben in den letzten Jahren die Techniken der funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRI) geliefert. Gerade die Untersuchungen an wachen, völlig uneingeschränkten Hunden, die sich bereitwillig in eine Magnetresonanzröhre legen, um dann verschiedene Signale ihres Menschen, oder auch Tonbandaufnahmen, Gerüche oder Ähnliches zu bewerten, um im Gehirn deutliche Reaktionen zu zeigen, werden wir z. B. im Kapitel über die Bedeutung der Bindung oder der Emotionen kennenlernen (siehe hier).
© Enikő Kubinyi
Die funktionelle Magnetresonanztomographie ist ein großer Fortschritt zum Verstehen von hundlichem Verhalten.
BESTIMMUNG VON HORMONEN
Auch die Auswertungsmethoden zum Bestimmen minimaler Hormonkonzentrationen, aber auch der Konzentration von Immunglobulinen und anderen Eiweißen nicht nur im Blut, sondern auch im Urin, im Speichel oder sogar in den Haaren wären hier zu nennen. Gerade die Stressforschung hat von diesen Techniken erheblich profitiert.
KOMPLEXE STATISTISCHE VERFAHREN
Auch modernere, komplexere statistische Verfahren können uns helfen, nicht zuletzt aufgrund der verbesserten Computerkapazitäten. Wenn es früher noch sehr schwer war, mehrere Einflussfaktoren gleichzeitig statistisch zu betrachten, kann heute in groß angelegten Ähnlichkeitsanalysen eine Vielzahl unterschiedlicher Merkmale gemeinsam betrachtet, und nach ihren wichtigsten Gemeinsamkeiten hinterher grafisch dargestellt werden. Sowohl bei der Stammbaumanalyse, z. B. bei der Aufklärung der wirklichen Verwandtschaftsbeziehungen zwischen Hunderassen und verwandten Arten der Hundeartigen, als auch bei der Erstellung von Persönlichkeitstypen, wird uns diese Methode wieder begegnen.
MATHEMATISCHE MODELLE
Auch die mathematischen Modelle der theoretischen Verhaltensökologie waren anfänglich noch sehr grob und kaum in der Lage, das Verhalten hoch entwickelter Tierarten sofort zu erklären. Zudem fehlte es lange Zeit an Vorstellungen und Messmethoden, um die in diesen Modellen geforderte (und auch oft beobachtbare) Verhaltensplastizität zu bearbeiten. Seit Beginn der 1990er Jahre ist nun eine zunehmende Annäherung der proximat und ultimat forschenden bzw. argumentierenden Teile der Verhaltensbiologie zu beobachten, wobei sich viele ehemals als „Black-Box-Begriffe“ betrachteten Erscheinungen, etwa Bindung oder Beziehung, durchaus als (z. B. hormonphysiologisch) messbare wie auch mit Kosten und Nutzen für das betreffende Tier funktional bewertbare Größen erweisen. Jedoch darf diese (sehr wichtige) Annäherung der Standpunkte nicht zu einer Vermischung der Argumente führen. Wer eine Frage nach dem Selektionswert eines Verhaltens stellt (Was hat die Hündin davon, die Welpen ihrer Konkurrenten umzubringen, Frage „Wozu?“), darf nicht mit einem Mechanismus (Das ist nur der Stress, Antwort „Wie?“) antworten.
GRUNDBEGRIFFE DER VERHALTENSPHYSIOLOGIE
Das Verhalten eines Tieres ist nicht verständlich erklärbar, wenn man nicht weiß, wie es funktioniert. Und so werden wir uns nun zunächst mit einigen Grundbegriffen und -gegebenheiten der Verhaltensphysiologie allgemein beschäftigen. Denn viele dieser Aspekte werden wir in ganz verschiedenen Zusammenhängen später immer wieder benötigen. Zuerst werden wir uns mit dem Aufrechterhalten und Regulieren der Lebensvorgänge und inneren Zustände eines Tieres beschäftigen.
© Shutterstock/Ozerov Alexander
Um nicht zu viel Energie zu verbrauchen, fliegen Vögel nicht mit Maximalgeschwindigkeit zum Nest.
HOMÖOSTATISCHE REGULATION
Der Schlüsselbegriff der Regulierungsvorgänge war lange Zeit die sogenannte Homöostase.
HOMÖOSTASE
Unter Homöostase (= gleicher Stand) versteht man ein reguliertes Gleichgewicht, wobei die lebenswichtigen Funktionen innerhalb bestimmter, möglichst optimaler Grenzwerte gehalten werden.
Ändert sich einer der regulierten Werte, z. B. die Körpertemperatur, dann wird durch verschiedene innere (Zittern, Schwitzen) oder äußere (Schatten suchen) Vorgänge versucht, den „ausgerissenen“ Wert wieder „zu regulieren“. Die Regelung der Homöostase wird oft als rein reaktiver Prozess gesehen, der nur durch Zustandsänderungen aufgrund von anderen Ursachen ausgelöst wird. Wir werden jedoch sehen, dass dies z. B. bei der Tagesrhythmik nicht stimmt.
Begriff der Allostase
Der Begriff der Homöostase wird in der modernen physiologischen Literatur meistens durch den der Allostase ersetzt. Hintergrund dieser begrifflichen Veränderung ist die Erkenntnis, dass die Sollwerte eines Regelkreises sich durchaus in Abhängigkeit von verschiedenen Umweltfaktoren, aber auch in Abhängigkeit von den derzeit gerade aktiven Regulierungsvorgängen verändern können. Wer freiwillig in die Sauna geht, wird eine andere Vorstellung von wünschenswerter Umgebungstemperatur haben, als jemand, der momentan gerade mit der Aufgabe betraut ist, zwei Festmeter Kaminholz zu hacken.
Und gerade bei der Regulierung sozialer Bedürfnisse und sozialer Gegebenheiten, spielt diese Allostase eine wichtige Rolle. Wer abends freiwillig in die Disco geht, hat wahrscheinlich eine andere Vorstellung von wünschenswerter Individualdistanz zu seinen Artgenossen, als jemand, der sich vor einer schwierigen Prüfung auf einer Parkbank konzentrieren und nochmals das Gelernte Revue passieren lassen möchte. Gerade im Zusammenhang mit den Regulationsmodellen des aggressiven Verhaltens oder auch im Zusammenhang mit der Betrachtung von Stress und Belastung, wird uns das Konzept der Allostase mehr helfen können als die starren festgelegten Sollwertbetrachtungen, die der Begriff der Homöostase beinhaltet.
OPTIMIERUNGSPROZESSE
Zur Regulation wird vielfach neben den physiologischen Möglichkeiten (Wärmeproduktion, Verdauung, Nerven, Hormone), auch das Verhalten eingesetzt. Hier sind die schon erwähnten Optimierungsprozesse und -betrachtungen besonders wichtig. Schließlich sind Zeit und Energie eines Tieres immer begrenzt. Es muss also auswählen, wann es wofür wie viel Energie und Zeit einsetzen will. Letztlich sollte das alles natürlich der Fitnessmaximierung dienen, messbar aber wird es für uns z. B. anhand des Nährstoffbedarfs oder -gewinnes, oder des Zeitaufwandes. Wildlebende Tiere, und teilweise auch Haustiere, haben hier zwei grundsätzliche Möglichkeiten, die Optimierung zu erreichen, nämlich durch Optimierung der Effizienz des betreffenden Vorganges oder Maximierung der Energiegewinnungsrate.
Ein Beispiel hierfür zeigt sich bei Vögeln, die auf dem Weg zum Nest (wo die Jungen warten) nicht mit Maximalgeschwindigkeit fliegen, weil sie dabei mehr Energie verbrauchen. Solche Vorgänge sind zwar nicht exakt gemessen, aber beschrieben. Dieses Phänomen ist auch von im Rudel jagenden Raubtieren bekannt, deren Laufgeschwindigkeit bei der Suche erheblich geringer ist als die Spitzengeschwindigkeit bei der Jagd.
Stoffwechsel von Schlittenhunden
Gerade die Untersuchungen von Ray Coppinger (Coppinger und Feinstein, 2015) zum Stoffwechsel von arbeitenden, das heißt laufenden Schlittenhunden in Nordamerika, und die stoffwechselphysiologischen Arbeiten von Matthias Starck (Starck und Gerth 2012) veranschaulichen sehr deutlich die feinen Zusammenhänge. Schlittenhunde sind gerade bezüglich ihrer Körpergröße, aber auch ihrer anatomischen Verhältnisse bestens optimierte Lebewesen, die den Geschwindigkeitsaufbau und die Ausdauer bei sehr tiefen Temperaturen optimal bewältigen. Ray Coppinger konnte zeigen, dass die Körpergröße eines Alaskan Malamute den optimalen Kompromiss zwischen Oberfläche und Volumen, also Körpermasse und Körperoberfläche darstellt. Größere Hunde könnten zwar mehr Kraft ausüben, würden aber noch schneller überhitzen. Kleinere Hunde könnten die bei der Arbeit entstehende Wärme besser abstrahlen, würden aber zu viel durch die Umgebungskälte verlieren und auch weniger Muskelkraft aufbringen können. Gleichzeitig sind bei Schlittenhunden die Arbeitsmuskeln, also insbesondere die Muskeln an den Extremitäten, noch besser durchblutet als bei anderen Hunderassen. Dadurch werden die Muskeln mit mehr Sauerstoff und Nährstoffen versorgt, überhitzen aber auch schneller. Deshalb ist die Empfehlung, Schlittenhunde oberhalb des Temperaturbereichs von 8 bis 10 Grad Celsius möglichst nicht mehr, oberhalb von 15 Grad Celsius keinesfalls mehr in schnelleren Gangarten zu bewegen, verständlich. Die Untersuchungen der Arbeitsgruppe von Matthias Starck haben gezeigt, dass zwischen Sommer und Winter bei den Schlittenhunden erhebliche Unterschiede in den Stoffwechselbedingungen herrschen. Im Winter sind die Schlittenhunde an Höchstleistungen angepasst, und haben dann auch einen sehr effektiven Leistungsstoffwechsel. Im Sommer, beim Gammeldienst, müssen sie zum Teil sogar an körpereigenen Muskel- und Knochenreserven zehren, um ihre schlechten Futterbedingungen auszugleichen.
© Shutterstock/Konstantin Tronin
Schlittenhunde können ihren Stoffwechsel an die Jahreszeit anpassen. Im Winter ist ihr Leistungsstoffwechsel erhöht.
Coppinger zeigt auch an Beispielen seiner eigenen Schlittenhunde, dass diese im Tiefschnee und bei tiefen Minusgraden während des Rennens ab und zu ein Maul voll Schnee aufnehmen, um die Kühlung von innen zu unterstützen.
Im Zusammenhang mit der Energiegewinnung tritt auch die Frage der Energiespeicherung auf: Soll man lieber Energie im Körper in Form von Fett speichern, dadurch weniger beweglich werden und etliche Krankheiten riskieren, oder soll man sie in externe Nahrungsspeicher bringen, wie dies auch Hundeartige durch Vergraben tun. Dabei besteht das Risiko der Plünderung durch andere, und man muss sich den Ort merken. Welche Möglichkeit ergriffen wird, hängt wieder von den derzeitigen und zum Teil auch den vorhersagbaren Umweltbedingungen ab.
Grundstoffwechsel eines Tieres
Wichtige Bereiche, in denen homoöstatische Regelungen auftreten, sind natürlich zuerst Energiehaushalt und Wasser. Der Energiebedarf eines Tieres setzt sich aus dem Grundstoffwechselbedarf und dem Bedarf für die jeweilige Tätigkeit zusammen. Der Grundstoffwechsel wiederum hängt unter anderem von der Körpergröße und der Hirngröße ab, aber auch von bestimmten Verhaltenseigenschaften (vgl. Kappeler, 2012). So haben Tiere, die zu energieaufwendigem Verhalten befähigt sind, auch einen höheren Grundstoffwechsel.
Die Zusammenhänge zwischen Grundstoffwechsel, Lebensdauer und Persönlichkeit werden im Kapitel über Persönlichkeitstypen noch ausführlicher besprochen (siehe hier). Die wichtigsten Erkenntnisse dieser Studie wurden nicht umsonst in der Allgemeinpresse unter dem Schlagwort „Gehorsame Hunde leben länger“ zusammengefasst. Letztlich geht es hier auch um die chemischen Zusammenhänge zwischen den für den Verhaltensablauf wichtigen steuernden Botenstoffen und deren gleichzeitiger Auswirkung auf den Grundstoffwechsel, wodurch aktive, eher vorwärts-naseweis orientierte Hunde (sogenannter A-Typ) auch einen schnelleren Grundstoffwechsel und damit schnellere Abläufe im gesamten Organismus aufweisen. Zellteilungsprozesse laufen also schneller ab, und die Zahl der durchlaufenden Zellteilungszyklen ist einer der beeinflussenden Faktoren für die Alterung.
© Shutterstock/Bianca Grueneberg
Windhunde, z. B. Galgos, sind nicht an kalte Temperaturen angepasst. Sie können jedoch durch einen Mantel geschützt werden.
Thermische Neutralzone
Ein wichtiger Bestandteil der stoffwechselphysiologischen Anpassung an Umwelttemperaturen ist die Lage der thermischen Neutralzone. Jedes Säugetier besitzt einen solchen Temperaturbereich, innerhalb dessen keinerlei Energie zur Temperaturregulation, weder zum Kühlen noch zum Heizen, zusätzlich eingesetzt werden muss.
Für die meisten Säugetierarten liegt die thermische Neutralzone in der Umgebungstemperatur, die in ihrem natürlichen Lebensraum meistens vorhanden ist. Sie kann sich eventuell sogar durch jahresperiodische Veränderungen verschieben. Sie verschiebt sich aber auf jeden Fall, wenn man verschiedene Populationen der gleichen Art vergleicht, die in Lebensräumen mit unterschiedlichen Temperaturbedingungen leben. Die Thermische Neutralzone ist derjenige Temperaturbereich, der aus energetischen Gründen wegen der nicht vorhandenen Notwendigkeit zum Heizen oder Kühlen, für die Tiere die günstigsten Bedingungen liefert. Auch dieser Bereich ist nicht beliebig leicht verstellbar, was wiederum bei der Verlagerung von Hunden, z. B. aus dem Mittelmeerraum ins nördliche Europa, nicht außer Acht gelassen werden darf. Die jahresperiodische Steuerung der Energieaufnahme werden wir im Zusammenhang mit biologischen Rhythmen nochmals kennenlernen (siehe hier).
Anpassung an große Höhen
Neben der Temperaturregulation und dem Wasserhaushalt gibt es noch, zumindest bei Hunderassen aus Extremlebensräumen, eine andere bemerkenswerte ökologische Anpassung. Bekanntermaßen ist in Hochgebirgsregionen die Sauerstoffdichte in der Atemluft geringer, was zu erschwerten Atembedingungen in solchen großen Höhenlagen, bisweilen sogar zum Entstehen der berüchtigten Höhenkrankheit führt. Eine mögliche Anpassung an diese Bedingungen in großen Höhen ist eine Veränderung der chemischen Struktur des roten Blutfarbstoffs, um dadurch die Sauerstoffbindung zu verbessern. Diese, bei vielen Hochgebirgstieren zu beobachtende Anpassung finden wir auch z. B. beim tibetischen Do Khyi. Durch die Veränderung des roten Blutfarbstoffs sind diese Hunde in der Lage, auch in der „dünneren Luft“ der großen Höhenlagen in ihrem tibetischen Lebensraum noch genug Sauerstoff zu binden, und ihren großen und damit anspruchsvollen Körper zu versorgen.
© Shutterstock/Mathias Möller
Der Do Khyi hat sich an Bergregionen durch mehr Sauerstofftransport in den roten Blutkörperchen angepasst.
Wasser als wichtigstes „Lebenselixier“ muss ebenfalls sehr haushalterisch eingesetzt werden, und in diesem Zusammenhang spielt auch, unabhängig von der Bedeutung für sonstige Lebensfunktionen, die Temperaturregelung eine Rolle. Wüsten bewohnende Tiere (vgl. Müller, 1997) oder Hochgebirgsbewohner (de Lamo, 1999) zeigen uns hier eine Kombination aus physiologischen Vorgängen und Verhaltensmechanismen, die zumindest teilweise auch genetisch fixiert sind – Tiere ein und derselben Art aus heißeren oder höher gelegenen Gebieten haben unterschiedliche Stoffwechselraten, Wärmeleitfähigkeiten der Haut und Hitzetoleranzen. Auch ein Problem, das bei den derzeit beliebten Hunderettungsaktionen aus dem Mittelmeergebiet völlig missachtet wird.
© Shutterstock/Debra G
Die Hunde der Wüstenbewohner halten den hohen Temperaturen stand. Über Generationen haben sie sich an diese heiße Klimazone angepasst.
„KOSTEN“ DER NAHRUNGSAUFNAHME
Ein Faktor, der bei der Effektivierung der Nahrungsaufnahme ebenfalls eine Bedeutung hat, sind die Kosten, die die Nahrungsaufnahme selbst bzw. die Gewinnung und „Zubereitung“ der Nahrung verursacht, im Vergleich zum Nutzen durch Nährstoffgewinn. Gerade größere Fleischfresser sind hier in einer Zwickmühle; sollen sie kleine, recht leicht zu überwältigende Beute suchen und dafür Zeit und Energie einsetzen, oder sich auf größere, ertragreiche, aber wehrhafte und/oder fluchtbereite Tiere konzentrieren?
Von Wölfen ist bekannt, dass sie zwar theoretisch auch Mäuse fangen können, aber erst in Gebieten auch auf Dauer leben, in denen mindestens bibergroße Beutetiere vorhanden sind (Bibikoff, 1992). Sind aber genug große Beutetiere da, werden Beutegreifer sehr wählerisch und fangen nur ausgewählte Tiere oder fressen nur die „wertvollsten“ Teile, wie etwa von Bären beim Lachsfang bekannt ist. Dies kann das gleiche Individuum in unterschiedlichen Zeiten sein, je nach Abwägung des Aufwandes zum Ertrag der Nahrung. Die hierbei im Innern des Tieres ablaufenden Entscheidungsprozesse und ihre Mechanismen sind noch nicht in letzter Einzelheit verstanden, die Konsequenzen daraus spielen aber eine bedeutende Rolle. Bemerkenswert bezüglich des Hundes ist, dass z. B. Zimen (1987) feststellt: Die Fähigkeit zur effektiven Abschätzung von Aufwand und Erfolg sei auf dem Weg vom Wolf zum Hund verlorengegangen, daher die erfolglosen Hetzjagden von Haushunden auf Wild beim Spaziergang.
Die Optimierung der Nahrungsaufnahme können wir auch besonders gut beim Nahrungsspektrum der menschenferner lebenden, bis verwilderten Haushunde erkennen (Gompper, 2014; Spotte, 2012). Nur in ganz seltenen Ausnahmefällen werden von diesen verwilderten und menschenfern lebenden Haushunden tatsächlich aktive und damit auch energieaufwendige Jagden nach größeren Beutetieren (seien es größere Wildtiere oder auch Nutztiere) beschrieben. Die Nahrungssuchstrategie besteht vielmehr in einer opportunistischen, eher an Füchse oder Kleinbären erinnernden Suche nach verwertbaren Happen, seien es Aas, menschliche Nahrungsreste, Kleintiere oder bisweilen auch pflanzliche Nahrungsbestandteile.
Jagderfolg
Wie fein abgestimmt die energetischen Bedingungen bei der aktiven Jagd auf Großtiere sein müssen, zeigen unter anderem die Untersuchungen von David Macdonald am Afrikanischen Wildhund (Macdonald, 2006). Dieser, bisweilen auch als Hyänenhund bezeichnete Großkarnivor kann, wie Untersuchungen an wildlebenden Hunden und ihrem Stoffwechsel zeigen, nur dann überleben, wenn er mindestens 3,5 Kilogramm Huftierfleisch pro Tag erbeuten und fressen kann. Verlieren diese Hunde 25 % ihrer Beute an Konkurrenzarten, z. B. an die Tüpfelhyäne, so müssten sie anstatt 3,5 Stunden pro Tag 12 Stunden pro Tag jagen. Damit würde ihr Energieaufwand so groß werden, dass sie ihn selbst bei optimalem Jagderfolg nicht mehr decken könnten. Aus ähnlichen, energetischen Betrachtungen ergibt sich auch, dass für rein karnivore Arten der Familie der Hundeartigen oberhalb eines Körpergewichts von 21 Kilogramm kaum mehr kostendeckend mit kleinen Beutetieren allein der Energiebedarf gedeckt werden kann. Hundeartige mit Körpergewichten oberhalb von 21 kg müssen daher Großtierbeute jagen.
DER HUND, EIN OMNIVOR
Nochmals betont werden muss an dieser Stelle allerdings, dass der Haushund nicht zu diesen, als Hyperkarnivor bezeichneten, rein Fleisch fressenden Arten gehört. Er gehört, wie die genannten Beobachtungen an verwilderten Haushunden sowie auch die stoffwechselphysiologischen Bedarfszahlen der Tiermedizin zeigen, zu den Omnivoren, mit einem gewissen fleischlichen Grundanteil.
VERMEIDUNG VON KRANKHEITEN
Auch die Vermeidung von Parasiten und Krankheiten kann ein wichtiger Teil der homöostatischen Regulation sein. Meidung eines von Parasiten befallenen Artgenossen anhand seines Aussehens (vgl. Wehnelt, 2000), Geruchs (Kavaliers et al., 2003) oder Verhaltens, kann nicht nur bei der Partnerwahl eine Rolle spielen. Nunn (2003) zeigt, dass verschiedene Verhaltensweisen nach der Kopulation, z. B. heftiges Urinieren oder Genitallecken, der Verminderung des Infektionsrisikos für Geschlechtskrankheiten dienen können. Auch bei Hunden finden wir diese Verhaltensweisen nach der Paarung.
Noch nicht näher untersucht sind dagegen bei Hundeartigen, die allerdings anekdotisch von vielen Trainern und Haltern beschriebenen Beobachtungen, wonach Hunde sehr fein erkennen, wenn ein Artgenosse erkrankt ist, und diesen dann je nach vorangehender Qualität ihrer Beziehungen entweder ausgrenzen oder auch mit intensivem Krankenpflegeverhalten betreuen. Krankenpflegeverhalten wiederum ist durchaus auch von wildlebenden Kaniden, z. B. Wölfen (Bloch, 2009, 2017), Afrikanischen Wildhunden (Rasmussen, 2006) und anderen beschrieben.
HORMONE UND BINDUNGSFÄHIGKEIT
Ebenso aufregend sind Ergebnisse, die aus einer Zusammenfassung von hormonphysiologischen mit Verhaltens- und modernsten neurobiologischen Forschungsansätzen. Neue Arbeiten dazu zeigen, dass es bestimmte Regionen im Vorderhirn nahezu aller Wirbeltiere gibt, die mit An-/Abwesenheiten von Revierverteidigung, sozialen Bindungen, Aggression/Dominanz oder Sexualverhalten in Beziehung stehen. Diese Regionen sind untereinander vernetzt, und durch Unterschiede in der Ausprägung können Art-/ Populations- oder Geschlechtsunterschiede in den genannten Verhaltensbereichen abgebildet und teilweise erklärt werden. Neben einigen Regionen an der Basis von Groß- und Mittelhirn (vgl. Goodson, 2005) scheint auch bei Raubtieren sowie bei Primaten die Größe der Neuhirnrinde (Dunbar und Bever, 1998) eine wichtige Rolle zu spielen.
Neuere und detailliertere Betrachtungen der Zusammenhänge zwischen Hirngröße, Hirnregionen, systematischer Position im Tierreich, und verschiedene andere Einflussfaktoren zeigen, dass es hier wohl noch etwas komplizierter zugeht: Shultz und Dunbar (2007, 2010), Finarelli und Flynn (2009) und andere lassen erkennen, dass außerhalb der Ordnung der Primaten, also auch z. B. bei den Karnivoren und damit den Hundeartigen, größere Gehirne in der Regel mit Paarbindungen oder anderen, lang andauernden sozialen Beziehungen einhergehen. Nur bei den Primaten ist offensichtlich auch die Gruppengröße noch ein weiterer Faktor, der die Gehirngröße beeinflusst.
Gerade die Einbeziehung von ausgestorbenen Arten, über deren Sozialsysteme wir selbstverständlich keine direkten Beobachtungen haben, die aber die Zusammenhänge zwischen Körpergröße, Nahrung (am Gebiss erkennbar) und ihren Lebensräumen durch die botanischen Begleitfunde sehr deutlich offenbaren, lassen diese Hypothese der Paarbindungsabhängigkeit der Gehirnentwicklung bei Hundeartigen besonders wahrscheinlich werden.
© Milada Krautmann
Blick auf das Gehirn des Hundes (von oben).
© Milada Krautmann
Das Riechhirn macht beim Hund 10 %, beim Menschen nur 1 % des Gehirns aus.
SOZIALES NETZWERK IM GEHIRN
Auch die Zusammenhänge zwischen Gehirnregionen und Botenstoffkonzentrationen sind offensichtlich dynamischer, als dies eine weitgehend statische Betrachtung ihrer Funktionen bisher gezeigt hat. Goodson und Kabelik (2009) beschreiben ausführlich die Dynamik des sogenannten sozialen Netzwerks im Gehirn, also der bereits angesprochenen Zusammenschaltung einer Reihe von Gehirnregionen im limbischen System, dem Mittelhirn und dem Vorderhirn. Offenkundig ist, dass nicht jede dieser Regionen für eine bestimmte Option im Sozialverhalten zuständig ist. Stattdessen sind diese Hirnregionen in einer dynamischen Weise miteinander verschaltet, reichen sich gegenseitig Informationen weiter, hemmen und fördern ihre neuronalen Aktivitäten gegenseitig, und dies auch noch in Abhängigkeit von den Konzentrationen der wichtigsten, dabei beteiligten Botenstoffe.
Zu den wichtigen Botenstoffen, die in diesem Gehirnnetzwerk aktiv sind, gehören zum einen die Steroide (sowohl das Cortisol als auch die Sexualsteroide), aber auch Oxytocin und Vasopressin, auf die wir im Kapitel über die sozialen Bindungen nochmals treffen werden (siehe hier