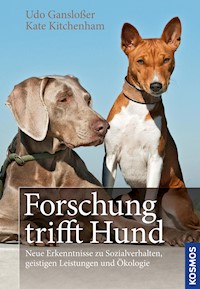17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kosmos
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Bindung, Dominanz, Prägung und Rangordnung – Begriffe, die von Hundehaltern immer wieder benutzt werden. Doch was sagen sie wirklich aus, welche Verhaltensweisen stecken dahinter und welchen Zweck verfolgt dieses Verhalten? Der Blick in die Tierwelt macht deutlich: Verhalten ist immer zweckgebunden und nie sinnlos. Hier erfährt der Hundehalter, wie Verhalten entsteht, wie sich Affen, Elefanten oder Meerschweinchen untereinander verständigen, welche Rangordnungen sie bilden und wie er diese Erkenntnisse auf seinen eigenen Hund übertragen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 305
Ähnliche
Dieses E-Book ist die digitale Umsetzung der Printausgabe, die unter demselben Titel bei KOSMOS erschienen ist. Da es bei E-Books aufgrund der variablen Leseeinstellungen keine Seitenzahlen gibt, können die Seitenverweise der Printausgabe hier nicht verwendet werden. Statt dessen können Sie über die integrierte Volltextsuche alle Querverweise und inhaltlichen Bezüge schnell komfortabel herstellen
Tinbergens vier Fragen und das Gerüst der Verhaltensbiologie
Verhalten zu definieren mag trivial erscheinen, Kappeler (2006) zitiert einige Versuche dazu, am besten finde ich noch Folgendes: „Verhalten ist das, was tote Tiere nicht mehr tun.“
Weniger leicht zu umreißen ist, was die Verhaltensbiologie oder Ethologie tut. Denn es gibt eine ganze Reihe von Wissenschaften, von der Psychiatrie bis zur Soziologie, die sich auch mit dem Thema Verhalten beschäftigen. Das spezifisch Biologische an der Ethologie muss also schon genauer beschrieben werden. Richtungsweisend dafür war eine Arbeit von Nico Tinbergen (1963), in der er erstmals seine inzwischen sehr berühmt gewordenen vier Fragen als Forschungsrahmen der Verhaltensbiologie aufstellte.
Erst wenn alle vier Fragen von Tinbergen für ein Merkmal, sei es Verhalten, Organ oder Aussehen eines Tieres beantwortet sind, könnte man dieses als erklärt betrachten.
Verfahren zur Überprüfung eines Verhaltens
Beschreibung eines Phänomens
Vorausgehen muss jedoch eine ganze Menge Vorarbeit: Zunächst gilt es, das zu erklärende Phänomen exakt und umfassend und so interpretationsarm wie möglich zu beschreiben. Diese Beschreibung ist eine notwendige Voraussetzung für die wissenschaftliche Erklärung, aber nur durch Beschreiben und Begriffsbildung allein ist überhaupt nichts erreicht.
Aufstellen von Hypothesen
Hat man das Phänomen, etwa ein bestimmtes Verhalten („männliche Hunde heben zum Pinkeln meist das Bein, weibliche selten“), exakt beschrieben (das heißt, wie genau tun beide Geschlechter das), dann geht es darum, testbare Hypothesen aufzustellen, also Erklärungsversuche, die überprüfbar sind. Auch das Aufstellen von Hypothesen und Spekulationen ist noch keine Wissenschaft, behaupten lässt sich schließlich viel.
Eine gute Hypothese muss daher mehrere Anforderungen erfüllen:
▶ Sie muss allgemeingültig für das zu erklärende Phänomen sein,
▶ sie muss testbar sein,
▶ sie muss einen biologischen Sinn ergeben,
▶ sie muss eine Gegenhypothese haben, das heißt, es muss möglich sein, durch die folgende Datensammlung zwischen ihr und einer alternativen Erklärungsmöglichkeit zu unterscheiden.
Aufstellen von Alternativ- bzw. Nullhypothesen
Meist stellt man seine Hypothese, die oft als H1 bezeichnet wird, einer Alternativhypothese H2 gegenüber, die ein anderes Erklärungsmodell zur Grundlage hat oder eine Nullhypothese H0, die besagt, dass der behauptete Effekt keinen erkennbaren Einfluss im Sinne meines Überlegens auf das zu erklärende Phänomen hat.
Versuche, Langzeitbeobachtungen und Experimente
Hat man die Hypothesen testbar gemacht, geht es an die Überprüfung durch systematische und unabhängige Datensammlung, sei es durch Versuche, Langzeitbeobachtungen oder Experimente.
Am Ende steht die Annahme oder Zurückweisung beziehungsweise Nichtbestätigung der Hypothese(n). Erst dann, wenn die Hypothesen zweifelsfrei bestätigt werden, kann man die Sache als in diesem Aspekt erklärt betrachten.
Das Sparsamkeitsprinzip
Zu diesem gängigen wissenschaftlichen Standardverfahren gehören noch einige weitere einschränkende Aspekte. So ist es ein seit Jahrhunderten gepflogenes Verfahren, das sogenannte „Sparsamkeitsprinzip“ oder „Prinzip der sparsamsten Erschließung“ walten zu lassen. Dieses besagt, dass im Zweifelsfall von mehreren alternativen Erklärungen diejenige zu bevorzugen ist, die mit den wenigsten (vor allem den wenigsten derzeit nicht testbaren) Hilfsmaßnahmen auskommt. Dies gilt zum Beispiel für die Annahme sogenannter höherer geistiger Leistung als Erfolg. Außerdem ist, und das gilt für die Verhaltensbiologie ganz besonders, die Biologie in weiteren Bereichen eine sogenannte probabilistische Wissenschaft, also eine, die mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten muss, im Gegensatz etwa zur klassischen Physik, deren Ergebnisse als Naturgesetze von Zeit und Raum unabhängig sind. Zwar folgen auch Lebewesen den Naturgesetzen, aber durch die biologiespezifischen Einflüsse der Vorgeschichte jeden Tieres einerseits und der hierarchischen Organisation und Wechselwirkungen (zwischen Zellen, von Zellen zu Organen, von Organen zu Organkomplexen, zu ganzen Tieren, die wieder in ein Sozialsystem, dann eine Population und schließlich ein Ökosystem eingebunden sind) andererseits, kommt es eben hier zu mehr Variabilität. Deshalb sind die Aussagen der Verhaltensbiologie grundsätzlich nur mithilfe analysierend-schließender Statistik zu überprüfen und dazu bedarf es vor allem größerer Datenmengen. Wer sich genauer zu diesen wissenschaftstheoretischen Aspekten und dem methodischen Vorgehen informieren will, dem sei hier Lamprecht (1999) zur Methodik und Mayr (2000) empfohlen. Ich habe diese Zusammenhänge als kleinen Umweg an den Anfang des Kapitels gestellt, weil gerade im Bereich des Hundeverhaltens viele sogenannte Erklärungen und Konzepte, meist in Buchform und auf Vorträgen, mit viel Erfolg verkauft und angeboten werden, die diesen simplen Anforderungen einer wissenschaftlichen Arbeit überhaupt nicht gerecht werden.
Beschreibung von Verhalten
Schon die Beschreibung des Verhaltens ist ausgesprochen schwierig, wenn man es wirklich exakt definieren will. Das sichtbare Verhalten sollte in messbare Einheiten zerlegt werden. Es ist nicht nur die Struktur jedes Verhaltens zu erfassen, sondern auch die Latenz (Zeitabstand zu vorigem Verhalten des äußeren Ereignisses), die Dauer, die Häufigkeit und wenn möglich die Intensität (Kappeler 2006, Wehnelts Beyer 2002). Und schließlich gibt es, sobald man diese Beschreibungen für jedes erkennbare Verhalten erstellt hat, verschiedene Aufzeichnungsmethoden.
Elemente sollten bei Beschreibungen immer neutral sein („Kopf hoch bei gespitzten Ohren“), nicht interpretierend („Überlegenheitsgeste“).
Erst wenn zum Beispiel die Statistik zeigt, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Hund B, nachdem Hund A dieses Verhalten gezeigt hat, jenen Platz verlassen oder sonstige seiner eigenen Interessen nicht ausüben wird, darf man festlegen, dass dieses Verhalten die Überlegenheit von A auszudrücken scheint, der statistische Wahrscheinlichkeitswert sowie die Stichprobe, also auf wie viel Beobachtungen meine Aussage beruht, sollte angegeben sein! Ich überlasse es den Lesern, mithilfe dieser Qualitätskriterien die einschlägigen Hundeverhaltenstheorien genau zu überprüfen.
Tinbergens vier berühmte Fragen
Die ersten beiden der vier Fragen von Nico Tinbergen befassen sich mehr mit den geschichtlichen beziehungsweise mit den evolutionsbiologischen Aspekten.
Frage drei und vier befassen sich mit den Mechanismen, die das Verhalten steuern.
Frage 1 – „Woher?“
Die erste Frage ist die nach dem stammesgeschichtlichen „Woher?“ In diesem Verfahren wird untersucht, wie sich das betreffende Merkmal, zum Beispiel eben ein Verhaltenskomplex, von den Vorfahren der betreffenden Art her weiterentwickelt hat und welche gemeinsamen Vorstufen dieses Verhalten im Laufe der stammesgeschichtlichen Entwicklung von unseren heute zu betrachtenden Tieren angenommen hat.
Diese Frage nach dem stammesgeschichtlichen „Woher?“ ist zugegebenermaßen für Verhaltensmerkmale schwerer zu beantworten als beispielsweise für Organe oder andere Merkmale des äußeren Aussehens. Schließlich lassen sich Verhaltensmerkmale nur in seltenen Fällen als Fossilien finden.
Die Homologiemethode
In der Biologie gibt es eine ebenso erprobte und akzeptierte Methode, wie man stammesgeschichtliche Vergleiche anstellen kann, nämlich die sogenannte Homologiemethode. Hierbei werden die Ausprägungen bestimmter Merkmale bei nahe verwandten Arten verglichen. Aus den Gemeinsamkeiten beziehungsweise Unterschieden dieses betreffenden Merkmals bei den verwandten Arten wird auf die wahrscheinlichen Vorstufen bei den Vorfahren und im Laufe der Stammesgeschichte zurückgeschlossen. Mit diesem Verfahren kann man zum Beispiel Lautgebungen oder komplexe Verhaltensmuster des Werbeverhaltens oder Drohverhaltens, aber auch Bewegungsmuster in anderen Zusammenhängen vergleichen. Wenn wir diese Methode auf das Verhalten der Hundeartigen anwenden, so stellen wir beispielsweise fest, dass innerhalb der Untergruppe der Wolfsartigen (Canini) das Hervorwürgen von Nahrung an die Jungtiere entstanden ist, während die Füchse (Vulpini) dieses Verhalten nicht zeigen. So kann auf eine Trennung der beiden großen Entwicklungslinien vor dem stammesgeschichtlichen Entstehen dieses Futterhochwürgeverhalten geschlossen werden (s. Gansloßer 2006).
Frage 2 – „Wozu?“
Die zweite Frage ist derzeit in der Verhaltensbiologie ganz besonders interessant, nämlich die Frage nach dem „Wozu?“ Hier wird letzten Endes nach der Bedeutung des betreffenden Merkmals für den Fortpflanzungserfolg gefragt, denn nur der Fortpflanzungserfolg zählt als Erfolgskontrolle der evolutionsbiologischen Prozesse. Die dabei stattfindenden Prozesse führen im Laufe vieler Generationen zu einer zunehmend besseren Anpassung einer Art an ihren jeweiligen Lebensraum.
Individualselektion
Diejenigen Mitglieder der Art, die besonders gut mit den vorhandenen Umweltbedingungen klarkommen, werden durchschnittlich mehr Nachkommen in die nächste Generation bringen als ihre Konkurrenten, deren Anpassungsfähigkeit nicht so vorteilhaft ist. Sind nun diese Anpassungsfähigkeiten zumindest erblich verankert, so wird im Laufe der Generationen der Erbanteil der besser Angepassten eben größer und die weniger gut Angepassten der Population sterben nach und nach aus.
Dieser Prozess wird als natürliche Auslese oder natürliche Selektion bereits von Darwin beschrieben. Die Selektion wirkt hier zunächst einmal auf das Individuum, jedes einzelne Tier muss sich mit seiner Erbausstattung und seinen Eigenschaften bewähren.
Verwandtschaftsselektion
Zusätzlich zu dieser Individualselektion gibt es dann noch die Verwandtenselektion, denn jeder hat ja auch einen gewissen Anteil seiner Erbeigenschaften mit seinen Verwandten gemeinsam (zum Beispiel 50% mit Vollgeschwistern, 25% mit Neffen/Nichten). Über diese indirekte Selektion ist zum Beispiel erklärbar, dass man evolutiv gesehen mehr Vorteile hat, wenn man drei Neffen/Nichten aufzieht als ein eigenes Kind. Durch diese Verwandtschaftsselektion werden zum Beispiel die Brutpflegehelfersysteme der Hundeartigen begründbar.
Arterhaltung
Eine positive Wirkung auf die Arterhaltung ist stets nur eine Konsequenz, aber nie eine Ursache des jeweiligen Verhaltens. Insofern ist die Aussage „dieses oder jenes Verhalten dient dem Arterhalt“ als Erklärung wertlos. Der sogenannte Kampf ums Dasein besteht normalerweise nicht aus direkten und blutigen Auseinandersetzungen, sondern eher aus einem Wetteifern um „Marktanteile“. Dabei darf man jedoch nicht den Fehler machen, anzunehmen, dass alle Merkmale, die wir bei einem Lebewesen finden, auch adaptiv, also vorteilhaft sein müssten. Es genügt, wenn sie keine Nachteile haben. Viele Merkmale, die Tierarten in den Genen verankert haben, sind neutral. Das bedeutet, dass sie den Fortpflanzungserfolg ihres Trägers weder positiv noch negativ beeinflussen.
Fitness
Der Fortpflanzungserfolg wird als die sogenannte Fitness eines Tieres bezeichnet, wobei man unter Fitness hier den Anteil des eigenen Erbgutes am gesamten Genpool der nächsten Generation, also den Anteil eigener Erbeigenschaften im Vergleich zu denen, die von Konkurrenten vererbt wurden, gesehen wird. Betont werden muss außerdem, dass bei diesen sogenannten funktionalen Erklärungen, also bei Erklärungen, die den Fortpflanzungserfolg und die Anpassungsfähigkeit einer Art betreffen, Begriffe verwendet werden, die aus der Wirtschaftsmathematik und Wahrscheinlichkeitsrechnung stammen, etwa der Begriff der Strategie oder das Optimierungsprinzip. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die betreffenden Tiere sich der zugrundeliegenden Prozesse und Entscheidungen bewusst sein müssen. Es genügt, wenn sie sich richtig verhalten, auch wenn das „richtige“ Verhalten „nur“ im Erbgut verankert ist, anstatt dass es durch bewusste oder rationale Entscheidungen ausgewählt wurde. Betrifft das betrachtete Verhalten nur ein einzelnes Individuum, zum Beispiel bei der Nahrungssuche oder sonstigen Auseinandersetzungen mit der nichtsozialen Umwelt, so können einfache Optimierungsmodelle herangezogen werden. Ist z.B. bekannt, wie viel Energie ein Tier zur Nahrungssuche pro gelaufenem oder geflogenem Kilometer verbraucht, dann kann errechnet werden, für welchen Nahrungsbrocken es sich lohnt wie weit zu laufen. Sind jedoch zwei oder mehr Individuen an der Entscheidung beteiligt, so müssen die Entscheidungen der jeweils anderen Artgenossen mitberücksichtigt werden. Dies ist dann das Feld der evolutionären Spieltheorie, auf die wir im Kapitel über Kampf und Aggressionsverhalten noch näher eingehen werden.
Strategien
Strategien sind hier im Sprachgebrauch der Verhaltensökologie solche Entscheidungen, die durch genetische Vorgaben fixiert sind und nach dem Motto „wenn Situation A, dann tue X, wenn Situation B, dann tue Y“ ablaufen. Die Strategien, die sich im Laufe der Evolution dann durchsetzen und auch erhalten bleiben, werden als evolutionär stabile Strategien (ESS) bezeichnet.
Evolutionär stabile Strategien sind solche Strategien, die unter den Lebensbedingungen der Population durch keine andere denkbare Alternative ersetzt werden können, weil jede andere denkbare Alternative für die beteiligten Individuen weniger Vorteile oder mehr Nachteile bringen würde.
ESS müssen nicht jeweils auch den individuellen Vorteil jedes Beteiligten an der Auseinandersetzung maximieren, sie sind vielmehr häufig auch Kompromisse zwischen den Anforderungen verschiedener Mitbewerber.
Kosten-Nutzen-Analyse
Bei allen Betrachtungen zur Frage nach dem „Wozu?“ werden Kosten-Nutzen-Analysen angestellt, die den Ausgang einer möglichen Entscheidung oder die Folgen einer Verhaltensentscheidung berücksichtigen müssen. Dies ist das Arbeitsgebiet der Verhaltensökologie, beziehungsweise wenn Sozialverhalten dabei betrachtet wird, spricht man auch von Soziobiologie. In neuester Zeit werden die Erkenntnisse der Verhaltensökologie insbesondere durch Artvergleiche von nahe verwandten Arten in anderen Lebensräumen oder nahe verwandten Arten mit unterschiedlichen Sozialsystemen noch weiter überprüft. Verhaltensökologische Betrachtungen erlauben zum Beispiel eine Aussage über den Anpassungswert der Rudelbildung, der gemeinsamen Jungenaufzucht oder der gemeinsamen Revierverteidigung bei Hundeartigen. Diese Untersuchungen haben beispielsweise starke Zweifel an der häufig geäußerten Meinung aufkommen lassen, dass die gemeinsame Jagd oder die gemeinsame Jungenaufzucht die Fortpflanzungserfolge und damit die evolutionsbiologischen Antriebsmotoren der Rudelbildung bei Hundeartigen beeinflusst hätten. Vielmehr erscheint die gemeinsame Revierverteidigung oder das schnellstmögliche Fressen der einmal geschlagenen Beute, bevor die Konkurrenz sie findet, ein viel wichtigerer evolutionsbiologischer Antrieb zu sein, die Rudelbildung wäre also eher eine Anpassung an Revier und Nahrungsverteidigung.
Kommen wir nun zur dritten und vierten Frage, die häufig als die beiden proximaten Fragen zusammengefasst werden, um den ultimaten, den evolutionsbiologisch-evolutionsgeschichtlichen Fragen gegenübergestellt zu werden.
Frage 3 – „Wie?“
Die dritte Frage ist die nach dem „Wie?“ Hier geht es um die beteiligten Mechanismen, die die Ausprägung eines bestimmten Verhaltensmerkmals steuern. Ob es sich dabei um die beteiligten Sinnesorgane, Hirnregionen, Nerven oder Hormonimpulse handelt, ob es um auslösende Reize und auslösende Situationen geht, immer wird die Frage nach dem „Wie funktioniert das Tier in dieser Situation?“ gestellt. Auch Fragen nach dem Einfluss von Jahreszeiten, Sonneneinstrahlung, Temperatur und anderen Klimafaktoren sind hier zu nennen. Gerade in diesem Bereich sind durch die neueren und verfeinerten Analysemethoden der Laboranalytik in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte erzielt worden. So ist es heute möglich, Hormone, seien es Stress- oder Fortpflanzungshormone aus Kot, Urin oder Speichel zu bestimmen, ohne dass eine Blutabnahme erfolgen muss. Solche Verbesserungen haben erheblich dazu beigetragen, die Frage nach den Verhaltensmechanismen aus dem „black box“ der frühen Verhaltensbiologie zu überarbeiten und wiederum in eine testbare und damit dem wissenschaftlichen Erforschen zugängliche Form zu überführen. Umso wichtiger ist es, die Begriffe in diesem Zusammenhang exakt zu definieren und der wissenschaftlichen Analyse im hier geschilderten Sinne zugänglich zu machen.
Motivationsanalyse
Begriffe wie Trieb oder auch Motivation erklären zunächst einmal überhaupt nichts. Sie sind überdies so verwaschen und schwammig, dass sie kaum einer messbaren und damit exakt quantifizierbaren Analyse zugänglich sind.
Die sogenannte Motivationsanalyse galt früher als die Königsdisziplin der klassischen Ethologie. Sie war mit sehr großem methodischem Aufwand, sehr viel Arbeit und mit einem sehr guten Gespür für das Verhalten der zu untersuchenden Tierart verbunden, denn man musste versuchen, das zu untersuchende Verhalten in möglichst vielen verschiedenen Situationen mit genau quantifizierbaren Außenreizen in Verbindung zu bringen, um durch diese Außenreize unterschiedliche Ausprägung auszulösen.
Wenn heute vorschnell von Motivation oder sogar von Trieb gesprochen wird, so hat sich fast niemand die Mühe gemacht, auch nur ansatzweise diese Aufwände zu betreiben. In der Grundlagenforschung der Verhaltensbiologie wird der Motivationsbegriff ohnehin fast nicht mehr verwendet. Die gängigen Lehrbücher der Verhaltensbiologie versuchen, ganz ohne ihn auszukommen. Hogan (2005) ist einer der wenigen Autoren in einem grundlegenden Lehrbuch der Verhaltensbiologie, der ein ganzes Kapitel über das Motivationsproblem schreibt.
Motivationsbegriff nach Hogan
Seine Motivationsdefinition umfasst Faktoren, die für die Auslösung, Aufrechterhaltung und Beendigung eines Verhaltens verantwortlich sind. Er nennt als wichtige Bestandteile der Motivationsuntersuchung
▶ die Frage nach der Rolle der inneren und äußeren auslösenden Faktoren,
▶ die Frage nach den spezifischen oder mehr generellen Wirkungen der genannten Faktoren,
▶ die Frage nach der zentralen oder eher peripheren Wirkungsstätte der genannten Faktoren.
Besonders interessant wird diese Frage jeweils, wenn mehrere, zum Teil sogar konkurrierende Systeme miteinander wetteifern und das entstehende Verhalten gemeinsam beeinflussen. Hier werden die hemmenden, auslösenden, dirigierenden und vorbereitenden Effekte sowohl der Auslösereize als auch der nervösen wie hormonellen, zentralen und peripheren Aktivitäten besonders eng miteinander verknüpft.
Auch bei diesen Studien bedarf es einer sehr hohen methodischen und analytischen Begabung und man sollte daher den Motivationsbegriff nach Möglichkeit nur verwenden, wenn man durch einschlägige Studien nachgewiesen hat, dass es sich hier um ein gemeinsames System handelt.
Im Bereich der angewandten Verhaltensforschung wird der Motivationsbegriff noch häufiger verwendet als im Grundlagenforschungsbereich, denn für die Beurteilung von Tierhaltungen, seien es Nutztiere oder Zootiere, oder eben für die Ausbildung von Tieren, seien es Hunde, Pferde oder andere, sind die aus der Motivationsforschung stammenden Erkenntnisse häufig sehr hilfreich. Jedoch sollten auch hier die einschlägigen exakten Untersuchungen vorangehen, bevor man ein bestimmtes Motivationssystem als gegeben hinnimmt oder einen „Trieb“ für irgendetwas postuliert. Dies gilt umso mehr, je komplexer und aus mehr verschiedenen Verhaltensweisen zusammengesetzt das betreffende System ist.
Frage 4 – „Wodurch?“
Die vierte und letzte Frage wendet sich an das „Wodurch?“, an die Frage nach der individualgeschichtlichen Entwicklung eines Merkmals. Hier werden vor- und nachgeburtliche Reifungs- und Lernprozesse, genetische Einflüsse und Umweltfaktoren auf das Verhalten, sowie das Zusammenwirken mehrerer Faktoren des sozialen und nichtsozialen Umfeldes analysiert, um die sogenannte Ontogenese, also die Individualentwicklung des betreffenden Merkmals nicht nur zu beschreiben, sondern auch zu untersuchen, welchen Einfluss welcher Faktor auf die Ausbildung des betreffenden Merkmals jemals hat.
Dieser Frage nach dem „Wodurch?“ werden wir ein eigenes Kapitel widmen, so dass wir an dieser Stelle nicht weiter darauf eingehen müssen. Es sollte jedoch schon hier betont werden, dass diese Faktoren in einem sehr komplexen wechselseitigen Zusammenwirken das zukünftige Individuum formen.
Stamps (2003) hat betont, dass Jungtiere keineswegs passive Empfänger der einschlägigen Umwelteinflüsse seien. Jungtiere suchen und formen vielmehr die Umwelt, die dann wiederum in einem nächsten Schritt die Lern- und Sozialisationseinflüsse auf das Jungtier, sein Nervensystem und seine Verhaltensausstattung prägt. In der Ökologie wurde für die Erklärung dieser Wechselwirkungen der Begriff der ontogenetischen Nische geschaffen (s. Gansloßer 1998), das heißt, man betrachtet jedes Entwicklungs- und Altersstadium so, dass es den in diesem Alter herrschenden Anforderungen und Bedingungen möglichst optimal angepasst sein sollte. Jungtiere sind keine unfertigen Erwachsenen, sondern sie sind Tiere, die mit den Anforderungen des momentanen Alters- und Reifezustandes möglichst optimal zurande kommen. Nur dann kann bereits während der ontogenetischen Entwicklung auch die Anpassung und damit die Fitnessmaximierung vorbereitet werden. Die Durchgangsstadien der Entwicklung sind also immer zugleich auch Stadien der momentanen Optimierung. Diese Doppelanforderung ist es, die die Interpretation von Jungtierverhalten so schwer macht.
Neue Betrachtungsweisen in der modernen Verhaltensbiologie
Im Laufe ihrer Geschichte hat die Verhaltensbiologie eine Reihe von Stadien durchlaufen, die jeweils mit bestimmten Konzepten und theoretischen wie methodischen Eigenmerkmalen verbunden waren (s. Hinde 2005, Kappeler 2006). Nach einer Frühphase, die überwiegend von Vogelbeobachtern und Ornithologen bestimmt war (O. Heinroth hat damals zum Beispiel den Prägungsbegriff geschaffen), folgte eine getrennte Entwicklung in Europa und Nordamerika. Die nordamerikanische Richtung, die überwiegend psychologisch/lerntheoretisch ausgerichtet war, betonte die Bedeutung der Umwelt, in der Extremform des Behaviorismus wurde sogar angenommen, jedes Lebewesen käme als weißes Blatt auf die Welt und müsste alles lernen.
In Europa entwickelte sich die sogenannte klassische Ethologie, die in den 1930er Jahren vorwiegend von Lorenz und Tinbergen vorangetrieben wurde. Hier wurde sehr stark der angeborene Teil des Verhaltens sowie die innere Verursachung (Lorenz schuf dafür den Begriff der „reaktionsspezifischen Energie“) betont. Viele Extrempositionen, sowohl in der Gegenüberstellung des angeborenen im Gegensatz zum erworbenen Verhalten wie in der Betonung der inneren Antriebe, sind vorwiegend als gezielte und teilweise überspitzte Gegenreaktionen gegen die Behavioristen zu verstehen. Seit den 1950er Jahren kam es langsam zu einer Annäherung beider Extrempositionen und es wurde zunehmend klar, dass Begriffe wie „angeborener Auslösemechanismus“, „Erbkoordination“ oder „xy-Trieb“ viel zu grobe Vereinfachungen darstellten. Als gegen Ende der 1960er Jahre dann die sich auf Fortpflanzungsoptimierung und Individualselektion beziehenden Theorien der Verhaltensökologie und Soziobiologie zunehmend Anerkennung fanden, war zugleich der Streit um die Existenz angeborenen Verhaltens entschieden.
Nur wenn Verhalten zumindest eine erbliche Komponente hat, kann Selektion wirken und Anpassungsprozesse beeinflussen.
Mathematische Modelle
Auch die mathematischen Modelle der theoretischen Verhaltensökologie waren anfänglich noch sehr grob und kaum in der Lage, das Verhalten hoch entwickelter Tierarten sofort zu erklären. Zudem fehlte es lange Zeit an Vorstellungen und Messmethoden, um die in diesen Modellen geforderte (und auch oft beobachtbare) Verhaltensplastizität zu bearbeiten. Seit Beginn der 1990er Jahre ist nun eine zunehmende Annäherung der proximat und ultimat forschenden beziehungsweise argumentierenden Teile der Verhaltensbiologie zu beobachten, wobei sich viele ehemals als „Black-box-Begriffe“ betrachteten Erscheinungen, etwa Bindung oder Beziehung, durchaus als (zum Beispiel hormonphysiologisch) messbare wie auch mit Kosten und Nutzen für das betreffende Tier funktional bewertbare Größen erweisen. Jedoch darf diese (sehr wichtige) Annäherung der Standpunkte nicht zu einer Vermischung der Argumente führen. Wer eine Frage nach dem Selektionswert eines Verhaltens stellt (Was hat die Hündin davon, die Welpen ihrer Konkurrenten umzubringen, Frage „Wozu?“), darf nicht mit einem Mechanismus (Das ist nur der Stress, Antwort „Wie?“) antworten.
Neuere Entwicklungen
Die neuesten Entwicklungen der Verhaltensbiologie betreffen einerseits neuere und präzisere Verfahren zur Auswertung der Daten sowie verbesserte Berechnungsmethoden für stammesgeschichtlich-evolutionsbiologische Fragen, die konsequente Anwendung von Kosten-Nutzen-Analysen und Optimierungsmodellen und die Aufdeckung von lebensgeschichtlichen Strategien, das heißt die Frage, mit welchen Entscheidungsmöglichkeiten die Tiere in einem jeweiligen Lebensabschnitt konfrontiert werden. Ein anderer stark beachteter Bereich betrifft die sogenannten kognitiven Aspekte, das heißt komplexere Prozesse der Informationsgewinnung und -verarbeitung im Gehirn. Die Erkenntnis, dass Lernprozesse auch bei anderen Tieren, außer unserer eigenen Art, auf Einsicht, Vorausplanung, episodischem Gedächtnis, Verallgemeinerungen etc. beruhen können, hätte, wenn sie dann weiterverbreitet würde, enorme Bedeutung für die Ausbildung von Tieren, gerade weil bei Hunden solche Erkenntnisse besonders stark sind (vgl. Hare et al. 2002, Miklosi et al. 2004).
Zusammenhänge zwischen Bindungsfähigkeit, Hormonen und dem Gehirn
Ebenso aufregend sind Ergebnisse, die aus einer Zusammenfassung von hormonphysiologischen mit Verhaltens- und modernsten neurobiologischen Forschungsansätzen über die Zusammenhänge zwischen Sozialbeziehungs-/Bindungsfähigkeit, Hormone und bestimmten Hirnregionen vorliegen. Neue Arbeiten dazu zeigen, dass es bestimmte Regionen im Vorderhirn nahezu aller Wirbeltiere gibt, die mit An-/Abwesenheiten von Revierverteidigung, sozialen Bindungen, Aggression/Dominanz oder Sexualverhalten in Beziehung stehen, dass diese Regionen untereinander vernetzt sind, und dass durch Unterschiede in der Ausprägung dieser Regionen Art-/Populations- oder Geschlechtsunterschiede in den genannten Verhaltensbereichen abgebildet und mindestens teilweise erklärt werden. Neben einigen Regionen an der Basis von Groß- und Mittelhirn (vgl. Goodson 2005) scheint auch bei Raubtieren sowie bei Primaten die Größe der Neuhirnrinde (Dunbas und Bever 1998) hier eine wichtige Rolle zu spielen.
Gerade durch Untersuchungen an wild lebenden Hundeartigen (vgl. MacDonald 2006, MacDonald und Sillero-Zubiri 2005) wird die innerartliche Variabilität sozialer Systeme als wichtiger Bestandteil ökologischer Anpassungen hervorgehoben. Es wäre sehr aufregend, wenn dieser Aspekt, verknüpft mit dem vorgenannten, auch bei Hunden neue Einsichten bringen könnte.
Grundbegriffe der Verhaltensphysiologie
Das Verhalten eines Tieres ist nicht verständlich erklärbar, wenn man nicht weiß, wie es funktioniert. Und so werden wir uns nun zunächst mit einigen Grundbegriffen und -gegebenheiten der Verhaltensphysiologie allgemein beschäftigen, denn viele dieser Aspekte werden wir in ganz verschiedenen Zusammenhängen später immer wieder benötigen. Zuerst werden wir uns mit dem Aufrechterhalten und Regulieren der Lebensvorgänge und inneren Zustände eines Tieres beschäftigen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!