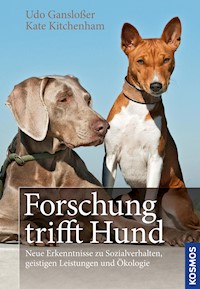
26,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Franckh-Kosmos Verlags-Gmbh & Co. KG
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Geforscht wird viel – über Wölfe, Wale, Affen. Der Hund, bester Freund des Menschen, schien lange Zeit vergessen. Doch das ändert sich, immer mehr Forschungsprojekte in Europa und den USA befassen sich mit dem Haushund, seiner Entwicklung, seinem Verhalten, seiner Intelligenz und seinen Emotionen. Dr. Udo Gansloßer und Kate Kitchenham berichten über die Forscher und ihre Arbeit, fassen die interessantesten Ergebnisse zusammen und geben damit Hundehaltern Anleitung für ein besseres Verständnis ihres Vierbeiners.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Dieses E-Book ist die digitale Umsetzung der Printausgabe, die unter demselben Titel bei KOSMOS erschienen ist. Da es bei E-Books aufgrund der variablen Leseeinstellungen keine Seitenzahlen gibt, können Seitenverweise der Printausgabe hier nicht verwendet werden. Stattdessen können Sie über die integrierte Volltextsuche alle Querverweise und inhaltlichen Bezüge schnell komfortabel herstellen.
Zu diesem Buch
Zu diesem Buch
Pawlows Hunde waren die ersten und hatten es nicht leicht: am Kopf wurde ihnen chirurgisch ein Speichelauffangbehälter implantiert. Dann ließ man ein Glöckchen klingeln, hielt ihnen leckeres Futter vor die Nase und ließ das Schüsselchen aufsammeln, was ihnen dabei im Maul an Wasser zusammenlief. Diese berühmte Premiere für Hunde als Versuchstiere hat den Tieren damals sicherlich wenig Freude bereitet. Den russischen Wissenschaftler Iwan Pawlow aber machten seine „Pawlowschen Hunde“ unsterblich und beschenkten Psychologie und Verhaltensforschung mit den ersten Erkenntnissen zur klassischen Konditionierung.
Sehen, riechen, schmecken, verstehen: Immer mehr Forscher fragen sich, wie Hunde ihre Umwelt wahrnehmen und Probleme lösen.
© Kate Kitchenham
Forschung heute
Zum Glück hat sich der Hundealltag im Forschungslabor heute stark verändert: Rund 100 Jahre später haben Bello und Fifi bei Versuchen im Namen der Forschung deutlich mehr Spaß. In Massen strömen sie weltweit mit ihren Herrchen und Frauchen in Universitäten und warten dort auf ihren Einsatz. Getestet werden ihre Fähigkeiten, andere Menschen oder Hunde zu beobachten und zu manipulieren, ihre Kommunikationsfähigkeit wird mit der von Schimpansen und Wölfen verglichen oder sie zeigen, welche Kenntnis sie von physikalischen Vorgängen haben, wenn sie versuchen, an leckeres Futter zu kommen.
Doch diese weltweite Begeisterung für Hunde als Versuchskaninchen ist relativ neu: Seit Pawlow und später Konrad Lorenz haben Wissenschaftler um Canis lupus f. familiaris lange Zeit einen großen Bogen gemacht. Der Grund: Für viele Wissenschaftler sind sie „unechte Tiere“, sie teilen schon seit der Steinzeit unseren wachsenden Lebensstandard und liegen heute gemütlich und satt neben uns auf dem Sofa anstatt sich dem Überlebenskampf in freier Natur zu stellen und selber für ihr Futter zu sorgen. Dazu kommt, dass ihre Begabungen nicht nur durch unterschiedliche Persönlichkeit und Rasseeigenschaften, sondern auch durch das erzieherische Talent ihrer Herrchen oder Frauchen stark beeinflusst werden. Eine allgemeingültige Erforschung der Spezies „Hund“ scheint da fast unmöglich.
© Kate Kitchenham
Forschung – Definition und Bedeutung
Die Einstellung zu wissenschaftlichen Untersuchungen ist häufig von unklaren Vorstellungen, bisweilen auch Vorurteilen geprägt. Udo Gansloßer erklärt, was sich hinter den Labortüren der Universitäten tatsächlich abspielt.
Was ist Forschung?
Forschung ist der Prozess, durch den Wissenschaft entsteht. Gute Forschung verschafft uns ein bewährtes System von Kenntnissen, die auf international akzeptierten Prinzipien basieren und die wir auch mit unseren Kollegen und Partnern teilen können. Letztlich können Forschungsergebnisse dabei helfen, im Zusammenhang mit dem Erkennen, Beschreiben und Lösen von Problemen sowie bei der Bildung von Prioritäten und Entscheidungsfindungen in Naturschutz, Tierschutz und anderen Bereichen, einschließlich der Ausbildung und Weiterbildung bei der Öffentlichkeitsarbeit, zu helfen.
Wozu braucht man Forschungsmethoden?
Forschungsmethoden zeichnen sich unter anderem aus durch logisches und rationales Denken, Objektivität, die Etablierung und Erkennung allgemeiner Muster, den Test von Hypothesen (meistens als informierte Schätzungen über Ursache und Wirkung bestimmter Zusammenhänge), die Notwendigkeit zur Beweisführung, enge und kritische Beobachtung, Quantifizierung, präzise Messungen, Test- und Kontrollvergleiche, vorsichtige Analysen, statistische Bewertung, Korrelationen, exakte Vorhersagen und Wiederholbarkeit der Ergebnisse. Diese „ernste“ Herangehensweise an Hypothesen ist wichtig, denn gute Wissenschaft beruht nicht auf Folklore, Anekdoten, Intuitionen, persönlichem Glauben oder einzelnen und statistisch unbedeutenden Vorfällen. Stattdessen hängt sie ab von der Beschaffung und kritischen Bewertung der Belege für ihre Hypothesen und von der Fähigkeit, sinnvolle und tragfähige Verallgemeinerungen zu tätigen. Dies wird durch die Verwendung solider, schlüssiger und zuverlässiger Fakten durch wiederholte Beobachtung und dort, wo notwendig, durch rigorose, systematische, experimentelle Arbeit in wiederholten Versuchsansätzen geschaffen.“
Diese Auszüge aus der Forschungsstrategie der Europäischen Zooassoziation erklären in kaum besserbarer Weise, was wissenschaftliche Arbeit mit Tieren bedeutet. Sinn ist es also, verallgemeinerbare Erkenntnisse zu gewinnen, die von den getesteten Tieren auf gleichartige (seien es vergleichbare Rassen, vergleichbare Haltungssituationen, oder andere vergleichbare Lebensumstände) verallgemeinert werden können. Sowohl durch systematische, auf vorher gefassten Hypothesen und Annahmen beruhende Datensammlung, wie auch durch gezielte Beeinflussung von Umweltsituationen in Versuchs- und Testsituationen können Daten gewonnen werden. Zur wissenschaftlichen Arbeit gehört also nicht notwendigerweise ein Versuch, solange auch auf andere Art die Randbedingungen konstant gehalten und nur eine, die zu untersuchende Bedingung verändert werden können.
Was sagt die Diskussion der Ergebnisse konkret aus?
Die Erklärung der gewonnenen Beobachtungen und Daten in einer möglichst widerspruchsfreien und mit möglichst wenig nicht belegbaren Zusatzannahmen unterstützten, zusammenhängenden Weise wird dann als Theorie bezeichnet. Eine Theorie ist also in einer wissenschaftlichen Untersuchung das „höchste Gut“, das man anstrebt. Der negative und abfällige Ton, mit denen viele Theorien im allgemeinen Sprachgebrauch abgetan werden („nur eine Theorie“), bezieht sich nicht auf den wissenschaftstheoretischen Begriff der Theorie. Vielmehr bezieht sich diese Bezeichnung auf das, was in wissenschaftlichen Untersuchungen als Hypothesen bezeichnet wird, nämlich eine noch nicht belegte und weitgehend nicht überprüfte Grundannahme. Leider hat auch unser großer Dichterfürst mit seiner abfälligen Bemerkung über die graue Theorie und den grünen Baum des Lebens nicht gerade dazu beigetragen, dies zurechtzurücken.
Gute wissenschaftliche Forschung beruht also auf wiederholbaren, verallgemeinerbaren, und mit nachvollziehbaren Methoden und in geplanter Art und Weise gesammelter Datenfülle. Zur Auswertung dieser Daten bedarf es der Statistik. Jedoch ist auch Statistik nur so gut wie die zu Grunde liegenden Daten, und daher ist es bei einer wissenschaftlichen Untersuchung unumgänglich, die statistischen Auswertemethoden bereits vor dem Beginn der Datensammlung, unmittelbar im Anschluss an die Formulierung der zu testenden Hypothesen auszuwerten. Wer Statistik benutzt wie ein Betrunkener den Laternenpfahl, nämlich zum Festhalten anstatt zur Erleuchtung, hat das Wesen der wissenschaftlichen Arbeit allgemein, und keineswegs nur das Wesen der Statistik, gründlich missverstanden.
Alles andere als graue Theorie: Hundestudien sind lebendig und stecken oft voller Überraschungen.
© Kate Kitchenham
Wer finanziert die Forschung?
Wie nicht anders zu erwarten, sind solche Vorgehensweisen zeitaufwändig und kosten auch sehr viel Mühe und oftmals Geld. Leider finden sich nur wenige Sponsoren, die allgemeingültige Untersuchungen beispielsweise über das Verhalten des Haushundes als solchen unterstützen würden. Daher sind viele der in den folgenden Kapiteln gemachten Untersuchungen in anderen Zusammenhängen begonnen worden, sei es der Hund als Modell für menschliche Verhaltens- oder auch medizinische Prozesse (z. B. in der Altersforschung), sei es im Zusammenhang mit allgemeinen Fragestellungen der Stressforschung oder im Zusammenhang mit naturschutzökologischen Untersuchungen über Gruppenstrukturen und Futterversorgung bei wild lebenden Raubtieren. Eine Zusammenschau der genannten Ergebnisse unter dem Aspekt, was können wir dadurch für unseren Haushund lernen, ist nichtsdestotrotz sehr aufschlussreich.
Der Hund im Fokus der Wissenschaft
Heute sind die jahrzehntelangen Bedenken der Neugier und Faszination von Evolutionsbiologen und Verhaltensforschern gewichen: Zum einen sind Hunde als Forschungsobjekte reizvoll, weil Hundehalter den Gassigang gerne mit einem Abstecher an die Uni verbinden. Versuchshunde in großer Anzahl sind deshalb in der Regel leicht zu bekommen und günstig in der Haltung. Gleichzeitig erhoffen sich immer mehr Forscher vom Hund große Erkenntnisse auch über unsere eigene Geschichte: Immerhin sind sie unsere ersten gezähmten Haustiere und haben uns bei unserer Ausbreitung über die Weltkugel und zunehmenden Zivilisierung begleitet. Dabei hat sich aber nicht nur der Hund, sondern parallel mit ihm auch der Mensch in seinen Fähigkeiten und Vorlieben in einem ähnlich schnellen Tempo verändert. Besonders der Vergleich dieser kognitiven Talente weckt zurzeit das Interesse von Wissenschaftlern auf der ganzen Welt. Ihr Ziel: Verstehen, wie Hunde denken – und dadurch nachvollziehen, wie die Entwicklung geistiger Fähigkeiten funktioniert.
Neues Wissen über Hunde
Dank dieser Forschungen wissen wir heute, dass Hunde in ihrem Hundeleben viel mehr lernen als nur die Bedeutung von „Sitz“ und „Platz“: Sie sind z. B. ähnlich wie Kleinkinder in der Lage, Wörter zu lernen –1.022 Begriffe konnte sich Border Collie Hündin „Chaser“ merken (siehe hier). Außerdem können sie feinste Zeichen deuten, die ihnen ihre Besitzer signalisieren – z. B. wenn wir nur über Augenbewegung andeuten, wo sich ein Leckerbissen versteckt hat (siehe hier). In der Beziehung mit Menschen verhalten sich Hunde bei Mann und Frau unterschiedlich, wie Forscher um den Wiener Ethologen Prof. Dr. Kurt Kotrschal herausgefunden haben (siehe hier), oder haben ansatzweise ein Grundverständnis von der unbelebten Natur (siehe hier). Doch nicht nur die Kognitionsforschung ist auf den Hund gekommen: Feldforscher und Ethologen auf der ganzen Welt haben sich in den letzten Jahrzehnten darauf konzentriert, welche ursprünglichen Verhaltensweisen bei Hunden verloren gegangen sind und welche die Domestikation durch den Menschen überstehen konnten (siehe hier), welchen Einfluss Gene auf Verhalten haben können (siehe hier), wie Hunde über Gerüche miteinander kommunizieren (siehe hier) und Konflikte vermeiden (siehe hier).
In diesem Buch haben wir versucht, einen wenn auch lange nicht vollständigen, so doch möglichst umfassenden Überblick über den Forschungsstand zum Thema „Hund“ zu bieten. Alle Studien haben unter kontrollierten wissenschaftlichen Bedingungen stattgefunden und wurden immer im Rahmen der Ländergesetze und deren Ethikverpflichtungen durchgeführt. Wir möchten die spannenden Ergebnisse dieser Arbeiten so bündeln, dass sie für jeden eine Bereicherung sind, der Hunde liebt und ihre Einzigartigkeit besser begreifen möchte.
In diesem Sinne wünschen wir viel Spaß beim Lesen!
PD Dr. Udo Gansloßer und Kate Kitchenham
So kam der Mensch auf den Hund
So kam der Mensch auf den Hund
© Kate Kitchenham
Wann kam der Mensch auf den Hund?
Es trabt keine andere Spezies über unsere Erde, die in so großer Formenvielfalt auftritt wie der Hund. Doch wie konnte sich der Wolf zum chinesischen Nackthund entwickeln? Und wo auf der Welt hat das alles angefangen?
Was haben ein zwei Kilo schwerer Chihuahua, ein 90 Kilogramm schwerer Mastiff, der kurzbeinige Dackel oder der windschnittige Saluki gemeinsam? Sie alle gehören zur Canis-Form „Haushund“ und gehen zurück auf Wölfe, die sich, wie aktuell kontrovers diskutiert wird, eventuell schon vor rund 130.000 Jahren unseren Vorfahren angeschlossen haben (Vila, 2007, S. 45). Aus diesem „Wolfshund“ wurde im Zuge einer langen Zeit des Zusammenlebens nach und nach der Haushund (Canis lupus f. familiaris), wie wir ihn heute kennen. Er ist ein Kulturprodukt des Menschen und sein erstes Haustier. Doch wann ist das erste Mal der Funke zwischen Mensch und Wolf übergesprungen? Wo hat diese Annäherung stattgefunden und warum wurde der Wolf plötzlich nützlich für Menschen? Archäologen, Kulturwissenschaftler, Verhaltensforscher und Molekularbiologen haben sich der Beantwortung dieser Fragen in den letzten 20 Jahren intensiv gewidmet. Durch die Zusammenfassung der Ergebnisse der aktuellsten Studien möchten wir in diesem Kapitel Licht in die Entstehung der einzigartigen Freundschaft zwischen Mensch und Hund bringen.
Datierung von Knochenfunden
Wenn Forscher Knochen finden, können sie das Alter mit Hilfe der Radiokarbonmethode ziemlich genau datieren. Dabei wird gemessen, wie viele Kohlenstoffatome der Knochenmaterie bereits zerfallen sind – eine recht genaue Möglichkeit, um auf den Todeszeitpunkt des Tieres zu schließen.
Archäologische Funde
Die ersten modernen Menschen (Homo sapiens sapiens) lebten vor etwa 150.000 Jahren in Afrika (Niemitz, 2004), von hier aus eroberten sie den ganzen Kontinent. Vor ungefähr 100.000 Jahren besiedelten sie den Nahen Osten und breiteten sich von dort vor 50.000 Jahren über den Rest der Welt aus (Finlayson, 2005). Ausgrabungen aus allen Erdteilen zeigen, dass sich Wölfe schon immer in der Nähe der Lager von Homo sapiens aufgehalten und dort wahrscheinlich nach fressbaren Überresten gesucht haben (Olsen, 1985). Der bislang älteste Knochenfund eines Hundes ist ein Schädel, der 2011 in Südsibirien in einer Höhle im Altai Gebirge gefunden wurde. Mittels Radiokarbonmethode wurde er vom Forscherteam um den russischen Archäologen Nikolai Ovodov vom Institut für Archäologie und Ethnographie in Novosibirsk auf rund 33.000 Jahre datiert.
Der Schädel ist vollständig inklusive Kiefer und Zähnen erhalten und in einem sehr guten Zustand. Durch diese Vollständigkeit konnten die Forscher bestimmen, wie der Hund ausgesehen haben muss: Sie verglichen seine Schädelform und Zahnstellung mit der von Wolfsschädeln der damaligen Zeit, anderen prähistorischen Hundeschädeln und modernen Wolfsschädeln. Das Ergebnis der Vergleichsstudie: Der Hund aus Südsibirien hatte wahrscheinlich große Ähnlichkeit mit Hunden aus Grönland, die dort vor 1.000 Jahren zusammen mit Wikingern gelebt haben. Gut dokumentiert sind ansonsten archäologische Hundefunde hauptsächlich aus der Phase der letzten großen Eiszeit und der frühen Holozän-Periode, vor ungefähr 14.000 – 9.000 Jahren (Clutton-Brock, 1995). Deutlich wird die gehobene Stellung des Hundes für Kulturwissenschaftler und Archäologen durch Knochenfunde, die auf eine Zeit um 12.000 v. Chr. datiert wurden. Menschen ließen sich hier gemeinsam mit ihren Hunden bestatten (Benecke, 2000). Gleichzeitig konnten an prähistorischen Lagerstätten vollständige Hundeknochen gefunden werden, die nicht durch Schabmesser bearbeitet wurden. Solche Skelettteile ohne Gebrauchsspuren sind ein wichtiger Hinweis für Archäozoologen, dass Hunde nicht mehr hauptsächlich als Nahrungsmittel angesehen wurden, sondern wahrscheinlich bereits eine gehobene soziale Stellung innehatten.
© Wolfgang Lang
Die Molekularbiologische Uhr
Genforscher nutzen für die Bestimmung des Alters einer Art ebenfalls eine rückwärts gewandte Zeitmessung. Die sogenannte „Molekularbiologische Uhr“ (siehe Kasten) zeigt ihnen, wie viele Veränderungen im Erbgut im Laufe der Zeit stattgefunden haben. Durch diese Vielfalt lässt sich ermitteln, vor wie langer Zeit sich der Hund aus dem Wolf entwickelt hat. Dieser Zeitabstand wurde als Letztes vom kalifornischen Genetiker Robert Wayne mit ungefähr 130.000 Jahren angegeben (Wayne et al, 2010).
Die Bestätigung dieser Ergebnisse durch weitere genetische Studien steht noch aus, aber selbst wenn Wölfe vor 100.000 Jahren die Nähe der menschlichen Lager suchten und die Domestikation dort irgendwann ihren Anfang genommen hat, dann ist der Hund wahrscheinlich bereits an unserer Seite getrabt, als wir die Erde noch mit Mammuts, Säbelzahntigern, Neanderthalern und dem Homo erectus geteilt haben.
Wo kam der Mensch auf den Hund?
Besonders um den Ort der ersten Freundschaftsschließung zwischen Wolf und Mensch ist in den letzten Jahren viel diskutiert und geforscht worden. Molekularbiologen nutzen zur Klärung von Verwandtschaftsverhältnissen den Vergleich des Genmaterials von Hunden und Wölfen, um daraus eine Art Stammbaum zu entwickeln. Diese Abstammungslinien, so die Hoffnung, werden sie zum Geburtsort des ersten Hundes führen.
Asiatische Mischlinge im Fokus der Forscher
Bereits im Jahr 2002 hat der schwedische Molekularbiologe Peter Savolainen China als möglichen Ausgangspunkt für die Domestikation des Hundes vorgeschlagen. In seiner Studie konzentrierten sich Forscher zum ersten Mal auf eine genaue Untersuchung der Vielfalt der DNA, die sich in den Mitochondrien finden lässt. Diese mitochondriale DNA (mtDNA) ist eine Erbsubstanz, die in jeder Körperzelle innerhalb der Mitochondrien nur über das Eizellplasma der Mutter an die Nachkommen vererbt wird. Dadurch wird diese mtDNA von Genetikern besonders für Analysen von Herkunftslinien eingesetzt. Savolainen untersuchte diese mtDNA von insgesamt 654 Hunden, die mehrheitlich aus dem asiatischen Raum stammten und als Beispiel für die weltweite Population gelten sollten. Seine Daten legten nahe, dass der Hund von drei Urstämmen abstammt, was durch einige einheitliche Sequenzen deutlich wurde (siehe Kasten unten). Gleichzeitig konnte er eine besonders große genetische Variation der Hunde im Osten Asiens ausmachen. Dadurch schloss er auf eine ostasiatische Herkunft des Haushundes, die ungefähr 15.000 Jahre zurückliegt. Dass es bis zu dem Zeitpunkt kaum einen archäologischen Hinweis auf diese Gegend als Ausgangspunkt der Freundschaft zwischen Hund und Mensch gab, begründete er mit der mangelhaften Anzahl von Ausgrabungsprojekten in dieser Region.
Was verrät die Molekularbiologische Uhr?
Je länger eine Tierart über die Erde läuft, kriecht oder schwimmt, desto häufiger musste sie im Laufe der Zeit den veränderten Umweltbedingungen angepasst werden. Diese Anpassung wird durch Veränderungen im Genmaterial deutlich. Solche Abweichungen können Forscher also nutzen, um Zeitdimensionen einzuschätzen:
Eine Art ist besonders alt, wenn sie sehr viele Veränderungen im Erbgut gegenüber einer verwandten Art vorzuweisen hat oder wenn – wie im Fall der Hunderassen – der Mensch sehr viele extreme Veränderungen im Aussehen und Verhalten durch Zucht gefördert hat. Noch mehr Informationen verrät der exakte Vergleich der veränderten Gene: Darüber können wir viel über Herkunft und Verwandtschaft der Rassen untereinander aber auch zum Wolf erfahren. Auf diese Weise wurde z. B. deutlich, dass der asiatische Grauwolf am engsten mit allen heute lebenden Hunderassen verwandt ist (Wayne, 2010).
Einfacher zu analysieren ist die Abstammungsgeschichte für Forscher, wenn sie sich nur auf die Veränderungen in der mütterlichen oder der väterlichen Linie konzentrieren können. Das gelingt für die mütterliche Seite, indem das Erbgut der Mitochondrien untersucht wird, väterliche Abstammungsverhältnisse können über das Genmaterial der Y-Chromosomen analysiert werden.
Entschlüsselung des Hunde-Genoms
Einen Meilenstein auf dem Weg zur Aufklärung der Herkunft des ersten Hundes bildete mit Sicherheit die Entschlüsselung des menschlichen Genoms durch das „Human Genome Projekt“ im Jahre 2004. Nach dem Mensch geriet unter anderem der Hund in den Fokus der Genomforscher: Ein Team um die Molekularbiologin Kerstin Lindblad-Toh aus Cambridge, Massachusetts wurde mit dem „Canine genome Projekt“ beauftragt. Sie dekodierte bereits im Juli 2004 das gesamte Genmaterial einer Boxer-Hündin namens Tasha. Tasha wurde aus 60 verschiedenen Rassen ausgesucht, weil Analysen ergeben hatten, dass Boxer die geringste genetische Variation zeigen und dadurch am besten als „Vergleichs-Genommodell“ für alle anderen Rassen dienen können. Tashas Genentschlüsselung sorgte besonders bei Forschern, die sich für die Abstammung des Hundes interessieren, für viel Freude: Denn mit der Möglichkeit, schon kleinste Genveränderungen innerhalb der Rassen feststellen zu können, wurde ein ganz neues Fenster in die Vergangenheit der Hunde aufgestoßen. Durch den Vergleich wurde es möglich, Unterschiede und damit Verwandtschaftsgrade zu verschiedenen Wolfspopulationen aber auch von Hunden untereinander noch genauer zu analysieren (siehe Kasten „So kamen Locken und Punkte auf den Hund“). Jetzt konnten Genetiker Gensequenzen effektiv entschlüsseln und direkt vergleichen. Optimale Voraussetzungen, um daraus endlich ein Bild über die Verbreitungsgeschichte des Hundes und die Entstehung der Rassen gewinnen zu können.
Im Jahr 2004 entschlüsselten Genetiker das Genmaterial einer Boxerhündin.
© Doreen Zorn / Tierfotoagentur
Afrikanische Mischlinge im Fokus der Forscher
Als Nächstes nahm sich ein internationales Forscherteam um Adam Boyko von der Cornell University in Ithaca der Frage nach der Herkunft des Hundes an. Hierzu wählten die Wissenschaftler Genproben von Dorfhunden aus verschiedenen Erdteilen aus, der Fokus lag dabei aber auf halbwilden Hunden aus Afrika. Der Grund: Nur „eingeborene Hunde“, also Tiere, die sich möglichst ohne den Einfluss europäischer Rassehunde vermehrt haben, bieten eine genetische Variationsbreite, die bei den streng nach Merkmalen gezüchteten Rassehunden und deren Mischlingen nicht mehr zu finden ist. Die Gene eingeborener Hunde haben sich nahezu isoliert vom Rest der Welt seit der ersten Domestizierung erhalten. Die Genetiker aus Ithaka achteten bei der Untersuchung der Hunde deshalb penibel darauf, ortsansässige Dorfhunde von Mischlingen zu unterscheiden, die durch jüngere Einmischung europäischer Rassen entstanden waren. Insgesamt verglichen sie mehrere Genabschnitte von 318 Dorfhunden aus sieben Regionen in Ägypten, Uganda und Namibia, von 16 halbwild lebenden Straßenhunden aus Puerto Rico sowie 102 Dorfmischungen aus den USA.
Durch die hohe Anzahl an untersuchten Genorten konnte gezeigt werden, dass die genetische Diversität aller Dorfhunde von verschiedenen Erdteilen besonders vielfältig, aber einheitlich groß ist. Mit diesem Ergebnis wurde also deutlich, dass Peter Savolainens Vorschlag, aufgrund der genetischen Vielfalt asiatischer Mischlinge den Ursprung des Hundes in Asien zu orten, angezweifelt werden muss, denn die genetische Vielfalt gilt für Mischlingshunde aller Erdteile. Die Schlussfolgerung dieser Studie aus dem Jahr 2009 musste deshalb etwas ernüchternd lauten, dass es unter Berücksichtigung dieses Ergebnisses sehr schwierig ist, die Zeit und den Ort der Domestikation des Haushundes zu rekonstruieren.
So kamen Locken und Punkte auf den Hund
Die Desoxyribonucleinsäure (DNA) ist ein langer Strang, der aus den vier verschiedenen Nucleotiden Adenin (A), Guanin (G), Cytosin (C) und Thymin (T) besteht. Diese Nucleotid-Moleküle heften in unterschiedlicher Abfolge in Form einer gewundenen Strickleiter aneinander. Eine komplette Kette wird als Chromosom bezeichnet und kodiert mit einer bestimmten Anzahl anderer Chromosomen im Innern des Zellkerns bestimmte allgemeine Eigenschaften, wie z. B. das Laufen auf zwei Beinen – oder individuelle Eigenschaften des Organismus, wie z. B. die Augenfarbe. Kojote, Wolf, Schakal oder Hund sehen sich also nicht aus Zufall sehr ähnlich, sondern sie teilen bestimmte DNA-Abschnitte und gehören deshalb genetisch allesamt zur Caniden-Familie. Doch da sich im Laufe der Evolution in der Caniden-Familie neue Arten abgespalten haben, gibt es charakteristische Abschnitte in der DNA der Chromosomen, die jeweils nur die Artangehörigen teilen. So können Genetiker heute Schakale, Wölfe oder Haushunde auch anhand bestimmter DNA-Abschnitte unterscheiden. Doch es geht noch weiter: Innerhalb der Spezies wiederum gibt es weitere Unterarten, die sehr unterschiedlich aussehen und deshalb wieder über eigene DNA-Besonderheiten verfügen. Das weiße Fell unterscheidet auf diese Weise den weißen Polarwolf (Canis lupus arctos) aus Grönland deutlich von seinem Europäischen Vertreter, dem Eurasischen Wolf (Canis lupus lupus), der in Europa, Russland und Teilen Asiens Zuhause ist. Noch mehr feine Unterschiede in den Genen sorgen unter Hunden für das getupfte Fell der Dalmatiner, den quadratischen Körperbau einer englischen Bulldogge oder die Größe einer Dänischen Dogge. All diese gewaltigen Unterschiede innerhalb der fast 400 Hunderassen werden letztlich also durch kleine Änderungen in der Abfolge der Nucleotide G, A, T, und C kodiert. Wenn Forscher sich für den Ort der Wiege des Hundes oder den Ursprung der Rassehundezucht interessieren, dann müssen sie sich ganz genau diese Unterschiede in der Abfolge der Nucleotide ansehen. Durch diese genaue Studie konnte die Verwandtschaft zwischen Wolf und Hund genauso festgestellt werden wie die Entwicklung der einzelnen Arten während der Evolution.
Für den Hund bedeutet dies konkret: wann er an welchem Ort zum ersten Mal mit Menschen zusammengelebt hat und zu welchem Zeitpunkt sich die ersten Rassenunterschiede herausgebildet haben (siehe auch Kasten „Was verrät die Molekularbiologische Uhr?“).
Afrikas Osten als Wiege der Menschheit und der Hunde?
Doch ein weiteres Forscherteam ließ sich von diesem Ergebnis nicht entmutigen und hat sich auf Spurensuche nach der Herkunft des Hundes begeben: Im Jahr 2010 wurde eine große Studie unter Leitung des Biologen Robert Wayne der Universität von Kalifornien, Los Angeles (UCLA) angestoßen. Es beteiligten sich Forscher aus der ganzen Welt und unternahmen eine genaue Erbgutanalyse der Haushunde und Wölfe im jeweiligen Land, um die Abstammung und Herkunft unserer Hunde in einem erneuten Anlauf doch noch klären zu können, ohne sich dabei auf die Hunde eines bestimmten Landes zu fokussieren. Dabei wurden mit Hilfe einer modernen Spezialsequenziertechnik 48.000 Stellen im Erbgut von über 1.000 Hunden und Wölfen untersucht, die dem internationalen Team dabei halfen, in der Erbgut-Vielfalt der rund 400 Rassen den Überblick zu behalten. Insgesamt wurden Gensequenzen von mehr als 200 Wölfen sowie 900 Hunden, die 85 Rassen angehörten, untersucht und miteinander verglichen. Das Ergebnis dieser Studien zeigt deutlich, dass Hunde am engsten mit den Grauwölfen des Jordanlandes verwandt sind. Das gilt sogar für Hunde, die in Asien oder Europa leben. Für die Forscher ist dies ein wichtiges Indiz für einen Ursprung des Hundes im mittleren Osten. Die Region zwischen dem Irak, Israel und Saudi Arabien gilt Archäologen schon lange als „Wiege der Menschheit“. Viele bedeutende Funde zeugen von der Entstehung der ersten Hochkulturen in dieser Erdregion. Aus dieser Gegend im Tal des Jordans, „Ein allaha“, Israel wurde z. B. das berühmte 12.000 Jahre alte Grab einer Frau entdeckt, die sich mit einem Welpen bestatten ließ. Für Kulturwissenschaftler ist die gemeinsame Bestattung ein eindeutiger Hinweis für die gehobene Stellung des Hundes im Zusammenleben mit Menschen. Dass sich an dieser Stelle die ersten Wölfe den Menschen angeschlossen und von hier aus über die Welt ausgebreitet haben sollen, scheint angesichts dieser Funde also als schlüssig. Da in der Studie von Wayne erneut deutlich wurde, dass auch alle Hunde aus Amerika mit den Hunden Europas eng verwandt sind, scheint auch die Theorie weiter gefestigt, dass Hunde den Menschen bereits beim Gang über die Beringstraße vor 10.000 bis 15.000 Jahren und der Besiedlung des neuen Kontinentes begleitet haben (Leonard, 2002). Doch selbst wenn der Ort der ersten Domestikation damit vorerst ermittelt scheint, bleibt die Frage offen, warum Wolf und Mensch zueinander gefunden haben?
Warum kam der Mensch auf den Hund?
Verhaltensforscher diskutierten in den letzten Jahren viel über die Frage, wer die Initiative ergriffen und den ersten Schritt auf dem Weg zur Freundschaft gemacht hat – der Mensch oder der Wolf?
Tatsächlich wird vermutet, dass es der Wolf war, der sich, wie schon Knochenfunde an menschlichen Lagerstädten von vor über 100.000 Jahren zeigen (Clutton-Brock, 1995), gezielt in der Nähe der Menschen als „Säuberungstrupp“ aufhielt, indem er die Abfälle des Lagers fraß. Wahrscheinlich wurde er dadurch von den Menschen mehr und mehr geduldet. Schließlich wurden weitere Fähigkeiten der wilden Tiere wie das Warnen vor Gefahren aus der Umwelt von unseren Vorfahren als vorteilhaft erkannt. Doch welcher Grund auch letztendlich für den Zusammenschluss von Wolf und Mensch vorlag, sicher ist, dass die Kooperation von Anfang an eine Beziehung zum gegenseitigen Vorteil war. Durch die Symbiose mit dem Wolfsrudel ergaben sich wichtige positive Impulse für den Überlebenserfolg der Menschen: Die Lager wurden sauberer, denn die Urvorfahren der Hunde interessierten sich mit Sicherheit genau wie unsere heutigen edlen Rassehunde für eklige Exkremente und sonstige Abfälle aus dem menschlichen Alltag. Eine Idee, die besonders dem amerikanischen Biologen Raymond Coppinger und seine Frau Lorna (Coppinger & Coppinger, 2001) sowie Erik Zimen anhängen: Der 2003 verstorbene Verhaltensbiologe schlägt die Vorliebe der Hunde für unsere Hinterlassenschaften als einen wichtigen Grund für den Zusammenschluss der beiden Arten vor (Zimen, 1992). Diese Theorie entwickelte er unter anderem nach seinen Studien in Ostafrika: In Kenia studierte er das enge Zusammenleben der Turkana mit ihren Hunden. Dort sind es vor allen Dingen die Frauen, die sich Hunde halten. Diese Tiere haben klar definierte Aufgaben: Sie halten das Lager sauber, ersetzen Windeln und spielen mit den Kindern. Dieses Beispiel könnte laut Zimen ein Beispiel für den Ursprung der Beziehung zwischen Mensch und Hund sein. Eine Theorie, die einleuchtet, da sich der Hund vor allen Dingen als Allesfresser auszeichnet (Zimen, 1992). Dadurch wurden die Bande viel enger, der Wolf durfte nicht mehr nur in der Nähe des Lagers, sondern bald schon zwischen den frühen Menschen leben.
Teamwork macht erfolgreich
Die weiteren Schritte auf dem Weg zur innigen Freundschaft unterliegen natürlich der Spekulation, könnten sich aber so abgespielt haben: Wahrscheinlich haben unsere Vorfahren die Talente der ersten wolfsartigen Hunde im Aufspüren und Stellen von Beute mit der Zeit als hilfreich erkannt. Fortan durften Hunde mit zum Jagen kommen, die sich besonders kooperativ zeigten. Eine weitere Erfahrung der Menschen war vielleicht, dass die intensive Beschäftigung im Welpenalter die spätere Zusammenarbeit entscheidend verbessern kann. Deshalb konnte die Beziehung zwischen Urhund und Mensch durch die gezielte Zähmung von Welpen noch inniger werden, so wie es die Verhaltensforscher Zimen und Savishinsky (Zimen, 1992; Savishinsky, 1983) vermuteten. Ihrer Theorie nach haben sich hier besonders die Frauen hervorgetan, indem sie Welpen noch vor dem Öffnen der Augen an ihre eigene Brust legten und säugten. Erst durch diese frühe Prägung meinen Biologen, könne es gelingen, scheue Wolfsnachfahren dauerhaft an sich zu binden. Tatsächlich kann man dieses Phänomen der Aufzucht von Tieren durch Menschenmütter z. B. bei den Aborigines beobachten (Savishinsky, 1983: 114). Doch diese Theorie ist nur stimmig, wenn der Hund schon ein Hund und kein Wolf mehr war, hat Ádám Miklósi von der Universität Budapest herausgefunden. Denn die Aufzucht durch Menschen macht aus einem Wolf noch lange keinen Hund: Ádám Miklósi hat mit seinem Forscherteam in den Jahren 2001 bis 2003 13 Wolfs- und 11 Hundewelpen ab dem sechsten Lebenstag von Studenten mit der Hand aufziehen lassen. Sie wurden über 24 Stunden am Tag intensiv von ihren Bezugspersonen betreut, bis sie neun bis 16 Wochen alt waren. In dieser Zeit lebten die Studenten mit den Wölfen wie mit Hunden, gingen zur Hundeschule, nutzten öffentliche Verkehrsmittel, ließen sie an der Leine laufen. Ab der dritten Lebenswoche wurden die Hunde- und Wolfswelpen regelmäßig besonders auf die Art der Kommunikation mit den Menschen getestet; diese Ähnlichkeiten und Abweichungen im Zusammenleben mit Menschen wurden genau protokolliert. Die Ergebnisse: Es gibt deutliche Unterschiede in der Bindung und Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit dem Menschen. Wölfe orientieren sich sehr früh viel weniger am Menschen und suchen den Artgenossen als Bezugsperson, während Hunde schon als Welpen den Menschen anderen Hunden als Bindungspartner vorziehen (Miklósi, 2003). Anders als die Vergleichsgruppe der Hunde ließen sich die Wölfe kaum trainieren und zeigten wenig Kooperationsbereitschaft bei der Lösung von Aufgaben.
Viel Zeit mit Welpen zu verbringen, erhöht die Bindung und sorgt später für eine gute Zusammenarbeit. Das wussten wahrscheinlich auch schon unsere Vorfahren.
© Kate Kitchenham
Warum Hunde bellen, Wölfe aber fast nie
Problemstellung
Über Jahrzehnte hat die Forscherwelt behauptet, beim Bellen des Hundes handele es sich um eine Lautäußerung, die keinerlei kommunikative Aussage hätte. Dagegen positionierten sich in den letzten Jahren immer mehr Wissenschaftler, die verschiedene Formen zu bellen ausmachten und dadurch dieser „Sprache“ der Haushunde durchaus einen Informationsgehalt in der innerartlichen Kommunikation aber auch in der Kommunikation mit dem Menschen zuschrieben. Dorit Feddersen-Petersen hat mit ihrem Team am Institut für Haustierkunde der Universität Kiel in vielen Studien das Lautäußerungsverhalten von Hunden und Wölfen untersucht. In dieser Studie fasst sie die Methoden und Ergebnisse zusammen.
Methoden
Die Kategorisierung der Geräusche wurde auf der Basis der akustischen Analyse, des sozialen Kontextes (also der Beobachtung der Situation, in der die Laute entstanden waren) erstellt. Berücksichtigt wurden auch die verschiedenen Entwicklungsstadien der Hunde, in denen die Belllaute entstanden waren. Zusätzlich wurden die Laute durch Sonagramme analysiert. Ein Sonagramm macht die unterschiedlichen Schalleigenschaften der einzelnen Laute im Zeitverlauf erkennbar und erleichtert damit die objektive Identifikation von Lauten. So kann die subjektive Einteilung von Lauten überprüft werden. Untersucht wurde die Jugendentwicklung der akustischen Kommunikation von insgesamt 84 Hunden neun verschiedener Rassen und 11 Europäischen Wölfen vom Zeitpunkt der Geburt bis zum Alter von vier Monaten. Neben der sonagrammatischen, akustischen und kontextspezifischen Auswertung erfolgte eine statistische Analyse.
Ergebnisse
Während Wölfe nur in abwehrenden Kontexten ein kurzes, lautes Bellen von sich geben, konnten innerhalb der Hunderassen für die verschiedenen Rassen 12 Untergruppen der Lautgruppe „Bellen“ klassifiziert werden. Die Kategorien schlossen z. B. Sozialspiel, Spielaufforderung, erkundendes Verhalten, Fürsorgeverhalten, soziale Begrüßung, soziale Kontaktaufnahme, Isolation und abwehrende Situationen ein. 56 Prozent aller Verhaltensweisen mit Bellen wurden im Zuge einer spielerischen Interaktion gezeigt. Insbesondere im Nahbereich wurde anspruchsvoll über das Bellen kommuniziert. Das Bellen zeigte sich als sehr anpassungsfähig an die soziale Situation und in der Struktur. Deutlich wurden auch rassetypische Besonderheiten im Bellverhalten. Generell kann festgehalten werden, dass es innerhalb der akustischen Kommunikation viele Belluntergruppen gibt, die besondere Informationen, Ausdrücke von Gefühlslagen oder Motivationen des Hundes unterstreichen sollen. So konnte z. B. gezeigt werden, dass der Play Bow (siehe hier) sehr häufig von einem Bellen begleitet wurde, das im Sonagramm das Bild eines Tannenbaums ergab und deshalb von den Forschern als „Christmas-tree-bark“ bezeichnet wurde.
Diskussion
Die in dieser Studie gefundene, sehr differenzierte Form der Kommunikation von Haushunden könnte mit den Einschränkungen erklärt werden, die viele Hunde durch züchterische Veränderung in Mimik und Körpersprache erfahren haben. Zusätzlich müssen Hunde in der Lage sein, nicht nur mit Artgenossen, sondern auch mit Menschen zu kommunizieren. Deshalb könnte sich eine Veränderung in der Kommunikation durch die Domestikation ergeben und die Kommunikation über Belllaute die aktuelle Bedeutung gewonnen haben. Zusätzlich wurde während des Prozesses der Domestikation das Bellen durch gezielte Zucht wahrscheinlich sehr variabel in Qualität und Quantität selektiert und verändert. Dadurch konnten Menschen z. B. auf der Jagd am Bellen des Hundes erkennen, welche Situation der Hund gerade erlebt. Auf diese Weise konnte Bellen zu einer neuen, sehr wichtigen Kommunikationsform für Haushunde werden.
Quelle: Dorit Urd Feddersen-Petersen, 2000: Vocalization of European wolves (Canis lupus lupus L.) and various dog breeds (Canis lupus f. fam.). In: Archiv Tierzucht, Dummerstorf 43, 387–397.
Domestikationsbedingte Verhaltensänderungen
Auch Dorit Feddersen-Petersen hat in ihren 35 Jahre andauernden Studien im Tiergarten der Universität Kiel die unterschiedliche Entwicklung von Wölfen und Hunden unter gleichen Bedingungen beobachtet. Die Tiere lebten in gleich großen Gruppen für sich in Gehegen, der Kontakt zu Menschen beschränkte sich auf die Gewöhnung an die Anwesenheit, es kam aber nicht zur Etablierung einer Bindung. In dieser Situation waren die Hunde den Wölfen unterlegen: Es gelang ihnen nicht, den Wölfen vergleichbare soziale Mechanismen auszubilden. Die domestikationsbedingten Verhaltensänderungen der Hunde zeigten sich beim Leben in der Gruppe eher als Hindernis; so beobachtete Feddersen-Petersen, dass z. B. die Schäferhunde anders als die Wölfe nicht in der Lage waren, ihr Drohverhalten situativ durch Lernprozesse zu verbessern. Nach harten körperlichen Auseinandersetzungen begannen Wölfe damit, länger und differenzierter zu drohen – eine Anpassung an das Leben mit Artgenossen, die Schäferhunden so nicht mehr gelang. Feddersen-Petersen schließt daraus, dass die domestikationsbedingten Anpassungen an die Kommunikation mit Menschen eine Verschlechterung der strategischen Kommunikationsfähigkeit mit Artgenossen zur Folge hatte. Deutlich wird die Menschenbezogenheit auch durch die Beobachtung der Forscherin, dass die Hunde sofort Interaktionen mit Artgenossen unterbrachen, sobald ein Mensch am Gehege zu sehen war, und sich diesem zuwandten (Feddersen-Petersen, 2006). Die Domestikation des Hundes hat also dazu geführt, dass der Mensch als Bindungspartner für den Hund wichtiger wurde als Artgenossen. Dadurch hat er Verhaltensweisen des innerartlichen Ausdrucks- und Kommunikationsverhaltens verloren, doch diese durch neue Fähigkeiten zur Kommunikation und Kooperation mit Menschen ersetzt (siehe „Die soziale Intelligenz des Hundes“; „Können Hunde Physik?“).
Diese erste Selektion auf Zahmheit und Kooperationsbereitschaft mit dem Menschen verlief dabei mit Sicherheit nicht zielgerichtet, sondern war sehr oft auch den bestimmt stimmungsabhängigen und spontanen Ansichten unserer Vorfahren unterworfen. Doch der Effekt war über eine lange Zeitspanne dann doch eine Selektion auf Zahmheit, die eine Verstärkung der Kooperationsbereitschaft des Wolfes zur Folge hatte. Ein Prozess, der in einer jüngeren Forschungsarbeit des amerikanischen Verhaltensbiologen Brian Hare tatsächlich nachgezeichnet werden konnte.
Wer zahm ist wird schlau?
Russische Winter sind lang und zum Leid vieler Tiere lieben die vornehmen Damen Pelze – besonders das schimmernde Fell des Silberfuchses ist sehr begehrt. Deshalb gibt es in Russland viele Farmen, in denen diese kleinen Canidenvertreter gezüchtet werden. Die dort arbeitenden Tierpfleger machten bei der Auswahl der Zuchttiere bereits vor rund fünfzig Jahren eine entscheidende Entdeckung: Verpaarten sie gezielt Tiere miteinander, die sich im Umgang freundlicher und weniger aggressiv zeigten, waren ihre Nachkommen vom Wesen noch viel freundlicher und zahmer. Doch diese Selektion nach einem sanften Wesen hatte einen weiteren Nebeneffekt: es veränderte sich nämlich zusätzlich das Äußere der kleinen Füchse. Plötzlich lockte und fleckte sich das Fell, der Schwanz kringelte sich über den Rücken und Ohren standen nicht mehr spitz nach oben, sondern hingen zuweilen neckisch geknickt nach vorne. Zusätzlich zeigten die Welpen der domestizierten Füchse zwei Tage früher als die Babys ihrer wild gebliebenen Artgenossen eine Reaktion auf Geräusche und öffneten auch durchschnittlich einen Tag früher ihre Augen. Fiepen, um Aufmerksamkeit zu bekommen, und Schwanzwedeln behielten die zahmen Füchschen genauso lebenslang bei, wie eine hundeähnlich leicht verkürzte Schnauze. Diese Beobachtung sprach sich herum bis zum russischen Wissenschaftler Dmitry Belyaev und weckte sofort sein Interesse als Evolutionsbiologe: Er wollte an den Farmfüchsen nachvollziehen, wie die Domestikation des Hundes vonstattengegangen sein könnte. Bereits im Jahr 1959 startete das Institut für Zytologie und Genetik die berühmte Silberfuchsstudie mit dem Ziel, die genetischen Hintergründe der Domestikation des Hundes zu ergründen. Hierzu wurde jeder Fuchs mit sieben Monaten einem Wesenstest unterzogen und einer von zwei Gruppen zugeteilt: Es wurde geschaut, ob ein Jungfuchs eher geneigt war, sich Menschen freundlich zu nähern oder nach der ausgestreckten Hand zu beißen. 35 Fuchsgenerationen später sind viele freundliche Füchse ihrem Schicksal als Pelzmantel entgangen, stattdessen sind aus ihnen im Namen der Forschung kleine hundeartige, liebenswerte und sehr unterschiedlich aussehende Familientiere geworden. Zum Vergleich züchteten die sibirischen Forscher eine Kontrollgruppe mit Füchsen, die ihr ängstliches Verhalten gegenüber Menschen beibehielten – und erzielten keinerlei Veränderungen im Verhalten und Aussehen (Trut, 1999).
Soziale Fähigkeiten zahmer Füchse
Der amerikanische Verhaltensforscher Brian Hare hat sich in seinen Arbeiten mit den Verhaltensänderungen der Füchse beschäftigt. Dabei interessierte ihn besonders die Frage, warum diese Tiere, die nicht auf Intelligenz sondern auf Zahmheit selektiert worden waren, trotzdem besondere soziale Fähigkeiten entwickelt haben, die sie deutlich von ihren „aggressiv gebliebenen“, wilden Artgenossen unterschieden. So schnitten Füchse im Zeigetest, bei dem die Tiere durch den Fingerzeig des Menschen erraten sollen, unter welchem Becher ein Stück Futter versteckt ist, genauso gut ab wie Hunde. Brian Hare stellte deshalb die Hypothese auf, dass die enormen sozialen Fähigkeiten der Hunde (siehe auch Kapitel „Die soziale Intelligenz der Hunde“) ein direktes Ergebnis der Selektion unserer Vorfahren nach Zahmheit sind. Um diese Hypothese zu überprüfen, zog er zwei Gruppen von Füchsen unter gleichen Bedingungen groß: Eine Gruppe hatte „zahme“ Eltern, die Kontrollgruppe stammte von ursprünglichen Silberfüchsen ab, die nicht nach Wesensmerkmalen gezüchtet worden waren. Der Kontakt zu Menschen beschränkte sich auf die Anwesenheit in der Nähe der Gehege. Nun unterzog der Forscher beide Gruppen zwei Arten von Tests:
In der ersten Runde wurde der Zeigetest durchgeführt, in der zweiten wurde die Bereitschaft überprüft, mit einem Spielzeug zu spielen, das von einem Menschen angeboten worden war. Beim Spieltest hatten die Füchse die Wahl zwischen einem Spielzeug, das der Mensch berührt, und einem, das er ignoriert hatte.
Die Ergebnisse: Die zahme Fuchsgruppe konnte die Signale im Zeigetest besser umsetzen und zog auch das vom Menschen berührte Spielzeug dem vom Menschen ignorierten Spielzeug vor, während die „wilde“ Gruppe die Zeigegesten des Menschen nicht gut umsetzen konnte und das unberührte Spielzeug auswählte. Damit zeigten die Ergebnisse der Fuchs-Versuche deutlich, dass die Bereitschaft, Signale zu entschlüsseln, gekoppelt auftritt mit einer Zahmheit Menschen gegenüber. Die besonderen Fähigkeiten der Hunde, menschliches sozial-kommunikatives Verhalten zu verstehen, hat sich für Hare deshalb nicht nur während der Domestikation entwickelt, sondern ist eine Folge der Selektion durch den Menschen auf Zahmheit (Hare et al, 2005). Brian Hare zieht aus seinen Studien deshalb die Schlussfolgerung, dass Zahmheit und Bereitschaft für Kooperation mit anderen Arten anscheinend in Genen gekoppelt auftreten müssen. Doch diese Studie wirft auch zwangsläufig die Frage auf: Warum waren es nicht Silberfüchse sondern Wölfe, die sich Menschen anschlossen?
Forscherportrait: Dr. Brian Hare
© Dr. Brian Hare
Brian Hare hat als 19jähriger Student in der Garage seiner Eltern den mittlerweile berühmten Becherversuch (siehe hier) zum ersten Mal durchgeführt – um seinem Professor Michael Tomasello zu beweisen, dass Hunde besser darin sind, menschliche Zeigegesten zu interpretieren als Schimpansen. Mit diesem Versuch, der später unter wissenschaftlichen Bedingungen von verschiedenen Forschern wiederholt wurde, hat er die Studien um die sozial-kognitiven Fähigkeiten des Hundes beflügelt. Brian Hare studierte an der Emory Universität Psychologie und Anthropologie, in Harvard schloss er 2003 mit dem Doktor in Anthropologie ab. Seine erste Anstellung führte ihn 2004 ans Max Planck Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig. 2005 wurde er dort zum Direktor der Forschungsgruppe „Hominoide Psychologie“. Besonders interessiert ihn, wie sich die sozialkognitiven Fähigkeiten des Menschen seit der stammesgeschichtlichen Trennung von Schimpansen und Bonobos entwickelt haben. In Akademgorodok in der Nähe von Novosibirsk in Russland untersuchte Hare im Institute für Psychologie und Genetik, wie gezielte Zucht auf Zahmheit die soziale Intelligenz der Silberfüchse beeinflusst. Aktuell forscht und unterrichtet Hare an der Duke University in North Carolina/ USA, der auch eine eigene Hundeforschungsabteilung angeschlossen ist (dukedogs.com). Hier untersucht Hare besonders die sozialen und mentalen Fähigkeiten von Hunden und Schimpansen.
Der Wolf war Schuld
Wenn es im Tierreich einen Integrationsspezialisten gibt, dann ist es der Wolf: Er hat sich nicht nur die Nähe der Lagerstätten unserer Vorfahren gesucht und spielt hin und wieder mit Bären (siehe hier), sondern geht sogar mit Federvieh enge Verbindungen ein. Das meinen zumindest der Verhaltensforscher Bernd Heinrich und der Feldforscher Günther Bloch in Kanada beobachtet zu haben. Die neuesten Feldbeobachtungen der beiden haben gezeigt, dass Wölfe häufig mit Raben kooperieren (Heinrich 1999; Bloch 2010). Günther Bloch hat bei seiner Feldforschung im Banff Nationalpark in Kanada beobachtet, dass in ungefähr 100 Metern vom Wolfsbau entfernt häufig Raben nisten, zu denen enge soziale Beziehungen gepflegt werden (Bloch, 2010). Eine Gemeinschaft, die über das gemeinsame Jagen weit hinausgeht: So genießt der schwarze Vogel beim Wolf eine Art „Narrenfreiheit“, er stolziert zwischen den ruhenden Rudelmitgliedern umher und zwickt diese zuweilen sogar neckisch in die Ruten. Eine Freundschaft, die Indianern schon lange bekannt war, ein Grund, warum sie Raben als „Wolf-Bird“ bezeichneten. Liegt in dieser Fähigkeit des Wolfes, über Artgrenzen hinweg Beziehungen zu anderen Tieren eingehen zu können, eventuell die Wurzel für seine Domestikationsfähigkeit?
Hier schließt sich der Kreis zum Silberfuchs: Wenn eine Domestikation auf Zahmheit bereits mit dieser Canidenart möglich ist, muss sie mit dem Wolf noch besser möglich gewesen sein. Die Wandlung des Wolfes zum Hund könnte also tatsächlich mit dem gemeinsamen Nutzen eines Territoriums begonnen haben. Wie bereits beschrieben, wurde durch dieses zunehmende Vertrauen zueinander noch viel mehr möglich: Die ersten Welpen wurden von Menschenhand aufgezogen und weiter nach Zahmheit selektiert. Diese ersten hundeartigen Wölfe zeigten sich dann wachsam, kooperierten beim
Beuteverfolgen und begleiteten fortan ihre menschlichen Jäger und Sammler zur Jagd. Bemerkenswert ist, dass der kulturelle Entwicklungsstand unserer Vorfahren jahrtausendelang nahezu stagnierte. Erst vor ungefähr 40.000 Jahren kam es plötzlich zu einer kleinen Explosion kultureller Erfindungen, z. B. die Jagd mit Bogen und Pfeil. Dies könnte ein Hinweis auf eine veränderte Jagdstrategie sein, die sich eventuell durch das gemeinsame Jagen mit den Urhunden ergeben haben könnte.
Stimmen diese Theorien, dann hat zwischen Hund und Mensch eine „Koevolution“ stattgefunden: Beide Arten konnten durch das Zusammenleben neue Fähigkeiten entwickeln.
Die Hypothese der Koevolution von Hund und Mensch
In Forscherkreisen gewinnt die These von der gemeinsamen Evolution von Hund und Mensch immer mehr Anhänger. Einer der ersten, die diese Theorie formulierten, war der britische Verhaltensbiologe Joel Savishinsky. Für ihn nimmt die Beziehung zum ersten Haustier eine Schlüsselrolle in der Zivilisierung der Menschheit ein: Savishinsky erschien es gut möglich, dass Menschen die hoch empfindlichen Sinne der Wölfe schnell zu schätzen wussten. Deshalb begannen sie damit, das Verhalten der Tiere zu beobachten und zu interpretieren. Für diese erste Verhaltensanalyse eines Tieres war aber eine Selbstbezähmung notwendig. Für Savishinsky ein wichtiger Schritt, damit die Fremdbezähmung – also die Zähmung des Wolfes und später weiterer Haustiere – gelingen kann (Savishinsky, 1983). Damit begründete der Verhaltensforscher in den achtziger Jahren die Theorien zur Koevolution von Mensch und Hund: Für ihn ist Domestikation von Haustieren eine bedeutende kulturelle Leistung des Menschen, denn eine erfolgreiche Züchtung und Zähmung erfordert vom Menschen die Unterdrückung primärer Wünsche wie Töten und Verspeisen. Wenn sich die ersten Wölfe tatsächlich wie Wayne vermutet bereits vor über 100.000 Jahren den Menschen anschlossen, dann hat sich der Mensch durch die Kooperation mit dem Wolf sozusagen selbst gezähmt – der Startschuss für die Domestizierung weiterer Haustiere und den ersten Siedlungsbau der Weltgeschichte. Eine Annahme, die durch Brian Hares Theorie der gekoppelten Merkmale Zahmheit und Fähigkeit zur Kooperation gestützt wird: Auch der Mensch konnte durch seine zunehmende Zivilisierung immer besser kooperieren. Durch diese erste Domestizierung wurde auch der Wolf zahm und hat im Zuge seiner Hundwerdung seine Fähigkeiten entwickelt, menschliches Sozial- und Kommunikationsverhalten zu verstehen. Dass diese Talente sogar schon von neun Wochen alten Hundewelpen gezeigt werden, hat der Becherversuch von Brian Hare (siehe Portrait „Brian Hare“ und hier) und Michael Tomasello aus Leipzig gezeigt: Die Hundekinder waren Wölfen und sogar Schimpansen darin überlegen, die Zeigegeste des Menschen richtig zu interpretieren (Tomasello, 2002). Menschen und Hunde haben also in ihrer gemeinsamen Entwicklungsgeschichte zwar nicht gleiche, aber ähnliche sozial-kommunikative Fähigkeiten entwickelt. Die These der Forscher lautet: Durch die Wesensänderung des Menschen und des Hundes wurde eine sozial-kognitive Evolution angestoßen, die zum modernen Menschen und Hund mit all seinen intelligenten Fähigkeiten führte.
Forscherportrait: Dr. Joel Savishinsky
© Dr. Joel Savshinsky
Der Kulturanthropologe studierte Anthropologie am City College of New York (1964), seinen Doktor machte er 1979 an der Cornell University in Ithaka. In den sechziger Jahren arbeitete Joel Savishinsky auf archäologischen Ausgrabungen in der Türkei und als Feldforscher in der Kanadischen Arktis. In seiner Forschungs- und Lehrzeit hat er sich häufig mit Persönlichkeits- und Familienforschung beschäftigt. Besonders interessieren ihn dringende soziale Probleme und ihre Lösung in der Gegenwart, z. B. der Umgang der Gesellschaft mit dem Älterwerden. Als einer der Ersten hat er sich bereits in den 80er Jahren der Erforschung der Tier-Mensch-Beziehung gewidmet und die Theorie einer Koevolution von Hund und Mensch beschrieben, wie sie sich heute in aktuellen Forschungen zu bestätigen scheint. Diese Gedanken finden sich in seinem 1983 erschienenen Text „Pet Ideas: The Domestication of Animals, Human Behaviour, Human Emotions“. In den letzten Jahren hat er besonders die Rolle von tiergestützter Therapie vielfach untersucht, z. B. wie das Leben in Geriatrieabteilungen von Krankenhäusern in den USA durch den Einsatz tierischer Therapeuten menschlicher gestaltet werden könnte.
Entstehung der Rassen
Konrad Lorenz hat sich bei seiner Theorie zur Abstammung des Hundes leider geirrt: für ihn war der Schakal der Stammvater unserer fast 400 Rassen, diese Urform soll sich dann Lorenz zufolge später in manchen Regionen mit Wölfen durchmischt haben (Lorenz, 1965). Die Hypothese, dass der Hund aus mehreren Canidenarten entstanden ist, war für den Begründer der vergleichenden Verhaltensforschung eine mögliche Erklärung für die beeindruckende Erscheinungs- und Wesensvielfalt der Hunde. Tatsächlich ist es schwer vorstellbar, dass aus dem Urtyp „Wolf“ solch unterschiedlich geformten Rassen entstehen konnten. Archäologische Knochenfunde zeigen bereits ab der Steinzeit unterschiedliche Formen bei wolfsähnlichen Hunden. Eine zielgerichtete Zucht vermutet Juliet Clutton-Brock erst ab einem Zeitraum von vor 3.000 – 4.000 Jahren. Erst ab diesem Zeitpunkt finden sich Hinweise auf bestimmte Rasseschläge, die wiederholt auftreten, wie z. B. der Typ „Greyhound“, der auf antiken Vasen aus Ägypten oder Asien abgebildet wurde. Ebenfalls in dieser Zeit soll es bereits Hunde vom Typ „Mastiff“ sowie Hunde mit sehr kurzen Beinen gegeben haben (Clutton Brock, 1995).
Die Gruppeneinteilung
Bei einer weiteren Studie unter Leitung der Kalifornier zur genetischen Diversität und Abstammung der Hunderassen (Byoto et al, 2010) stießen die Forscher um Robert Wayne noch auf weitere interessante Details in den Hundegenen: Die Evolutionsbiologen entdeckten beim Blick auf den durch die Genanalysen gewonnenen genetischen Stammbaum der Hunderassen, dass dieser mit der Klassifikation der Hunde durch Züchter in Hütehunde, Apportierhunde, Sichthunde, kleine Terrier und andere kleine Hunde tatsächlich oft übereinstimmt. Die funktionale Einteilung von Hunden findet sich tatsächlich in der genetischen Struktur wieder.





























