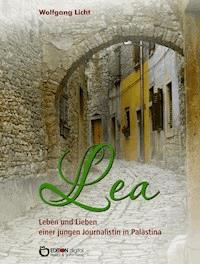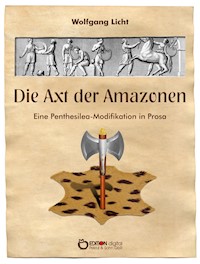7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Mozartstraße ist das Zuhause der jungen Frauenärztin und Ich-Erzählerin Claudia und ihrem Mann Martin. Beide sind zwölf Jahre miteinander verheiratet, und diese Ehe scheint sich etwas abgenutzt zu haben: Er hat seinen Kugelschreiber aufgeschraubt, prüft die Miene. Da hört er mich an der Schwelle, dreht sich herum. Möchtest du etwas? Ich lehne am Türrahmen, blicke Martin an. Er kommt, küsst mich aufs Haar, den Stift in der Hand. Und ich sehe, auch dieser Abend verschwindet wie so viele andere, ohne Spuren zu hinterlassen. Die Struktur ihrer Schlafzimmerdecke scheint wie ein Symbol ihrer Ehe zu sein: Die Decke unseres Schlafzimmers ist quadratisch. Ihre rechten Winkel, die sie mit den Wänden bildet, scharf und genau. In Richtung der beiden von einer gemeinsamen Gardine verhangenen Fenster ziehen sich zwei feine Risse hin. Sie verlaufen beinahe in der Längsachse unserer Betten. An keiner Stelle berühren sie sich, was Parallelen, wie ich ja weiß, auch nicht können. Wir haben sie mehrmals verputzen und übermalen lassen. Sie durchdringen den Bewurf wieder und wieder. Gleichweit von jedem Riss entfernt und im Schnittpunkt der Diagonalen hängt die Lampe, mit rotem Seidenstoff bespannt. Ich habe sie gekauft, aufgehängt und angeschlossen. Claudia hat ihren späteren Mann nahe der heutigen gemeinsamen Wohnung kennengelernt: Ich liebe den künstlichen Hügel am Rande des Stadtwaldes nahe der Mozartstraße. Ein ehemaliger Schutt- und Scherbenberg. Nun bewachsen. Sogar bewaldet. Hier ist mir Martin zum ersten Male begegnet. Zaghaft erst finden die beiden nahe der Mozartstraße zueinander, küssen sich erst nach Monaten, auch wenn Claudia ihren Martin bewundert. Und aus der Liebesgeschichte wird eine Liebesheirat. Und die beiden Liebenden geben sich ein Versprechen: Wir dürfen uns niemals verbergen voreinander, rief ich, als hätte ich eine Formel entdeckt. Jeden Gedanken wollen wir uns sagen und jedes Gefühl. Dennoch scheint dieses Versprechen nach Jahren der Gemeinsamkeit nicht mehr gültig zu sein. Und Claudia fragt sich, wie es nur gekommen sei, dass sie sich so missverstehen. Auch eine gemeinsame Reise in die CSSR kann das scheinbar unausweichliche Ende dieser Beziehung nicht aufhalten. Claudia sucht und findet sogar einen anderen Mann. Kann sie Martin zur Liebe zwingen? Und was erwartet sie eigentlich von diesem anderen Mann? Aber auch das letzte Wort dieser sensiblen Beziehungsgeschichte lautet Mozartstraße.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 259
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Impressum
Wolfgang Licht
Bilanz mit Vierunddreißig
oder Die Ehe der Claudia M.
ISBN 978-3-86394-375-2 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1978 im Aufbau-Verlag Berlin und Weimar.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2013 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Alte Dorfstraße 2 b 19065 Godern Tel.: 03860-505 788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
In der Mozartstraße
1. Kapitel
Ich habe mich heute rasch verabschiedet von Dr. Anna Kerst, Oberarzt Fahrner, Dagmar und den anderen Schwestern, plötzlich beunruhigt, es könnte mich etwas zum Bleiben zwingen: eine regelwidrige Geburt, eine Blutung. Ich habe ihnen entschieden die Hand gedrückt und mich sofort umgedreht.
In der Bahn suche ich einen Haltegriff, blicke über die Gesichter hinweg durch die Scheiben. Am Borchertplatz steige ich aus. Vor der Brücke gehe ich langsamer, beobachte die vorbeifahrenden Autos. Martins Wagen würde ich sofort erkennen, obwohl ich das Kennzeichen oft falsch ansage wie damals auf der VP-Meldestelle, als ihn jemand „ungerechtfertigt benutzt“ und an einen Prellstein gefahren hatte. Ich kenne Martins Auto so gut wie seine Stimme am Telefon. Martins Stimme. Martins Auto. Martins Sachen. Ja, das ist seins, könnte ich sagen, auch von dem ältesten abgelegten Stück, das ich fände. Nach zwölf Ehejahren ergibt sich das so.
Ich blicke hinab in den Fluss neben der Straße. Sein Wasser ist violett und riecht stark, auch der Stadtwald ist voll von dem Geruch.
In diesen Straßen sind nur noch vereinzelt Autos, wie Spritzer einer Flut. Auf den Fahrbahnen kreiseln Kinder. Ich biege ein in die Mozartstraße. Das Jugendstilwohnhaus liegt wie hinter Palisaden. An dem hohen Kunstschmiedegitter ein übergroßes Emailschild. Dunkelblau. Darauf die Zahl vierzehn, weiß.
Im Treppenhaus höre ich meine eigenen Schritte. Hinter einer Flurtür brennt Licht. Eine Männerstimme tönt laut, aber was sie sagt, ist nicht verständlich. Als ich vorbeigehe, erlöscht das Licht, und eine Tür schlägt. Mir kommt das blonde Fräulein Grabner aus dem dritten Stock entgegen. Sie hält ihr langes Kleid unter dem hellen Mantel. Wir grüßen beide gleichzeitig und sehen uns freundlich an. Unwillkürlich horche ich auf das Zuschlagen der Haustür. Eine Weile noch gehe ich durch Parfümhauch.
In der Diele neben dem Spiegel der Fleck an der Tapete. Die schmutzgefüllten Risse im Parkett. Der Garderobenhaken, immer noch abgebrochen. Ich hebe die Zeitungen vom Fußboden auf, stecke sie in den Ständer. Eine Ansichtskarte aus Strbske Pleso. Berge, Schnee auf dem Gipfel, der glatte See: Ferienfarben hinter Glanzschicht. Sind sie wirklich? Die Luft hier ist abgestanden. Vielleicht riecht es auch bloß nach nichts. Oder wie gestern und alle Tage.
Ich öffne das Wohnzimmerfenster und beuge mich hinaus, unruhig auf Martin. Die Bewohner in den gegenüberliegenden Häusern bewegen sich hinter ihren Fenstern, als bereiteten sie etwas vor. Aber ich weiß, alles, von dem ich denke, es seien Vorbereitungen, ist bereits das Ziel. Ich nehme den Staublappen aus dem Fach und beginne zu wischen. Obwohl fast kein Staub liegt auf den Flächen, den Stuhlrändern. Vielmehr, an meinen prüfenden Fingern, der gleiche Staub danach wie vorher.
Auf der hinteren Parkseite haben die Baumwipfel jetzt den Abendmond zwischen sich. Im Dunkeln tschilpen Spatzen.
Eine Autotür schlägt. Sofort spüre ich mein Herz. Als sei eine Sperre behoben. Ich halte wieder alles für möglich, Verzicht unnötig. In der weit geöffneten Tür warte ich auf Martin.
Er kommt, Stufen überspringend, mit vorgeschobenem Oberkörper, die Lippen voneinander.
Er stellt seine Tasche ab. Du bist im Mantel?
Ich gehe zum Eisschrank, mache die Tür auf. Könnten wir nicht einmal essen gehen? Ich achte auf sein Gesicht. Bier ist auch alle, sage ich.
Ich höre sein Taschenschloss klicken. Er hat Kleiderhaken gekauft.
Da lese ich ihm vor, was sie im Schauspielhaus, in der Oper geben.
Ich wollte die Haken eigentlich gleich anmachen. Aber wenn du große Lust hast?
Ach, ich sage es leichthin, es gibt nichts Gescheites.
Längst geht mein Herz wieder seinen Gang. Warum sollte es sich beeilen?
Ich schneide Brot, wasche Messer. Das Neonlicht brennt, die Kacheln blinken, die Küchenmaschine heult, das Wasser rumort in der Leitung. Ich halte meine Miene beieinander. Stirn, Lippen glatt. So glätte ich auch mein Empfinden. Zwinge es aufs Tischdecken. Platten garnieren, noch einmal die Gläser überputzen. Ich trage eine dunkelblaue Schürze mit weißem Rand. Martin hat sie für mich ausgesucht.
Als ich alles auf den Tisch im Wohnzimmer gebracht habe, ruft mich Martin in den Flur und zeigt mir die neuen Haken.
Auch wenn wir wie heute im Wohnzimmer zusammensitzen, liest Martin in wissenschaftlichen Zeitschriften. Er ertastet das Glas, hält es eine Weile vor seinem Munde, bis er, lesend, trinkt.
Ich lege das Zeichen zwischen die Seiten. Blicke auf den messingnen Ständer der Lampe, unter der wir sitzen. Die Birnen blenden mich, sodass ich Martin nicht ansehen kann. Wie er aussieht, weiß ich dennoch. Er hält den Kopf schief. Rechtsschief. Linksschief. Die eingezogene Halsseite ist faltig, schwammig. Seine Augen bewegen sich ruckartig.
Willst du etwas?
Sein entzerrtes Gesicht gefällt mir. Ich schüttle den Kopf, lege das Buch weg, halte die Kanne hoch.
Das Licht im Tee. Sein Duft. Unser Blick am Gesicht des anderen, dann im Raum an Punkten.
Was denkst du?
Unwichtig.
Sag’s schon.
An ein paar Fälle.
Ich merke, mein Ton missfällt ihm.
Was hat dich denn aufgebracht heute?
Ich zucke die Achseln. Ich weiß: Er wird jetzt in sein schmales Zimmer gehen und seine Tasche zurechtmachen für morgen.
Er hat seinen Kugelschreiber aufgeschraubt, prüft die Miene. Da hört er mich an der Schwelle, dreht sich herum. Möchtest du etwas?
Ich lehne am Türrahmen, blicke Martin an. Er kommt, küsst mich aufs Haar, den Stift in der Hand.
Und ich sehe, auch dieser Abend verschwindet wie so viele andere, ohne Spuren zu hinterlassen.
Ich bleibe lange im Bad. Mein Gesicht im Spiegel über dem Waschbecken. Es ist warm hier. Es riecht gut. Auf der Haut spüre ich das frische Nachtzeug. Ich knipse die Lampen aus. Die warmen Farben verwandeln sich, tauchen unter.
Unsere Welt ist am Tage und in unseren Augen. Das Bad: ein Zwischenreich, wo ich in Spiegel lächle.
Martins Nachttischlampe brennt. Er liegt auf dem Rücken. Seine Hand hält ein Buch. Er schläft.
Die Fenster, die wir tagsüber offenstehen lassen, sind jetzt geschlossen. Und es riecht schon wieder nach Schlafzimmer. Rasch und leise lege ich mich neben ihn. Aber er wacht auf durch das Knarren der Stahlfedern. Ich wende mich ihm zu. Seiner Hand entgegen, die er schließlich auf meiner Schulter ruhen lässt.
Vieles, was ich jetzt bemerke, geschieht schon jahrelang. In der gleichen Weise.
2. Kapitel
Die Decke unseres Schlafzimmers ist quadratisch. Ihre rechten Winkel, die sie mit den Wänden bildet, scharf und genau. In Richtung der beiden von einer gemeinsamen Gardine verhangenen Fenster ziehen sich zwei feine Risse hin. Sie verlaufen beinahe in der Längsachse unserer Betten. An keiner Stelle berühren sie sich, was Parallelen, wie ich ja weiß, auch nicht können. Wir haben sie mehrmals verputzen und übermalen lassen. Sie durchdringen den Bewurf wieder und wieder.
Gleichweit von jedem Riss entfernt und im Schnittpunkt der Diagonalen hängt die Lampe, mit rotem Seidenstoff bespannt. Ich habe sie gekauft, aufgehängt und angeschlossen.
Das sieht aus wie eine Hafenlaterne, sagte Martin sofort. Er will kein farbiges Licht.
Die frühere Lampe war grellweiß. Ich hatte oft gegen sie protestiert: Das ist ja ein wissenschaftliches Licht, Martin, wie im Labor, so werde ich den Tag nicht los. Oder liebst du solche Ausleuchtung? Da ließ er es zu, dass ich uns diese Lampe brachte.
Ich knipse sie an, nachts, wenn mich etwas aufgeweckt hat. Betrachte den Farbhauch auf meiner Haut und dem weißen Leinen. Ein sänftigendes Licht, unter dem ich gern träume.
Ich öffne das Fenster. Kühle Luft wie eine Flut. Durch das dunkle Rechteck sehe ich den Mond. Er hat sich befreit aus den Fesseln der Stämme und Äste und hängt nun hoch über den Parkbäumen.
3. Kapitel
Durch die hohen Fenster der Frauenklinik fällt Licht auf die Steintreppen. Langsam steige ich hinab. Nach vierundzwanzig Stunden Dienst bin ich müde, doch ohne Lust auf Schlaf.
Ich halte mich fest am Geländer. Ich nicke den Frauen zu, die schon auf den Wartebänken vor der Ambulanz sitzen. Auf der Straße bleibe ich einen Augenblick stehen. Mir ist, als hätte ich eine Saugglocke über dem Kopf. Da war noch ein Kaiserschnitt heute Morgen. Die Gebärmutter, von Muskelknoten durchsetzt, musste ich herausnehmen. Freut sich die Frau, wenn sie erwacht? Sie hat schon vier Kinder. Jetzt fünf.
Ich bin vorbeigegangen an der Haltestelle, habe aber keine Lust umzukehren. Die Straßenbahnen sind beinahe leer, und es fahren nur wenige Autos.
Im grellen Licht rissig die Lippenfarben in Frauengesichtern. Lidschatten blasswolkig. Ich gehe wie unter Drogen mit überscharfen Sinnen. Gehe, zu sehen, zu hören, die Stadt zu riechen, zu schmecken auf der Zunge.
Hinter offenen Fenstern stelle ich mir verlassene Wohnungen vor. Sonne auf ungemachten Betten. Verschobene Kaffeetassen, zerkrümeltes Brot, Wurstpellen. Über Stuhllehnen, auf Sofas Kleidungsstücke. Hausschuhe achtlos hingeworfen.
Am Ring herrscht dichter Verkehr. Doch die meisten Geschäfte haben noch geschlossen, und als ich in ein Café will, finde ich die Tür versperrt. Der Tag ist hier noch nicht angebrochen.
Ich habe sie niemals so gesehen, die Stadt am Morgen. Eine Straße wird aufgerissen. Ich gehe über Bretter. Arbeiter in Helmen hämmern gegen Rohre. Das Unterirdische, sichtbar für eine Weile. Interessant. Aber es missfällt mir: klumpiger Lehm, schmutziges schwarzes Gestänge. Ich bin Verkleidung gewöhnt, das Eingekleidete. Wo das Rohe aufbricht, scheint es mir Wunde, Verletzung.
Am Körnerplatz stürzen alte Mauern unter dem Anprall einer Eisenkugel wie in Kriegen des Mittelalters. Es wird Platz für Neues. Viel Platz. Am Bahnhof endlich finde ich ein Espresso.
Die Läden und Kaufhäuser sind jetzt geöffnet. Bis sie schließen, wird der Menschenstrom vor ihnen nicht abreißen. Die Luft hat sich erwärmt. Ich komme am Rathaus vorbei. Eine Burg in granitener Rüstung gegen die Jahrhunderte. Ihr Turm steht gereckt, als führe er sie an, die anderen Türme der Stadt.
Ich laufe ein Stück neben dem Fluss. Die mächtigen alten Häuser um die Mozartstraße erscheinen hinter dem Springbrunnen und dem Musikhaus. Dann bin ich angelangt. Ich lege mich angezogen auf die Couch und schlafe sofort ein.
4. Kapitel
Ich liebe den künstlichen Hügel am Rande des Stadtwaldes nahe der Mozartstraße. Ein ehemaliger Schutt- und Scherbenberg. Nun bewachsen. Sogar bewaldet. Hier ist mir Martin zum ersten Male begegnet.
Ich saß auf einem Stein. Da hörte ich Gehen. An Stimmen und Schritten erkennt man das Geschlecht. Ich schaute nicht auf. Er blieb stehen, glaubte, ich brauchte Hilfe, wie ich mich hielt: die Schultern nach vorn, die Haare im Gesicht.
Ich bin rasch heraufgestiegen an diesem Nachmittag. Spüre den warmen Wind und denke, dass ich ihn nun sehen müsste, Martin, wie er damals war. Er würde mich an der Schulter berühren, seine ersten Worte an mich wiederholen. Diesmal würde ich achtgeben auf alle Zeichen und Hinweise von Anfang an. Aber ich höre nur die Geräusche der nahen Stadt und den Wind in den Ästen und Blättern. Ich bin schweißnass, und die Sonne brennt mir auf der Stirn.
Nein. Ich hatte mich nicht verletzt. Ich war aufgestanden und mit ihm gegangen, weil es dunkelte und es nur einen Weg gab nach der Stadt.
Wir standen nicht lange vor meiner Haustür. Im Autolicht stürzten Baumschatten auf uns zu und vorbei. Die Linden wechselten in Schwarz, Grün, Schwarz.
Ihr süßlicher Duft in meinem Zimmer. Ich drehte mich im Bett und blickte in den Schein vor meinem Fenster. Zerlegte Martins Namen in Silben und hörte auf den Klang, bis sie sinnlos wurden in der Wiederholung.
Er gefiel mir. Sein Gesicht. Vielleicht zu ernst. Sogar abweisend. Wie er versuchte, sein schwarzes Haar immer wieder glatt zu streichen, mit unwilliger Handbewegung.
Ich kannte den Klang seiner Stimme, seine Art sich zu bewegen. Wusste, worüber er sprach. Er war ein Meter achtzig groß, fünfundsiebzig Kilo schwer. Sohn eines Lehrerehepaars, und vor allem: Medinzinstudent im dritten Studienjahr. Ich bewunderte ihn.
Martin hielt mich mit beiden Armen an der Schulter, als ich die Straße betrat, vor heranbrausenden Autos. Ich traf sie gerne, meine Mitschülerinnen. Sie lachten und nickten anerkennend. Da wusste ich: Jetzt giltst du.
Am Anfang vermagst du nicht über die Hecke zu sehen. Die Wolken hinter den Kirschbäumen hältst du für ein Gebirge, das in Wahrheit weit hinter dem Horizont liegt. Die Sommer sind lang und heiß, und winters liegt der Schnee in den Straßen meterhoch.
Ich war siebzehn. Ich wusste, wie Rosenblätter sich anfühlen, und sah: Alle Pflanzen wenden sich der Sonne zu. Ich lachte in den Wind, der mein Kleid aufwirbelte. Sah Städte, Architekturen, Galerien und Landschaften, auch die Elbe, die Oder, die großen Seen.
Endlich das Meer. Hinter letzten grünen Hügeln hörten Straße und Land plötzlich auf. Da lag es, gegen den Himmel blauer als blau. Ich rutschte vom Rad, stand und stand.
Kein Meer hatte danach wieder diese Wirkung auf mich.
Nach Monaten erst werden wir uns küssen. Im Park, unweit der Mozartstraße. Rhododendren schimmerten wie Ballkleider. Ich legte meinen Arm um seinen Hals.
5. Kapitel
Wie ich mir meinen Partner dachte. Das Aufsatzthema hat es wohl nicht an den Tag gebracht. Da schreibt man, was auch laut gelesen werden kann vor der Klasse als Öffentlichkeit. Keine macht sich gern lächerlich mit Gefühlen. Die einen Schönen will, gilt für eitel, das ist klar. Groß sein dagegen darf er. Es geht um Hirn und Muskeln und um Charakter. Dabei kennt man den eigenen nicht.
Wir verlangen Interessengleichheit nach der Alternative Theater oder Fußballplatz. Und Hilfe im Haushalt. Was wir so fertigten, war nicht mehr als ein Wertekatalog nach Klischeebegriffen.
Wir hatten nichts geschrieben über „das Verlangen“. Das ließ auch der Biologielehrer unerwähnt. Unsere Vorstellungen von männlichen Körpern, Händen, Lippen, unsere Hautgefühle, all die herzspringenden, atemstoßenden Bedrängnisse wurden hingelenkt auf das Studium von Eizelle und Spermium, Genträger, die Menschheit wie in heiligen Schreinen bewahren.
Wenn wir auch niemals die Liebe im Biologischen suchten, so würde doch, was wir da hörten, lasen, auf farbigen Lehrtafeln sahen, an einem einzigen Tage mit und in uns geschehen. Unsere Körper würden sich umstellen und mit einem Kinde wachsen. Dass wir uns dann verändern in allem, musste eine notwendige Folge sein. Wir würden auch anders heißen: Frauen.
Nur ist die Zeit noch nicht. Das wurde uns gesagt.
Sommers lagen wir neben dem Bassin auf der Wiese und sahen zu, wie die Jungen vom Turm sprangen. Trotz Koedukation blieben sie uns die andere Art Mensch. Selbst ihren körperlichen Schmerz dachten wir verschieden von unserem, und wenn sie bluten. In der Zeit waren wir am wenigsten Mütter.
Liebe setzt sich nicht zusammen aus Themen wie Imprägnation, Embryologie, Haushaltführung und Säuglingspflege, die man uns lehrte. Das eben war unser Problem.
6. Kapitel
Martin hat uns mit einer Wolldecke zugedeckt. Er ist eingeschlafen und schnarcht leise. Ich stütze den Kopf in die Hand. Atme langsam. Sehe die halb vollen Weingläser auf dem Tisch, vor den brennenden Kerzen. Den Aschenbecher mit halb gerauchten Zigaretten. Mein Mund ist taub und rau. Zum ersten Male hab ich heute geraucht. Aber keinen Geschmack daran gefunden. Unsere Kleidung liegt ziemlich durcheinander auf dem Fußboden. Ärmel und Hosenbeine nach innen gestülpt. Martin hat mich gehalten wie ein Turnlehrer.
Ich erschrak über die Ruhe in mir. Jetzt müsste sich doch, dachte ich angestrengt, unser Leben von Grund auf ändern. Jetzt gehörten wir einander. Dann hatte ich Angst, seine Eltern könnten zurückkehren und uns entdecken. Und gleich wieder stellte ich mir vor, Martin würde ihnen von uns erzählen, und sie würden uns Glück wünschen. Und es würde sehr feierlich sein.
Ich küsste Martins Schulter und sein Gesicht, bis er erwachte.
Tage später gingen wir mit nassen Schuhen durch Taugras.
Der weiße Schleier über den Wiesen hob sich vor der Sonne, der wir, geblendet, entgegenliefen.
Wir dürfen uns niemals verbergen voreinander, rief ich, als hätte ich eine Formel entdeckt. Jeden Gedanken wollen wir uns sagen und jedes Gefühl.
Ich nahm die Farben und Töne der Felder auf. Und überall Martin mit mir: vor den tiefen Dächern, in der romanischen Dorfkirche, am Fahrkartenschalter und dann im Zug, der uns zurückbrachte in die Stadt.
Wir heirateten, als Martin sein Arztdiplom bekam.
7. Kapitel
Tagelang war das Wetter schlecht gewesen. Auf dem Weg von der Klinik nach Hause fühle ich die Sonne wie eine freundliche Berührung. Martins Mantel hängt an der Garderobe. Ich blickte flüchtig in den Spiegel, schüttle mein Haar locker und eile ins Wohnzimmer. Da ist er nicht. Als ich seine Zimmertür öffne, entsteht ein Luftzug, der Papiere von seinem Schreibtisch weht. Martin stößt den Stuhl zurück, hockt sich auf den Fußboden, um sie wieder einzusammeln.
Du bist immer so hastig.
Die Hand herstreckend, sieht er mich an, als fürchtete er, etwas zu vergessen, wenn er es nicht sofort aufschreibe. Ist dir nicht kalt, frage ich und blicke zum offenen Fenster, weil er nichts weiter gesagt hat und sich wieder hinsetzt, wahrscheinlich in der Meinung, ich würde sein Zimmer gleich verlassen. Es gelingt mir, zu lächeln über ihn, wie er da hockt, den Finger im Ohr, die Augen auf den Papieren.
Ich bin ins Wohnzimmer zurückgegangen, habe das Radio angedreht, nähe, auf dem Boden sitzend, meinen Rocksaum. Blättere in Modejournalen. Da reißt Martin die Tür auf, schnellt förmlich auf das Radio zu und stellt es ab. Sein Gesicht ist zerfaltet. Er sieht mich nicht an, steigt zurück über das Nähzeug, die Journale. Wendet sich noch einmal um. Das hält doch kein Mensch aus! Er sagt es wie jemand, der sich aufbringen will durch seine eigene Stimme.
Als er hereinkam, hatte ich aufgeschaut, erwartend, Liebkosungen vielleicht. Da hast du’s, sage ich mir. Sei nur gewärtig. Lass dich nicht fallen und gehen. Auch hier nicht, in deiner Wohnung. Nicht vor ihm. Ich hätte ihm etwas an den Kopf werfen sollen, das Likörglas, die Zeitung. Oder wenigstens ihn anschreien. Dann brauchte ich jetzt nicht zu heulen. Gleichmäßig muss ich mich machen.
Ich habe mein Kopfkissen vom Bett geholt, eine Wolldecke dazu und mich im Wohnzimmer eingeschlossen.
Ich liege auf dem Sofa und versuche mich um alle Freude zu bringen. Hinter den Fenstern der Stadthimmel. Käsefarben. Die Straßen denke ich mir öde. jeder, der hier geht, will unterkommen, so schnell wie möglich: in Gaststätten, Wohnungen. Lampenschein beleuchtet nur den Schmutz, den die Luft an Hauswänden abgelagert hat. Ruß. Kohlenstoff. Schwefelblüte. Vor den Bars werden die Gesichter der Nachtschwärmer bunt, wenn sie hineingehen, vorbei an großhändigen Türstehern.
Abnutzung auch drin in den Räumen. Lackschäden an Stuhlbeinen. Flecke auf Polstern. Geschwärzte Parketts. Strähnige Streifen auf Teppichen. Auch neue Farben und Gewebe werden bald verbraucht, Gläser gesprungen sein, frisch gehobelte und polierte Hölzer Risse haben. Verschleiß der Sachen. Verschleiß auch der Gefühle.
Ich stehe auf, stecke die Zeitungen zurück, falte den Schnittmusterbogen in seine Brüche, Da höre ich Martin klopfen. Ich schließe ihm auf. Siehst du verstört aus, sagt er. Er nimmt mein Kopfkissen.
Martin liegt auf dem Bauch. Seine Lippen blähen sich und blasen. Und meine Wachheit steigert sich.
8. Kapitel
Martin hat Klinikdienst über sechsunddreißig Stunden. Als er nach Hause kommt, sehe ich, wie sehr er abgespannt ist. Aber Martin, meinen Blick bemerkend, sagt: Ich bin nicht müde. Ich biete ihm trotzdem an, die Karten zu verkaufen. Er beginnt sich umzuziehen.
In der schmalen Straße vor der Konzerthalle stauen sich die Autos. Wir fahren im Schritt. Benzingestank dringt herein. Martin sieht mich an: Du hast dein Haar hochgesteckt. Es kleidet dich. Ich betaste meine Frisur: Dass du das siehst.
Wir haben unseren Platz. Die Gesichter um uns herum kenne ich. Es bleibt hell.
Ich beobachte den Dirigenten, versuche dem Kontrabassisten abzusehen, wie ihm zumute ist, achte auf die Einsätze, die Motive, die Themen. Ich muss mich wehren gegen das Licht. Noch tanzt der Tag. Ich suche mit meiner Hand Martins Arm. Er beugt sich herüber, seine Lippen an meinem Ohr: Ich schlafe nicht, und es klingt gereizt. Ich spüre, wie sich mein Herz leerschlägt. Wie ist es nur gekommen, dass wir uns so missverstehen.
Ich sitze im Halbdunkel und lasse mich heimsuchen von matten, ungenauen Bildern.
Martin knipst das Licht an. Eine Weile sitzen wir uns gegenüber.
Trinkst du? fragt er. Seine Stimme geht langsam, die Lippen berühren sich nicht. Er holt Gläser. Ausgießgeräusche. Sonst nur die Stille, die mir Ohrensausen macht. Martin riecht an seinem Glas. Was hast du eigentlich? Ich trinke rasch, dass es mir im Halse brennt, und sage; Ich machte dir eine Liste von Symptomen und du mir eine andere.
Symptome von was?
Ich würde mich wiederholen. Mein Schluckgeräusch ist hörbar, und ich ärgere mich darüber.
Damals, sagt Martin, hast du auf keine Symptome geachtet, damals haben wir uns geliebt. Das Wort schreit er beinahe.
Wir haben sie übersehen, sage ich. Das ist es.
Sein Gesicht ist rot vor Zorn. Gut, Ohrbohren, sagt er. Wichtigeres fällt dir nicht ein.
Meinetwegen. Zum Beispiel, du machst dir nichts aus Romanen.
Das ist nicht wahr, ich lese welche.
Ich meine, poetisches Empfinden hast du nicht. Auf Spaziergängen ...
Was ist da?
Bestimmst du Pflanzen.
Du auch.
Aber ich rieche vor allem ihren Duft.
Die wenigsten haben einen. Er lacht.
Da siehst du’s. Es hat keinen Zweck, sage ich.
Ich widerlege dich, und du sagst, keinen Zweck.
Nun reden wir beide laut. Und trinken schnell.
Sieh, sage ich ruhiger, du vermischst leider, und weißt das auch ganz genau, zwei sehr verschiedene Dinge. Nicht die Wirklichkeit, die wir beide sehen, ist verschieden, gewiss aber unser Empfinden von ihr.
Er unterbricht mich. Es gibt Notwendigkeiten, aber du sperrst dich, sie zu begreifen!
Notwendigkeit nennst du das, deine Planungssucht, deine ...
Die Flasche ist fast leer. Wir sind aufgestanden. Er wolle mir sagen, wie ich sei, ruft Martin, und es kommt dazu, dass wir einander mit Worten packen und verletzen. Martin steht mit dem Rücken gegen die Tür. Reißt die Augen auf, wiederholt sich. Er ist blass. Redet gegen das Fenster. Mitten im Wort rutscht er langsam, sich gegen das Holz stemmend, zu Boden. Ich renne hin, Herzschlag im Halse. Sein Puls geht rasch, ist kaum zu fühlen. Ich halte seinen Kopf.
Du bist erschöpft, sage ich, streichle sein Gesicht und führe ihn ins Schlafzimmer.
Vor den Fenstern sind die Sterne im Grau ertrunken.
9. Kapitel
Vogellärm. Sie müssen Nester gebaut haben, ganz in der Nähe. Ich spähe durchs Fenster. Martin steht im Hof und sieht in den Himmel. Er ist im Trainingsanzug, ist gelaufen. Als er mich entdeckt, zeigt er nach der Sonne.
Wir frühstücken. Martin hat die Zeitung mitgebracht. Ich bekomme meine Hälfte. Wir rühren in den Tassen, beißen in die Brötchen, lesen, zur Seite gerückt. Martin hat eine Platte aufgelegt. Ich versuche, auch auf die Musik zu hören, während Martin spricht und ich lesend an den Tag denke hinter den Fenstern. Es ist anstrengend. Wenigstens markiert Martin den Rhythmus nicht mit kräftigem BAM-ba-ba-BAM.
Für den Ausflug in den Wernheimer Forst haben wir alles vorbereitet. Anfangs ist es die gleiche Straße wie jeden Tag. Nur erscheint sie mir breiter als sonst, sauber geblasen vom Wind. Vor den Kliniken biegen wir ab. Stört es dich? Martin zeigt durch die Scheibe auf die verdreckte Motorhaube. Ich lache und lege die Hand auf sein Bein. Martin schweigt, und ich spüre seine Muskeln, wenn er die Pedale wechselt. Nach einer Weile schiebt er vorsichtig meine Hand beiseite. Ich merke, wie er mich rasch ansieht. Pass auf, sage ich und nicke gegen die Fahrbahn.
Vor einer kleinen Stadt müssen wir an einer Bahnschranke warten. Ich beobachte Martin aus den Augenwinkeln: seine helle Stirn, die immer noch dunklen Haare, gerade Nase, die Kinnkerbe unter den vollen Lippen. Jeder Ausdruck hat für mich eine Geschichte. Zu jeder Miene gehört eine Stimmung, die ich kenne seit Langem. Wie sein Gesicht kenne ich die Art seiner Bewegungen. Und schon habe ich aus Gesten, einem besonderen Lächeln auf Gedanken geschlossen, die ihm doch vielleicht gar nicht kommen. Wäre diese Befangenheit nicht, ich glaube, manchmal verstünden wir einander müheloser.
Hast du etwas? Du hast doch etwas?
Nein, nein.
Die Felder neigen sich gegen den Horizont. Ein grauer Streifen kommt hochwachsend näher, gliedert sich in Kronen und Stämme.
Durch den Kiefernhimmel flirren Lichtrohre. Wir steigen über Baumholz, biegen Büsche auseinander.
Die Zweige peitschen mir die Beine. Dann stehen wir vor dem Bach. Wir haben ihn schon eine Weile gehört. Helle Flecke kreiseln auf seiner Oberfläche.
Los, sage ich und springe. Martin mir nach. Aber dort! Ich zeige hin, wo das Ufer steiler, das Bett breiter ist. Er tritt zurück und springt. Ich rutsche mit einem Fuß ins Wasser. Martin zieht mich heraus.
Ich sitze im Moos, den Kopf nach hinten. Sonnenschein tropft mir in die Augen.
Martin hat Fliegenpilze entdeckt. Amanita muscaria, sagt er. Es klingt ergriffen. Ich stütze mich auf die Ellenbogen und strecke ihm mein Bein entgegen. Sieh mal, Schlamm. Er kommt, kniet sich hin. Zieht mir den Schuh aus. Ich schaue ihm ins Gesicht.
Bist du zerschrammt, sagt er. Er entdeckt krautartige Blätter, bricht sie ab und beginnt meinen Schuh zu säubern.
Da ist ein Geräusch, als sei ein Stein in den Bach gefallen. Siehst du jemand? Martins Nein klingt nicht überzeugt.
Wenn man so ruhig liegt, ist es doch kühl. Spinnennetze wie dünne Nebel zwischen niedrigen Kiefern. Der rote Pilzhut leuchtet nicht mehr, der Rand zeigt auch Bissschäden. Amanita muscaria. An dem bleichen Schaft kriechen Schnecken. Ich stehe auf und streiche mir den Rock glatt.
10. Kapitel
Die morgendlichen Verrichtungen müssen ineinandergreifen wie Zahnräder. Zähneputzen, Brotschneiden, Wasser aufsetzen. Kein Handgriff darf länger dauern als vorgesehen. Schon wenn mir wie eben die Zahnpasta von der Bürste ins Waschbecken fällt, weggespült und neue ausgedrückt werden muss, ist das eine Störung, die erschreckt: Um Gottes willen, ich vertrödle mich!
Von den Abläufen hat Martin die Zeit genommen. An einem Sonntag, in aller Ruhe. Für Störungen hat er fünfundzwanzig Minuten berechnet. Um soviel stehen wir früher auf. Wenn der Motor schwer anspringt oder die Ampeln rot zeigen, brauchen wir das Zeitpolster auf. An der Art, wie Martin dann auf seine Uhr sieht, erkenne ich, wie sehr ihn die Angst vorm Zuspätkommen treibt.
Programmiert auch der Anfang des Kliniktags.
Ich trete vor die Tafel, auf der mit Kreide die Operationsfolge geschrieben steht. Zuoberst: der Name der Patientin, dahinter mein Signum als Operateurin, erste Assistenz: Dr. Anna Kerst, zweite Assistenz: Famulus Günter, Narkose: Oberarzt Fahrner. Indem ich es lese, löse ich mich von allem, was mich abbringen könnte, von Schlafresten, Hast, Zweifeln. Hier werden Stimmungen nicht geduldet.
Ich gehe zwischen den Betten, die auf dem Gang stehen. Betrachte flüchtig die Frauen. Auch sie haben sich geschickt, von den Haushalten, den Partnern, dem Kind Abschied genommen, die Welt jenseits der Milchglasscheiben verlassen, auf Zeit. Man ist aufgenommen in den Orden und hat nun die Regeln zu befolgen.
Frau Otto, meine Patientin, wird hereingebracht. Ich gehe ein paar Schritte neben dem Bett her. Dann lasse ich ihre Hand los. Sie fragt nichts. Jetzt.
Ich schiebe die Füße in die weißen, ungefügen Gummischuhe, binde die Haare in ein Tuch und stelle mich an das Waschbecken neben Dr. Anna Kerst. Sie bearbeitet Hände und Arme bis zu den Ellenbogen kräftig mit Wurzelbürste und Kernseife. Ich drehe den Kran auf, prüfe die Wassertemperatur und sehe noch einmal nach der großen Uhr über uns. Belangloses Reden mit Anna Kerst und Famulus Günter. Von der Operation kein Wort. Wir tauchen unsere Hände in die Schüsseln mit Desinfektionslösung. Einen Augenblick presse ich den Atem in meiner Brust.
Mit ausgestreckten, tropfenden Händen gehe ich als erste in den Saal. Schlüpfe in das hergehaltene Operationszeug.
Die Operationsschwester gibt mir das Skalpell. Fertig? frage ich Fahrner, der, in der Hand den Atembeutel, auf einem Hocker sitzt. Ich blicke zur Saaluhr und beginne mit einem bogenförmigen Hautschnitt.
Arbeitsfeld im Schein der Operationslampe. Hinsehen. Schneiden. Abklemmen. Nadeleinstechen. Das Spektrum meiner Gefühle engt sich ein wie im Fanatismus. Ich handle unter Zwängen: Schnelligkeit. Genauigkeit. Vollständigkeit. Es ist heiß. Vorsichtig beuge ich den Kopf zur Seite, damit die Schwester mir Schweißtropfen abwischen kann.
Ich höre den Ventilator. Sehe Stäubchen wie Lichtpunkte auf den Fliesen zwischen Tupfern und abgeschnittenen Fäden. In einem Zeitbruch habe ich Angst. Ein Mensch. Aber wir sind eingeübt, aufs einzelne zu sehen: Gewebe, Harnblase, Ureter, Därme, Gefäße.
Ich trenne ab, nähe, Anna Kerst knotet, tupft. Günter hält die Darmschlingen zurück. Endlich fasse ich den Uterus.
Nach der letzten Hautnaht verkündet die Operationsschwester: 1.15 Minuten! Fahrner zieht den Tubus heraus, ruft die Patientin an: Aufwachen, Frau Otto, Augen auf! Wir binden die Mundtücher ab, schlurfen zur Tür und steigen aus den Gummischuhen.
Dann operiert Fahrner. Ich assistiere, Anna Kerst macht Narkose, Günter hält wieder die Haken. Ich tupfe, knote, halte gegen mit der Pinzette. Da ich immer den gewiesenen Handgriff tue, ist meine Aufmerksamkeit äußerlich. Mir gelingt die Distanz aus der Haltung der Zweiten. Angst hat man da nicht einen Augenblick.
Im schmalen Zimmer neben dem Waschraum trinken wir Kaffee, die Hände, damit sie steril bleiben, in Gummihandschuhen. Der Ausnahmezustand ist aufgehoben.
Wie viele Operationen ich gemacht hätte, fragt Günter. Ich weiß es nicht genau. Über zweihundert jedenfalls. Es beeindruckt ihn. Er will auch Gynäkologe werden. Fahrner mischt sich ein. Die Zahl mache es nicht.
Ich höre nicht mehr zu, denke, wenn es vierhundert, zweitausend sein werden, sitze ich auch noch hier, mein Leben wäre dann zweitausend Operationen lang.
Die Pause, sage ich und gähne. Es sollte sie nicht geben. Keine Abende, keine Sonntage. Keinen Urlaub. Nicht zur Besinnung kommen. Arbeiten und Schlafen.
11. Kapitel
Ich treffe Dagmar allein an im Stationszimmer. Der Tag ist über seinen Gipfel. Wir sind eher wieder bereit, an Sicherheit zu glauben, wo wir wissen, dass die großen Einsätze geplant sind für morgen. Soweit vorherzusehen.
Dagmars Dienst ist zu Ende. Sie will die Station übergeben. Es ist ihr recht, dass wir die Kurven hier durchsehen. Zwei Patientinnen haben Temperatur. Frau Jordans Bein schmerzt. Hoffentlich keine Thrombose. Das fehlte uns gerade noch.
Wir haben keinen wirklichen Einblick. Jederzeit können die Übel ausbrechen. Und ich sage: Wieso haben die denn Fieber?
Während ich das Bein untersuche, schaut mir Frau Jordan mit aufgerissenen Augen auf den Mund. Es ist nichts, sage ich. Wirklich. Auch wenn es eine Thrombose wäre, das beherrschen wir.
Nur langsam glaubt sie. Ich nehme ihre Hand, als wollte ich den Puls fühlen. Betrachte die Aufschrift einer Büchse, die Zahnputzgläser auf der Glaskonsole über dem Waschbecken und denke: Warum sagst du das, beherrschen. Du weißt doch, was wir vermögen, was nicht.
Ich sehe uns sitzen im Hörsaal der Medizinischen Klinik, die Köpfe über den Kollegheften. Professor Büner steht vor der untersten Bankreihe, spricht, mit den Händen sich abstützend, das Gesicht zu uns erhoben, über Entwicklung in der Medizin. Werden histologische Bilder gezeigt, schreiben wir unter dem Streulicht der Projektionslampe, Wir hören von erstaunlicher Wiederherstellung der Gewebe, wahren Wunderheilungen. Und während Büner uns die Niederlagen der Bakterien darstellt, von den Siegen über den Kreislaufschock berichtet, atme ich auf, glücklich, heute zu leben, in unserer Zeit.
Die redenden Lehrer, in ihren Vortragshaltungen, im Selbstbewusstsein ihrer Wissenschaften. Kaum einer sagt, was wir nicht können, und die verdorbenen Fälle, die sie uns vorführen, gelegentlich, haben immer finstere Gesellen auf dem Gewissen, die nichts gelernt hatten und meist von „außerhalb“ waren.
Wir lernten das Erklärbare, fühlten uns aufgenommen, würdig befunden und glaubten sie bald ganz im Besitz zu haben: Die moderne Welt, in der es warm sein würde, trocken und hell wie in den Hör. sälen. Wir erkannten die Ordnung in den Organsystemen, und es lag nahe, sie wohlbedacht zu nennen. Der Bau einer Drüse, ihre Steuerung, Absonderung und abgestimmte Wirkung versetzte uns schon in Staunen. Zwar hatten wir die Idee aus dem Himmel gejagt, aber die Evolution, auf bloßen Mutationen hinkend, hat ihre Stelle in unserer Fantasie und Psyche keineswegs eingenommen. Von altersher lieben wir es, Natur in Nymphen und Göttern zu verlebendigen. Es ist uns lustiger und wohnlicher so. Wohl daher heißt es noch immer: Die Natur hat es eingerichtet. Als sei sie ein planender Geist. Der Mensch hat zwei Augen, damit er räumlich sieht. Und wir erfahren die Ordnung der Werte.
Wenn Professor Alredes, meine Testatkarte in der Hand, mich abfragte nach dem Verlauf des Nervus obturatorius und ich ihm antwortete, kaum dass er diese und die nächste und die dritte Frage gestellt, folgte sein frohes Gut so wie die gesetzmäßige Anerkennung für meine Leistung. Also war die Welt auch gerecht. Es bekam jeder, was er verdiente.
So wurden wir bewehrt, und es war nicht leicht, sich von dieser Rüstung wieder zu befreien. Nicht jedem ist es gelungen.
Im Stationszimmer steht Anna Kerst, die Hände in den Kitteltaschen. Kerstin, ihre Tochter, ist erkrankt. Fieber, Erbrechen. Ich erschrecke, aber nicht wegen des Kindes. Anna Kerst hat Bereitschaftsdienst. So schnell übernimmt den keiner. Und ihr Mann, frage ich und höre selbst den Vorwurf. Sie sieht mich an, und ihre Augen haben den Ausdruck wie die von Frau Jordan, als ich ihr Bein untersuchte. Ach, sagt sie.
Die Enttäuschung macht mir Luftnot. Und immer noch hoffend, sie lehnt ab, sage ich: Gut, ich springe ein. Sie drückt mir die Hand. Heftig.
In meinem Zimmer stehe ich hinter dem Fenster und blicke auf die Straße. Die Autos fahren vom Parkplatz ab, eins nach dem anderen. Ich höre Anna Kersts Schritte auf den Treppen. Es kommt mir vor, als bliebe ich allein im Haus. Eingesperrt. Festgehalten. Du bist schön blöd, denke ich. Als ob es nicht ausreicht, wenn sich der Mann kümmert. Ich gehe zum Telefon, um Martin zu sagen, dass ich nicht komme.
Dumm und gut gebraucht man häufig in einem Sinne, es heißt auch, dass schwach sei, wer nicht nein sagen könne. Ich weiß es, und es nützt mir nichts. Ich gehe hinunter zur Pforte und lasse meinen Namen an die Tafel schreiben.