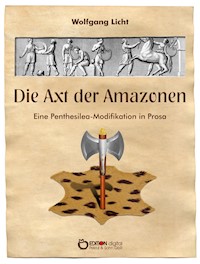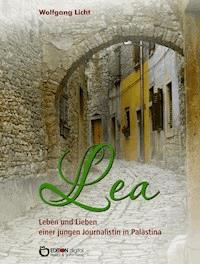
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es sind ungewöhnliche, abenteuerliche Erlebnisse, die Lea als Journalistikstudentin in Deutschland mit diversen Männern und mit deren Umwelt erfährt. Doch als sie dann nach dem Studium als Auslandskorrespondentin in Jerusalem arbeitet, erlebt sie derart Dramatisches und kommt in komplizierte psychologische Situationen, die sie sich bisher nicht vorstellen konnte. Ursachen dafür sind der Konflikt zwischen dem israelischen und dem palästinensischen Volk und Leas intensive, prickelnde Liebesbeziehung sowohl zu einem Juden als auch zu einem Palästinenser, die in packenden Szenen geschildert wird. Ein unter die Haut gehendes Buch mit einem realistischen, bisher ungelösten gesellschaftlichen Hintergrund! LESEPROBE: Wenig später kam Sonja zu mir ans Werk. Sie wartete neben dem Werktor vor einer Litfaßsäule. Sie hatte einen Schreibblock in der Hand und es sah aus, als schriebe sie das Kinoprogramm der Woche ab. Als sie mich sah, steckte sie ihr Schreibzeug in die Handtasche und ging weg von der Säule, sodass ich meinen Anruf zurückhielt. Sie lief ganz langsam, schlenderte förmlich; so ging ich ihr nach. Als ich neben ihr war, drehte sie mir ihr Gesicht nicht zu, ich gebe Dir heute nicht die Hand, sagte sie ziemlich leise. Zuerst sag Lydia nichts, ich besuche sie wieder. Aber ich muss aufpassen, dass sie mich nicht vorher abfangen. - Sie war aufs Präsidium bestellt worden, Auskünfte wurden verlangt über Lydia; wo sie, Sonja, ihre Zeit zubringe, von der sie wohl zu viel habe, nichts damit anzufangen wisse; und heute war sie zur Personalabteilung ihres Krankenhauses bestellt worden. Man hielt ihr dort vor, Patienten hätten sich über ihren Umgang beschwert, eine Schwester habe auch außerhalb des Krankenhauses auf ihren Ruf zu achten. - Ich legte ihr nahe, eine Weile wenigstens, nicht zu kommen. Ich werde Lydia sagen, Du bist krank, hättest mich angerufen im Werk. - Ja, sagte sie, es ist wohl besser so, eine Weile wenigstens. Ich konnte nicht erkennen, was Lydia dachte, als ich ihr die Nachricht überbrachte. Ihr Gesicht schien ohnehin nur noch einen einzigen Ausdruck zu kennen, oder vielmehr gar keinen; als sei die Muskulatur ihres Gesichts unfähig, sich zu koordinieren: die Lippen immer ein wenig voneinander; das Kinn gesenkt, die Lider gedunsen; am schlimmsten ihr Starren, als fixiere sie einen einzigen Gegenstand jenseits aller für mich erkennbaren Dinge.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 429
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Impressum
Wolfgang Licht
Lea – Leben und Lieben einer jungen Journalistin in Palästina
ISBN 978-3-86394-380-6 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 2006 im Tauchaer Verlag unter dem Titel „Lea“.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2013 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860-505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Erster Teil
1. Kapitel
In der Stille hörte sie nur das Geräusch ihrer Schritte auf dem Kiesweg. Sie atmete den Duft von Pflanzlichem, der ihre Sinne wie eine Würze erregte. Vom Schein ferner Stadtlampen getroffen glänzten die Blüten mächtiger Rhododendren, die Lea wie die farbigen Lampions eines Zaubergartens erschienen. Mit einem leichten Erschrecken nahm sie die dunkle Gestalt eines Nachtvogels war, der plötzlich aus einem nahen Gebüsch aufgeflogen war und nun lautlos mit ausladenden Schwingen davonstrich und in der Dunkelheit verschwand. Der Vogel kam ihr wie ein Bote vor, ein Abgesandter der hier lebenden Geschöpfe. Auf seltsame Weise fühlte sie sich den Pflanzen und Tieren zugehörig, wie der Erde, deren Nachtdüfte sie gierig atmete.
In ihr herrschte jetzt ein Gefühl der Schwere. Sie hätte hinsinken wollen, auf das Gras, eintauchen in das Blütenmeer der Rhododendren.
In ihre Neugier, Begierde auf das Leben, mischte sich für einen Augenblick aber auch Beklemmung, Angst vor der Dunkelheit, die sie sich nun voller ungestalter Wesen dachte, denen sie in ihrer Einsamkeit hilflos ausgeliefert wäre.
In diesem Augenblick stieß sie an einen Stein, was einen harten, hellen Laut gab, der sie veranlasste stehenzubleiben, um zu lauschen; war jemand auf sie aufmerksam geworden, hatte sie sich verraten? Lea glaubte, sich in einer zauberischen Welt zu befinden; ein Unhold hätte sie womöglich an- und aufgreifen können. Die Dunkelheit, ein besonderes Reich, in das Tagmenschen nicht eindringen dürfen.
Als sie in die Richtung sah, in die der Vogel davongeflogen war, fiel ihr Blick auf eine am Wege in einer Nische stehende Bank, auf der zwei Menschen lagen. Dass es Menschen waren, erkannte sie erst im Näherkommen, als deren schattenhafte Umrisse deutlicher wurden. Anfangs nahm sie nur eine dunkle, klumpige Masse war, die mit der Bank verschmolzen schien. Ein dem Schreck verwandtes Gefühl beherrschte sie augenblicklich. Der für einen Zeitbruch aufzuckende Gedanke, sich wegzuwenden, davonzumachen, die Augen zu schließen, umzukehren oder einen anderen Weg zu nehmen, erstarb vor dem Drang, Zeuge eines Vorgangs zu werden, der nur in dieser Verborgenheit stattfinden konnte. Die Begier, Unerhörtem beizuwohnen, ergriff ihre Sinne wie eine aufschießende Hitze. So ging sie weiter, vorsichtig, um das Geräusch ihrer Schritte zu dämpfen. Sie behielt die Bank unverwandt im Auge, senkte ihren Blick keinen Augenblick auf den Weg, in Furcht, eine entscheidende Phase zu verpassen, etwa, dass sich das Paar voneinander lösen könnte, der Mann aufstehen und sie den Blick auf seine Blöße hätte und die der Frau. Da sah sie einen weißen gebogenen Schenkel aufschimmern, vom Licht der Stadtlampen getroffen, wie vorhin die Blüten der Rhododendren, sah das Heben und Senken des männlichen Körpers in einem schaukelnden Rhythmus. Weitere von Kleidern entblößte Partien waren nicht zu sehen.
Lea war herangekommen. Unterdrückte ihren Drang, stehen zu bleiben. Wendete aber im langsamen Vorbeigehen ihren Blick von dem Paar nicht ab. Da sah sie, wie die Frau Lea das Gesicht zuwandte, dem Mann etwas sagte, offenbar, dass sie beobachtet würden, dabei hielt sie ihn mit beiden Händen an der Schulter, als wolle sie ihn veranlassen, sich ruhig zu verhalten. Doch der Mann ließ sich nicht beirren, setzte seine Handlungen fort. Er hatte seinen Kopf zur Seite gedreht und Lea flüchtig angesehen. Es schien ihr, dass er, nachdem er sie wahrgenommen hatte, intensiver zu Werke ging. Ein so junges Mädchen wie sie, dachte Lea, sah er jedenfalls nicht als Grund an, seinen Liebesakt zu unterbrechen. Vielleicht war das der Grund, warum sich Lea gewissermaßen in den Akt einbezogen und sich berechtigt fühlte, ihn bis zum Ende zu verfolgen.
Es traf sie in diesem Augenblick ein kühler Luftzug an Waden und Schenkeln und sie vermeinte zu fühlen, wie jener Mann sie berührte, obwohl sie wusste, dass es die Bewegung der Luft war, ein leichter Wind, den sie wie eine kosende Berührung empfand.
Sie war weitergegangen. Der Weg machte jetzt eine Biegung. Sie würde, dachte Lea, dem Paar nun aus den Augen sein. Da blieb sie stehen. Ein abenteuerlicher Gedanke kam ihr. Sie wollte das Ende des Aktes abwarten. Herausfinden, was das Paar danach beginnen würde. Sie betrat den Rand einer Wiese, die mit Buschwerk besetzt war. Vorsichtig ging sie im Schutze der Büsche zurück bis zu einem Baum, hinter dessen Stamm sie sich verbarg. Die Bank hatte sie deutlich im Blickfeld. Doch sie war zu spät gekommen. Das Paar war schon aufgestanden und kam, sich an den Händen haltend, langsam den Weg entlang, den Lea eben verlassen hatte. Auf seltsame Weise war Lea enttäuscht. Sie dachte, dass der Akt in dem Antlitz der Liebenden Spuren hinterlassen haben müsste, die Leidenschaft sich in ihren Zügen wieder finden. Am liebsten hätte sie ihre Gesichter mit einer Lampe ausgeleuchtet. Sie beschloss, dem Paar nachzugehen. Vielleicht würde sie aus ihrem ferneren Verhalten erkennen können, was der Liebesakt bei ihnen bewirkt hatte. Denn nach Leas Verständnis müsste ein solches Ereignis zwei Menschen vollkommen verwandeln. Obwohl, das war ihr natürlich bewusst, eine solche Wandlung nicht vor den Augen der Öffentlichkeit, gewissermaßen auf der Straße erkennbar sein konnte. Und genau hätte Lea auch nicht sagen können, worin diese Wandlung im Konkreten bestehen sollte.
Vorerst hielt sich Lea hinter dem Baum weiterhin verborgen. Sie veränderte ihren Standort nur immer so weit, dass sie von den Liebenden nicht bemerkt werden konnte. Nach einer Weile kamen sie an Lea vorbei. Sie hielten sich nicht mehr an den Händen, berührten sich auch sonst nicht. Nach geraumer Weile trat Lea hinter dem Baum hervor und ging in gehörigem Abstand hinter den beiden her. Diese blieben plötzlich stehen, wodurch sie Lea zwangen, ebenfalls stehen zu bleiben. Sie küssten sich, aber wie es Lea schien, ziemlich flüchtig. Der Mann war es, der sich aus der Umarmung löste, weiterging und die Frau gleichsam an der Hand nach sich zog. Unerwartet rasch war der Weg, der aus dem Park heraus in die Stadt führte, zu Ende.
An einer Straßenbahnhaltestelle blieben die Liebenden stehen. Lea verlangsamte ihre Schritte, ging dann auf die Haltestelle zu, entschlossen, dieselbe Bahn zu nehmen, in die die beiden emsteigen würden. Andere Wartende gab es nicht. Würde der Mann, der, auf der Frau liegend, Lea gesehen, ihr sein von Leidenschaft verzerrtes Gesicht zugewandt hatte, sie wieder erkennen? Und für einen Augenblick, das Blut stockte ihr, schien es, als erinnere er sich tatsächlich. Lea trug einen kurzen roten Rock zu einer schwarzen Bluse. Auffällige Farben, die aber in der Dunkelheit ihre Leuchtkraft verloren hatten.
Angestrengt schaute sie an dem Mann, der sie soeben kurz fixiert hatte, vorbei, scheinbar in Gedanken versunken. Im Licht der entfernt stehenden Laterne waren ihr Gesicht und die Gestalt wohl ohnedies in einige Unschärfe getaucht. Zudem hatte der Mann sie aus der Perspektive eines Liegenden gesehen, gewissermaßen von unten nach oben, während er sie jetzt, er war deutlich größer als sie, eher von oben betrachtete.
Was würde in ihm, dachte Lea, vorgehen, erkannte er sie? Womöglich Begehren oder Furcht vor Zeugenschaft, falls er seine Partnerin hatte heimlich treffen müssen.
Ziemlich rasch war die Bahn herangekommen, hatte Lea aus ihren Betrachtungen gerissen. Sie sah, wie beide sich die Hand gaben, die Frau den Mann flüchtig küsste, schließlich allein die Bahn bestieg und mit ihr davonfuhr. Der Mann blickte nochmals nach Lea, die sich anschickte, auf- und abzugehen, wobei sie auf ihre Armbanduhr sah. An dieser Haltestelle kamen Bahnen verschiedener Linien an. Lea wartete eben auf eine andere Bahn.
Sie beobachtete den Mann aus den Augenwinkeln. Der schien sie ansprechen zu wollen, unterließ es aber. Er wendete sich schließlich entschlossen ab und ging zu Fuß weiter. Offensichtlich wohnte er in der Nähe oder hatte sein Auto hier irgendwo geparkt. Einem plötzlichen Impuls nachgebend, beschloss Lea, ihm zu folgen. Dieser Entschluss basierte nicht auf einer rationalen Überlegung. Als sie die ersten Schritte tat, um dem Mann nachzugehen, hatte sie keine Vorstellung, was daraus folgen könnte. Es war ein übermächtiger Drang, etwas herauszufinden, was sie erst dann, wenn sie es entdeckt hätte, auf seine Verwendungsfähigkeit hin beurteilen könnte. Der Mann lief gleichmäßig, wie einer, dem eine Sache geglückt ist; wenn es das gibt, das man dem Gang eines Menschen dessen Gemütslage ansehen kann. In Lea war eine zunehmende Spannung entstanden, die ihre Pulse rascher schlagen ließ. Der Grund war nicht etwa Verliebtheit oder die Lust, ein Abenteuer zu erleben, sondern ein ihr eigener kriminalistischer Spürsinn. Auch deshalb studierte sie schließlich Journalistik. Während sie den Abstand einhielt, der sie von dem Verfolgten trennte, fasste sie gleichzeitig ihre Umgebung ins Auge: Haustüren, Litfaßsäulen oder Laternen, hinter denen sie notfalls Deckung nehmen könnte, und. falls das nicht gelänge, bedachte sie Begründungen, die sie ihm, falls er ihr den Weg verlegen würde und wissen wollte, warum sie ihm nachliefe, sagen wollte. Das Beste wäre, sich jede Belästigung zu verbitten. Schließlich war es ihre Sache, welchen Weg sie auf öffentlichen Straßen wählte und warum. Darüber war sie keinem Rechenschaft schuldig.
Aber der Mann blieb nicht stehen. Er ging jetzt in einer breiten Straße, die von gut erhaltenen Mietshäusern gesäumt war. Vor einer der Haustüren blieb er stehen, zog umständlich einen Schlüsselbund aus seiner Jackentasche, hielt ihn gegen das Licht einer Laterne und schloss die Tür endlich auf. Lea sah noch, wie der Hausflur durch die offenbar von dem Mann eingeschaltete Nachtbeleuchtung erhellt wurde. Dann wurde die Tür wieder verschlossen. Fenster im Treppenhaus waren nicht zu erkennen. Wahrscheinlich lagen sie an der Rückfront des Hauses. Lea lief auf die gegenüberliegende Straßenseite und beobachtete von dort aus die Fensterfront des Hauses. Zwei der Fenster waren erleuchtet. Würde der Mann dort wohnen, hieße das, jemand wartet auf ihn. Da, auf der rechten Frontseite des Hauses ein erleuchtetes Fenster! Davor ein Balkon. Lea hielt die Arme an den Seiten, die Hände gekrümmt, als wolle sie einen Gegenstand festhalten, der ihr zu entfallen drohte. Das Fenster blieb hell. Sie glaubte, einen Schatten hinter den Scheiben zu sehen. Den Schatten eines Mannes. Tatsächlich, ein Mann trat auf den Balkon. Der Mann aus dem Park! Es war auch gerade so viel Zeit vergangen, wie einer brauchte, das Treppenhaus zu durchsteigen, in diese Wohnung zu gelangen, das Licht anzuknipsen und schließlich den Balkon zu betreten. Bald zog sich der Schattenmann zurück ins Zimmer und ließ Lea weiter im Ungewissen. Lea eilte über die Straße, fand die Klingeltafel mit den Namensschildern. Das erleuchtete Fenster befand sich im dritten Stock, rechts. Im schwachen Schein der Laterne war es mühsam, die Namen zu erkennen. Reuter oder Rauper. Überlegend blieb sie eine Weile im Schatten der Haustür stehen. Jetzt zu klingeln würde sie nur bloßstellen. Sie könnte allerdings sagen, falls es tatsächlich die Wohnung des Parkmannes wäre und er gewillt das Fenster zu öffnen oder herunterzukommen, er habe etwas verloren, seinen Ausweis oder seine Brieftasche. Er würde in seinen Sachen nachsehen, feststellen, dass ihm nichts dergleichen fehle und ihr das ärgerlich oder freundlich verkünden. und sie wäre abgeblitzt.
Für heute musste sie aufgeben. Aber sie würde wiederkommen. Am Tage. Wenn er zu Hause wäre. Würde sich als Reporterin ausgeben. Unterwegs in Sachen einer Umfrage-Aktion. Vor einiger Zeit hatte sie einen Artikel über »Partnerwahl« geschrieben und an die Redaktion der »Rundschau« geschickt. Sie hatte keine Antwort bekommen. Aber bei sich selbst konnte sie sich auf diesen Vorgang berufen. Sie würde vorgeben, so überlegte sie, für die »Rundschau« zu recherchieren. Das Thema: Was Frauen und Männer über die Ehe als Institution dachten und ob sie sich Alternativen vorstellen könnten. Als Studentin der Journalistik im 2. Semester fühlte sie sich dazu berechtigt.
Am übernächsten Tage stand sie wieder vor der Tür, die sie offen fand. Dritter Stock. Eine schwere Holztür mit Messingklinke. Ein Namensschild aus schwarzem Marmor. Darauf in grauer Färbung ein Name: Reiter. Es war nicht ersichtlich, ob der Bewohner ein Mann oder eine Frau war. ln Lea war Gespanntheit zum Zerreißen. War er zu Hause? Würde ihr womöglich eine Frau gegenüberstehen, seine? Die Geliebte auf der Bank konnte es ja nicht sein. Von ihr hatte er sich an der Straßenbahnhaltestelle verabschiedet. Lea hatte unwillkürlich das Namensschild berührt, mit den Fingerkuppen darüber gestrichen, beinahe zärtlich. Wollte sie den Inhaber der Wohnung günstig stimmen?
Sie drückte die Klingel. Unmittelbar darauf hörte sie Schritte. Es war, als hätte der Bewohner auf das Klingelzeichen gewartet. Die Tür wurde geöffnet. Der Mann, gleichgültig, ohne Neugier, eher ungehalten, schien jetzt doch überrascht. Seine Züge veränderten sich ins Höflich-freundliche. Er musterte sie, lächelte dann. Lea glaubte, ein äußerst leises Geräusch zu vernehmen, wie es entsteht, wenn trockene, fest geschlossene Lippen sich voneinander lösen.
Lea war sich bewusst, dass der Erfolg ihrer Unternehmung abhing von dem ersten Eindruck, den sie auf den Mann machte. Sie musste eine Anmutung bei ihm auslösen, die ihn bereit machte, ja, begierig darauf, sich mit ihr zu befassen. Es müsste ihm, so dachte sie, schmeicheln, dass er das Ziel ihres Besuches war.
Mein Name ist Lea Martin, sagte sie. Ich komme von der »Rundschau« und möchte Sie zu einem Thema befragen, was die Öffentlichkeit interessiert. Dabei sah sie ihn mit einem Lächeln an, als frage sie ihn, ob sie ihn küssen dürfe. - Es dauert nicht lange. - Wie kommen Sie gerade auf mich? - Ausgewählt wurde nach dem Zufallsprinzip, sagte sie rasch und ein wenig undeutlich. - Und über welches Thema wollen Sie mich befragen? - Über die Ehe. - Da sind Sie falsch, ich bin nicht verheiratet. - Lea hatte einen ersten Erfolg erzielt. Also war die Frau auf der Bank tatsächlich seine Geliebte, vielleicht sogar nur eine flüchtige Bekanntschaft. - Das mache nichts, sagte Lea weiter: es gehe darum, was Frauen und Männer heutzutage von der Ehe als Institution hielten. Und vielleicht, sie machte eine Pause, hängte ihre Tasche über die linke Schulter, eine Gebärde, als müsse sie einen inneren Widerstand überwinden: Vielleicht, wiederholte sie, mache sich jemand Gedanken über eine Alternative. - Eine Alternative? - Der Mann lachte leise und umfasste zum ersten Male Leas ganze Gestalt mit einem Blick, wobei er einen Schritt zurücktrat. Immerhin hatte Lea erreicht, dass der Mann sich für sie interessierte, in der Begegnung mit ihr ein Amüsement sah. - Ich habe eigentlich keine Zeit, sagte er jetzt, aber ich bin gespannt, warum ein so junges Mädchen wie Sie solche Fragen stellt. Kommen Sie herein. - Er machte eine auffordernde Geste.
Sie trat an ihm vorbei in eine Diele, von dort aus führte er sie in einen Raum, der wohl sein Arbeitszimmer war. Er wies auf einen schwarzen Ledersessel. Lea fühlte die Kühle des Materials. Seiner Glätte wegen gelang es ihr nicht, gerade zu sitzen. Wie durch einen Sog wurde sie immer wieder in die Tiefe des Sitzes gezogen, was sie durch Auflegen beider Arme auf die Lehnen zu verhindern suchte. Dabei verrutschte ihr Rock aus Lyoner Seide.
Während des Gespräches nahm sie wahr, wie der Hausherr hin und wieder einen Blick auf ihre Schenkel warf. Sie glaubte in seinen Augen den gleichen Glanz der Begehrlichkeit zu erkennen, wie sie ihn bei dem Mann auf der Parkbank wahrgenommen hatte oder sich einbildete, wahrgenommen zu haben, weil dieser Glanz in ihrer Fantasie zu dem Vorgang gehörte.
Um diesen Blicken nicht zu begegnen, betrachtete sie die Bücherregale an der Wand hinter dem Mann. Titel konnte sie nicht erkennen. Neben in Farbe und Format gleichen, gab es in Größe und Ton unterschiedliche, neben in Reihen geordneten, schräg gestellte und quer gelegte Exemplare. Es schienen, dachte Lea, Bücher wissenschaftlichen Inhaltes und schöngeistige in paritätischer Mischung zu sein. Lea gab sich den Anschein, die ihr in diesem Augenblick völlig gleichgültigen Bücher mit Interesse zu betrachten.
Sie hatte Reiter berichtet, dass sie Journalistik studiere und er hatte sie nach Einzelheiten der Ausbildung und nach den Namen ihrer Lehrer gefragt. Jetzt wäre es an der Zeit, das Interview zu beginnen. Doch Lea wollte den Beginn der Befragung hinausschieben, sie suchte deshalb nach einer Ausweitung des Gesprächs, wozu ihr die Bücher dienen sollten. Auch aus Neugier drehte sie jetzt den Kopf ein wenig, um die Wohnungseinrichtung zu betrachten. Da fiel ihr Blick auf ein Gemälde, das sie augenblicklich fesselte. Es war ein etwa 40 mal 60 cm großes Bild in einem elfenbeinfarbenen Rahmen. Auf den ersten Anschein hin schien es, in expressiver Manier gemalt, eine Frau darzustellen. Ein schmaler, fleischfarbener Kopf, große, dunkle Augen, eine schmale gerade Nase, ein roter Mund; die Arme, mit den Ellenbogen nach außen gedreht auf die leicht gespreizten Schenkel gestützt. Aus weiten Ärmeln ragten Hände mit jeweils zwei langen Fingern und kurzen Daumen. Sie schien zu sitzen. Ihre Beine waren von den Knien an abwärts nicht dargestellt. Die Figur war in ein blaugraues pierrotartiges Gewand gehüllt, das vorn mit vier roten großen Knöpfen verziert war. Der unterste Knopf wirkte wie eine Art Bauchnabel über einem Gürtel.
Was Lea verwirrte, war, dass dieser Frau, vielmehr dieser einer Frau gleichenden Figur, ein bräunliches Gebilde aus ihrem Schoß ragte, das seiner Anatomie nach nur ein männliches Geschlechtsorgan sein konnte. Obwohl Lea ihre Augen rasch wieder von jenem Bild abwandte, versuchte sie es, aus den Augenwinkeln spähend, wieder in ihr Blickfeld zu bringen.
Natürlich bemerkte der Gastgeber ihre Neugier. Er drehte sich um, deutete auf das Bild: Sie sehen recht, es ist ein Hermaphrodit. - Wer hat es gemalt? - Der Mann stand auf, trat vor das Bild. Lea folgte ihm.
Hier links unten. Sehen Sie die Signatur? - Lea trat näher. Um genauer sehen zu können, beugte sie sich vor, wobei ihre Brüste den Bankmann beinahe berührten. - Es könnte ein »R« sein, oder ein »Z«, hier ein »I«, aber nein. Ich kann es nicht entziffern. - Lea, dazu aufgefordert, konnte es ebenfalls nicht. - Ich habe es bei einem Antiquar gekauft. sagte Reiter, der kannte den Maler auch nicht. - Entschuldigen Sie meine Neugier, aber warum haben Sie es gekauft? - Aus keinem besonderen Grund. Es hat mir gefallen, mich angeregt. - Lea schwieg.
Ihnen gefällt es wohl nicht? - Es regt mich jedenfalls nicht an. - Oho, sagte Reiter. - Ich habe, fuhr er fort, im Archäologischen Museum in Athen eine Herme gesehen, sie wurde auf Siphnos gefunden, wurde etwa 500 v. u. Z. geschaffen. Sie hatte einen Dionysoskopf und einen recht kräftigen Phallus. Wissen Sie, was eine Herme ist? - Lea schüttelte den Kopf. - Sie stellt den Gott Hermes mit einem Phallus dar.
Ursprünglich war es ein brettartiges Idol in Pfeilerform aus Holz. - Sie saßen sich wieder auf den Sesseln gegenüber. - Hermaphroditos, - Reiter lehnte sich jetzt ein wenig zurück: Sohn von Hermes und der Aphrodite. Aphrodite liebte Hermes, aber der sie nicht. Die Quelennymphe Salmakis bat nun die Götter, den Körper der Aphrodite mit dem des Hermes zu verschmelzen, so entstand ein androgynes Wesen. Es reizt mich zu erfahren, sagte Reiter weiter, welche Motive und Vorstellungen unsere Altvorderen von der Liebe hatten, von den Geschlechtern. Sie wollten wohl eine körperliche Verschmelzung erreichen über die bloße sexuelle Vereinigung hinaus. - Er machte eine Pause, sah Lea an: Das berührt doch auch Ihre Problematik. - Meine Problematik? - Nun, ich dachte, Sie wollten die Leute über die Ehe ausfragen und mögliche Alternativen. - Lea schob ihre Lippen vor: So weit wollte ich allerdings nicht ausholen, sagte sie und lachte. Aber seine Worte hatten sie bewegt.
Wir neigen offenbar zum Dualismus, sagte Reiter. Liebende Frauen wie Männer verlangen enge Gemeinschaft mit dem Geliebten, wollen ständig zusammen sein, alles miteinander machen, aber auch ihr Selbst bewahren. Die zwei Seiten in einer Person, Mister Jekyll und Mister Heyde. Das Faustische und das Mephistophelische. Das polygame Element in einer monogamen Gesellschaft und was dergleichen an Beispielen zu dieser Sache noch anzuführen wäre. Aber das alles wollen Sie wohl nicht auf Ihrer Liste haben. - Ohne auf Leas Antwort zu warten sagte er weiter: Das Zwittrige gibt’s sogar im Biologischen. Der männliche Organismus produziert auch weibliches, der weibliche männliches Hormon. Es kommt wie in all den Beispielen aufs Überwiegen eines Elementes an, auf das, was sich schließlich durchsetzt. Aber zurück zu Ihrem Anliegen. Sie fragten nach Alternativen zur Ehe. Lassen Sie mich überlegen. Dass der Mensch monogam veranlagt sei, ist unwahrscheinlich. Betrachten sie nur die Anzahl seiner sexuellen Partnerschaften im Laufe seines Lebens. - Reiter beugte sich jetzt vor und sah Lea an, der in diesem Augenblick die hellbraune Farbe seiner Iris auffiel. Und unvermittelt fragte er: Was halten Sie denn von freier Liebe? - Lea war bestürzt, aber sie fasste sich. - In der frühen SU wurde sie propagiert, sagte sie, ich glaube um 1920. Die Lasten aus solchen Verbindungen trugen allein die Frauen. Man hat das Gesetz bald wieder abgeschafft. Nein, das ist keine lebbare Alternative. - Sie faltete ihre Finger ineinander, löste sie dann wieder: Denkbar wäre eine erweiterte Ehe mit allen juristischen Absicherungen der Partner wie in der monogamen Ehe. Ich glaube, in einem skandinavischen Land hat man einen solchen Vorschlag im Parlament behandelt. Wie er ausgegangen ist, weiß ich nicht.
Plötzlich sagte Reiter: Aber Sie schreiben doch gar nichts auf? - Das Gesprochene ist interessant genug. Ich kann es mir merken. - Und Reiter: Könnten Sie denn teilen? - Das war in einem beinahe schmeichelnden Tone gesagt, als sei die Frage für ihn persönlich wichtig. Lea spürte, dass sie errötete. Gedanken an die Bankfrau gingen ihr durch den Kopf. Sie antwortete erst nach einer Weile: Ich weiß nicht. Das kommt auf den Mann an. - Das sagte sie, um ihn durch ein promptes »Nein« nicht zu brüskieren oder weil sie wirklich an diese Möglichkeit dachte? Auch auf die Frau, fügte sie hinzu. - Natürlich, sagte Reiter. - Lea glaubte einen spöttischen Ton aus der Antwort herauszuhören, worauf sie nachdrücklich erklärte: Nein, ich glaube nicht, dass ich es könnte. Vor allem wollte ich es nicht.
Reiter kommentierte ihre Antwort nicht. - Es ist ein langes Gespräch geworden, sagte er: Sie haben mich in eine Lage gebracht, in der ich Dinge überlegen musste, an welche ich sonst kaum gedacht hätte. Ein konstruktives Treffen also. - Er beugte sich ein wenig gegen Lea vor: Wollen wir unsere Begegnung wiederholen? Ich glaube, Sie müssen zustimmen, um mir Gelegenheit zu geben, mich weiter zu entwickeln. Manchmal provoziert uns die Jugend zu unserem Vorteil. Wollen Sie dieses Opfer bringen? - Lea erklärte, dass sie sich gern mit ihm treffen würde, aber sie könnte seine letzten Bemerkungen nicht ernst nehmen. - Das stimme nicht, erwiderte er. Er kenne Lea ja nicht und wisse nichts über ihr Leben, den Ablauf ihrer Tage. Es könne ja sein, dass sie, versehen mit Freunden ihres Alters, wie alt sind Sie eigentlich? - Achtzehn - mit Freunden also und Bekannten lieber zusammen wären, als ihre Zeit mit mir, einem 35-Jährigen, zu verbringen.
Das alles mit Gesten begleitet im leicht überdrehten Tone eines Vertreters gesagt, der einem Kunden etwas aufschwatzen wollte, und selbstverständlich erwartet er, dachte Lea, dass sie auf diesen Ton einging. Je besser sie das verstünde, je mehr würde er mit ihr zufrieden sein. Und Leas Ziel war ja, sein Interesse an ihr zu erhalten. Wie weit das Ganze gehen sollte, wollte sie zu diesem Zeitpunkt nicht bei sich entscheiden.
Wissen Sie was, sagte er, wobei er den Kopf neigte und sich am Ohrläppchen zupfte, ich lade Sie zu einem Abendbrot in die »Möwe« ein. Sie können mir dort den Bericht für Ihre Zeitung vorlesen. Wie hieß sie doch? - »Rundschau«, sagte Lea schnell. - »Rundschau«? Wiederholte er: Einfach nur »Rundschau«? - Lea sagte nichts. - Und nach einem Blick zur Decke, als überlege er, sagte er plötzlich: Sie haben noch gar nichts zu meiner Einladung gesagt! - Ich komme gern, sagte Lea, wenn Sie es wirklich wollen. - Gut, sagte er, Freitag. Das ist in drei Tagen. Passt es Ihnen? - Ja, sagte Lea. - Ach, ich habe Ihnen gar nichts angeboten, möchten Sie vielleicht einen Cognac? - Nein, danke. Ich habe Ihre Zeit schon übermäßig in Anspruch genommen.
Er hielt ihr alle Türen, wobei er sich jedes Mal, bevor sie hindurchging verbeugte. - Also bis Freitag. - Ja.
Wieder auf der Straße atmete Lea tief. Sie vermied es, einen Blick nach dem Fenster zu werfen, das sie an jenem Abend so sorgfältig beobachtet hatte. Womöglich würde er hinter den Scheiben stehen und ihr nachschauen.
Sie schlug den Weg zum Stadtpark ein, wo sie dem Paar damals begegnet war. In ihrem Kopf klangen die Gespräche wider, die sie mit Reiter geführt hatte. Von seinem Beruf hat er nichts gesagt, dachte sie. Er scheint etwas mit der Branche zu tun zu haben. Doch dann beschäftigte sie der Gedanke an den Bericht für die »Rundschau«. Sie beschwichtigte ihr Gewissen in Bezug auf falsche Angaben gegenüber Reiter. Ihr blieb nichts, als den Bericht zu schreiben und der Redaktion der »Rundschau« anzubieten. Vielleicht erinnerten die sich an ihre frühere Zuschrift. Immerhin, sagte sie bei sich, bin ich eine angehende Journalistin und irgendwie muss schließlich jeder einmal anfangen. »Bericht«, das war das Wort, das Reiter gebraucht hatte. Sie hatte ja anfangs von einem Interview gesprochen und von einem Zufallsprinzip, nach dem Reiter ausgewählt worden sei. Während sie jetzt die Pfade des Parks betrat, in das Laubwerk der Bäume blickte, ohne es wirklich zu beachten, dachte sie, es genüge, das mit Reiter Besprochene in eine Form zu bringen, eine Art Essay, den sie dann der Zeitung anbieten könne. Das wäre also abgemacht.
Was sie bedrängte und zu beantworten war: was hatte Reiter mit ihr im Sinn? Wie sollte sie sich ihm gegenüber weiter verhalten. Was wollte sie eigentlich. Ihm die Geliebte ausspannen, doch nicht, um deren Stelle einzunehmen. Sie war verwirrt. Man wird sehen, sagte sie sich. Lass es auf dich zukommen.
2. Kapitel
Es war nicht so, dass Lea sich nach körperlichen Beziehungen, Umarmungen mit einem Manne gesehnt hätte. Im Grunde eignete ihr eine erstaunliche Unbefangenheit in Bezug auf die Beziehungen der Geschlechter zueinander. Die körperlichen Unterschiede zwischen Mann und Frau empfand sie als natürliche Tatsachen, unsensationell, wie die Unterschiede zwischen Tag und Nacht.
Sie wurde nicht heimgesucht von sexuellen Visionen, Träumen, Vorstellungen. Und wenn sie solche Vorstellungen hatte, die sich natürlicherweise gelegentlich einstellten, wenn sie an Männer dachte, oder Liebespaare in Umarmungen beim Küssen antraf, wie auch das Paar auf der Bank, dann war das in ihr vorherrschende Gefühl eher der Neugierde verwandt als sexuellen Wünschen. Diese Neugierde hatte sich zuerst auf ihren eigenen Körper bezogen. Ihre Menarche, das Wachsen ihrer Brüste, Schamhaare, weckten diese Neugierde zuerst. Das Wissen um die Bedeutung dieser Veränderungen ihres Körpers beschäftigte ihre Fantasie. Das wuchs und entwickelte sich, damit sie, Lea, Kinder gebären und säugen konnte. Und bevor sie gebären konnte, musste sie empfangen. Ein Mann musste seinen Samen in ihre Scheide einbringen. Das alles wusste sie, siebenjährig. Sie hatte es von einer Schulfreundin namens Elvira gehört, die hinzufügte, dass Leas Eltern diesen Akt auch vollzogen haben mussten, sonst wäre sie, Lea, ja nicht auf der Welt. Diese Vorstellung war Lea unangenehm und sie zweifelte an der Aussage der Freundin. Dennoch bewirkten deren Reden, dass Lea die fantastischsten Bilder durch den Kopf gingen. Sie erinnerte sich undeutlich daran, wie sie ihre Eltern bei einem Vorgang beobachtet hatte, den sie für sich eine »Kampelei« genannt hatte. Eines Nachmittags, als die Mutter das Geschirr aufwusch und Lea es abtrocknete, erzählte sie der Mutter Elviras Geschichte. Dann fragte sie die Mutter, ob sich die Sache wirklich so verhielte. Die Mutter hatte eine Porzellanschüssel mit fliederartigen Blumen in einer Hand, in der anderen den Aufwaschlappen, im Begriff, die Schüssel zu säubern. Als Lea die Frage gestellt hatte, hielt die Mutter in ihrer Arbeit inne und blickte zuerst auf Lea, die zu ihr aufsah, tauchte dann die Schüssel wieder in das Wasser des Beckens, behielt nur den Lappen in der Hand. Schließlich sagte sie: Ja, so ist es. - Weiter sagte sie nichts. Lea hatte den Vater schon nackend gesehen, wohl auch dessen Glied betrachtet. Das war der auffälligste Unterschied zwischen Mutter und Vater: Vaters Glied und Mutters Brüste, und dass sie natürlich kein Glied hatte. Daran dachte sie jetzt flüchtig. Aber wo der Samen herkäme und wie er in die Scheide gelangte, konnte sie sich nicht vorstellen.
Aber, begann Lea zögernd. Die Mutter hob die saubere Schüssel aus dem Wasser und gab sie Lea zum Abtrocknen in die Hand mit einer Miene, als wolle sie der Tochter bedeuten, in ihrer Arbeit fortzufahren, anstatt weiteres Geschwätz von sich zu geben.
Lea stellte das abgetrocknete Geschirr auf den Tisch, nahm gesäubertes in Empfang, während sich in ihrem Kopf die Fragen immer dichter drängten, bis sie sich nicht mehr zurückhalten konnte.
Wo kommt er her? fragte sie, einen Teller in der Hand, den sie dabei abtrocknete. - Wer? erwiderte die Mutter mit unwirschem Gesicht, wohl um Zeit zu gewinnen. - Na, der Samen.
Die Mutter schien es nicht gehört zu haben. Sie fuhr sich mit der Hand, die das Tuch hielt, über die Stirn, die sie dadurch benetzte, schloss einen Augenblick die Augen, als sei sie müde, legte dann alles aus der Hand, sagte: Die Sache ist so. Der Mann hat, wie du ja sicher schon gesehen hast, unter seinem Glied einen Beutel. Dort wird der Samen hergestellt. Wenn der Mann die Frau sehr lieb hat, drängt sich der Samen aus dem Beutel durch eine Röhre in seinem Glied. Die Frau hat eine Scheide, auch eine Art Rohr. In diese Scheide steckt der Mann sein Glied und bringt so den Samen in die Frau. Über der Scheide hat die Frau auch einen Beutel, größer als der des Mannes, und dieser Beutel nimmt den Samen auf. In dem Beutel entsteht dann das Kind, das in dem Beutel heranwächst. Man sieht es, wenn sich der Bauch der Frau vorwölbt. Du hast es vielleicht schon gesehen. - Ja, sagte Lea. Ihre Ohren hatten sich gerötet. Sie hatte die Rede der Mutter mit Spannung vernommen. Nun schwieg diese. Eine Fortsetzung schien es nicht zu geben. Das Kind war auf gewisse Weise enttäuscht. Aber, sagte es schließlich, Vater hat dich doch immer sehr lieb. - Diese Reaktion hatte die Mutter nicht erwartet. Die Fähigkeit ihrer Tochter, einen unbekannten Vorgang auf den Punkt genau zu begreifen, hätte die Mutter stolz machen können. Aber daran dachte sie nicht. Sie begriff augenblicklich das Dilemma ihrer ausschließlich auf das technisch-mechanische gerichteten Erklärung des Liebesaktes. Leidenschaft, Wollust hatte sie ausgelassen. Dass Sex auch ohne Liebe vonstatten gehen, sogar sehr gut funktionieren konnte, wusste sie natürlich. Ja, selbst die körperliche Lust Liebender war mitunter eher Ausdruck von Begierde als ideeller Liebe. Und wiederum ist Liebe ohne Begehren nur deren Schatten, eine Hülse. Liebe, dieses Gefühl der Sehnsucht nach dem anderen, das Glücksgefühl in seiner Nähe zu sein, die Freude an seinem Anblick, seiner Stimme, seinen Bewegungen, seiner ganzen Art. Wie sollte sie das diesem Kind erklären, wo sie es nicht einmal sich selbst in seiner Gänze, seiner Widersprüchlichkeit und Kompliziertheit erklären konnte. Dass zur Liebe auch die Toleranz gehörte. Unbequeme, manchmal sogar kaum erträgliche Eigenschaften des geliebten Menschen bewirken, dass die Liebe in solchen Augenblicken weniger strahlt, an Glanz verliert, im Ganzen matter werden kann. Dabei hat sich im Laufe der Jahre einfach nur der kanten- und eckenreiche Kern der Wirklichkeit aus dem einstigen Traumbild, dem Ideal herauskristallisiert. Diesen Geliebten dennoch anzunehmen, ist Voraussetzung, um Liebe dauerhaft zu machen.
Dergleichen ging der Mutter damals wohl durch den Kopf, dachte Lea, die sich an diese Situation heute noch in allen Einzelheiten erinnert. Sie hatte sogar noch den leicht muffigen Geruch des Spülwassers in der Nase. Geruchserinnerung ist eine erstaunliche Fähigkeit des Gedächtnisses. Sie hilft Vergangenes zu verlebendigen, ins Heute zurückzuholen. Und Lea glaubte auch noch das Haut- und Tastgefühl des lederartigen Aufwaschlappens auf der Haut zu spüren, obwohl sie einen solchen, inzwischen Besitzerin eines Bosch-Spülautomaten, nie wieder angefasst hat.
Und Lea dachte weiter: Ob es vielleicht nützlich wäre, könnte einer das Technische am Vorgang des Sex von seiner gefühligen Komponente trennen? Wäre das gut, von Vorteil, oder nehme er Schaden an seiner Seele. Seele, diese Bezeichnung gebrauchte die Mutter, wenn sie das »empfindende Ich« meinte.
Diese Gespräche mit der Mutter bewirkten wohl auch, dass Lea später ihren Körper aufmerksam beobachtete, nachgerade studierte. Wo sie ihr »Rohr« zu suchen hatte war offensichtlich, obwohl die Mutter die Lokalisation dieses Organs nicht genannt hatte. Schließlich hatte das Kind Lea begonnen, sich zu betasten, vorerst ohne Emotionen, ohne Anzeichen einer Libido, von der sie - auch Jahre später - von der Natur »verschont« geblieben war, wie sie diesen Zustand bei sich selbst nannte.
Eines Nachmittags, die Eltern waren ausgegangen, betrat sie deren Schlafzimmer. Der große Spiegel hatte es ihr angetan. Sie zog sich langsam aus, legte sich vor dem Spiegel auf den Boden, spreizte die Beine ein wenig, tastete, ihr Abbild dabei in dem Glas betrachtend, vorsichtig an ihrem Geschlecht herum, führte einen Finger ein kleines Stück ein.
Diese Berührung bewirkte ein angenehmes, aber keineswegs aufregendes Gefühl in ihr. Vielmehr unterlag sie einer eigentümlichen Vorstellung. Sie hatte einmal den Umkleideraum eines Hallenbades betreten, als sie einen großen Jungen erblickte, der masturbierte. Gebannt sah sie, wie sich das angespannte Gesicht des Jungen in ein »Schmerzgesicht« verwandelte, als er seinen Samen ausstieß. - Das bin sonst ich, dachte sie, eine Frau, die das vermag. Dieser Gedanke erfüllte sie mit einer eigenartigen Genugtuung. Das war es, was sie am Sex reizte. Lea wollte Journalistik studieren, diesen Beruf ausüben, weil er ihr die Möglichkeit bot, interessante Vorgänge zu erkunden und darüber zu berichten. Wenn andere zurückgewiesen würden durch Ordnungskräfte, gehindert durch Absperrungen, durfte sie den Dom betreten, in dem gerade die Trauung einer berühmten Diva stattfand, konnte der Grablegung eines bedeutenden Regisseurs beiwohnen; in Gerichtsverhandlungen konnte sie das Rechtswesen unserer Gesellschaft live erleben und die Ursachen von Verfehlungen hinterfragen. Sie wollte aufdecken, herausfinden, was sie interessierte. Eine prickelnde Neugier beherrschte sie, vor der alle anderen Emotionen verblassten. Sie empfand etwa wie ein Bergsteiger bei einer Erstbesteigung, den es nicht einer schönen Aussicht wegen trieb, die Besteigung in Angriff zu nehmen, sondern allein der Wunsch, den Gipfel zu erreichen und läge er auch im Nebel. Das Ziel erreicht zu haben war dann Lohn für alle Mühe.
Schon als Kind wurde sie von dieser Neugier beherrscht. Sie erinnerte sich der Erzählungen ihrer Mutter, die von ihren eigenen, allerdings lückenhaften, Erinnerungen gestützt wurden.
Es war ein Sonntagmorgen im Mai. Lea befand sich vor dem Eingang zum häuslichen Keller. Die Tür stand ein wenig offen. Das Kind schob sie weiter auf, stieg die Treppen hinunter. Langsam. Es war dämmrig. Sie ertastete die Stufen mit den Füßen. Sie war noch nie hier unten gewesen. Doch ihre Neugier war stärker als die Bangigkeit vor dem Unbekannten, das sie sich voller Geheimnisse dachte. Sie trug ein kurzes weißes Kleid und rosafarbene Schuhe. Hin und wieder berührte sie die Wand zur rechten, um sich im Gleichgewicht zu halten. Endlich war sie im Kellergewölbe angelangt. Durch ein kleines Fenster drang Licht herein und beleuchtete einen riesigen Haufen Briketts. Das Licht war wie ein silberner, durchsichtiger Körper, der aus unzähligen winzigen leuchtenden Teilchen bestand. Lea ging an dem Kohlenberg vorbei zum Fenster, um zu erkunden, ob man von hier aus die Straße sehen konnte. Da sah sie das Netz. Es war ein großes Netz, ausgespannt zwischen dem Fenster und den schwarz-silbernen Kohlebrocken. Lea hatte so etwas noch nie gesehen. An die Längsfaden waren ringförmig Querfäden gefugt, ein dichtes Geflecht, glitzernd, als bestünde es aus Eis oder Silber. Eine Spinne war nicht zu sehen. In diesem Augenblick begann das Netz zu schwanken. Mit einem Brummton war eine große fette Fliege dagegen geprallt. Sie versuchte, sich zu befreien. Doch infolge ihrer zappelnden Beinbewegungen und dem Geschwirr ihrer Flügel verfing sie sich immer fester in dem Gespinst. Lea war gerade im Begriff, die Fliege, die sie eigentlich nicht leiden konnte, zu befreien, als sie die Spinne bemerkte. Sie sah ihren großen Leib, die drahtartigen langen Beine, die sie rasch und sicher bewegte wie ein Seiltänzer und im Nu hatte sie die Fliege erreicht.
Lea starrte und wartete. Sie würde nicht eingreifen. Sie hatte die Fliege berühren wollen, schon die Hand erhoben, die sie sogleich wieder sinken ließ. Der Vorgang dauerte. Lea hatte sich gegen den Kohleberg gestützt und mit Gepolter waren Briketts in einer Staubwolke auf den Boden gerollt. Lea bemerkte es kaum. Die Spinne hatte die Fliege nun vollständig mit kaum sichtbaren Fäden umwickelt. Lea ergriff nicht Partei. Sie bedauerte flüchtig die Fliege, hatte einen Anflug von Abscheu vor dem Tun der Spinne. Aber nur in Zeitbrüchen. Wie ein Brand loderte in ihr die Begierde, den Vorgang weiter verfolgen zu können. In dem Kind war die Vorstellung von Leben und Tod noch nicht entwickelt. Heute war ihr Geburtstag. Sie war fünf Jahre alt geworden. Der Körper aus Licht hatte sich verschoben. Die Kampfstatt war nur noch am Rande erleuchtet. Die Spinne und ihr Opfer glichen zuckenden Klumpen. Lea war nun im Licht. Ihr Atem ging rasch, ihre Augen glänzten wie im Fieber. Sie hatte sich auf eine Kiste gestellt, um die Spinne besser beobachten zu können, die ihr Opfer jetzt aussaugte. Das Licht war weiter gewandert und ließ jetzt die Kellerwand aufleuchten. Da hörte sie Schritte und einen Aufschrei. Es war ihre Mutter. - Hier bist du! Was treibst du denn hier unten. Wir suchen dich seit Stunden. - Sie ist im Keller! rief sie dem Vater zu, der eilends herunterkam. - Sie gehört verhauen, sagte der Vater gegen die Wand, und zu Lea: Du hast deine Mutter angstkrank gemacht.
Lea war von der Kiste abgestiegen Die Mutter hatte sie an sich gedrückt. Dann hielt sie das Kind von sich ab: Du bist ja über und über schmutzig. Das schöne Kleid. - Die Spinne, sagte Lea nur und streckte den Arm nach dem Netz aus, das im schwindenden Licht kaum noch zu erkennen war. - Eine Spinne? Pfui! rief die Mutter. Sie ergriff einen Besen und wischte damit das Netz vom Fenster. - Jetzt sind alle beide tot, sagte Lea. Und der Vater: Du bist ein seltsames Kind. - Und das war sie wohl auch.
Auch diese Tür war nur angelehnt. Lea, im Begriff, die Diele zu durchqueren, hörte die Stimmen der Eltern aus deren Schlafzimmer. Es waren kurze Anrufe, Lautungen.
Lea schob sich durch den Türspalt, blieb auf der Schwelle des Zimmers stehen und schaute: Die Mutter rang mit dem Vater im Bett. Im Augenblick war er der Sieger. Sie unterlag ihm, versuchte dennoch mit aller Kraft sich unter ihm hinwegzudrehen, bäumte sich auf. Jetzt umschlang sie mit ihren Fersen Vaters Schenkel. Das Deckbett war zu Boden gefallen. Die Eltern waren nackt. Auf dem Rücken des Vaters hatte sich Schweiß gebildet. Während des Ringens hatte die Mutter kleine Schreie ausgestoßen, der Vater keuchte. Und jetzt! Vor Aufregung und Überraschung presste Lea ihre zur Faust geballte Hand gegen den Mund. Der Mutter war es gelungen, den Vater abzuwerfen. Er lag auf dem Rücken und blitzschnell kniete sich die Mutter über ihn, drückte ihn mit ihrem Leib aufs Bett und hielt ihn fest. Umsonst bäumte er sich unter ihr auf, hob sein Becken. - Die zierliche Mutter! Lea hätte nicht gedacht, dass sie den starken Vater besiegen könnte. Schon wollte sie zu den Eltern laufen, da sah sie, wie die Mutter nach vorn auf die Brust des Vaters sank und der Vater ihren Kopf streichelte. Leas aufgeregte Stimmung schlug um. Sie fühlte sich abgewiesen. Sie begriff, dass die Eltern jetzt zärtlich zueinander waren. Aber diese Zärtlichkeit war von anderer Natur als die, die Lea bislang erfahren hatte. Wenn sich die Eltern, was mitunter geschah, im Wohnzimmer küssten, dann warfen sie auch einen Blick auf Lea, so fühlte sich das Kind einbezogen in die elterliche Zuneigung. Manchmal streckten sie sogar eine Hand nach der Tochter aus und Lea rannte zu ihnen, presste den Kopf gegen den Leib der Mutter, die diesen Kopf streichelte, wie jetzt der Vater den der Mutter. Und manchmal nahm der Vater das Kind auf den Arm und sie umfassten sich zu dritt.
Jetzt aber schienen die beiden in einer eigenen Welt zu leben. Die von Lea als fröhlich empfundene Kampfszene war beendet. Lea hatte keinen Zugang mehr zu den Eltern. Sie fühlte sich ausgeschlossen.
Es war der Zustand, den sie kannte, wenn ihr die Mutter den Eintritt in Vaters Arbeitszimmer untersagte, weil jener nicht gestört werden durfte. Vaters Arbeit hatte schließlich den Charakter einer heiligen Handlung bekommen, wie die Tätigkeit des Pfarrers in der Kirche an Feiertagen. Dort saß Lea zwischen den Eltern. Sah zu, wie der Pfarrer den Gläubigen ein Stück vom Leib Jesu auf die ausgestreckte Zunge legte und aus einem Glas das rote Blut des Heilands trank. Da konnte man auch nicht einfach aufstehen und sich in die Schlange der Gläubigen einreihen oder sich von dem Pfarrer die Hand auf den Kopf legen lassen, wie er das einmal mit ihr getan hatte. Das war, als Lea ihm nach dem Gottesdienst im Beisein ihrer Mutter ihre Sünde in der Sakristei gebeichtet hatte und der Pfarrer sie entsühnte: durch Auflegen seiner Hand auf ihren Kopf. Diese Geste war für sie eine Verkörperung von Sanftheit, väterlicher Fürsorge; es war eine Hand, in die sich schmiegen konnte und so von aller Todesangst und Furcht befreit war.
Ihre Sünde war folgende: Sie hatte eine geweihte Kerze an sich genommen, ohne das dafür vorgesehene Geld zu entrichten. Sie stellte die Kerze auf das Brett zu den anderen Kerzen, die sämtlich zu Ehren der heiligen Cäcilie brannten. Der Versuch aber, ihre Opferkerze zu entflammen, misslang. Der Docht wollte die Flamme des Streichholzes nicht annehmen. Als Lea die Kerze an den brennenden anderen anzünden wollte, verlöschte die Flamme nach einem kurzen Flackern. So wurde es offenbar: die Heilige selbst wies Leas Opfer zurück, weil es keines war. Darauf erzählte sie das Geschehene der Mutter mit verhaltenem Schluchzen. Und diese ging mit ihr zum Pfarrer. Der Grund aber, warum Lea weiterhin bedrückt blieb, war, dass sie das für den Kauf der Kerze von der Mutter erhaltene Geld für Bonbons ausgegeben hatte. Das aber hatte sie nicht gestanden. Eines Tages hatte sie die Kirche betreten und sich vor den Altar der heiligen Cäcilie hingekniet und sie um Vergebung gebeten. - Ich schäme mich so sehr, sagte sie. Die Mutter und der Pfarrer würden mich für sehr böse halten. Das stimmt aber nicht. Ich will es dir selber sagen: Hier, sie nahm zwei Groschen aus ihrer Tasche, habe ich mein Gespartes und bringe es dir. Und es schien dem Kind, nein, es war sicher, dass die Cäcilie ein leises Lächeln zeigte und ihre Augen glänzend geworden waren und voller Güte auf Lea gerichtet.
Zwar war sie nun der Vergebung durch die Heilige sicher, aber ein leises Unbehagen wegen ihrer Tat der Mutter gegenüber konnte sie noch lange nicht überwinden. Es war das gleiche Unbehagen, das sie jetzt beschlich, als sie sich vom Schlafzimmer der Eltern entfernte.
Lea war ein Einzelkind. Ihre Mutter hatte sie empfangen in der Minute ihrer Defloration. Beide Eltern hatten sich über den raschen »Erfolg« ihres ersten Liebesaktes sehr gefreut. Es schien, als wären sie stolz auf ihr Vermögen, ein Kind gewissermaßen auf Anhieb zu zeugen beziehungsweise zu empfangen. Die Schwangerschaft machte der Mutter keine Beschwerden. Morgendliche Übelkeit plagte sie nicht. Sie aß mit Appetit, hatte keine Gelüste auf Besonderes wie saure Gurken oder Heringe. Allerdings wurde sie naschhaft. Sie verzehrte Schokolade und Obstkuchen in bemerkenswerter Menge. Dass Schokolade fröhlich macht, wird behauptet. Sei’s drum. Die Schwangere war fröhlich. Ob durch die Freude auf das Kind oder infolge des Schokoladeessens war nicht erkennbar; womöglich verdankte sie ihre Heiterkeit beidem. Sie hatte eine schöne Stimme. Sang viel. Wenn der Vater, Beigeordneter für Infrastruktur im Rathaus der Stadt, zu Mittag nach Hause kam, fand er jeden Tag frische Blumen vor, die die Mutter in einer Vase, einem Hochzeitsgeschenk, kunstvoll angeordnet hatte.
Häufig sprach sie mit dem Vater von dem Kind in ihrem Leibe, mit dem sie, wie sie behauptete, sich schon verständigen könne, indem es auf eindringliche Weise ihr mit Bewegungen antwortete, deren Charakter dem Inhalt der Reden entspreche: bei zärtlichen Worten dehne es sich »lustvoll«, und bei stürmischen Worten führe es rasche Stöße gegen den Leib, die der Mutter sogar Schmerzen bereiten, einen Schmerz, den sie aber wiederum als »lustvoll« empfände. Schade, sagte die Mutter und wiederholte das Wort: schade, dass ich sie nicht sehen kann. Das Ultraschallphantom befriedigt mich nicht.
Lea kam an einem Montag zu Welt. Die Geburt war leicht und ging rasch vonstatten. Ein Montagskind, sagte der Vater. Und es klang, als sei er enttäuscht. Er hätte wohl lieber einen Leo, dachte die Mutter, deshalb nennt er sie Montagskind. Und sie sagte, das klingt wie Montagsauto. Wir müssen eben besonders auf sie Acht geben, erwiderte der Vater, wobei er lächelte und der Mutter beide Hände auf die Schultern legte.
Das ist ein komisches Kind, sagte die Hebamme. Sie hielt Klein-Lea von sich ab und betrachtete sie, als wolle sie in den Zügen des Babys eine Erklärung für sein eigenwilliges Verhalten finden.
Lea hatte nämlich, kaum aus dem Leib der Mutter gekommen, nicht sofort wie erwartet geschrien, sondern sie blieb still und blickte die Hebamme aufmerksam an. Erst als diese den Arm hob, um dem Baby auf den Rücken zu klopfen, gab es einen erschrockenen Laut von sich, keinen Schrei.
Ich hatte den Eindruck, sie wollte erst wissen, wer ich bin, bevor sie sich äußert, sagte die Hebamme. Das war Leas erster Ausdruck von Neugier auf Menschen und Dinge, so der Vater später.
Einen Monat danach fiel sie aus dem Bett bei dem Versuch, eine Vase, die auf einem Blumentisch stand, zu erreichen. Mit ihr zu Boden stürzte die Vase, die im Gegensatz zu Lea den Sturz nicht heil überstand. Die Mutter, durch das Klirren des Porzellans alarmiert, kam herbeigeeilt und hob das Kind aus den Trümmern. Lea schrie nicht, streckte einen Arm aus, wobei sie urähnliche Laute ausstieß.
Der Kinderarzt, zu dem sie das Baby vorsorglich gebracht hatte, damit er etwaige Schäden des Säuglings ausschließe, erklärte, der Sturz sei ein Zufall gewesen; Kinder würden erst in der Mitte des ersten Lebensjahres Sehen und Greifen koordinieren können.
Eines Montags, sie war drei Jahre alt, schob sich Lea einen Stuhl vor das zur Straße geöffnete Fenster. Ergriff dann eine Gießkanne voller Wasser, mit der die Mutter die Geranien in ihren Blumentöpfen zu gießen pflegte. Es waren aber nicht die Blumen, die Lea jetzt interessierten. Unten, auf der Straße, liefen Passanten. Und Lea überkam die Lust, die Leute zu wässern. Sie war neugierig auf deren Reaktion. So beugte sie sich vor, in der Rechten die Messingkanne, die, vom Schein der Sonne getroffen, wie eine Zauberlaterne erglänzte, mit der Linken hielt sie sich am Fenstersims fest. Sie kippte dann die Kanne und sah dem blinkenden Strahl nach, bis er auf der Straße ankam. Nach einem zweiten Versuch traf sie eine Frau, die erschrocken aufschrie; sah ihr vor Zorn gerötetes himmelwärts gerichtetes Gesicht. Lea zog sich nicht zurück. Sie beobachtete die Frau. Ihr kleines Antlitz erschien wie eine Blume zwischen den Blüten der Pelargonien. Die Passantin hatte das offene Fenster entdeckt, rief nach oben und als sie keine Antwort bekam, betrat sie das Haus. Als die Flurklingel schrillte, ging die Mutter, zu öffnen. - Ich verlange Schadenersatz, rief die Frau. Sie haben mir mein Kleid verdorben durch ihr Gießwasser! - Sie habe kein Gießwasser gebraucht, erwiderte die Mutter in scharfem Ton. Sie sei in der Küche gewesen, aus der sie eben auf das Läuten hin gekommen sei.
In diesem Augenblick kam Lea hinzu und blickte die Frau neugierig an. - Und das Kind? Fragte die Frau. Und die Mutter darauf: Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ein dreijähriges Kind Gießwasser auf die Straße schüttet. Sie ist doch viel zu klein, um die Blumen zu erreichen. - Die Frau blieb im Zweifel: Vielleicht hat sie es doch gekonnt. - Aber man sah, dass sie ihren eigenen Worten nicht traute. Und leise schimpfend zog sie ab.
3. Kapitel
Das Restaurant »Die Möwe« lag in einer Straßenzeile, in der sich Häuser aus der sogenannten Gründerzeit befanden. Sie besaßen Erker und Balkone und fantasievolle Fassaden. Jedes Haus stellte eine besondere Welt dar, war wie von einer eigenen Atmosphäre umgeben. Dieses Stadtviertel strahlte Individualität aus, im Gegensatz zu den monotonen, vielstöckigen Häuserfronten anderer Großstadtstraßen.
Über einem großen Schaufenster war der Schriftzug »MÖWE« in weißer Farbe auf blau emailliertem Grund angebracht. Die Gestaltung der Buchstaben sollte wohl an schwingende Flügel erinnern, an Unbeschwertheit und Freiheit in den Lüften, aber auch das Raubtierhafte der Tiere war ausgedrückt, assoziiert durch die Abbildungen mehrerer Möwen in verschiedenen Phasen ihres Fluges, mit eleganten luftgeübten Schwingen und einem Kopf, der in seiner Schnabelform an einen Weißkopfadler erinnerte, der im Begriff stand, auf eine erspähte Beute herabzustürzen. Auf Leas Gemüt fiel es wie ein flüchtiger Schatten, der sich aber bald wieder auflöste.
Sie sah auf ihre Armbanduhr. Es war sieben Minuten vor sechs, der Zeitpunkt, den sie mit Reiter vereinbart hatte. Sie wollte aber nicht zu früh da sein. Er hätte es als Zudringlichkeit deuten können. Sie vermied es, näher an die bis zum Boden reichenden Fenster heranzugehen oder gar die an den Tischen sitzenden Gäste zu mustern. Also ging sie langsam an dem Gebäude vorbei, schlenderte noch bis zu einer Kreuzung, an welcher sie eine Weile stehen blieb. Jetzt würde sie pünktlich sein, dachte Lea. Und nun ging sie flotten Schrittes zu der Gaststätte zurück.
Sie sah ihn sofort, auch er hatte sie bemerkt. Er stand auf, kam auf sie zu. Er trug ein dunkelgrünes Jackett zu einer hellgrauen Hose. Sie betrachtete ihn zum ersten Mal genauer. Er war groß, hatte dunkles kurz geschnittenes Haar, feste klare Gesichtszüge, die sie ausnehmend männlich fand. Er gefiel ihr. Und: er war ihretwegen gekommen. Sie war aufgenommen in seinen »Kreis«, den sie sich als eine Gruppe von Menschen besonderer Art vorstellte. Ein Gefühl von Erfolg überkam sie. Es war ihr gelungen. Der Liebhaber der Bankfrau stand jetzt vor ihr und lud sie zur Tafel. - Schön, Sie zu sehen, sagte er: - Nice to meet you too, dachte Lea und schwieg. Lächelte. Von ihrem Tisch aus hatte sie einen Blick auf die Straße. Gehende Menschen. Fahrzeuge und jenseits der Fahrbahn eine Baum- und Buschgruppe, die zu einem kleinen Park gehörten, den sie vorhin nicht bemerkt hatte. Wieder ein Park, dachte Lea, und ihr war, als erröte sie.
Ein Kellner hatte ihr die aufgeschlagene Karte in die Hand gegeben und stand nun wartend neben dem Tisch. Die Fülle der angebotenen Speisen verhinderte eine schnelle Entscheidung Leas. Sie wollte aber den Kellner und Reiter, der sich schon entschieden hatte, nicht warten lassen, wählte deshalb auf gut Glück unter den Horsd'oeuvre Lachs á la Bolique. - Sie haben Geschmack, sagte Reiter, und zum Ober gewandt, ich nehme ebenfalls den Lachs anstatt des argentinischen Rindersteaks. Dazu einen trockenen Silvaner. - Schoppen? - Flasche, sagte Reiter, und zu Lea: Da haben wir Stoff für den Abend. - Trotz des einfallenden Tageslichtes brannten über dem Tisch an der getäfelten Wand Leuchter mit japanischen Schirmen, die den Eindruck erweckten, dass Sonnenlicht den Raum durchflute. Vielmehr wurde das um diese Zeit noch helle, farblose Tageslicht rötlich eingefärbt, sodass die Stimmung eines Sommerabends entstand.
In diesem Mischlicht, und infolge des vorzüglichen Weines, überkam Lea allmählich ein Gefühl heiterer Besinnlichkeit, sie geriet in einen beinahe traumhaften Zustand. Ihr war, als sei sie mit dem ihr gegenübersitzenden Mann schon lange Zeit verbunden, habe ihn schon in einem früheren Leben gekannt, sei ihm nach langer Trennung endlich wieder begegnet. Sie versuchte nun, in den ihr inzwischen doch fremd gewordenen Zügen die frühere Vertrautheit wieder zu finden.
Wie er die Gabel hält, etwas zu ihr sagt zwischen zwei Bissen, wobei sie mehr auf seinen Mund blickte, seine Zähne, ja, das Spiel der Zunge beobachtete, anstatt auf seine Worte zu achteten, deren Tonfall allein ihr im Ohr blieb.
Ihren Sinn nahm sie auf seltsame Weise gewissermaßen in einer zweiten Ebene wahr. Und dies dennoch in aller Klarheit, ohne die mindeste emotionale Eintrübung. Es war in der Tat so, als habe die wörtlich zu nehmende Zwielichtigkeit, das Mischlicht, auch Leas Sensorium gespalten, vielmehr zu doppelter Empfindung fähig gemacht: Welt oder bloße Eindrücke von Welt auf zweierlei Art wahrzunehmen und zu verarbeiten. Gewissermaßen das geistig-intellektuelle neben dem emotionalen Sein zu empfinden.
Zu diesem Zustand trug natürlich auch bei, dass Lea ihr Glas hatte von Reiter häufig füllen lassen und sie beide überraschend schnell dem Grund der Flasche nahe gekommen waren.
Der Wein in den Gläsern hatte die gelbliche Farbe des pergamentenen Schirms der japanischen Lampe und Lea schien es, als trinke sie mit der Flüssigkeit zusammen das Licht im Raum.
Reiter, der mit dem Rücken zum Fenster saß, blickte sie jetzt lange an. Obwohl Lea den werbenden Ausdruck in seinen Augen sehr wohl wahrnahm, registrierte sie die anatomischen Eigenschaften in diesem Gesicht mit anteilnehmender Neugierde: da war die braune Iris, die mit gelblichen Einsprengseln durchsetzt war. Die leichte Rötung in den Augenwinkeln, die Ausdruck einer geringfügigen Entzündung waren. Die etwas zu kurzen Wimpern, deren Wuchsunregelmäßigkeiten vielleicht Folge der Bindehautentzündung waren. Die schmalen, farb-schwachen Brauen, Stirnfalten, die sich bei heftigem Sprechen bildeten, sonst jedoch nur als feine Rillen auf der glatten Stirn auftraten. Der relativ niedrige Haaransatz, die starke Nase, die den Eindruck von Stärke und Männlichkeit vermittelte. Und gleichzeitig, während ihr intellektuelles Selbst diese Beobachtungen machte, durchdrang unter Reiters lastendem Blick wollüstige Wärme ihren Leib.
Der Kellner hatte die Teller abgeräumt und neuen Wein gebracht. Lea blickte jetzt eine Weile auf die Straße hinter der Scheibe. Und als wäre eine Automatik in ihrem Kopf angesprungen, sagte sie, sich wieder Reiter zuwendend, ich hab über Ihre Janustheorie nachgedacht und darüber auch in meinem Bericht geschrieben. - Sie machte Anstalten, die Schrift aus ihrer Tasche, die sie über die Stuhllehne gehängt hatte, herauszunehmen, doch Reiter sagte rasch: Lassen Sie es. Später. - Und Lea fuhr fort: Dieser berühmte Satz von den »zwei Seelen, ach in meiner Brust« bedeutet doch wohl, dass in einer Person sich einander widersprechende Ansichten, Auffassungen von ein und derselben Sache gebildet haben und gewissermaßen miteinander ringen. Die betreffende Person gerät in Entscheidungsnot. Ein Mensch glaubt beispielsweise an die Existenz Gottes und zweifelt gleichzeitig daran. Das muss kein Zeichen von Schwäche sein. Denn selbst die Heilige Therese von Lisieux hat den Zweifel an ihrem doch so fest gegründeten Glauben gekannt. Ein Hungernder sieht und riecht das duftende Brot auf dem Ladentisch. Er ist allein im Raum. Soll er das Brot nehmen, um zu überleben, oder standhaft bleiben. Wäre also der Diebstahl des Brotes Sünde, oder nehme er nur das Recht wahr, sein Überleben zu sichern. Die Frage ist, wer oder was sich durchsetzt: Dieb sein oder Gerechter; aber wie ich glaube, hängt das nicht nur von unserem Willen ab. So viel Macht über sich selbst hat wohl kein Mensch.
Während ihrer mitunter heftiger werdenden Rede hatte sie Reiter nur flüchtig angesehen. Sein Gesicht, von der draußen einsetzenden Dämmerung etwas beschattet, schien wieder Ironie auszudrücken, die er sichtlich zu unterdrücken suchte. - Ihre Sicht auf die Dinge ist für eine Frau Ihres Alters recht ungewöhnlich, sagte er. Sein Ton war väterlich freundlich. - Haben Sie eine Neigung zur Philosophie? Lea sagte nichts. Auch Reiter schwieg. Er blickte, als wäre er in Gedanken versunken, auf Leas Hände, die sie auf die Tischplatte gelegt hatte, als halte sie ein Buch, aus dem sie ihre Argumente vorgelesen hätte.
Es war draußen inzwischen gänzlich dunkel geworden Die Helle der beleuchteten Straßen und Häuserfenster gaben das trauliche Muster einer belebten Stadt.
Ihre Stimmen waren im Eifer des Gespräches etwas lauter geworden, als stritten sie. Lea hatte den prüfenden Blick eines Mannes am Nachbartisch aufgefangen. Es schien, als versuche jener herauszufinden, wie Lea und Reiter zueinander stünden. Als Lea ihn anblickte, wandte er sich ab und seiner Partnerin zu, der er etwas ins Ohr sagte. - Es ist anregend, mit Ihnen zu plaudern, sagte Reiter in diesem Augenblick. Lea stellte sich vor, sie würde mit Reiter hinaus in den Abend gehen, er würde ihr seinen Arm bieten und sie würden ohne Absprache irgendwohin gehen.
Manchmal, dachte Lea, drängt sich etwas aus dem Unbewussten ins Heute: ein Geruch, ein plötzlich vor dem »inneren Auge« erscheinendes Bild eines Baumes, einer Bank; und diejenige, die es »sieht«, erlebt es als »Damalige«.