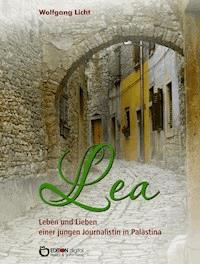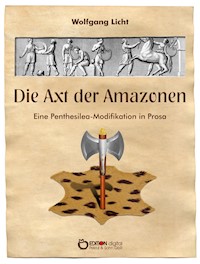8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte der Gussmanns beginnt mit Wilhelm, einundzwanzig Jahre alt, gelernter Dreher. An einem kalten Morgen im Herbst 1927 verlässt er die Pflegeeltern und kommt in die fremde Stadt. Mehr als die Kälte treibt ihn die Erwartung: Er wird seine Mutter sehen. In seiner Vorstellung ist sie jung, weißhäutig und von sanfter Natur. Hier muss die Geschichte stocken. Sie verändert die Richtung, und eines Tages begegnet Wilhelm dem jungen Mädchen Elisabeth. Alles an ihr ist hell: die Haut, die Haare, selbst die Brauen. Diese hier, weiß Wilhelm, hat er gesucht. So könnte Elisabeth in die Geschichte der Gussmanns eintreten, aber sie zögert. Dieser dürftig gekleidete, magere Bursche, arbeitslos zumal, gleicht wenig dem Bild, das sie sich von dem Geliebten erträumt hat. Sein Drängen erschreckt sie, die Liebe dachte sie sich anders. Doch die Geschichte, einmal begonnen, nimmt nun ihren Verlauf. Wolfgang Licht beschreibt in diesem Roman mit subtiler Genauigkeit das Werden und Wachsen einer Familie. Es ist eingeschlossen in die Geschichte des Dritten Reiches und vollzieht sich auf dem in jenen Jahren mitunter schmalen Grat zwischen Gut und Böse, Humanismus und Barbarei. Das Buch erschien erstmals 1986 beim Aufbau-Verlag Berlin-Weimar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 697
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Impressum
Wolfgang Licht
Die Geschichte der Gussmanns
Roman
ISBN 978-3-86394-760-6 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien 1986 beim Aufbau-Verlag Berlin und Weimar.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta, Monika Franta
© 2012 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Alte Dorfstraße 2 b 19065 Godern Tel.: 03860-505 788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Teil 1
1. Kapitel
Wilhelm erwachte vor Kälte. Er klopfte sich das Stroh von der Kleidung, nahm die Tragtasche und trat vor die Scheune. Das Dorf, gestern Abend wie ein Schatten gegen den Horizont gestellt, war in der Nacht nicht zu erkennen: Dir hilft nur losgehen. Allmählich bekam der Himmel über der tuchflachen Landschaft einen tintigen Ton. Die Bäume zu Seiten der Landstraße lösten sich aus der Fläche, wurden körperlich. Wilhelm blickte beim Gehen in ihre Kronen und überließ sich dem Eindruck, das regellos verbundene Geäst ziehe über ihn hin, zurück nach K., wo er die Zieheltern vor Tagen verlassen hatte. Ganz weit, ein Zug. Wilhelm blieb stehen, das Stoßen der Räder zu hören. Da war nur der Nordwind. Eine Weile dachte er sich in den Sitz eines Abteils. Dann hängte er sich die Tasche über den Arm und bewegte die Finger: Spanne deine Muskeln, dann wird dir warm. Kein Weichling sein. Mehr aber als die Kälte trieb ihn Erwartung. Er wird seine Mutter sehen! Einen halben Tagesmarsch noch, dann wird er die Stadt erreicht haben.
Bertha, seine Ziehmutter, hatte versucht, ihm diese Reise auszureden. Am letzten Tage noch. In dunkler Küche, beschienen vom Herdfeuer, machte sie ihm Vorhaltungen. Das Gesicht im Glutschein unbewegt, die Augen gekniffen, als sehe sie sein Geschick. Sich ins Ungewisse trollen. Nun, wo er heraus sei aus dem Gröbsten. Pflichten habe er ihr gegenüber und Erich. Nicht dieser Mutter. Aber wahrscheinlich sei er ein Abenteurer. Und darin gleiche er ihr. Da war Wilhelm vor sie hingetreten, die Arme an den Leib gepresst, und hatte sie angestarrt, bis Bertha, für den Augenblick erschrocken, höhnisch auflachte: Schlagen, was? So kommt es an den Tag. Er war ohne Abschied aufgebrochen.
Seit er sprechen konnte, hatte Wilhelm seine Mutter verteidigt. Als Kind verkündete er, sie würde bewacht. Dämonen, der Schwarze Mann, verhinderten, dass sie sich um ihn kümmerte. Zehnjährig befand er, ein Mann, sein Vater, habe Schuld. Er verlange von der Mutter, Wilhelm zu vergessen. Doch sie litte um ihn. Soviel stehe fest. Und sie sei arm. Deshalb habe sie ihn auch weggeben müssen. Unter Qual. Damit Wilhelm ein Heim bekäme. Das tägliche Essen.
Diese Geschichte hatte er sich so oft vorgesagt, bis er vergaß, dass er selbst sie ausgedacht hatte. Vielleicht hatte er diese Version ersonnen, weil Bertha ihm nicht erlaubte, sie als Mutter anzunehmen. Sie verstand sich als Beschließerin, bei der er logierte. Niemals war sie zärtlich zu ihm. Du vergisst nicht den Tag deiner Einschulung. Du warst zeitig aufgestanden. Die Wohnstube blendete vor Sonne. Auf deinem Essplatz lag die Zuckertüte, womit du nicht gerechnet hattest. Du warst zu Bertha gerannt, hattest sie umhalst. Sie fasste dich bei den Handgelenken, zog deine Arme von sich ab und sagte: Bleib mir vom Leibe. Ihr Griff war nicht hart, und sie blickte freundlich, aber du hattest dich in Grund und Boden geschämt. Dagegen setztest du das Bild deiner Mutter: Die war jung, weißhäutig und von sanfter Natur.
Wilhelm waren diese Erinnerungen unangenehm. Er wollte wie seinen Körper auch das Gemüt beherrschen. Es gibt, dachte er, einen natürlichen Grund, warum Lucy, die Mutter, niemals gekommen ist. Sie wollte sein Verhältnis zu Bertha nicht beschädigen. Nun würde er sie aufsuchen. Er wollte sie sehen, endlich kennen.
Da erblickte er die Stadt. Sie lag hingestreckt über die Ebene. Wie ein Krake, eine bizarr gegliederte Masse mit funkelnden Lichtern und Feuern. Lautlos. Und wie unter Atemstößen, als habe er Brust und Lunge, färbte sich jetzt der Himmel über ihr hellblau um weißliche Inseln.
2. Kapitel
Wilhelm betrat die Straßen der Stadt. Sie kamen ihm fremdartig vor, als würde hier anders gebaut. Durch tausend Fenster in glatten Fassaden schienen die Häuser ihre Haltung gegen ihn auszudrücken: feindselig, abweisend. Er hatte die Endstation einer Straßenbahn erreicht und sah flüchtig auf Wartende. Da fiel ihm ein Mann auf. Groß, in dunkelblauem Zweireiher, steifem Hut, einen schwarzen Stockschirm in behandschuhten Händen. Was sieht er an dir? Dass du ihn anstarrst! So könnte dein Vater aussehen! Über seinen Vater dachte Wilhelm zwiespältig. Er glaubte ihn zu hassen und wäre ihm gern begegnet. War das, was er gegen den unbekannten Vater fühlte, wirklich Hass? Du hasst ihn, weil er dich nicht liebt. Er hat Lucy verstoßen und sich auch von dir freigekauft. Dennoch hast du dir ein Bild von ihm zu machen versucht, ihn einen schönen Mann sein lassen. Groß. Schlank. Er hat dich, ließest du ihn auftreten, jedes Mal sofort erkannt und angesprochen in herzlichem Ton. Und du hattest Mühe, die aufbrechende Neigung zu deiner Fantasiefigur zu unterdrücken. Du führtest dir den Vorgang des Verrats vor Augen, um den, der ihn beging, zu verdammen.
Mit einem Male war es hell geworden. Über den Dächern stand ein weißlicher Schein. Der Himmel, unendlich hoch, war dort, wo die Sonne sich wölbte, von metallenem Gelb.
Als Wilhelm das Straßenschild erkennt, zwingt er sich, langsam zu gehen. Da fällt die erinnerte Zahl mit der in Emaille gebrannten zusammen, und im Schreck des Erkennens geht er an dem Haus vorbei. Umkehrend klinkt er entschlossen die Tür. Sie klemmt anfänglich und gibt unter seiner Anstrengung rasch nach. In die plötzliche Leere hineintaumelnd, wäre er ums Haar gestürzt. Er sagt sich den Namen an, den Lucy jetzt führt: Feiler. Ihm wird bewusst, dass er auch mit dem Mann rechnen muss, den er nicht eingelassen hat in seine Vorstellungen von ihrem Leben. Wilhelm nimmt die Hand vom Geländer, an dem er sich gehalten hat, für einen Augenblick. Er drückt die Klingel mit ausgestrecktem Arm. In der geöffneten Tür sieht er eine fremde Frau und sagt seinen Namen gegen ihr gleichgültiges Gesicht. Da ist ihr Mund offen im Entsetzen. Sie presst die Handflächen, als wolle sie mit sich selbst ringen. Fasst ihn endlich bei den Schultern. Sagt: Um Gottes willen. Und: Er weiß nichts von dir. Geh. Rasch. Und: Versteh doch, bitte. Sie war auf den Treppenabsatz getreten, hatte die Tür hinter sich herangezogen.
Wilhelm hatte sich langsam herumgedreht und war die Treppe hinuntergegangen. Er fühlte sich wie in einem Fieberzustand: Wohin er blickte, Unschärfe, Zergliederung von Körpern und Dingen; die Augen Berthas, ihr Mund, hinter fremdem Gesicht. Menschen auf den Straßen wie gestikulierende bunte Schatten. Der Verlauf der Straßen ein Labyrinth.
Lange war er gegangen. Da fiel sein Blick auf die Gaslaternen. Er blieb stehen, sie zu betrachten. Wilhelm war jetzt nur in der Stadt, um herauszufinden, wie sie entflammt werden. Allmählich wurden diese Überlegungen zersetzt, durchsetzt von anderen, bis ihm bewusst war, woran er wirklich gedacht hatte: Seine Mutter war das nicht. Nicht die seiner Vorstellung. Diese Lucy war keine Frau mit hellen Gliedern und glänzendem, weichem Haar. Wie hatte er die Zeit vergessen können! So war der Weg zur Mutter nur ein Vorwand gewesen und gerecht, dass sie ihn abwies, die er gar nicht gemeint hatte?
Eine Weile schon hatte er, ohne es auf sich zu beziehen, seinen Namen gehört. Ein Bursche lief quer über die Straße auf ihn zu. Das karierte Hemd offen, die Jacke vom Wind aufgeschlagen. Jünger als Wilhelm, das Gesicht rot vom Lauf. Das blonde Haar kurz geschnitten und an den Schläfen geschoren, so dass die Ohren groß wirkten. Bist du Wilhelm? Er fragte es zwischen Atemstößen. Wilhelm nickte. Ich soll dich zurückholen. Vater will es. - Es hat keinen Zweck. Wilhelm sagte es unentschlossen: Sie will mich doch gar nicht. Aber der Junge: Ich heiße Herbert. Und: Los, sei nicht blöd. Er zog Wilhelm am Arm und griff dann nach der Tasche, die Wilhelm zögernd losließ. Während sie zusammen zurückgingen, erzählte Herbert: Der Vater, Gerhard, habe Wilhelms Klingeln gehört und wie die Mutter mit Wilhelm gesprochen. Sie habe behauptet, es sei ein Vertreter gewesen, worauf Gerhard fragte, warum sie da weine. Sie sagte es ihm, da wurde er wütend und schickte mich los.
Die Mutter und Gerhard erhoben sich vom Sofa im Wohnzimmer. Sie waren in Hausschuhen und gleich groß. Beide waren feierlich gestimmt. Und für die Geste gegen den heimkehrenden Sohn hattest du Dankbarkeit vorzuzeigen. Der mehrfache Umschlag der Gefühle hatte Wilhelm abgekühlt. Er nahm nicht teil an der hergezeigten Rührung. Wieder einmal ein Ersatzvater, der sich für ihn eingesetzt hatte. Wilhelm ließ sich umarmen, umarmte seinerseits. Und noch einmal: Wie groß du bist. Lucy schien voller Stolz. Wohl auch befriedigt über den Ausgang: die Entbindung von jahrelangem Verschweigen. Es ist deine Mutter. Versteh sie, auch wenn es dir nichts nützt. - Sei willkommen, sagte Gerhard. Die Worte stimmten zum Ton. Er meinte, was sie bedeuten. Jedenfalls für den Augenblick.
Sie saßen um den Tisch. Beim Anblick von Kaffee und Butterbrot schoss Wilhelm Speichel ein. Er war krank vor Hunger. Und so, unter Reden und Sättigung, wurde er friedfertig, als sei der Magen das Organ seines Gemüts. Sie spielten die Versöhnung weiter, pressten aus ihrer Vergangenheit gegenseitig Neigung füreinander: Weißt du noch? Auch Wilhelm berichtete, aufgefordert und dann heimlich verhaltend, von der Fürsorge Berthas, der Freundschaft Erichs: Er hat mich die Namen der Bäume gelehrt. Mir Schwimmen beigebracht, und Melken. Und er erzählte Geschichten. In den Pausen schwiegen sie. Da brach er ab. Du wohnst doch bei uns. Gerhard sagte es. Wilhelm sah ihn an, zeigte Freude. - Nur... - Ja? - Viel haben wir nicht. Ich bin arbeitslos. Gerhard sagte es entschuldigend. Aber das macht nichts. Wilhelm sah, es machte ihm doch etwas aus. Gerhards Arbeitslosigkeit war saisonbedingt. Aber Lucy hatte Arbeit für Stunden. Sie war Hutmacherin. Und Herbert? In ein paar Wochen bekommt er den Gesellenbrief als Tischler. Trotzdem, sagte Gerhard. Acht Jahre nach dem Versailler Diktat muss etwas getan werden. Eine Erneuerung der Verhältnisse von Grund auf. Da konnte Wilhelm nur zustimmen.
Gerhard war Zimmermann. Er hatte Lucy auf einer Baustelle kennen gelernt. Lucy holte das Album. Wilhelm sah ihn im breiten Hut, in der vielknöpfigen Jacke aus Manchester im Dachstuhl eines Hauses hocken. Die Bilderfolgen reihten sich und peinigten Wilhelm. Wie sie ausgesehen hat, als junge Frau! Und er, Gerhard. Unbekümmert. Lachend auf jedem Foto. Als Herbert vorkam, von Herbert im Zimmer kommentiert, schlug Lucy das Album zu. Sie begriff wohl, was du nun dachtest.
Wilhelm erwartete die Wirkung gleichen Blutes. Er wollte nicht länger beobachten und folgern, nun, da er doch noch angekommen war und aufgenommen. Er wollte brüderlich fühlen und als Sohn. Er strengte sich an, bis sein Gesicht schmerzte. Aber das Gefühl versagte: Du musst dich einstimmen. Zuwarten.
Er zwang sich, die Anordnung des Geschirrs auf dem Tisch zu betrachten, besah die Wand gegenüber. Tapete mit Ornamenten, die sich um einen quadratischen Kern in immer gleicher Weise schachtelten. Er versuchte herauszufinden, ob sie eine höhere Einheit bildeten oder sich nur unaufhörlich wiederholten, so dass einem taumelig werden konnte. Nun beobachtete er Lucy. Sie saß im rechten Winkel zu ihrem Zimmermann. Die gerundete Lehne des Plüschsofas schloss sie wie ein Kreisbogen ein. Das Seidenkleid, bedruckt mit stilisierten Blumen auf schattengrünem Grund. Der Hals, steil, entfleischt. Das Haar, dunkelfarben, bedeckte die Stirn im geraden Schnitt bis über die Brauen. Ihre Augen, dunkel, schmal, hielten ihm stand. Im zerstreuten Licht des Zimmers erschien ihm ihr beige getöntes Gesicht jugendlich. In diesem Augenblick war er davon überzeugt, dass sein Charakter von Grund auf anders wäre, hätte er ihre Fürsorge und Zärtlichkeiten als Kind erfahren. Und er glaubte fest, besser. Er sagte das Wort Mutter ohne Stimme, bis die Silben jeden Sinn für ihn verloren hatten. Dabei bewegte er die Lippen, und Lucy fragte ihn, ob er etwas sagen wolle. Und sogleich, als hätte er sie vorbereitet, kamen ihm die Worte, dass er glücklich sei, sie alle, und er sah auch Herbert und den Zimmermann kopfnickend an, endlich zu kennen, und wartete, dass Lucy aufstehe und ihn an sich ziehe, was ihm wiederum unbehaglich gewesen wäre. Sie aber blickte ihn nur freundlich an. Wie er ihr ähnlich sah! Die Wölbung der knöchernen Brauenbögen, darunter die Augen eng zurückgesetzt. Der leichte Knick in der Mitte der schmalen Nase, der Lippenschwung. Und für einen Augenblick fühlte er sich ihr sehr nahe.
Der Oktobertag dunkelte früh ein. Wilhelm befiel Müdigkeit zur Unzeit wie ein Rausch. Da richtete ihm Lucy das Plüschsofa zur Schlafstelle. Das Lager war unbequem. Seine Fläche schmal und zu kurz. Er versuchte sich zu verkleinern, indem er die Glieder beugte, den Rücken krümmte. Er war erschöpft. Dennoch blieb ihm der Schlaf fern. Die Begegnungen des Tages wiederholten sich als immer gleich bleibende Bilderfolge. Sein inneres Verhältnis zu Lucy blieb ungeklärt. Da, als könnte ihm das Klarheit bringen, versuchte er, sich seine Geburt vorzustellen, als bloßen mechanischen Vorgang. Indem er sich gewissermaßen in seine Anfänge zurückdachte, hoffte er, seine ursprüngliche Beziehung zu Lucy erneut herzustellen und so die natürliche, später abgerissene Bindung von diesem Punkt aus wieder zu knüpfen. Jedoch er brachte es nicht zustande. Da lag ihm seine Zeugung näher. Nicht der Akt. Ihn sich vorzustellen hätte Wilhelm Widerwillen bereitet. Ihm gefiel die Idee, sich als Spermium zu denken. Da entsetzte ihn der Gedanke, dass er sich ebenso gut hätte als einstige Eizelle fühlen können. Wer war er denn? Nicht einfach zusammengesetzt aus zwei Hälften. Nicht Lucy, noch sein unbekannter Vater, nach dem er zu fragen unterlassen hatte in Hörweite Gerhards. Damit er ein Ganzes werden konnte, hatten ja seine Urformen ihre Selbständigkeit völlig aufgeben müssen.
Er schüttelte sich. Hörte ein knirschendes Geräusch, bemerkte, dass er seine Zähne aufeinander presste. Seine Stirn war schweißig. Er versuchte die Hitze aus seinem Hals zu atmen. Warf die Wolldecke zurück. Verließ sein Lager. Räumte die Blumengläser vom Fensterbrett. Öffnete das Fenster. Beugte sich weit hinaus. Du bist ein verrückter Kerl, sagte er laut in die Nacht. Da sah er den Mond wie einen weichen Käse, und die Sterne brannten vor Helle. Er würde sich eine andere Unterkunft suchen. Schon bald.
3. Kapitel
Der Tag wurde nicht richtig hell. In den Gängen des Arbeitsamtes brannte Licht. Wilhelm wies dem grämlichen Beamten sein Arbeitsbuch vor und erfuhr, er wäre besser in K. geblieben. In seinem Beruf könne ihm nichts vermittelt werden. Anspruch auf Arbeitslosengeld habe er nicht. Allerdings, als Mitglied des Metallarbeiterverbandes könne er in einem Heim für Obdachlose wohnen. Wollen Sie? Wilhelm bekam eine Bescheinigung und war rasch wieder auf der Straße.
Das Asyl in der Salomonstraße stand vierstöckig in einer Reihe gleichhoher Häuser aus dem 19, Jahrhundert. Wilhelm betrachtete erstaunt die schweren, kunstgeschmiedeten Beschläge, Schrauben und doppelten Riegel des schokoladenfarbenen Holztores. Da hatten sie die Armut sorgfältig hinter Zierraten vor den Augen der Straße verborgen. Obwohl die Herberge, das war abzusehen, alle Armut der Stadt nicht fassen konnte. Der Pförtner, auf dessen Glatze sich die Lampe seiner Klause verkleinert und ungenau spiegelte, brauchte Zeit, Wilhelms Papiere zu prüfen und mit der Einweisung zu vergleichen. Und dann, den Finger auf der Zeile, den Namen in das Hauptbuch einzutragen, dessen starker Einband gefleckt war von schweißig-talgigen Absonderungen. Schließlich behielt er den Ausweis noch in der Hand, als sei er im Zweifel, ob er ihn Wilhelm zurückgeben dürfe. Bist ziemlich jung, sagte er. - Ist ja nur für kurz. Wilhelm nahm ihm den Ausweis fort, zusammen mit einer metallenen, gelochten Marke, auf die eine Nummer geprägt war und in Umschrift der Name des Asyls Herberge zur Heimat. Die ausgetretene Holzstiege in dem engen Treppenhaus roch nach ranzigem Öl. Im Schlafsaal waren alle Fenster geschlossen. Die Luft stand unbewegt, süßlich, wie eine Masse. Tageshelle drang nur bis zu den Spinden, die in der Mitte des Saales eine Schrankwand bildeten. Die Schlafkojen, zweistöckig, mit den Schmalseiten an der Fensterwand, teilten den Saal in helle und dunkle Abschnitte. Wilhelms Bett war das untere neben dem dritten Fenster. Aus dem Dämmer drangen Schnarchgeräusche und das Quietschen von Matratzen.
Wilhelm öffnete seine schwarze Wachstuchtasche, legte, was sie enthielt, auf das Bett: Unterwäsche, zwei Sporthemden, Taschentücher, Socken, einen hellgrünen kragenlosen Pullover, Rasierpinsel, Klingen und Kernseife in einem Waschbeutel. Er zog Windjacke und Hemd aus, legte beides daneben, nahm den Beutel und ging mit bloßem Oberkörper in den Duschraum. Er tat alles langsam. Die Beschäftigung musste ihm das Gefühl geben, den Tag mit sinnvollen Verrichtungen zu verbringen. An einem Rohr, das sich über die Länge des Raumes hinzog, waren in regelmäßigen Abständen Brausen angebracht. Jede mit einer Kette versehen, an der man ziehen musste, wollte man duschen.
Unter perlendem Wasser stand ein alter Mann. Wilhelm hängte seine Sachen an die Kleiderleiste und ging nackend auf ihn zu. Sie sagten einander ihre Namen: Wilhelm. Gotthold. Wilhelm betrachtete den Mann aus den Augenwinkeln: den faltigen Hals, die Backen, fettlos, schlaff; die Haut entfärbt, mit bräunlichen Malen besetzt; die Brustmuskeln mit ihren Warzen wie leere, spitze Tüten; den hängenden Leib, die Schultern von dünner Haut bedeckt, die zu knapp schien über den fleischlosen Beinen und Armen; die Lippen wie zerschnitten; die Augen, zwischen den gequollenen Lidern ertrinkend, den Mund voller schwarzer Stümpfe. Die ganze Gestalt auf großen roten Füßen inmitten von Dampf und Wasser, tröstlich verwaschen in ihren Umrissen und gleichzeitig überdeutlich, erschreckend vor der Leere weißer Kacheln. Was der sich wohl hat gefallen lassen müssen von seinen Widersachern, Arbeitgebern, Unteroffizieren, Behörden, Kindern und Frauen.
Wilhelm hatte sich eingeseift. Als er versuchte, mit verdrehter Schulter den Rücken zu erreichen, nahm ihm Gotthold die Seife aus der Hand: Gib her. Wilhelm war erstaunt: Hast du einen festen Griff. - Wenn mir nur einer noch etwas in die Hand gäbe, sagte Gotthold.
Wilhelm versuchte, die Klinge auf dem Handballen zu schärfen. Im Spiegel neben der Kleiderleiste sah er sein Gesicht von Sprüngen zergliedert und mit Flecken wie von Aussatz besetzt. Du denkst, ein Glück, es ist nur der Spiegel. Aber du wirst alle Kraft brauchen, damit es nicht dein wirkliches Gesicht wird.
4. Kapitel
In K. war es Wilhelm gewöhnt gewesen, in das mit Werg gefüllte Kissen eine Mulde für seinen Kopf zu drücken. Das Kissen hier aber war hart und voller Buckel. Um ihn wogten die Geräusche der Asylanten. Der Schlaf, in den er sonst verfiel, sobald er im Bett lag, kam nicht, dafür bedrängten ihn farbige Bilder: Da stand Bertha, vor dem Küchenherd Kartoffeln stampfend, von denen noch Pelle in Fetzen hing. Bertha war stark gebaut, aber nicht fett. Beim Hinkauern oder raschen Treppensteigen schimmerten ihre weißen, strumpflosen Beine. Unter dem Küchenkittel trug sie nur Unterwäsche. Es hatte eine Zeit gegeben, wo du die Augen abwendetest, während sie sich so unbefangen vor dir bewegte. Wenn sie schon nicht mütterlich war und nicht sein wollte, hätte sie sich streng kleiden sollen, ihn und Erich aus angemessener Entfernung dirigieren. Eine solche Person hätte dich Fähiger gemacht, Zärtlichkeiten zu entsagen, nach denen du dich sehntest. Du empfandest damals Zärtlichkeit nicht nur als Genuss oder Hautgefühl. Sie war dir auch ein Zeichen dafür, dass du etwas wert bist. Es hing zusammen mit dem Vorgang, bedient zu werden. Bedient wie Andreas Steigert, der Sohn des Fabrikherren in K., wo du den Beruf eines Drehers erlerntest. Du hast ihn ausgespäht, den jungen Andreas. Vom Amtssitz einer Pappel aus, die mit anderen in einer Reihe vor den Fenstern des herrschaftlichen Hauses wuchs. Du nahmst durch Augenschein teil an seinem reichen, wohlgeordneten Leben. Sahst ihn in der Sonnenhelle seines großen Schlafzimmers, in seidenem Anzug, dessen gleitende Kühle du dir auf deiner Haut dachtest, sahst sein weiches, rötliches Gesicht mit dem Ausdruck von Wichtigkeit unter glatten, hellblonden Haaren. Ein Dienstmädchen schob ihm den Frühstückswagen ans Bett. Du sahst, beide Hände um den vor dir ragenden Ast der Pappel geklammert, wie ein Diener in schwarzer Hose und gestreifter Weste das Hemd des jungen Herrn vor der Konsole des Spiegels ausbreitete. An jenem Nachmittag hast du dich das erste Mal geweigert, Pferdemist von den Straßen aufzuklauben, wie es Erich verlangte, um seine Tomatenstauden damit zu düngen. Ja, du hast sogar mit dem Fuß gegen den Eimer getreten, der dem Einsammeln des Kotes diente, aus Missachtung schon für das Behältnis.
Erich war kein Starker. Viel eher war dir, du müsstest es sein, der die Hand über den Ziehvater hielte. Dafür durchschaute er Welt und Verhältnisse und verstand es, sie dir ins Bild zu setzen. Der Mensch, hatte Erich einmal gesagt, befinde sich stets im Spannungsfeld zweier gegensätzlicher Eigenschaften. Die Auseinandersetzung mit ihnen forme seinen Charakter. Du hattest ein liniertes Schulheft genommen und begonnen, Gegensatzpaare einzutragen. Sehr bald aber fandest du Eigenschaften, die du nicht sicher voneinander abzugrenzen wusstest. Wie Ehrgeiz von Strebsamkeit, Egoismus von Durchsetzungsvermögen, Ausdauer von Starrsinn. So schobst du das Heft dem Ziehvater abends neben die Petroleumlampe. Wie solltest du hier einen Gegensatz finden? Vielleicht gäbe es da gar keinen? Da legte Erich seine flache Hand gespreizt auf das Heft. Dir kam es vor, als wolle er verhindern, dass die Begriffe aus den Seiten herausfielen und schwirrend, wie Wespen etwa, den Raum füllten. Der Mensch ist ein Ganzes, sagte er. Es kommt darauf an, welche Eigenschaften du ausbildest, so kannst du dich ändern, entwickeln, zum Guten oder Schlechten. Hier hustete Bertha über dem Stopfstrumpf und drehte die Augen nach oben, als wolle sie im Anblick der Decke bezeugen, wie erzdumm ihr diese Bemerkung scheine, und sagte dann doch noch, dann mach mal, ändere dich. Und zu dir: Geld, Junge, ändert alles, dich und mich und den da, und sie nickte mit dem Kopfe zum Ziehvater hin. Ist ein Ganzes, wiederholte Erich ungewohnt starrsinnig. Wilhelm müsse sich denken, er enthalte alle Eigenschaften gewissermaßen als Samen, und es komme wohl auf die Umstände an, aber auch auf ihn selbst, welcher Keim sich entwickle. Sie qualmt schon wieder, sagte er dann. Er nahm einen Lappen, fasste den heißen Glaszylinder der Lampe, verbrannte sich die Finger, stutzte mit einer Schere den dick berußten Docht, den er aus altem Zeug selbst gefertigt hatte, um die Pfennige für einen neuen zu sparen.
Ich will aber nicht arm bleiben, sagtest du zu Erich. Dann willst du ein Herr werden wie Steigert? Da fuhrst du auf. Lieber ein Boss als ein armer Holzdieb. Erich erwiderte ruhig, er sehe bei der Sache keinen Unterschied. Der eine sei lediglich erfolgreicher als der andere. — Lächerlich, sagtest du, Steigert mit einem Holzdieb zu vergleichen. Und Erich: Beide nehmen sich etwas, ohne zu bezahlen. Nur, dem Holzdieb erlauben das keine Gesetze. Also, willst du die Armut abschaffen oder nur selbst weiterkommen? Das erste ist sehr schwer, vielleicht unmöglich. Das zweite gelingt dir vielleicht. Aber rede mir dann nicht von Menschenwürde und Gerechtigkeit. Erich langte nach einer Bierflasche unter dem Sofa, hob sie an die Lippen, schloss die Augen und bog den Kopf zurück. Es gab ein saugendes Geräusch. Erichs Adamsapfel fuhr auf und nieder. Dann hielt er die Flasche prüfend vor die Augen, und du sahst, sie war leer und war es offenbar schon gewesen, als Erich sie angesetzt hatte. Er hatte seinen eigenen Speichel geschluckt.
Schaff sie weg, sagte er, und Bertha: Vergiss nicht, das Pfandgeld zu verlangen. Manchmal hattest du Bertha um ihre Haltung zum Leben beneidet. Auch für sie gab es ein oben und unten. Basta. Was ihm das ausmache. Sie richte sich eben ein. Ihr war es gelungen, die Theorie von zwei verschiedenen Gattungen Menschen anzunehmen, von denen jede ihren eigenen und dazu noch vorbestimmten Platz besetzt hält. Aus ihrer Weltsicht blickte sie auf eine fest gefügte Ordnung, an deren Veränderung sie nicht glaubte. Sie nahm die Existenz und die unterschiedliche Lebensform von arm und reich hin wie die Jahreszeiten. Als natürlichen Ausgleich für die Benachteiligung ihres Standes, die sie durchaus empfand, hielt sie für recht, kleine Diebereien zu begehen, die sie Aufbesserung ihrer Einkünfte nannte: Reste sammeln, Bergen von ohnehin Herumliegendem. Das hieß Holz sammeln auch mittels Handsäge, Kartoffeln ausbuddeln am Feldrande oder einem als verirrt bezeichnetem Huhn den Kopf umdrehen, eine einsame Kuh melken. Sie würde aber weiterhin jede Auflehnung gegen diese Ordnung verurteilen, den Kopf gebeugt, eine Hand mit gespreizten Fingern vor ihrem Busen: Da sei Gott vor.
In dem Saal ohne schirmende Wände war Wilhelm jedem Blick und allen Geräuschen ausgesetzt. Die ganze Nacht über brannten Glühbirnen, die gerade so viel Licht gaben, dass sich einer zurechtfinden konnte, wollte er den Saal verlassen oder sein Bettzeug ordnen. Und zunehmend quälte ihn Juckreiz.
Plötzlich fragte sich Wilhelm, ob er seinem unbekannten Vater nicht vor allem vorwerfe, ihn in Niederungen gestoßen, ihn um die Früchte einer gesellschaftlichen Stellung gebracht zu haben, die er hätte pflücken können, wäre er sein Sohn auch vor dem Gesetz geworden. Diese Gedanken überfielen ihn wie Buschräuber. Hätte er sich der Unterdrückten auch angenommen, wenn sein Vater ihn wohl ausgestattet hätte? War sein Abscheu vor dem Besitz nur der Groll des Verstoßenen? Er glaubte es nicht.
Am nächsten Morgen erschrak er vor rötlichen Knötchen und Quaddeln, die seine Haut bedeckten. Er dachte an eine Hautkrankheit. Aber Gotthold lachte ihn aus. Wanzen, mein Lieber. Du kommst ihnen gerade recht.
Bevor Wilhelm das Asyl verließ, um das Arbeitsamt aufzusuchen, bat er Gotthold um ein Blatt Papier aus dessen Schreibheft. Er beschrieb den Zieheltern seine Reise und Ankunft in der Stadt. Dass Lucy ihn zu verleugnen gesucht hatte, verschwieg er. Stattdessen ließ er sie »die Zieheltern von Herzen grüßen«. Und das Obdachlosen-Asyl nannte er eine »Herberge für Reisende«, wo er vorübergehend wohne. In einem Postskriptum entschuldigte er sich bei Bertha für seinen »Aufbruch ohne Abschied«, den sie seinem Temperament, das sie ja kenne, zugute halten möge.
5. Kapitel
Als Wilhelm an einem der folgenden Abende zu Lucy ging, um sie über seinen Vater zu befragen, fand er wiederum keine Möglichkeit, mit ihr allein zu sprechen. Stets hielten sich Gerhard, Herbert oder beide an ihrer Seite auf. Obwohl alle Wilhelm gegenüber Freundlichkeit bezeigten, verabschiedete er sich bald, nachdem er ihnen von Gotthold, dem Leben im Asyl, nichts aber von dem Ungeziefer erzählt hatte. Ein wenig verstimmt betrat er eine Bierstube, um die Zeit bis zur Nachtruhe im Asyl zu überbrücken.
Von seinem Platz am Tresen aus das Treiben betrachtend, fand er, dass alle Schenken, die er kannte, einander ziemlich ähnlich waren, wie die Leute, die sie besuchten. Auch die Wirte hinter den Tresen schienen einander zu gleichen, wie sie mit aufgekrempelten Hemdsärmeln die Gläser auf dem Blechrost der Theke ergriffen und in das Spülwasser tauchten, das selten erneuert wurde. Und wie das Spülwasser war auch die Beleuchtung. Eine Trübnis, als versuche eine sterbende Sonne den Dunst zu durchdringen, der aus Mündern, Küchenspalten hervorkam und hauchhaft sichtbar von Fleischbrühen und Bockwürsten aufstieg oder in Schwaden durch geöffnete Türen strömte. Die Wärme der Kneipen schien aus Gerüchen zu bestehen. Dem Biergeruch beigemengt war die Witterung von Leibern, Joppen, Hosen und Schuhen. Es war ein Geruch, gesättigt mit warmen Lebensessenzen. Anders als die Luft im Asyl, die an schwache Fäulnissüße, fadenziehenden Schleim erinnerte, an kranken Schweiß, den ein verlangsamter, gestockter Stoffwechsel auf klebriger Haut absonderte. Und in allen Schenken gab es den Lärm der Gäste. Ihre An- und Ausrufe, Worte und Satzfetzen wie Springquellen aus einem gleich bleibenden Grundlärm um die Tische, vor den Tresen. Sogar die Bewegungen der Besucher glichen sich in den Abläufen. Wie sie, die Arme gespannt, sich in den Hüften drehend, die Beine setzten, konnte man glauben, sie hielten noch den Hammer gepackt, die Eisenstange, den Griff des Schwungrades, um dann nach Schlag und Stoß, Stemmen und Kurbeln ihre Körper wieder zu lockern. Sie erinnerten in ihrer Bewegungsart an Bären, die, scheinbar tapsig und friedlich, keinen, der sie kannte, über ihre eigentliche Kraft und Behändigkeit täuschten. Es war ratsam, sie nicht zu reizen. Auch die Asylbewohner waren an ihren Bewegungen zu erkennen; auch sie regten sich langsam, aber ihre Langsamkeit war nachschleppend, stockend und wiederum ruckartig. Man glaubte das Knirschen in ihren Gelenken zu hören, das Knarren der Wirbelsäulen, die, zwischen Kalkspangen geschient, nur noch geringe Beweglichkeit zuließen.
Wilhelm trank sein Bier aus. Er hatte auch die Kneipen satt. Jede Art von Asyl. Er wollte nach Seife riechen und frischer Wäsche und höchstens ein bisschen nach sich selbst.
6. Kapitel
Am nächsten Morgen hatte Wilhelm Glück. Der Beamte vermittelte ihm Arbeit als Plakatkleber bei der UFA-Kinowerbung: Beschäftigungen gibt es, wenn Sie nur wollen!
Lange vor Tag verließ Wilhelm nun die Herberge. Im Hof der Agentur schichtete er die Plakate auf das Tragegestell über dem Vorderrad, hängte den Eimer voller Leim an die Lenkstange, befestigte die Leiter am Rahmen, steckte Handbürste und Schaber in die Halterungen an der Querstange, unter der auf einem Blechschild in roter Schrift UFA stand. Wilhelm fuhr rasch, um warm zu werden. Er musste weiter nach vorn in die noch andauernde Dunkelheit blicken, als das schmale Lichtband der Karbidlampe reichte. Hin und wieder erfassten Autoscheinwerfer Gruppen von Menschen, verwandelten Schatten in farbige Körper. An der Mauer zwischen Häusern sah er die erste Werbefläche. Die alten Plakate hafteten fest. Er strich Leim darüber und drückte die neuen an, glättete die Falten mit den Händen. Die Dirnentragödie mit Asta Nielsen las er. Er behielt nun Eimer und Pinsel in der Linken und fuhr einhändig weiter. An der Litfasssäule vor einem Feinkostgeschäft brauchte er seine Leiter. Er hatte ein Viertel der Säule von oben bis unten mit Astas zu bekleben. Im Grunde war es eine leichte Arbeit. Er dachte sie zu Ende zu bringen, bevor es hell wurde.
Da sah er beim Einbiegen in die Stehrer Straße eine Gruppe Arbeiter und dahinter in Reihe Polizisten neben einem Mannschaftswagen. Sie ließen keinen vorbei. Die Straße führte zu Schuckerts Maschinenfabrik. Vor dem Werktor standen wieder Arbeiter. Wilhelm hatte eine lang gestreckte Bretterwand zu bekleben, die im rechten Winkel zum Tor verlief. Nach einem kurzen Blick auf sein Fahrrad mit Firmenschild und Plakaten ließen die Polizisten ihn passieren. Im Näherkommen las er auf den Schildern in den Händen der Arbeiter die Sätze »Streik« und »Stoppt die Entlassungen«. Er lehnte das Rad neben das Pförtnergebäude und begann, die an der Klebewand in Fetzen hängenden Plakate mit dem Schaber abzukratzen. Als er mehrere Astas zu einer Werbereihe fügte, sprachen ihn zwei Arbeiter an: Gefällt dir das Kleben? - Ich bin Dreher, sagte Wilhelm. Arbeitslos. - Da gehörst du ja zu uns. Und: Du könntest uns helfen. Er erfuhr, der Streik sei von der Gewerkschaft nicht genehmigt. Sie wollten Schuckert zwingen, entlassene Arbeiter wieder einzustellen: Wir sind in Zeitnot. Der Unternehmer und seine Presse nennen uns Hetzer gegen den Arbeitsfrieden. Wir wollen die Öffentlichkeit aufklären. Wilhelm war erregt und voller Hochgefühl. Er, der Stadtfremde, wurde gebeten. Sie hatten Zettel vorbereitet: Packst sie zwischen deine Astas und bringst sie unter die Leute. Wilhelm belud sein Rad mit Streikparolen. Wieder in den Straßen, klebte er sie an Mauern, Hauswände und korrekt neben die Einladung zur Dirnentragödie an Litfasssäulen und Werbeflächen. Sehr verspätet lieferte er sein Rad in der Agentur ab.
Am nächsten Tag wurden ihm keine Plakate ausgehändigt. Der Lagerist schickte ihn ins Büro. Dort sagte ihm ein Mann mit Schnauzbart und Scheitel, Wilhelm habe das Geschäftsrad unbefugt benutzt und gegen Verordnungen über die Nutzung öffentlicher Werbeflächen verstoßen. Er solle froh sein, dass sie ihn nicht belangen.
Die Sonne schien mit für diese Jahreszeit ungewöhnlicher Kraft. Wilhelm setzte sich auf eine Bank. Der Platz, auf dem sie stand, wurde von vier Straßen umgrenzt, deren eine, auf die Wilhelm den Blick hatte, eine vielbefahrene Hauptstraße war. Wilhelm fiel auf, dass außer alten Menschen hier nur Mädchen und junge Frauen saßen, die spielende Kleinkinder überwachten.
Das Mädchen auf der Bank neben ihm nahm ein in Tücher gepacktes Baby aus dem Kinderwagen. Wilhelm wendete sich dem Kind zu. Die Frau lachte ihn an. Zwischen ihren salzweißen Zähnen erschien ihre bewegliche Zunge fleischrot.
Wilhelm fand, das Gesicht des Säuglings gliche dem des Greises, der, dem Mädchen benachbart, seinerseits auf das Baby blickte. Der Kopf des Babys wurde von einer verrutschten Strickmütze bedeckt, während der Alte eine Pudelmütze trug, die, kurios, in gleicher Weise verschoben war. Auch die Züge der beiden Ungleichen waren verschoben und verrutscht wie ihre Mützen. Beide waren sie zahnlos, und ihre Haare ringelten sich dünn unter den Mützen. Und ihre Mienen wechselten in alle Ausdrücke. Was denken sie? Der Kleine will die Welt begreifen und der Alte vielleicht nicht mehr. Und zwischen ihnen das frischfarbene, glatthäutige Mädchen. Weibliches als Natur, die alles Leben hervorbringt, selbst alterslos.
Wilhelm erschien auf einmal die Zeit zwischen den Lebensaltern bedrückend kurz, und zum ersten Male fragte er sich, wie es wäre, lebte er nicht mehr. Er empfand eine unerklärliche Beklemmung, und er sagte sich eindringlich, solange du fühlst, lebst du. Das beruhigte ihn.
Infolge der ungewohnten Wärme schläfrig geworden, schloss er die Augen.
Auf den Zuwegen, die den Platz mit den Straßen verbinden, erscheinen plötzlich Hunde. Wilhelm wundert sich über ihre Menge. Und dass er sie erst jetzt bemerkt. War nicht Leinenzwang für ihresgleichen? Diese Hunde aber laufen frei herum, und Wilhelm scheint es, als wüssten die Tiere um ihre Privilegien. Einige zwängen sich durch die Büsche bis hinter die Bänke und tauchen überraschend im Rücken der Sitzenden auf. Kläffen und springen gar auf die Bänke, als wollen sie die Menschen verdrängen. Andere tummeln sich im Sandkasten zwischen den Kindern, die zu schreien anfangen. Am erstaunlichsten aber scheint Wilhelm, was sich die Umsitzenden von den Hunden gefallen lassen. Ja, es hat den Anschein, als versuchen sie das, was um sie herum vorgeht, zu übersehen. Sie sprechen weiterhin miteinander wie der Mann mit der Nickelbrille mit dem, der Schlapphut und roten Wollschal trägt, indem sie sich, Körper und Hälse verdrehend, um die Dogge herum ansehen, die sich zwischen sie auf die Hinterpfoten gesetzt hat. Eine Frau entfaltet eine Zeitung. Nachdem ein Hund ihr die Zeitung weggeschnappt hat, wendet sich die Frau zu ihrer Nachbarin, als sei nichts geschehen. Eine dicke, plüschene Töle leckt einer der jungen Mütter das Knie, die tut, als scheuche sie eine Fliege fort. Das schlimmste, findet Wilhelm, ist der Kot. Hundedreck. Und es ist traurig anzusehen, wie die Kriechkinder da hineintappen. Die Mütter oder Ausfahrmädchen aber blicken in den Himmel, als sehen sie Vögeln nach. Da erscheint ein Mann in Ledermantel und Filzhut. Er geht quer über den Platz. Der Hundeherr, denkt Wilhelm.
In diesem Augenblick fuhr Wilhelm hoch. Fanfaren gellten. Auf der besonnten Hauptstraße rollte eine Autokolonne vorüber. Offene Lastwagen. Auf ihren beplankten Ladeflächen standen verrenkte Gestalten in Schirmmützen und jauchefarbenen Phantasieuniformen mit roten Armbinden, Runen auf weißem Kreis. Die Männer hielten sich wechselseitig an den Ellenbogen gepackt und schrien, als bisse sie wer. Hinter jedem Fahrerhaus wischte eine Fahne wie eine riesige Armbinde. Die Kolonne fuhr langsam. Fast alle Passanten auf den Bürgersteigen waren stehen geblieben, und es waren nicht wenige, die winkten oder ihre Hände schräg nach oben stießen. Endlich folgten Straßenbahnzüge dicht hintereinander. Langsam verebbte das Gebrüll in der Ferne. Wilhelm schaute um sich. Wie weggefegt waren die Hunde, als hätten die Lastautos sie mit sich genommen, mitsamt dem Kot. Die Hunde, fragte Wilhelm das Mädchen, das ihren Säugling längst wieder in den Wagen verpackt hatte, wo sind denn die Hunde? Sie sah ihn an und dann über den Platz, wo eine Frau in unbestimmtem Alter ihren Pudel an der Leine führte. Meinen Sie den? Das Mädchen drehte sich zu Wilhelm, der fassungslos schien, fragte: Sie sind wohl sehr müde?
7. Kapitel
Wieder ohne Beschäftigung, durchstreifte Wilhelm die Stadt. In der vornehmen Westvorstadt betrachtete er die Häuser. Hier war es still, die Luft klar und fast geruchlos, die Gegend beinahe menschenleer. Die Bewohner der Villen kamen oder fuhren ab in geschlossenen Kutschen oder Automobilen. Ein livrierter Diener hielt ihnen den Verschlag und ein anderer die Tore aus Schmuckgittern.
Wilhelm ging schlendernd, die flache Schirmmütze aus der Stirn geschoben, die Hände in den Taschen. Den Kragen seiner Jacke hatte er aufgestellt, der Kälte wegen, aber auch, um das Gefühl zu haben, in einer eigenen Sphäre zu gehen. In diesem Augenblick öffnete sich eines der Tore. Eine Frau und ein Mann traten heraus. Wilhelm betrachtete sie neugierig. Die Frau, jung, schmal, in hellgrauem Mantel, mit einem gleichfarbigen Velourhut und Lederhandschuhen, ging anmutig auf hochhackigen Schuhen. Sie berührte leicht den Arm ihres Begleiters. Ein weißer Kragen warf einen Schein auf Hals und Kinn des Mannes, der einen gedrechselten Spazierstock schwenkte. Sie gingen in der Mitte des nicht sehr breiten Fußweges. Wilhelm spähte aus den Augenwinkeln nach dem Paar, und als es ihm nahe war, wich er ein wenig nach der Fahrbahn hin aus, erwartend, dass der Mann ihm ebenfalls Platz mache. Bevor sie aber auf gleicher Höhe waren und, so schien es Wilhelm, ein Zusammenstoß drohte, trat Wilhelm zur Seite und ließ die beiden passieren. In diesem Augenblick sah er, dass die Frau graue Augen hatte, die wie die ihres Partners in eine weite Ferne blickten. Einen Laternenpfahl hätten sie beachtet, dachte Wilhelm, oder einen Hund, schon aus Sorge um ihre Waden. Er spürte, wie die Wut ihm Tränen auspresste. Lebhaft und deutlich stand ihm nun vor Augen, was er hätte tun müssen. Er hieb mit den Armen durch die Luft, dass es ein fauchendes Geräusch gab und er, sich um die eigene Achse drehend, stolpernd das Gleichgewicht halten musste. Hat dir deine Herkunft und Lebensweise einen Reflex ausgebildet, dich schmal zu machen vor den Bossen? Dann musst du ihn ausschleifen! Der Mensch ist nackt von Natur aus und jeder mit den gleichen Gliedmaßen und Organen versehen. Du wirst es nicht hinnehmen, dass die Begriffe hoch und niedrig angewendet werden auf Gleiche, dich nicht abfinden mit deiner niederen Existenzform. Gewaltsam und durch Betrug wurden die sozialen Unterschiede geschaffen, gewaltsam und betrügerisch werden sie aufrechterhalten, und nur mit Gewalt sind sie wieder abzuschaffen.
Auf der Höhe seines Zorns überlässt er sich Bildern der Zerstörung. Er sieht sich selbst vor dem Palisadentor. Fühlt seine Muskeln hart werden, als er sich vorstellt, wie er es aufschlägt mit einem Zehn-Kilo-Hammer in dröhnendem Rundschlag, bis sich das aus seinen Gebinden gesprengte Schloss aufsperrt wie ein ausgerenkter Kiefer. Haus- und Kindermädchen, Köchin und Gesinde entfliehen aus einer Seitentür in den Park. Erleichtert lässt er sie entkommen. Als nächstes splittert die Haustür wie trockenes Kiefernholz auf dem Hackklotz. Eingedrungen in die Halle, sieht er sich livrierten Handlangern gegenüber. Aber sie erstarren vor der Drohung des geschwungenen Hammers. Er hat die Tore zerbrochen, die Satrapen gebannt. Und hinter der weggesprengten Schale stehen sie, seine Widersacher, allein, schutzlos. Und er sieht sie zittern, mit blutleeren Gesichtern, wie gelähmt von seinem Anblick. Da wirft er den Hammer von sich.
Wilhelms Wut hatte sich erschöpft. Der Gegenschlag, das wusste er, war mit anderen Mitteln zu führen und nicht von einem einzelnen.
Der dich das lehrte und dich vor Terror und Anarchismus warnte, als du versucht hattest, Steigerts kostbaren Windhund zu entführen, um den Boss in seiner Eigenliebe zu treffen, war dein Lehrausbilder bei Steigert, Alwin Regent. Die Hände weit voneinander auf die Werkbank gestützt, den Oberkörper vorgebeugt, sprach er zu dir mit kauenden Bewegungen: Höre gut zu! Kein Mensch gleicht dem anderen, aber jeder ist gleich wert. Wenn wir Gleichheit fordern, so heißt das, alle Vorrechte und Privilegien abzuschaffen. Unsere Widersacher begreifen das wohl und drehen uns deshalb das Wort im Munde um: Wir wollten alle und alles gleichmachen, abholzen, glatt walzen. Aber unser Weg führt in ein Paradies, das nicht abhängt von der Laune eines Gottes, sondern von uns selbst. Er hatte seine Stimme erhoben, sein Brustkorb vibrierte. Besitz, rief er, Besitz gilt dann nicht länger als Symbol für Rang und Wert des Besitzenden, die Menschheit befindet sich endlich im Zustand der Brüderlichkeit! Lebe und streite für dieses Ziel, Wilhelm. Er drehte sich brüsk um und verließ die Werkstatt, ohne die anderen oder Wilhelm anzublicken. Lass dich nicht dumm quatschen von dem, rief einer, Steigert hört so was nicht gern. Steigert, knurrtest du verächtlich. Und: Es gefällt mir, was er gesagt hat. Dieses künftige Leben in klassenloser Gesellschaft. Warum soll man davon nicht schwärmen. An dieses Paradies glaube ich lieber als an das pfäffische.
8. Kapitel
Anderentags endlich traf er die Mutter allein zu Hause an. Dass sie, in der Küche Brot zurechtschneidend - du bist doch sicher hungrig -, den Laib gegen ihre Brüste drückte, wie Bertha es immer getan hatte, erstaunte ihn. Seltsamerweise hatte er gedacht, Lucy benutze dafür eine Maschine. Nachdem er Lucy im Wohnzimmer nach seinem Vater gefragt hatte, überkam ihn plötzlich ein Gefühl der Scham. Er fand sein Anliegen ungehörig. Lucy könnte denken, er wolle mit seiner Frage auch und vor allem Auskunft über die Motive seiner Zeugung haben. Doch hinter aller Fragerei ging es Wilhelm neben einer, schwachen, Neugier auf seinen Vater im Innersten wohl um Aufschluss, warum seine Mutter ihn Pflegeeltern überlassen hatte.
Ich will versuchen, es dir zu erklären, sagte Lucy in sein Schweigen hinein. Sie blickte auf die Brote, die er noch gar nicht angerührt hatte. Dein Vater war wohlhabend. Er besaß eine Holzhandlung, Sägewerke. - Kenne ich ihn? unterbrach Wilhelm sie. Das ist unwichtig, sagte Lucy zurückhaltend. Ich würde dir ungern seinen Namen nennen. Heute. Nach so langer Zeit. Es war wohl eine alltägliche Geschichte, fuhr sie rasch fort. Er versprach, sich scheiden zu lassen. Fand dann immer neue Gründe, es nicht zu tun. Er mietete mir eine Wohnung, damit ich seine Geliebte bliebe. Ich hasste ihn schließlich. Sie schwieg. Und mich wohl auch, dachte Wilhelm. Sehe ich ihm ähnlich? fragte er leise. Nein, rief Lucy abwehrend. Vielleicht, sagte sie plötzlich, hätte ich nicht die Kraft gefunden, ihn zu verlassen, wenn ich dich behalten hätte. Es war schwer damals für eine ledige Frau mit einem Kind.
Und Wilhelm begriff, dass seine Frage gegenstandslos geworden war. Die Tatsache, dass die Mutter sich von ihm getrennt hatte, überwog jedes Motiv.
9. Kapitel
Um zu Geld zu kommen, ging Wilhelm von nun ab in die Häuser und bot sich an für Reparaturen, Auch kleinere Möbel oder Spielzeug aus Holz könne er fertigen. Die vorweihnachtliche Zeit war ihm günstig. Für diese Besuche hatte er sich vorbereitet. Die Wachstuchtasche hing ihm über der Schulter wie einem Schaffner. Er trug die Ballonmütze von Gotthold, der ihm auch die Werkzeuge verschafft hatte. Die Jacke schnürte ein Ledergürtel, in dem ein Hammer steckte. Dieser Aufzug wirkte vertrauensbildend, der Gedanke, ihn für einen Landstreicher zu halten, kam gar nicht erst auf.
Als ihm im dritten Stock der Mahlmannstraße 14 ein junges Mädchen das Türfenster öffnete, glaubte er einen Augenblick, er werde verwechselt. Sie schien ihn erwartet zu haben, vielmehr den, dem er wohl glich. Sie lächelte, die Hand am Fenster, den hellhaarigen Kopf geneigt. Alles an ihr war hell. Die blauen Augen, die Wimpern, Brauen und vor allem die Haut. Hautfarbenes Weiß.
Mit einer Hand leicht den Hammer berührend, sagte Wilhelm seinen Spruch: Er sei, arbeitslos, unterwegs, um sein Brot zu verdienen, repariere beinahe alles und fertige auch Gebrauchsgegenstände.
Sie blickte belustigt auf das Werkzeug in seinem Gürtel: Kommen Sie doch! Sie ließ ihn ein, führte ihn in die Küche. Wilhelm fühlte die Winterkälte aus seinem Körper weichen. Er merkte, dass seine Ohren in der Wärme anfingen zu glühen, und dachte, bald gleichen sie Hahnenkämmen.
Sie trug ein weites, ärmelloses Kleid, von schmalen Trägern gehalten. Er hielt sie für siebzehn. Als sie sich nach einem Topf bückte, sah er, dass ihre Brüste schwer waren und, wo sichtbar, nicht weißer als ihre Arme. Es war unglaublich, wie unbefangen sie sich bewegte. Da rief sie: die Milch, rückte den Topf vom Herd und blies auf den hochsteigenden Schaum. Während sie rasch aus der Hocke hoch und an den Herd gesprungen war, hatte er ihre kräftigen Beine gesehen. Sie wendete sich ihm halb zu. Ja, zu reparieren gäbe es nichts, das mache ihr Bruder. Aber ein Nähkästchen könne sie brauchen, wenn er das könne? Und: Nehmen Sie einen Kaffee? Sie saß ihm gegenüber, die Kaffeemühle zwischen den Knien, drehte die widerstrebende Kurbel. - Darf ich? - Sie gab ihm die Mühle.
Später, mit den Töpfen beschäftigt, fragte sie nach seinem Beruf und wollte es nicht glauben, dass er als gelernter Dreher keine Arbeit bekomme. Wilhelm legte seinen Ausweis auf den Tisch, als sei es nun an ihm, sie von seiner Zuverlässigkeit zu überzeugen. Sie verglich das Foto mit seinem Gesicht, aufmerksam, wie auf Entdeckungen aus: Das sollen Sie sein? Ihre gewölbten Lippen waren blassrosa, scharf begrenzt. Sie las vor, als buchstabiere sie: Metallarbeiterverband. Was ist das? Eine Gewerkschaft? Mehr sagte sie nicht. Hatte sie gelesen, dass er im August geboren und einundzwanzig Jahre alt war? Und seinen Namen?
Sie goss ihm Kaffee ein. Er sah ihre Achselhaare als scharf begrenzten Rhombus. Suchte ihren Geruch aufzunehmen. Da war nur das Aroma des Kaffees. Um des Gespräches willen fragte er: Kathreiner? Sie lachte. Echter Bohnenkaffee. Und: ob er noch niemals... - Nein, er unterbrach sie, niemals. Sie war ihm so nahe, dass er sie hätte anfassen können. Das gedachte Wort anfassen bewirkte in seinem Munde eine klebrige Empfindung, als sei es eine schmeckbare Substanz.
Der Kaffee schien eine paradoxe Wirkung zu haben. Wilhelm fühlte sich plötzlich taumelig. Er dachte alles Mögliche gleichzeitig und ungenau und hatte das Bedürfnis, diesen Zustand dauern zu lassen. Sitzen bleiben in der Wärme. Neben diesem großen Mädchen. Zeitstillstand. In dieser Wohnküche wurde ihm plötzlich bewusst, dass er alle seine Tage Menschen und Verhältnissen gegenüber unduldsam gewesen war und wachsam vor Übertölpelung und Überfall, dass er Bequemlichkeit bekämpft hatte, ohne sie zu kennen, vorgebend, sie zu verabscheuen, weil sie ihn hindere, sich aus den Bindungen zu lösen, deren Riemen ihn schnitten: Armut und unfreiwillige Abhängigkeit. In dieser Wohnküche erlebte er eine andere Möglichkeit. Eine von wie vielen, die es für ihn gab? Er verspann sich für Augenblicke in die Vorstellung, angekommen zu sein. Sein Ziel war die Küche, das Mädchen in ihr.
Er versuchte den leichten Schwindel in seinem Schädel zu beherrschen, seine Gedanken zu bändigen. Er fragte, wie sie das Kästchen haben wolle, und sie erklärte es ihm mit kleinen Gesten. Er hätte gern ihren Namen gewusst und fragte schließlich danach. Sie sah ihn an, als forsche sie in seiner Miene nach dem Motiv für seine Frage. Sagte dann, sie heiße Anna Elisabeth, Elisabeth werde sie gerufen. - Wie ich heiße, haben Sie ja gelesen. - Nein, das habe sie nicht. Und Wilhelm hoffte, sie frage danach. Sie tat es aber nicht und schien auch nicht zu erwarten, dass er seinen Namen jetzt nannte. Wilhelm, sagte er nun, und der Klang hing im Raum, wie abgesondert. Wilhelm Gussmann, wiederholte er. Sie schwiegen eine Weile.
Da stand er auf, fragte, wann er sie antreffen könne, das Kästchen abzuliefern, und erfuhr, dass er abends kommen müsse. Es war Zufall, dass er sie heute vormittags angetroffen habe. Sie arbeite als Verkäuferin bei Pohlisch in der Herzenstraße.
Nachlassende Kaffeewirkung und zunehmende Hungerschwäche hielten Wilhelm in einem betäubungsähnlichen Zustand, der sich allmählich in Niedergeschlagenheit wandelte. Er hatte von dem Geld, das er sich im Voraus erhofft hatte, ein Frühstück bezahlen wollen. Er musste versuchen, zu weiteren Aufträgen zu kommen. Aber als er, weit genug entfernt vom Hause des Mädchens, vor einer Wohnungstür stand, fühlte er sich außerstande zu klingeln. Mit einem Mal kam ihm das Unternehmen vor wie Bettelei.
An diesem Tage lagen die Asylanten schon zeitig in den Betten. Es war die einfachste Art, sich vor der Kälte zu schützen. Wilhelm zog die Decke bis zum Kinn. Er fühlte sich schläfrig auf angenehme Art. Und gleichzeitig war er voller unruhiger Erwartung. Seltsam, wie dieses Mädchen hatte er sich Lucy gedacht. Ihr Äußeres, ihre Art und Redeweise schienen ihm bekannt und vertraut. Das Helle an ihr, selbst der blasse Mund, der ihm Zartsinn und Innerlichkeit anzeigte, die festen Beine und sogar ihr zuweilen ungeschickter Gang. Und plötzlich dachte er, diese hast du gesucht, nicht die Mutter. Er dachte sich die Körperlichkeit des Mädchens ohne Erregung: Sie wird einmal viel Milch geben, wenn sie ein Kind hat. Und er stellte sich vor, wie sie einen Säugling an ihrer Brust hält und ihm, Wilhelm, mit der anderen Hand Kaffee eingießt. Und es war ihm im Halbschlaf, als fühle er ihre Hände an seinem Kopf.
Von einem Traum gepeinigt, fuhr er auf. Gesichtslose weiße Leiber, sein fortwährender Versuch, sie zu überwältigen. Noch im Erwachen stieß er den Atem. Er lag auf seinem geschwollenen Geschlecht, in dem der peinigende Druck anhielt. Irritiert vom Licht der schirmlosen Glühlampe an der Decke, kam es ihm vor, als beleuchtete sie ausschließlich ihn und seine Lage. Auch wenn er den Kopf drehte, blieben die Glühfäden der Lampe in seinem Gehirn. Da schob sich das nackte Gesäß eines Asylanten wie ein gespaltener Mond in sein Blickfeld.
Wilhelm, bedrängt von der Enge des Bettes, der Öffentlichkeit des Schlafsaales, sprang auf und zerrte Hemd und Decke über das Hinterteil des Entblößten. Warf sich zurück auf sein Lager. Und plötzlich wandelten sich seine Gefühle ins Zynische. Er schlug sich gegen die Stirn, nannte sich selbst blöd, natürlich hatte sie ihn hereingelassen, weil sie etwas wollte von ihm. Er hätte sie hernehmen müssen, gleich im Flur. Und er presste sich auf die Matratze, als wäre sie ein Leib, bis er die Feuchte spürte in seinen Händen.
10. Kapitel
Elisabeth hakte den Beutel von der Türklinke und tastete die Brötchen durch den Stoff. Sie waren noch ofenwarm. In der Küche war Wanda dabei, den von Achim gemahlenen Kaffee aufzubrühen. Elisabeth dachte, dass Mutter und Bruder bei dieser Prozedur die gleichen Bewegungen machten wie gestern sie und der junge Mann. Später, ihr Brötchen aufschneidend, fragte sie sich, warum sie Wanda von diesem Besuch nichts gesagt hatte. Als Wanda, bald nach Wilhelms Weggang, gekommen war, hatte sie von der Wohnungstür her gerufen, wer diesen Dreck hereingebracht habe. Bevor Elisabeth es ihr erklären konnte, war die Mutter schon in der Küche, sog die Luft ein. Hast du Kaffee gemacht? Elisabeth war es unmöglich gewesen, in diesem Augenblick von Wilhelm zu sprechen. Sie fand den Ton nicht, den es brauchte, um den Besuch so zu beschreiben, wie er stattgefunden hatte. So hatte sie Wischlappen und Eimer genommen und die Fußspuren im Flur entfernt, worauf sich Wanda zufrieden gab.
Sie zögerte ihr Frühstück hinaus und wartete, bis Achim - er arbeitete, nach Abschluss der Mittelschule, seit einem Jahr als Schriftsetzer - sich in Mütze und Mantel verabschiedet hatte. Ach, sagte sie schließlich, die Tasse vor dem Mund, ehe ich's vergesse, wir bekommen eine Nähschatulle. Ein junger Mann wird sie bringen. - Und wie kommt er dazu? fragte Wanda. - Er ist arbeitslos. - Du hast ihm doch nicht etwa Geld gegeben? - Nein. Und Elisabeth dachte, sie hätte es tun sollen. Wanda stand vom Tisch auf. Du fällst auch auf jeden Landstreicher herein. - Er ist Dreher. Elisabeth sagte es ruhig. Das war es, warum sie sich hatte überwinden müssen, zu Wanda von dem Besuch zu sprechen: die Mutter setzte alles herab. Elisabeth räumte Geschirr auf das Tablett, dachte, man sieht ihr die Sprödigkeit schon äußerlich an. In allen Bewegungen entschlossen, rasch, ja heftig. Wie sie jetzt die Schuhe anzog und sich sofort wieder übergerade aufrichtete, als fürchtete sie, in gebeugter Haltung verharren zu müssen.
Ein einziges Mal, als Zwölfjährige, hattest du dich gegen Wanda aufgelehnt, überzeugt, ungerecht behandelt worden zu sein. Wanda hatte dein Ansinnen, ein Piano zu kaufen, abgelehnt, ohne auch nur einen Augenblick zu überlegen. Das war an einem Novemberabend. Und wie immer und noch heute brannte in der Hängelampe nur eine 25-Watt-Birne. In den Ecken der Küche lagerten Schatten, und die Züge Wandas waren in dieser Halbhelle konturenlos. Es war nicht zu erkennen, ob sie dein Wunsch geärgert oder gleichgültig gelassen hatte. Du erklärtest nun, du würdest auf alle anderen Dinge verzichten, die du dir zu Weihnachten gewünscht hattest. Als Wanda nicht nachgab, riefst du verzweifelt aus, Geld sei doch da, um genutzt zu werden, und Vater, lebte er noch, würde zustimmen, dass sein Geld dafür gebraucht werde. Wanda fand darauf nichts Besseres, als dir zum hundertsten Male die Geschichte ihres kleinen Vermögens zu erzählen. Zu deiner Belehrung, sagte sie, und dass du verstehst, was dieses Geld für mich bedeutet. Dein Großvater Alwin besaß ein Fuhrunternehmen. Die Geschäfte gingen gut, und er kam zu Geld. Da starb seine Frau. Er muss sie sehr geliebt haben. Vielleicht war er aber wirklich krank. Jedenfalls brachte er sich um, einen Monat nach der Beerdigung. Ihre drei Söhne kamen so in jungen Jahren zu einem guten Stück Geld. Dein Onkel Alfons kaufte sich das Schokoladengeschäft in der Mahlmannstraße. Sein Bruder Erich die Tabak- und Spirituosenhandlung in der Renkestraße. Dein Vater schlug aus der Art. Er gab seinen Anteil in eine Nähmaschinenfabrik und wurde dadurch einer der Verwaltungsbosse. Da brach der Krieg aus, und dein Vater fiel schon im August vierzehn. In dem Geld sehe ich sein Vermächtnis. Ich will es nicht antasten. Jedenfalls nicht um den Preis eines Klaviers. Es soll uns für Notfälle bleiben. In Wahrheit, das wusstest du damals schon, war Wanda von Gegenständen, die sie an Gustav erinnerten, auf seltsame Weise abhängig geworden. Und das Geld Gustavs war für sie ebenso ein Gegenstand wie das Hochzeitsservice, das er ihr geschenkt hatte. Zwei der Teller, die nur an hohen Festen benutzt wurden, waren in den Jahren zerbrochen. Und jedes Mal war Wanda in eine stumme Verzweiflung gefallen, hatte Migräne oder Gallenanfälle behauptet und sich in ihr Schlafzimmer zurückgezogen. Einmal hast du sie dort zufällig liegen sehen: vollständig angekleidet, die Hände über dem Leib gefaltet, die Augen weit geöffnet, wie von Starre befallen, und die Tür behutsam wieder geschlossen. Dir war, als hättest du Wanda gedemütigt, indem du ihre heimliche Trauer beobachtetest.
Schon in jener Zeit, dachte Elisabeth, die Mutter verstohlen betrachtend, trug sie ihr Haar straff an den Kopf gebürstet und zu einem Knoten aufgesteckt. Nur dass es heute von Grau durchzogen ist. Und unter der mürbe werdenden Haut ihres Gesichtes wird das Knöcherne zunehmend deutlich. Sie sollte die Arbeit in der Zigarrenfabrik endlich aufgeben. Als Wanda zusammen mit Elisabeth die Wohnung verließ, sagte sie, du bist erst achtzehn, denke daran. Noch bin ich für dich verantwortlich.
11. Kapitel
Drei Tage darauf hatte Wilhelm in der Werkstatt des Asyls, die ihm der Pförtner, gleichzeitig Hausverwalter, zur Benutzung dafür überließ, dass Wilhelm Reparaturen im Hause kostenlos ausführte, die Schatulle fertig gestellt. Am Spätnachmittag brachte er sie zu Elisabeth.
Als Achim hinausging, um zu öffnen, hielt Elisabeth das Fensterleder unbeweglich, damit das Geräusch des Wassers nicht die Worte übertönte, die an der Tür gewechselt wurden. Es war Wilhelms Stimme. Als er hereinkam, hielt sie ihm die beiden nassen Hände entgegen, sagte: Verzeihung, und ging zum Handtuch, sich abzutrocknen. So erreichte sie, dass Wilhelm Wanda zuerst begrüßte. Wanda legte das Stopfzeug aus der Hand und betrachtete Wilhelm, als suche sie in ihm einen zu erkennen, dessen Steckbrief sie am Anschlag gesehen habe. Wilhelm knotete den Bindfaden auf. Die von Achim angebotene Schere wies er zurück. Den Strick brauche er noch. Solcher Grundsatz gefiel Wanda. Elisabeth war besorgt, ob Wilhelm gefiele. Sie dachte es zu ihrer Rechtfertigung, nicht weil sie ihn mochte. Als Wilhelm das Zeitungspapier abgenommen hatte, zeigte sich auch Wanda überrascht. Ein hübsches Schränkchen. Elisabeth war es recht, dass sich jetzt alles um die Schatulle drehte. Eiche, sagte Achim, Wanda zog ein Kästchen heraus, roch hinein, schubste es zurück. Es glitt leicht. Schließlich, nach dem Preis gefragt, nannte Wilhelm eine Summe, und Achim erwiderte, soviel koste allein das Holz. Elisabeth richtete den Tisch für das Abendbrot, wie es ihr zukam. Sie sagte, einen Teller in der Hand, mit zögernder Bewegung, ob sie für den jungen Mann ein Gedeck auflegen dürfe, es sei heute reichlich. Wanda sagte: Meinetwegen, und Wilhelm bedankte sich. Nach einer Weile erkundigte sich Wanda, wie lange Wilhelm schon nicht arbeite und ob er sich denn nicht kümmere. Elisabeth und wohl auch die anderen merkten, dass Wilhelm sich um höfliche Antwort mühte. Da sagte Elisabeth: Für seine Lage kann er nichts. Wanda widersprach mit Schweigen, und Achim, wohl um das Gespräch ins Heitere zu ziehen, sagte: Vielleicht versuchen Sie es einmal als Tischler? Wilhelm antwortete nun doch recht scharf. Das alles verdanke man den Unternehmern. Und Achim, einen Bissen Brot heftiger kauend, im gleichen Ton, er halte nichts von Bilderstürmerei. Darauf Wilhelm: Keiner wolle etwas zerstören, aber es ginge nicht an, dass von Besitzern abhänge, ob Millionen Arbeit hätten oder nicht. Dann stopfte er große Stücke Brot in den Mund, als wolle er seine Erregung daran ersticken. Der Staat, sagte Achim, habe durchaus die Möglichkeit, die Macht der Reichen zu beschneiden. Das ist ja Kinderglaube, rief Wilhelm. Da mischte sich Wanda ein. Sie liebe solche Reden nicht. Aber Achim, wohl zu erbost über das mit Verachtung gesagte Wort Kinderglaube, gab nicht auf. Übrigens, sagte er, den Teller etwas kippend, um den Rest der Suppe aufzunehmen, Arbeit findet wohl jeder, der sucht. Man dürfe sich eben nicht auf seinen Beruf versteifen. Und Wilhelm: Das könne er für sich halten, wie er wolle, er, Wilhelm, habe einen ordentlichen Beruf. Er schlug mit der Faust neben den Teller, wischte sich einen Tropfen von der Unterlippe. In der Welt wird genug gebraucht, was aus Metall ist. Und leiser: Aber ich sehe schon, wir werden uns nicht einigen können.
Elisabeth wehrte sich, Wilhelms Partei zu nehmen. Er trug seine Worte vor in der Haltung eines Propheten. Den Kopf erhoben, das Gesicht glänzend, die Stirn glatt, das dunkle Haar in Locken, die sich in der Vibration des Redens bewegten. Die Augen, die nach ihrer Erinnerung schmal waren, nun groß, gerundet, sprühend. Aber gerade dieser äußeren Wirkung wollte sich Elisabeth entziehen, so sehr sie Wilhelm zustimmte. Auch sie wollte die Welt gerecht.
Dagegen redete Achim mit beinahe geschlossenem Mund, alle Zisch- und Lippenlaute betonend, seine Stimme ging gleichmäßig, nur in der Erregung um weniges unschärfer, als wolle er die Worte mit den Zähnen zurückhalten. Die Stirn kraus und mit gespannten Brauen, sah er Wilhelm gelegentlich von unten an, als kämpfe er mit einem Ekelgefühl.
Da stand Wanda auf, das Geld für Wilhelm zu holen. Sie gab es ihm in einem Kuvert. Er bedankte sich und ging, von keinem gehalten.
Das ist ein Radikaler, sagte Achim. Na, wir sehen ihn ja nicht wieder. Oder will er dir noch was bauen? Elisabeth antwortete ihm nicht. Sie nahm die Schatulle und trug sie in ihr Schlafzimmer, das sie mit Wanda teilte. Sie strich über das Holz. Es gefiel ihr.
12. Kapitel
Auch in diesem Monat hatte Elisabeth wieder den größten Verkaufserfolg gehabt. Die Direktrice gab das Ergebnis vor den Kolleginnen bekannt und übermittelte ihr die Glückwünsche des Chefs der Firma Pohlisch. In diesem Augenblick brachte Elisabeth dem Inhaber gute Gefühle entgegen. Die Welt war doch gerecht. Man musste sich eben rühren, darin musste sie Wanda zustimmen, und jener Wilhelm hatte doch wohl nicht in allem Recht. Und sie ahnte, dass Parteinahme zusammenhing mit Nutzen und Schaden, den man von einer Sache hatte.
Als sie an diesem Glückstag, bald nach der Rede der Direktrice, das Pohlische Haus verließ, sah sie Wilhelm auf der anderen Straßenseite. Als er heran war, fragte sie, wie er sie gefunden habe, und erfuhr verblüfft, sie selbst habe ihm Namen und Anschrift der Firma mitgeteilt. Er begleitete sie bis zur Haltestelle ihrer Bahn. Fragte, wie sie das Kästchen gebrauche, und erkundigte sich nach Achim und Wanda. Seinen Ton fand sie sachlich, und sie war wider Willen enttäuscht. Die ganze Zeit hielt er die Hände in den Taschen. Als die Bahn kam, stieg er mit ein. Elisabeths Frage, ob er in dieser Gegend wohne, verneinte er. In den engen Kurven, die die Bahn befuhr, wurden sie gegeneinander gepresst, so dass Elisabeth die knöcherne Magerkeit seines Körpers spürte. Er stieg mit ihr aus, obwohl sie ihm gesagt hatte, sie bekäme Ärger mit Wanda. Er wollte sie wieder sehen. Sie behauptete, darüber nachdenken zu müssen, und ließ offen, ob sie das Treffen meinte oder den Zeitpunkt. Sie brauchen sich nicht umzusehen, sagte er plötzlich. Sie war verwundert. Ich sehe mich um? - Ja, andauernd, als glaubten Sie sich verfolgt. Da sagte sie: Gut, übermorgen.
Elisabeth hielt sich für eine romantische Natur. Liebe dachte sie sich rauschhaft, Grenzen sprengend. Der Geliebte war in all ihren Vorstellungen von fließender, nicht fasslicher Gestalt, ohne erkennbare Züge. In kein soziales Gefüge eingeordnet, besaß er die Eigenschaften, die Elisabeth auf Grund ihrer Erziehung männlich nannte. All das galt nicht von Wilhelm. Seine magere Gestalt. Wie er sich hielt, ein wenig gebeugt, die Hände in den Taschen, als friere er. Da war nichts rauschhaft. Wie er der Kälte trotzte, schien er auch die Welt herauszufordern. Womöglich auch sie. Reizte sie das etwa? Oder wollte sie ihn vor Schaden bewahren? Vielleicht war es das: Menschenpflicht, Nächstenliebe. Nichts weiter. Man sah doch, wie schwer der es hatte.
Der Tag ihres vereinbarten Treffens kam, und Elisabeth hatte schon seit der Mittagspause Mühe, sich auf die Käuferwünsche zu konzentrieren.
Wilhelm stand an der gleichen Stelle in derselben Haltung wie das letzte Mal. Sie blickte auf seine Hände und verlachte sich innerlich. Hatte sie wirklich erwartet, er werde Blumen dafür mitbringen, dass er sie ein paar Straßen weit begleiten durfte? Sie nahm den kürzesten Weg nach Hause. Wilhelm hielt sich neben ihr in immer gleichem Abstand. Über lange Zeit schwiegen sie. Seine im Disput mit dem Bruder erwiesene Redefähigkeit schien abgestorben. Elisabeth fragte ihn nach Wohnung und Herkunft, seine Aussprache klinge fremd. Wilhelm antwortete einsilbig. Er sei zugereist, stamme aus K. Er nannte die Straße, wo er wohnte, ohne das Asyl zu erwähnen. Redete schließlich von Bertha und Erich und ließ es zu, dass Elisabeth sie für seine Eltern nahm. Seine Mutter verschwieg er.
Im schwindenden Abend wurden alle Lampen und Lichter, die Reklameschriften und Schaufensterbeleuchtungen zunehmend heller, strahlender. Es herrschte starker Verkehr. Vollbesetzte Bahnen, Autos, Fuhrwerke hielten die Straßen besetzt, die von Fußgängerströmen auf den Bürgersteigen flankiert wurden. Elisabeth war erregt. Die kalte Luft war ihr wie ein Medium, das sie mit allem und allen verband. Schatten wuchsen hoch an den Fassaden und stürzten zurück über Menschen und Fahrzeuge. Sie ahnte das Abenteuer in der Menge. Dachte, dass es sie ergreifen würde, winkte sie nur heimlich mit dem Finger. Stattdessen war dieser dürftig-bedürftige Mann neben ihr, dessen Rede stockend ging. Und sein Schweigen war Hilflosigkeit, nicht die süße Stille des Einverständnisses. Da packt er sie. Inmitten der Menschen, die sie anstoßen, umgehen. Er hält ihren Kopf mit beiden Händen und sucht ihren Mund mit geschürzten Lippen zu erreichen. Sie wehrt sich wütend, ist verblüfft über seine unerwartete Kraft. Sie stößt ihn mit Fäusten gegen die Brust, presst ihren Mund schmal und denkt, seine Lippen sind quallig. Da lässt er sie los. Elisabeth verlangt, dass er sich wegschere, sie wolle ihn nie wieder sehen. Er bleibt neben ihr, sagt, sie gefalle ihm, vom ersten Augenblick an. Elisabeth schweigt. Sie fühlt sich missachtet. Er zwingt ihr seinen Willen auf und bemerkt es nicht einmal, geht weiter neben ihr her, als hätte sein plumper Überfall nicht alles verändert. Da entschuldigt er sich. Kann plötzlich geläufig reden. Findet, was geschehen war, natürlich, nachgerade vorhersehbar. Auch ihre Reaktion. Sein Versuch, sich zu erklären, sei vielleicht etwas stürmisch gewesen, ungeschickt auch, aber immerhin aufrichtig, direkt, ohne Umschweife oder Vortäuschung. Jedenfalls verzeihlich, obwohl nicht zu billigen. Das sehe er jetzt. Elisabeth antwortet nicht.
Sie gingen jetzt in der Zolikofer Straße. Hier war es ruhiger, aber dafür verlängerte sich der Heimweg. Da sagte Wilhelm, die Schultern nach vorn krümmend, als dehne er sich: Ich muss Ihnen noch etwas sagen. Er wartete, sah sie aus den Augenwinkeln an. Ich bin unehelich geboren. Bertha und Erich sind meine Zieheltern. Er machte wieder eine Pause. Ja? sagte Elisabeth. Meine Mutter lebt in dieser Stadt, verheiratet. Und Wilhelm erzählte, wie er K. verlassen hatte, um Lucy zu finden, und wie es ihm dabei ergangen war. Und nun wohne ich im Heim für Obdachlose. Er hob laut atmend beide Schultern. Danach sah er die schweigende Elisabeth erwartungsvoll an. Sie sind betroffen, nicht wahr? - Wieso? - Weil Sie nichts sagen. - Was soll ich sagen? Zieheltern oder richtige, die Hauptsache, Sie hatten gute. Wilhelm war verblüfft, er hatte gedacht, sie mit seiner Geschichte ein wenig zu rühren.
Nein, gerührt war Elisabeth nicht. Sie fand nun die etwas undurchsichtige Lebensweise Wilhelms erklärt und das, was er tat, zielstrebig und vernünftig. Und als Wilhelm sie für den kommenden Donnerstag zu einem Kinobesuch einlud, stimmte sie rasch zu, als wolle sie das Unrecht, in das sie ihn durch vorschnelles Urteil gesetzt hatte, wieder gutmachen.
Erst nach dem Abendessen, bei einer Häkelarbeit, merkte Elisabeth, dass die Stiefkindgeschichte ihre Wirkung tat. In seiner dürftigen Kleidung sah sie Wilhelm nun als Verstoßenen. Den Aufbruch aus K. in dieser unwirtlichen Jahreszeit nannte sie entschlossen und seine Muttersehnsucht rührend, und herzlos, wie diese Frau ihn abgewiesen hatte, den Obdachlosen.
Elisabeth spürte, wie ihre Lider schwer wurden und die Augen brannten. Sie wusste, dass sie sich nun gerötet hatten. Das geschah ihr häufig, wenn sie bewegt war, und hatte mit Weinen nichts zu tun. Sie behauptete Kopfschmerzen zu haben und ging ins Schlafzimmer, kramte aus dem Nachtkasten das Fläschchen mit Eau de Cologne und rieb sich ein paar Tropfen auf die Stirn. Nun konnte sie, wenn Wanda nach der Augenrötung fragen sollte, angeben, es komme vom Kölnischen Wasser.
13. Kapitel
An jenem Donnerstag war Wilhelm viel zu früh da. Eine Weile betrachtete er die Filmbilder aus der Dirnentragödie mit Asta Nielsen hinter den Glasrahmen im tunnelartigen Eingang der Gloria-Lichtspiele. Ging dann zurück in die frischkalte Luft der Straße, um auf Elisabeth zu warten.