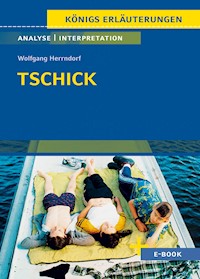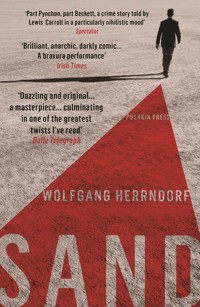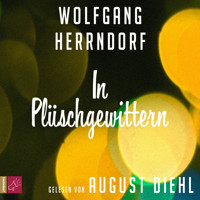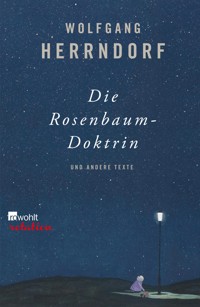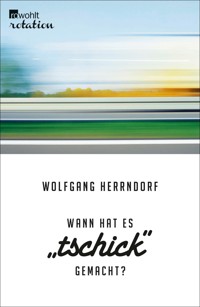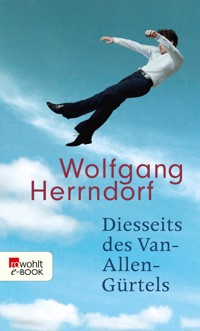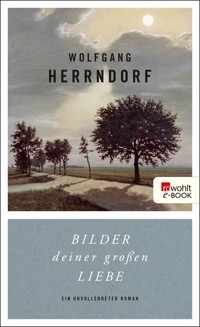
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Mädchen steht im Hof einer Anstalt. Das Tor geht auf, das Mädchen huscht hinaus und beginnt seine Reise, durch Wälder, Felder, Dörfer und an der Autobahn entlang: «Die Sterne wandern, und ich wandre auch.» Isa heißt sie, und Isa wird den Menschen begegnen – freundlichen wie rätselhaften, schlechten wie traurigen. Einem Binnenschiffer, der vielleicht ein Bankräuber ist, einem merkwürdigen Schriftsteller, einem toten Förster, einem Fernfahrer auf Abwegen. Und auf einer Müllhalde trifft sie zwei Vierzehnjährige, einer davon, der schüchterne Blonde, gefällt ihr. An dem Roman über die verlorene, verrückte, hinreißende Isa hat Wolfgang Herrndorf bis zuletzt gearbeitet, er hat ihn selbst noch zur Veröffentlichung bestimmt. Eine romantische Wanderschaft durch Tage und Nächte; unvollendet und doch ein unvergessliches Leseerlebnis. «Ich halte das Tagebuch wie einen Kompass vor mich hin. Pappelsamen schneien um mich herum, und der süße Duft der Lichtnelken strömt durch die Nächte. Ich sehe einen Wald, aus dem vier hohe Masten aufragen über die Baumwipfel. Am Waldrand steht eine kleine Hütte, die Teil eines Wanderwegs ist, wie drei eingekastelte Zeichen verraten. Ein schwarzer Gedankenstrich, eine gelbe Schlange, ein rotes Dreieck. Mein Name.»
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 139
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Wolfgang Herrndorf
Bilder deiner großen Liebe
Ein unvollendeter Roman
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Ein Mädchen steht im Hof einer Anstalt. Das Tor geht auf, das Mädchen huscht hinaus und beginnt seine Reise, durch Wälder, Felder, Dörfer und an der Autobahn entlang: «Die Sterne wandern, und ich wandre auch.» Isa heißt sie, und Isa wird den Menschen begegnen – freundlichen wie rätselhaften, schlechten wie traurigen. Einem Binnenschiffer, der vielleicht ein Bankräuber ist, einem merkwürdigen Schriftsteller, einem toten Förster, einem Fernfahrer auf Abwegen. Und auf einer Müllhalde trifft sie zwei Vierzehnjährige, einer davon, der schüchterne Blonde, gefällt ihr.
An dem Roman über die verlorene, verrückte, hinreißende Isa hat Wolfgang Herrndorf bis zuletzt gearbeitet, er hat ihn selbst noch zur Veröffentlichung bestimmt. Eine romantische Wanderschaft durch Tage und Nächte; unvollendet und doch ein unvergessliches Leseerlebnis. «Ich halte das Tagebuch wie einen Kompass vor mich hin. Pappelsamen schneien um mich herum, und der süße Duft der Lichtnelken strömt durch die Nächte. Ich sehe einen Wald, aus dem vier hohe Masten aufragen über die Baumwipfel. Am Waldrand steht eine kleine Hütte, die Teil eines Wanderwegs ist, wie drei eingekastelte Zeichen verraten. Ein schwarzer Gedankenstrich, eine gelbe Schlange, ein rotes Dreieck. Mein Name.»
Über Wolfgang Herrndorf
Wolfgang Herrndorf, 1965 in Hamburg geboren und 2013 in Berlin gestorben, hat ursprünglich Malerei studiert. 2002 erschien sein Debütroman «In Plüschgewittern», 2007 «Diesseits des Van-Allen-Gürtels», 2010 und 2011 folgten die Romane «Tschick» und «Sand», 2013 das posthum herausgegebene Tagebuch «Arbeit und Struktur».
Inhaltsübersicht
1.
Verrückt sein heißt ja auch nur, dass man verrückt ist, und nicht bescheuert.
Weil das viele Leute denken, dass die superkomplett bescheuert sind, die Verrückten, nur weil sie komisch rumlaufen und schreien und auf den Gehweg kacken und was nicht alles. Und das ist ja auch so. Aber so fühlt es sich nicht an, jedenfalls nicht von innen, jedenfalls nicht immer.
Es macht einem nur wahnsinnig Angst, wenn man merkt, dass man gerade auf den Gehweg kackt und weiß, dass das nicht üblich ist und dass so was nur Leute machen, die verrückt sind, und diese Angst macht, dass es einem auch wieder ganz gleichgültig ist, was die anderen denken, ob die jetzt gucken oder nicht, weil man in dem Moment wirklich andere Probleme hat. Und mein Problem war eben, dass ich langsam wieder verrückt wurde.
Es war nicht das erste Mal, deshalb wusste ich schon, wie das läuft und dass das in Schüben kommt. Für wer sich das nicht vorstellen kann: wie Hunger oder Durst, oder wenn man ficken will. Das kommt ja auch in Schüben. Und nicht immer, wenn’s einem passt. Und da stehe ich jetzt im Garten, vier hohe Ziegelsteinmauern um mich rum. Eltern sind weg, Ärzte und Pfleger auch gerade weg, und vor mir ein riesiges Tor aus riesigem Eisen.
Die Blumen blühen. Die Blumen, die der Depri mir gezeigt hat mit seiner Depribegeisterung, was schlimm ist. Alle Depris versuchen immer sofort, dich in ihre Deprischeiße reinzuziehen. Aber die Blumen sind okay und können nichts dafür, wer sie gut findet. Sie haben sich das nicht ausgesucht. Wenn sie es sich aussuchen könnten, würden sie vielleicht mich aussuchen. Und darüber denke ich seit zwei Stunden nach. Und am Himmel die Sonne, mein schöner Freund.
Ich hebe also den Arm und zeige mit der Hand nach oben, sodass mein rechter Daumennagel genau den Rand der Sonne berührt, damit sie nicht mehr weiterwandert. Und da wandert die Sonne nicht mehr weiter, und die Zeit steht still. Das ist leicht. Und auch das ist leicht: Mit sanftem Druck des Fingernagels schiebe ich die Sonne Millimeter für Millimeter zurück, und da weiß ich: Am Anfang war die Kraft. Isabel, Herrscherin über das Universum, die Planeten und alles. Wenn ich will, dass die Sonne steht, steht die Sonne. Wenn ich will, dass das Eisentor aufgeht, dann geht das Eisentor auf. Und im selben Moment geht es auf.
Ein Lkw fährt durch, und ich hinter dem Lkw vorbeigehuscht und raus.
So schnell kann keiner gucken. Aber es guckt eh keiner. Draußen ist dann auch alles gleich viel besser. Es ist nicht finster, sondern alles wie immer. Und wie ich das sehe, dass alles wie immer ist, bin ich selbst gleich wieder wie immer. Nur dass ich keine Schuhe anhab. Als mir das auffällt, ziehe ich auch die Socken aus. Ich brauche keine Socken, wenn ich keine Schuhe hab. Oranger Mülleimer und weiter.
Was ich dann noch anhab, ist die Hose mit Camouflage-Muster und das weiße T-Shirt. In der Hose vorne links die zwei Tabletten, die ich unter der Zunge rausgenommen hab, hinten links mein Tagebuch und vorne rechts ist auch noch was. Das weiß ich, ohne nachzugucken. Aber ich weiß nicht, was, und ich gucke auch nicht nach.
Eine Weile lang macht mir das das Gehen schwer. Um ehrlich zu sein, ich kann nicht atmen. Wie ein riesiges 16-Tonnen-Gewicht hängt das an meiner Hüfte. Aber dann sage ich mir, dass ich ja auch nicht nachgucken muss. Dass das ja meine Entscheidung ist, ob ich die rechte Hand in die rechte Tasche stecke oder nicht. Und da wird es sofort viel besser, und während ich noch die Böschung raufrenne und über die zwei Leitplanken hinweg, freue ich mich schon wieder. Nämlich, was für ein großer Spaß das wäre, wenn ich nachgucken würde, und dass ich mich groß selbst überraschen könnte, wenn ich wollte. Aber erst mal will ich nicht.
2.
Als ich die Hand raushalte, bremst in derselben Sekunde ein Auto. Vorn auf der Windschutzscheibe ist ein gelber Aufkleber mit einer lachenden roten Sonne drauf. Ich zeige mit dem Daumen auf den Aufkleber und sage: «Ich habe die Sonne angehalten», und die Fahrerin nickt und lacht und hält mir sofort einen Vortrag über den Unterschied von Kernfusion und Kernspaltung, über die Gefahren der Stromerzeugung, über Kohlekraftwerke und Tschernobyl, über Ehen in Harrisburg, Mesmerismus und Jakob von Gunten, und da schlafe ich ein.
Ich erwache von dem schweren Gewicht an meiner Hüfte und davon, dass die Frau ihre Hand zwischen meinen Beinen hat.
«Das müssen Sie nicht», sage ich. Sie macht es trotzdem, und ich habe den Eindruck, das ist gar keine Frau. Sie hat einen vollkommen asymmetrischen Haarschnitt und ein Gesicht, das man nicht beschreiben kann, weil es kein Merkmal besitzt. Und da steige ich aus und gehe in den Wald.
Ich nehme eine Tablette, um zu testen, was die macht, aber die macht nichts, und dann laufe ich bis tief in die Nacht und noch weiter und bis zum ersten Lichtschein und weiter. Ich schlafe bei Tag und gehe bei Nacht. Ich sehe die Sterne. Im Wald sind keine Sterne, über den Feldern sind Sterne und Kometen. Wald, Feld, Wiesen und Wege.
Ich steige über elektrische Zäune und Stacheldrahtzäune oder krieche unter ihnen hindurch. Ich verdrille die Drähte oben und unten und steige durch die Raute. Ich gehe immer genau geradeaus. Wenn drei Meter neben mir ein Gatter ist, gehe ich da hindurch. Wenn es dreißig Meter entfernt ist, steige ich über den Zaun. Ich halte inne und sehe in einer Pfütze die Sterne sich spiegeln. Sie tanzen und zittern und kommen zur Ruhe. Regulus steht im Westen, später steht Arktur im Westen, dann Gemma, M13 und Wega. Ich gehe zwischen den stummen Schatten der Kühe und Pferde hindurch, im Kreis der Gespenster, im Heer der Namenlosen. Ich fühle scharfen Kies unter den Sohlen. Ich sehe keinen Mond. Wenn ich Lichter sehe, laufe ich einen großen Halbkreis. Die meisten Dörfer sind dunkel.
Ich weiß nicht, warum ich keine Schuhe anhabe. Die ersten Schuhe, an die ich mich erinnern kann, waren Schuhgröße 29. Seitdem sind Jahre vergangen. Ich laufe barfuß durch den Nebel, trete in Pfützen und trinke das brackige Wasser. Schwankend erreiche ich am zweiten Morgen den goldenen Berg. Ich nenne ihn so, weil er rund ist und von einer Haube aus Weizen bedeckt. Von oben sehe ich über das Land und bin müde. In meinem Innern wüten eiserne Zangen. Ich versuche zu schlafen und kann es nicht. Ich versuche weiterzugehen und kann es nicht. Ich konzentriere mich auf die Sachlage und komme zu dem Ergebnis, dass ich Hunger habe.
Ich nehme einen Stein und einen Stock und stolpere in das Dorf, das hinter einem Wald war und jetzt vor mir liegt. Es gibt zwei kleine Geschäfte. Beim größeren schmeiße ich den Stein durch die Scheibe und schlage mit dem Stock die Splitter aus dem Rahmen. Trotzdem schneide ich mir beim Reinklettern die Fußsohlen auf. An der Kasse greife ich eine große Tüte mit Henkeln und packe blind alles hinein. Die Tüte reißt, und ich stecke sie in eine größere Tüte. Die größere Tüte reißt auch, und ich stelle sie in einen Henkelkorb aus Plastik. Ich stoße das Regal mit den Schokoriegeln um.
Auf der Straße kann ich vor Schmerz kaum laufen. In zwei Fenstern ist Licht angegangen. Ich sehe einen Schatten, der das Licht löscht, um besser sehen zu können. Wie ein Buckliger renne ich mit dem Korb in die Felder und zurück zum goldenen Berg. Nach einer Weile spüre ich keinen Schmerz mehr, weil meine Lippen blutig gebissen sind. Ich wälze mich im Korn, um ein Bett zu machen. Mir ist übel. Ich schütte den Korb aus, reiße eine Packung Choco Leibniz auf und trinke einen halben Liter Selter. Nach einer Weile verschwindet die Übelkeit, und ich schlafe ein.
3.
Das mit dem Fenster tut mir übrigens leid. Ich denke, wenn ich reich und berühmt bin, werde ich zurückkommen und den Schaden ersetzen. Vielleicht werde ich sogar für alle ein Fest veranstalten. Ich sehe den Himmel, ich warte auf den Adler. Mein größter Wunsch ist es, später beim Fernsehen zu arbeiten. Eine Cousine von mir ist da, sie macht eine Quizsendung. Die Leute erkennen sie auf der Straße.
Am Morgen weckt mich ein Traum. Die rote Sonne scheint durch ein Gitter aus Halmen, auf meiner Schulter sitzt ein Weberknecht. Ich denke darüber nach, worüber er nachdenkt. Ob er die Sonne zwischen Halmen so sieht wie ich. Ob er spürt, dass ich ein Lebewesen bin. Dass er auf einem Lebewesen steht, das hundert Mal mächtiger ist als er. Ob seine Synapsen ihm mitteilen, dass er Angst haben sollte. Ob er überhaupt Synapsen hat. Ich weiß es nicht, und er schwankt davon wie einer, der so eine Ahnung hat.
Ich schließe die Augen. Ich schlafe weiter.
4.
Ich habe schon immer im Freien übernachtet. Einmal brachte mein Vater ein Zelt mit nach Hause. Es war nicht mein Geburtstag, es war auch nicht Weihnachten. Es war einfach so. Ein billiges Zelt von Aldi, der Stoff gelb und lila, ich habe mit meinem Vater das Zelt im Garten aufgebaut, und dann haben wir darin übernachtet. Das war schön.
Meine Mutter meinte, wir wären verrückt geworden. Denn es war Frühling und noch kalt in den Nächten. Aber mir war nicht kalt. Ich bin in den Schlafsack meines Vaters gekrochen, und da war es warm, und ich war geborgen. Er hat gesagt, dass ich niemals Angst haben muss im Leben, und dann kam meine Mutter und hat uns zwei Schälchen mit Nüssen hingestellt, hyvää yötä, kauniita unia, und wir haben die Nüsse gegessen, das war das Größte, und wir haben den Reißverschluss hochgezogen und den Mückenschutz geschlossen, dann wurde es dunkel. Mein Vater hat seinen Arm um mich gelegt, und ich habe meinen Arm um seinen mächtigen Brustkorb gelegt, das war vor fünf oder sechs Jahren.
Danach habe ich fast jede Nacht draußen geschlafen. Das durfte ich natürlich nicht, aber ich hatte einen Trick. Jeden Abend vor dem Schlafengehen habe ich den Fensterhebel hochgedreht und den Rahmen ein paar Zentimeter angedrückt, sodass ich in der Nacht lautlos hinauskonnte, und dann bin ich ins Zelt geschlichen, fast den ganzen Sommer lang. Und auch, als das Zelt abgebaut wurde, dann einfach mit dem Schlafsack unter die Büsche. Und da habe ich unter den Büschen geschlafen und geträumt, dass ich unter den Büschen schlafe und träume, und morgens, beim ersten Licht und Tau, bin ich schnell zurück durch das Fenster gestiegen und heimlich in meinem Bett erwacht. Das habe ich mir nicht eingebildet. Dafür gibt es auch Beweise. Und seitdem gibt es zwei Welten, die dunkle und die andere. Das ist jedenfalls meine Meinung, und ich muss wohl nicht dazusagen, dass die Ärzte anderer Meinung sind.
5.
Ich liege auf dem Rücken. Aus dem Tal dringen Geräusche zu mir herauf. Eine Motorsäge, eine lachende Frau, eine Amsel, ein Auto, Schulkinder. Eine Bustür atmet aus. Und wieder die Amsel, nun näher bei mir.
Ich sehe den Wolken hinterher und untersuche meine Fußsohlen. Die Schnitte sind nicht so tief, wie ich gedacht hatte, aber sie tun noch weh und haben stark geblutet. Weil ich das Mineralwasser ausgetrunken habe, wasche ich Blut und Dreck mit Fanta von den Füßen und beschließe, den Tag hier liegen zu bleiben bis zur Nacht. Ich habe noch mehr Choco Leibniz und Marmelade und Nutella und Knäckebrot und Snickers und Erdnussflips. Ich werde ganz klar im Kopf, morgenlichtklar. Universum hier, Isa hier, alles, wo es hingehört. Ich denke nicht nach. Ich schlafe.
Am Nachmittag kommt ein Mähdrescher und zieht seine Bahnen, von einer gelben Staubwolke umhüllt. Aber nicht auf meinem Feld, auf einem anderen. Als das Motorengeräusch verschwunden ist, stehe ich auf und falle um vor Schmerzen. Nach zehn Minuten stehe ich wieder auf.
Die nächsten Tage passiert nicht viel. Ambosswolken türmen sich auf und verschwinden ohne Laut. Die Sterne wandern, und ich wandre auch.
Eine Weile noch bluten meine Füße. Dann bluten sie nicht mehr so stark. Wenn ich müde bin, baue ich eine Matratze aus Gras und lege mich ins Gras, und da bin ich dann.
6.
Als sich der Morgennebel in meinem Kopf und über den Wiesen aufgelöst hat, stehe ich vor einem Fluss. Der Fluss scheint kaum breiter als ein Steinwurf. Ich werfe einen großen Stein mit aller Kraft, und er fällt ins Wasser. Ich nehme einen besseren Stein, und er fällt auf Land. Ich kann nicht erkennen, wie tief der Fluss ist. Weder links noch rechts ist eine Brücke zu sehen. In weiter Ferne führt der Fluss in einen Wald. Aber ich will nicht zu weit abgehen von meinem Weg. Das Wasser ist nicht kalt, aber auch nicht warm.
Ich ziehe mich aus. Ich lege das T-Shirt auf die ausgebreitete Hose und die Unterhose auf das T-Shirt und rolle alles fest zusammen.
Nach einem Schritt steht mir das Wasser bis zur Wade, nach zwei am Knie, nach drei am Oberschenkel. Schwarze Schlammschlieren treiben hoch. Der Fluss rauscht und gurgelt. Ich halte das Kleiderbündel hoch und betrachte es lange. Dann betrachte ich das andere Ufer und wate zurück. Ich probiere es noch an zwei anderen Stellen, vergeblich.
Ich entrolle das Kleiderbündel wieder, nehme das Tagebuch aus der Tasche und lese den letzten Eintrag. Wenn ich eine Schnur hätte, könnte ich es mir auf den Kopf binden und schwimmen. Aber ich habe keine Schnur. Im Gras liegt ein Stück Plastikfolie, aber es reicht nicht, um das Papier vor dem Wasser zu schützen.
Ich ziehe die Sachen wieder an, halte meinen rechten Arm mit dem Tagebuch senkrecht hoch und gehe Schritt für Schritt in den Fluss. Als mir einfällt, dass in meiner rechten Hosentasche auch noch irgendwas war, wovon ich nicht mehr weiß, was es war, ist es schon zu spät. Im Schatten der Sträucher und Gräser blinken die Fische. Das Wasser umspült meine Taille. An der tiefsten Stelle reicht es mir bis zur Brust. Unter meinen Fußsohlen spüre ich große, runde, glitschige Steine. Ich bleibe einige Sekunden stehen. Dann wird es langsam wieder flacher. Auf der anderen Seite lege ich das Tagebuch ins Gras. Ich ziehe die nassen Kleider aus und lege sie zum Trocknen in die Sonne. Daneben lege ich mich zum Trocknen. Ich drehe mich auf den Rücken und schreibe.