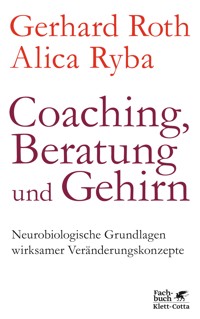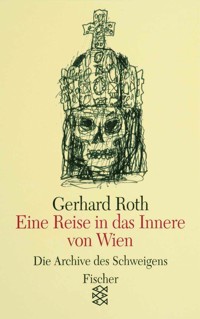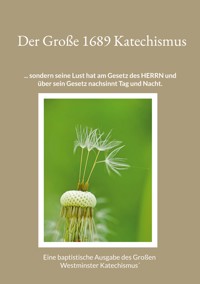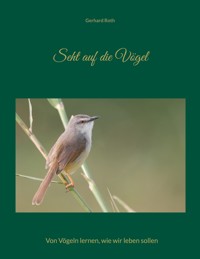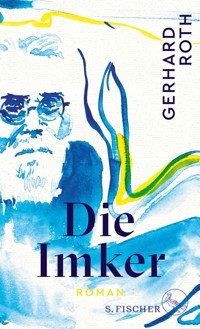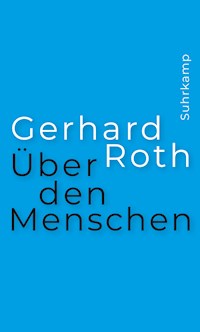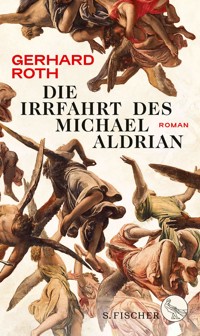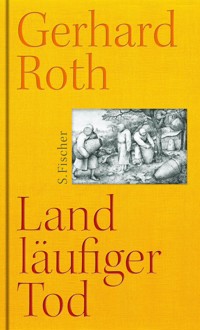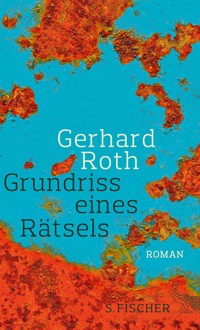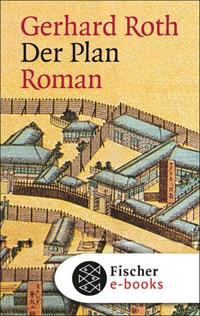19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Besser lernen und lehren ist möglich – auch mit digitalen Medien »Gerhard Roth – der wichtigste lebende deutschsprachige Naturwissenschaftler« Cicero »Roth öffnet das Feld des Lernens also ganz weit. Nach der Lektüre des Buches möchte man eine Revolution des Selbstverständlichen ausrufen.« Reinhard Kahl, Zeit Literatur »Erfrischend praxisnah!« Birgitta vom Lehn, Frankfurter Rundschau Der Bestsellerautor Gerhard Roth beantwortet die wichtigsten Fragen zu den Themen Bildung, Persönlichkeit und Lernen. Die Neuauflage liefert neben der Aktualisierung der wissenschaftlichen Grundlagen einen noch stärkeren Praxisbezug. Neu sind die Themen: - Digitalisierung und Schule einschließlich des Fernunterrichts per Video - Die Grundzüge eines Lehrercoaching mit Schwerpunkt auf Unterrichtsgestaltung und Gesprächen mit Lernenden und Eltern - Die unterrichtsrelevante Beurteilung der Lernfähigkeit und -motivation der Lernenden
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 535
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Gerhard Roth
Bildung braucht Persönlichkeit
Wie Lernen gelingt
Vollständig überarbeitete Auflage
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe
Vollständig überarbeitete und erweiterte Neuauflage 2021
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2011/2021 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Ulf Müller, Wuppertal
Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg
Gesetzt von Dörlemann Satz, Lemförde
Gedruckt und gebunden von CPI – Clausen & Bosse, Leck
ISBN 978-3-608-98072-1
E-Book ISBN 978-3-608-11710-3
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
Inhalt
Vorwort zur Neuausgabe 2021
Vorwort zur Neuausgabe 2015
Vorwort zur ersten Auflage
Einleitung
Besser Lehren und Lernen – aber wie?
Kapitel 1
Was soll Bildung, was kann Schule?
Kapitel 2
Persönlichkeit
Persönlichkeit aus Sicht der Psychologie
Die neurobiologischen Grundlagen der Persönlichkeit
Die Hauptfaktoren der Persönlichkeitsentwicklung
Das neurobiologische Vier-Ebenen-Modell der Persönlichkeit
Neuromodulatoren und Persönlichkeit
Die sechs psychoneuralen Grundsysteme
Stressverarbeitung
Selbstberuhigung
Selbstbewertung und Motivation
Impulskontrolle
Bindung und Empathie
Realitätssinn und Risikowahrnehmung
Ein neurobiologisch inspiriertes Modell der Persönlichkeit
Der Dynamiker und seine Varianten
Der Stabile und seine Varianten
Die Entwicklung der Persönlichkeit und des Ich
Die Bedeutung frühkindlicher Einflüsse und der Bindungserfahrung
Was sagt uns das?
Kapitel 3
Emotionen und Motivation
Was sind Emotionen und welche gibt es?
Emotion und Bewusstsein
Die neurobiologischen Grundlagen von Emotionen
Was sind Motive, und wie entstehen sie?
Welche Motive gibt es?
Kongruenz und Inkongruenz von Motiven und Zielen
Was sagt uns das?
Kapitel 4
Lernen
Arten des Lernens
Habituation und Sensitivierung
Klassische Konditionierung und Kontextkonditionierung
Operante Konditionierung
Weitere Lernformen
Schulisches Lernen
Kapitel 5
Gedächtnis und Erinnerung
Formen des Gedächtnisses
Wissenschaftliche Grundlagen dieser Unterteilungen
Der Patient H. M. und die Gedächtnisforschung
Das Arbeitsgedächtnis und seine Eigenschaften
Die Begrenztheit des vorderen Arbeitsgedächtnisses
Das Zwischengedächtnis
Das »Navigationssystem« des medialen temporalen Lappens
Die Engrammbildung durch frühe und späte Langzeitpotenzierung
Was genau machen Hippocampus und entorhinaler Cortex?
Erste und zweite Konsolidierungsphase deklarativer Inhalte
Das corticale Langzeitgedächtnis
Vergessen
Das Gedächtnis als »magische Kommode«
Supergedächtnis
Gedächtnis und alterndes Gehirn
Das emotionale Gedächtnis
Was sagt uns das alles?
Kapitel 6
Intelligenz
Was ist Intelligenz, und wie misst man sie?
Intelligenz: angeboren oder erworben?
Kritische Diskussion der Intelligenz-Vererbungsforschung
Die Bedeutung des sozioökonomischen Status
Geschlecht und Intelligenz
Hochbegabung
Lässt sich Intelligenz trainieren?
Neurobiologische Grundlagen von Begabung und Intelligenz
Die Hypothese der »neuronalen Effizienz«
Kapitel 7
Lernen, Emotionen und Vertrauensbildung
Emotionen und Gedächtnisleistungen
Neurobiologische Grundlagen des Zusammenhangs von Emotion und Gedächtnisleistungen
Lehren und Lernen als kommunikativer Akt
Was bedeutet dies für die Schule und das Lernen?
Kapitel 8
Faktoren für den schulischen, akademischen und beruflichen Erfolg
Intelligenz und Lernerfolg
Schichtenzugehörigkeit
Wie sehen »Sieger« aus?
Was bedeutet dies für die Schule und das Lernen?
Kapitel 9
Sprache
Das sprachbegabte Gehirn
Die »Sprachzentren« und ihre Verbindungen
Sprechen
Sprachmotorik
Sprechen und Denken
Sprache hören und verstehen
Lesen
Lesenlernen
Bilingualität
Kapitel 10
Bedeutung und Verstehen
Verstehen und Erklären
Wissensvermittlung als Informationsübertragung
Die Kontextabhängigkeit von Bedeutung
Die individuelle Konstruktion von Bedeutung
Das Erkennen der »Kuh« als Modell des Verstehens
Wie ist Verstehen zwischen autonomen Systemen möglich?
Was bedeutet das für die Schule?
Kapitel 11
Zeitgenössische didaktische Konzepte
Bildungstheoretische und kritisch-konstruktive Didaktik
Lerntheoretische Didaktik
Kommunikative und subjektive Didaktik
Konstruktivismus und konstruktivistische Didaktik
Neurodidaktisch-neuropädagogische Konzepte
»Pädagogische Neurobiologie«
Neurodidaktik und Neuropädagogik
Das Konzept des »selbstregulierten Lernens«
Die Hattie-Studie und ihre Folgen
Was sagt uns das?
Kapitel 12
Bessere Schule, bessere Bildung
Die Bedeutung der Lehrerpersönlichkeit
Glaubwürdigkeit
Fachliche Kompetenz
Feinfühligkeit und Kritikfähigkeit
Motivationsfähigkeit
Die Bedeutung der Schülerpersönlichkeit
Zielorientierung und Selbstmotivation
Anstrengungsbereitschaft, Ausdauer und Fleiß
»Hirngerechter« Unterricht
Aufmerksamkeit und Konzentration
Die Anschlussfähigkeit des Stoffes
Wiederholung
Vielfalt der Unterrichtsformen (Methoden-Mix)
Ganztagsunterricht mit fächerübergreifender Thematik
Wie sieht nach alledem ein guter, »hirngerechter« Unterricht aus?
Abschlussbemerkung
Kapitel 13
Der Einsatz digitaler Medien in der Schule, Homeschooling und die Einführung eines »Hybridunterrichts«
Gründe für die Einführung digitaler Medien in den Schulunterricht
Ergebnisse von Wirksamkeitsstudien
Die Nutzung digitaler Medien in der Schule aus Sicht der Kognitions- und Neurowissenschaften
Fazit
Homeschooling und Hybridunterricht
Gesamtfazit
Anhang 1
Wie ist unser Gehirn aufgebaut, wie funktioniert es und wie entwickelt es sich?
Bau und Funktion des menschlichen Gehirns
Die Großhirnrinde
Das subcorticale vegetativ-limbische System
Die zellulären Bausteine des Gehirns
Anhang 2
Wie verbessere ich mein Gedächtnis?
Literatur
Sachindex
Personenindex
Abbildungsverzeichnis
Dr. Otto Kirchhoff und dem Friedrichsgymnasium Kassel in Dankbarkeit.
Vorwort zur Neuausgabe 2021
Die vorliegende Überarbeitung der Ausgabe von 2015 wurde vor dem Hintergrund einer für die Bildungsanstalten turbulenten Zeit vorgenommen. Zum einen verstärkte sich in den vergangenen Jahren die Diskussion um die Einführung und Nutzung digitaler Medien(1), nachdem internationale Vergleichsstudien Deutschland einen der unteren Plätze zugewiesen hatten. Es stellte sich heraus, dass sich über gerätetechnische Fragen hinaus niemand so recht Gedanken darüber gemacht hatte, was nun mit den forciert in die Schulen importierten Geräten aus pädagogisch-didaktischer Sicht eigentlich gemacht werden sollte. Manche Bildungspolitikerinnen glaubten indes, durch die Einführung digitaler Formate ließen sich die Bildungsdefizite von Schulkindern aus benachteiligten Familien beheben oder zumindest verringern, aber die genannten Untersuchungen bewiesen das Gegenteil.
Diese prekäre Situation wurde im Frühjahr 2020 durch den Ausbruch der Corona-Pandemie und die dadurch notwendig gewordene Schließung der Schulen verstärkt. In der Not griff man im Rahmen eines Homeschooling(1) zu Methoden des Unterrichts per Videoübertragung, wofür anfangs in den Schulen kaum technische Voraussetzungen, geschweige denn Erfahrungen vorhanden waren. Man kann aber vielen Schulen bescheinigen, dass sie sich diesen Herausforderungen gestellt und Erhebliches geleistet haben. Zu einer Beantwortung der Frage, wie man denn unter solchen Umständen diejenigen Forderungen nach einem wissenschaftlich fundierten Lehren und Lernen und insbesondere nach der Rolle der persönlichen Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden umsetzen könne, auf die John Hattie(1) in seiner großen Studie »Lernen sichtbar machen« von 2013 hingewiesen hatte, besaß man begreiflicherweise keine Zeit. Manche Bildungspolitiker und sonstige Bildungsexperten propagierten sogar das Homeschooling(2) als »Schule der Zukunft«, bei der man vielleicht mit weniger Lehrpersonal auskommt – ein Schelm, wer Schlechtes dabei denkt!
Das Motto dieses Buches »Bildung braucht Persönlichkeit« hat sich weiterhin als richtungsweisend erwiesen, auch nachdem man demnächst hoffentlich zu einem teilweise geordneten Unterricht zurückkehrt – etwa in Form einer Mischung von Präsenzunterricht(1) und digitalem Fernunterricht(1). Denn auch wenn man irgendwann komplett zu einem Präsenzunterricht(2) zurückkehren sollte, so ist doch unklar, welche Anteile sich für ein digitales Format gut eignen und welche nicht. Ich diskutiere dies im letzten Kapitel dieses Buches.
Bei der Überarbeitung habe ich die Grundstruktur früherer Ausgaben beibehalten, jedoch – abgesehen von sprachlichen Korrekturen – einige Teile gründlich überarbeitet und auf den neuesten Kenntnisstand gebracht, so die Kapitel 3 über Persönlichkeit, Kapitel 5 über Gedächtnis und Erinnerung und Kapitel 9 über Sprache. Neu hinzugekommen ist Kapitel 13 über den Einsatz digitaler Medien in der Schule. Bei den genannten Kapiteln haben sich in den letzten Jahren viele neue wissenschaftliche Erkenntnisse ergeben, welche die in früheren Ausgaben vertretenen Anschauungen weiter untermauern.
Erfreulich war und ist die Zusammenarbeit mit der privaten Leibnizschule in Elmshorn und Kaltenkirchen, in denen die beiden Leiter, Frau Barbara Manke-Boesten und Herr Egon Boesten, konsequent, feinfühlig und erfolgreich versuchten, dasjenige in die schulische Praxis umzusetzen, was sie und ich für notwendig und brauchbar an wissenschaftlicher Erkenntnis hinsichtlich eines »guten Unterrichts« ansehen. Das wäre zugleich ohne eine große Zahl engagierter Lehrerinnen und Lehrer nicht möglich gewesen. Die große Akzeptanz in Kollegium und Schülerschaft und auch unter den Eltern zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Dabei gilt, dass zwar manches in einer Privatschule schneller und besser umzusetzen ist, aber die Probleme sind dieselben. Deshalb bin ich davon überzeugt, dass unsere Vorgehensweise ohne Schwierigkeiten auf öffentliche Schulen und Bildungsanstalten übertragbar ist.
Mein Dank geht deshalb vornehmlich an die Leitung der Leibnizschule in Elmshorn und Kaltenkirchen sowie an die jeweilige Lehrerschaft, und nicht zuletzt auch an die Schülerinnen und Schüler, soweit sie von unseren Maßnahmen betroffen waren und sind.
Kürzlich sagte mir ein Schüler: »Wir waren alle so froh, als wir nach der ersten Pandemiewelle endlich wieder zur Schule gehen konnten!« Als ich fragte, ob er damit die Möglichkeit meinte, seine Schulkameraden wiederzusehen, antwortete er: »Ja, aber ebenso wichtig war es, unsere Lehrerinnen und Lehrer wieder direkt vor unserer Nase zu haben!« Ein größeres Lob kann sich keine Lehrerschaft wünschen.
Danken möchte ich meiner Kollegin und Ehefrau Prof. Dr. Ursula Dicke für ihren fachlichen Rat und die Hilfe bei der Erstellung der neuen Abbildungen.
Lilienthal und Brancoli, Februar 2021
Vorwort zur Neuausgabe 2015
Ich habe die vorliegende Taschenbuchausgabe zum Anlass genommen, den Text zu aktualisieren und zu ergänzen. Anlass zu Ergänzungen war zum einen das Erscheinen der deutschen Ausgabe der Studie von John Hattie(2) mit dem Titel »Lernen sichtbar machen« vor zwei Jahren, was eine bis heute andauernde Diskussion um die Faktoren des Lernerfolges und insbesondere um die Bedeutung der Lehrperson sowie um die Wirksamkeit des »selbstregulierten Lernens« in Gang setzte, und zum anderen die eigenen Erfahrungen bei der Einführung eines fächerübergreifenden Projekttages an einer Reihe von Schulen. Entsprechend habe ich das Kapitel 11 »Zeitgenössische didaktische Konzepte« um Unterkapitel über selbstreguliertes Lernen und über die Hattie-Studie ergänzt und das Kapitel 12 »Bessere Schule, bessere Bildung« neu geschrieben. Dabei wurde die Bedeutung der Aussagen des vorliegenden Buches für die Schulpraxis ausführlich dargestellt. Außerdem wurden das 2. Kapitel »Persönlichkeit« und das 6. Kapitel überarbeitet und aktualisiert. Ich hoffe, dass das Buch dadurch an Aktualität gewonnen hat.
Danken möchte ich den Personen, die mir geholfen haben, die hier vorgestellten pädagogisch-didaktischen Vorstellungen zu entwickeln und in die Praxis umzusetzen. Dies sind Herr Michael Koop von der Gesamtschule Bremen Ost, das Ehepaar Barbara Manke-Boesten und Egon Boesten vom Leibniz-Gymnasium Elmshorn und Bad Bramstedt, Frau Andrea Honer von der Albert-Schweitzer-Realschule Böblingen, Frau Angela Huber vom Schulamt in Böblingen sowie – last but not least – meinen Bremer »Mitstreiterinnen« Frau Gisela Gründl von der Universität Bremen und Frau Anja Krüger von der Oberschule Ronzelenstraße.
Die vorliegende Taschenbuchausgabe ist meinem früheren Kasseler Lehrer Dr. Dr. Otto Kirchhoff, genannt »Moppel«, gewidmet. »Moppel« war von seinem Aussehen (er war fast so breit wie hoch) und Verhalten her ein Unikum und für mich wie viele andere Schüler des Friedrichsgymnasiums Kassel ein mitreißender Lehrer in Latein und Griechisch. Er hat es auch in die seriösere Literatur hinein geschafft, nämlich in das Buch »Zeit für ein Lächeln« von Rudolf Hagelstange, der ebenfalls in den Genuss von »Moppels« Lehrkünsten und Persönlichkeit gekommen war. Otto Kirchhoff liebte das Leben in seiner ganzen Breite und Tiefe. Es wurde über lange Jahre erzählt, er sei aus dem Leben geschieden, indem er in Griechenland (das er über alles liebte) weinselig vom Esel gefallen sei. Leider hat sich diese hochromantische Geschichte später als unzutreffend herausgestellt. Ebenso ist das Buch dem altsprachlichen Friedrichsgymnasium (FG) in Kassel gewidmet, dem Otto Kirchhoff über viele Jahre als Oberstudiendirektor diente. Ich besuchte das FG zwischen 1954 und 1963. Ich hatte überwiegend hervorragende Lehrer, die auch heute noch den gehobensten pädagogisch-didaktischen Ansprüchen genügen würden, indem sie es verstanden, Begeisterung für Lernen und Wissen zu wecken.
Lilienthal, Mai 2015
Vorwort zur ersten Auflage
Meine intensive Beschäftigung mit dem Thema »Lehren und Lernen« begann, abgesehen von meiner Lehrtätigkeit als Professor, vor rund zwölf Jahren mit der Bitte des damaligen Bremer Bildungs- und Wissenschaftssenators Willi Lemke an mich, im schönen Bremer Rathaus vor einer größeren Anzahl von Bremer Lehrerinnen und Lehrern einen Vortrag mit dem Titel »Warum sind Lehren und Lernen schwierig?« zu halten. In diesem Vortrag versuchte ich, eine Brücke zwischen den Fragen der schulischen Bildung und den neuen Erkenntnissen der Psychologie und der Hirnforschung zu Lehren und Lernen zu schlagen. Dies stieß auf großes Interesse, insbesondere bei meiner Kollegin Gisela Gründl von der Universität Bremen, die sich zusammen mit meinem Kollegen Prof. Heinz-Otto Peitgen mit Fragen der Mathematikdidaktik beschäftigte, und dies führte dann zur Gründung des »Forums Lehren und Lernen« an der Universität Bremen. Meine Berufung zum Rektor des Hanse-Wissenschaftskollegs (HWK) in Delmenhorst gab mir Gelegenheit und Mittel, solche Initiativen weiter zu verfolgen, wiederum ermutigt von dem damaligen HWK-Stiftungsratsvorsitzenden Willi Lemke. Es folgten zahlreiche Veranstaltungen mit Pädagogen, Didaktikern, Schulleitern, Lehrern und Lehramtskandidaten, in denen wir zusammen mit einer größeren Schar weiterer Verbündeter versuchten, unsere Ideen in die Schulen und Klassenräume zu tragen.
Nach anfänglicher Begeisterung mussten wir ernüchtert feststellen, dass dies erst einmal nicht gelang. Die Gründe hierfür sind komplex, und wir haben wohl die Schwierigkeit eines direkten Transfers neurowissenschaftlich-psychologischen Wissens in den Unterricht unterschätzt. Hinzu kommt, dass die Situation, in der sich unser Schulsystem in je nach Bundesländern unterschiedlicher Weise befand und auch heute noch befindet, äußerst verworren ist und das Kompetenzgerangel in der Bremer Bildungsbehörde sein Übriges tat. Jedenfalls hatte ich inzwischen bis auf gelegentliche Vorträge die Lust am Thema »Lehren und Lernen« verloren, bis mich der engere Kontakt zu Leitern und Lehrern von Schulen in Bremen und Umgebung wieder dazu brachte, mir die Frage des Transfers neurobiologisch-psychologischen Wissens in Schule und Bildung erneut zu stellen. Dies wurde bestärkt durch Gespräche mit dem Vorstandsvorsitzenden der Klett-Verlagsgruppe Philipp Haußmann und durch die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Dr. Heinz Beyer vom Lektorat des Klett-Cotta-Verlags, die mich dazu brachten, das vorliegende Buch zu schreiben.
Im Rahmen der Vorbereitung zu diesem Buch habe ich während rund zweier Jahre versucht, mich mit den aktuellen Problemen der schulischen Bildung erneut vertraut zu machen. Dies geschah in enger Zusammenarbeit mit den Schulleitungen und Lehrerinnen und Lehrern der Privatschule Gut Spascher Sand in Wildeshausen bei Bremen und der Gesamtschule Bremen-Ost GSO). Es kam zusammen mit Frau Dr. Monika Lück (Orbitak AG, Roth GmbH Bremen) zu zahlreichen Treffen mit diesem Personenkreis, und im ersten Halbjahr 2010 konnte ich als Zuhörer und gelegentlicher Mitwirkender am Mathematikunterricht in der GSO teilnehmen. Dem Schulleiter Herrn Bertold Seidel und seinem Stellvertreter Herrn Klaus Rumpel (Gut Spascher Sand) sowie dem Schulleiter Herrn Franz Jentschke und seiner Stellvertreterin Frau Annette Rüggeberg (GSO) danke ich herzlich für ihre Unterstützung. Mein besonderer Dank gilt Herrn Michael Koop, der als Lehrer an der GSO zusammen mit zahlreichen Kolleginnen und Kollegen meine »Erkundungen« nachhaltig unterstützt hat, und an dessen Mathematikunterricht ich teilnehmen durfte.
Mein weiterer Dank gilt den langjährigen Mitstreiterinnen im »Forum Lehren und Lernen« Frau Gisela Gründl (Universität Bremen) und Frau Anja Krüger (Oberschule Ronzelenstraße Bremen) sowie Herrn Jürgen Langlet (Schulleiter des Gymnasiums Johanneum Lüneburg), die mich über die vielen Jahre sachkundig unterstützt haben. Dank gilt auch meiner Kollegin und Frau Prof. Dr. Ursula Dicke für neurobiologisch-fachlichen Rat, meinem Bruder Dr. Jörn Roth, der auch Teile dieses Buches kritisch gelesen hat, Frau Anna-Lena Dicke (Universität Tübingen), die mich im Bereich der pädagogischen Psychologie beraten hat. Fachlichen Rat erhielt ich auch von meinen Kollegen Prof. Dr. Detlev Rost(1) (Marburg) und Prof. Dr. Günter Trost(1) (Bonn). Danken möchte ich – last but not least – Herrn Senator Willi Lemke, inzwischen UN-Sonderberater für Sport, für seine unermüdliche Arbeit für die schulische Ausbildung im Lande Bremen und die Förderung des Forums »Lehren und Lernen« an der Universität Bremen und am Hanse-Wissenschaftskolleg Delmenhorst.
Brancoli und Lilienthal, September 2010
Einleitung
Besser Lehren und Lernen – aber wie?
Klagen darüber, dass Schüler und Erwachsene in den bestehenden Bildungseinrichtungen zu wenig bzw. wenig Brauchbares lernen, existieren, seit es Hochkulturen gibt. Das hat sich auch in der Moderne nicht geändert, in der es Schulpflicht und eine systematische staatliche Lehrerausbildung gibt, in die die Gesellschaften sehr viel Geld investieren und die in der Pädagogik, Didaktik und Lehr- und Lernforschung(1) als etablierte akademisch-wissenschaftliche Disziplinen betrieben wird. Nicht nur in Deutschland werden seit 100 Jahren regelmäßig Bildungskrisen ausgerufen, die entsprechende Schulreformbewegungen nach sich ziehen. Hierzu gehörten die Reformpädagogik an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert und die berühmte Reichsschulkonferenz im Jahre 1920, dann die in den 1960er Jahren vom Philosophen und Pädagogen Georg Picht(1) ausgerufene Bildungskatastrophe, die erneut viele Maßnahmen im gesamten Bildungssystem hervorrief und u.a. zur Einführung der Gesamtschulen führte, bis zum PISA-Schock vor rund zwanzig Jahren, als die internationalen Schulvergleichsstudien in den OECD-Ländern Deutschland ein sehr mäßiges Abschneiden bescheinigten. Daran hat sich seither nicht viel geändert, wenngleich zwischen den einzelnen Bundesländern starke Unterschiede bestehen. Seit einigen Jahren ist die Diskussion über eine massive Einführung digitaler Medien(2) an den Schulen zu einem Dauerbrenner geworden, und durch den Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 wurde sie noch weiter angefacht.
Die Schuldigen sind jeweils schnell ausgemacht: die Kultusministerien, die Schulen, die Lehrer, die akademische Lehrerausbildung, die Schüler, der hohe Anteil an Migrantenkindern, die Lehrpläne, der exzessive Fernsehkonsum, der Zerfall der Familie, das Versagen der Eltern usw. Allerdings kann heutzutage kein Experte verlässlich erklären, welche dieser Faktoren am meisten zum angeblichen oder tatsächlichen Elend der Schule und zum Frust von Lehrenden und Lernenden beitragen und wo man entsprechend am dringendsten ansetzen müsste. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass auf vielen Gebieten sehr viele Reformmaßnahmen durchgeführt und ausprobiert werden, sich aber an den PISA-Ergebnissen Deutschlands im Vergleich zu anderen OECD-Ländern und zwischen den Bundesländern wenig geändert hat. Für einen kritischen Beobachter ist diese Situation typisch für ein Vorgehen, bei dem an zu vielen Punkten gleichzeitig angesetzt wird, nur ungenügend erprobte Mittel zum Einsatz kommen und mit zu wenig Geduld und unkoordiniert vorgegangen wird.
Die geringe Geduld ist dabei am ehesten verständlich, wenn man den großen Zeitdruck bedenkt, der auf den verantwortlichen Politikern und Beamten lastet. Die anderen Punkte sind schwerer zu durchschauen. Auffällig ist, dass die drei Institutionen, die für das Bildungssystem in unserer Gesellschaft verantwortlich sind, nicht oder nur sehr unwillig miteinander interagieren. Dazu gehören zum einen die Vertreter der staatlichen Bildungsbehörden. Diese sind von ehemaligen Lehrern durchsetzt, von denen zumindest einige nach eigenem Bekunden froh darüber sind, nicht in der Schule arbeiten zu müssen. Dieser Umstand hindert sie aber nicht daran, den Schulen eine bestimmte, meist parteipolitisch erwünschte Schulpraxis vorzuschreiben. Die zweite Gruppe wird gebildet von Professoren der Pädagogik und Didaktik, denen die Lehramtsstudenten ausgesetzt sind. Auch ich gehörte vor mehreren Jahrzehnten in meinem geisteswissenschaftlichen Studium zu diesen Lehramtsstudenten, und was wir damals im Bereich der Pädagogik gelernt haben, war für den Lehrberuf nutzlos und von unseren Professoren auch gar nicht als nützlich intendiert. Von führenden Pädagogen und Didaktikern wie Ewald Terhart(1) wurde vor einigen Jahren bescheinigt, dass die akademische pädagogische Ausbildung für die spätere Praxis der Schul- und Weiterbildung weitgehend wertlos ist. Experten bescheinigen auch der empirischen Lehr- und Lernforschung(2) eine ähnliche Abstinenz vom Schulalltag – es heißt, man konzentriere sich auf das von der Forschung am einfachsten Umsetzbare, und ich kann zumindest aus meiner eigenen Kenntnis des Schulalltags bestätigen, dass die Ergebnisse der Lehr- und Lernforschung(3) in den Unterricht bis heute (2021) keinen großen Eingang gefunden haben.
Schließlich gibt es die große Gruppe der Lehrenden in den Schulen, die sich mehr oder weniger redlich abmühen, an der Misere etwas zu ändern. Ihre Situation ist wiederum besonders bemerkenswert. Zum einen kennen sie oft moderne pädagogisch-didaktische Konzepte nicht bzw. haben das, was sie davon in der Hochschule einmal erfahren haben, längst vergessen, zum anderen halten sie solche Konzepte hinsichtlich ihres Berufsalltags oft für wertlos, und diese Einschätzung schließt nicht nur die akademische Ausbildung ein, sondern häufig auch die Ausbildung an den staatlichen Ausbildungsstätten für Lehramtskandidaten (vgl. (1)(2)(1)Terhart 2002; Becker 2006). Was aber am meisten beeindruckt, ist die Tatsache, dass alle Lehrer, mit denen ich in den vergangenen Jahren zu tun hatte, sich ihr Unterrichtskonzept individuell erarbeitet haben und überdies der festen Meinung sind, das sei gut so und ginge auch gar nicht anders. Das bedeutet: so viele Lehrer, so viele Unterrichtskonzepte! Dies verbindet sich mit der unter Lehrern noch immer verbreiteten Neigung, sich nicht in die Karten schauen zu lassen und mit anderen Lehrern keine Erfahrungen auszutauschen. Warum sollte man auch, wenn jeder Lehrer seine ganz individuellen Unterrichtsformen(1) finden muss!
Über so viel Individualismus mag man erschrecken, man mag ihn auch als »gottgegeben« oder sogar als positiven Zustand ansehen. Wenn es gilt, dass »kein Schüler ist wie der andere«, dann gilt dies wohl auch für den Lehrer. Dieser hat durch Versuch und Irrtum oder eigenes Nachdenken »selbstorganisiert« herauszubekommen, wie optimales Lehren funktioniert, genauso wie konstruktivistische Lehr- und Lerntheoretiker dies behaupten (davon später mehr). Wenn dies zuträfe, dann könnte man sich jede systematische Lehrerausbildung und erst recht jede Pädagogik und Didaktik sparen. Gutes Unterrichten – so die Abwandlung einer Äußerung der Lernpsychologin Elsbeth Stern(1) – wäre dann erlernbar, aber nicht lehrbar.
Obgleich ich einen solchen »pädagogischen Agnostizismus« nicht teile (sonst hätte ich das vorliegende Buch nicht geschrieben), ist die geschilderte Situation dennoch ernst zu nehmen. Bedenkenswert ist die Feststellung führender Experten wie Ewald Terhart(3) (vgl. Terhart 2002) oder Hilbert Meyer(1) (Meyer 2004) und vieler Lehrenden, dass die heute vorliegenden pädagogisch-didaktischen Konzepte wenig hilfreich für die Unterrichts- und Bildungspraxis sind. Dieses Manko kann zweierlei Ursachen haben. Zum einen mag es sein, dass sich Pädagogen und Didaktiker – wie viele Experten ihnen vorwerfen – zu sehr um das Konzeptuelle und Prinzipielle kümmern und nicht um die Praxis. Zum anderen kann es aber auch daran liegen, dass sie sich nicht genügend um Erkenntnisse der empirischen Wissenschaften wie der Psychologie oder – neuerdings – der Neurobiologie kümmern, sondern »im eigenen Saft schmoren«.
Dies mag für einen beträchtlichen Teil der Pädagogen und Didaktiker gelten, die fernab von empirisch arbeitenden Disziplinen innerhalb philosophisch-soziologischer Denkweisen ihre Konzepte zu entwickeln versuchen. Für sie ist alles Empirisch-Experimentelle wertlos und ideologieverdächtig, man orientiert sich lieber an einer philosophischen Hermeneutik(1) und/oder an sozialkritischen Utopien (vgl. Kapitel 11). Es hat jedoch in der modernen Geistesgeschichte immer wieder intensive Bemühungen gegeben, Einsichten der empirisch-experimentellen Disziplinen, namentlich der Psychologie, zu nutzen, die pädagogische Konzepte entwickelt hat.
Einer der einflussreichsten Pädagogen war in neuerer Zeit Johann Friedrich Herbart(1) (1776–1841), der eine umfangreiche Lehr- und Lerntheorie entwickelte. Diese erlangte im 19. Jahrhundert und bis ins 20. Jahrhundert hinein als »Herbartianismus« eine weit über Deutschland hinausreichende Bedeutung, allerdings in einer aus heutiger Sicht stark verfälschten Form eines starren und autoritären Erziehungsstils. Herbarts eigene Anschauungen waren dagegen sehr liberal und klingen sogar heute noch fortschrittlich, wenn er fordert: »Machen, dass der Zögling sich selbst finde, als wählend das Gute, als verwerfend das Böse: Dies oder nichts ist Charakterbildung! Dies Erhebung zur selbstbewußten Persönlichkeit soll ohne Zweifel im Gemüte des Zöglings selbst vorgehen und durch dessen eigene Tätigkeit vollzogen werden; es wäre Unsinn, wenn der Erzieher das eigentliche Wesen der Kraft dazu erschaffen und in die Seele eines anderen hineinflößen wolle« (J. F. (2)Herbart, zitiert nach Benner 1997). Für Herbart stand die Persönlichkeitsbildung eindeutig im Vordergrund.
Das genaue Gegenteil dieses Herbart’schen(3) Ansatzes war das pädagogische Konzept, wie es gut 100 Jahre später der amerikanische Behaviorismus(1) vertrat und unter dem Schlagwort »Instruktionspädagogik«, »Instruktionspsychologie« und »lernzielorientierte Didaktik(1)« in abgewandelter Form auch heute noch bedeutsam ist. Der amerikanische Behaviorismus ist sicher die bisher erfolgreichste und folgenreichste Theorie menschlichen und tierischen Verhaltens. Er stellte eine radikale und strikt empiriegeleitete Auseinandersetzung mit einer philosophisch orientierten Humanpsychologie dar, die ihr Hauptziel in einer »verstehenden« Erklärung von Phänomenen wie Bewusstsein(1), Erleben, Geist und allgemein mentalen Leistungen sah. Deren Vorgehen bestand im Wesentlichen in der Introspektion, d.h. der Analyse des eigenen Erlebens – also aus etwas, das in den Augen des Behaviorismus(2) nicht objektiv nachweisbar und daher unwissenschaftlich war.
Als der eigentliche Begründer des amerikanischen Behaviorismus(3) ist der Psychologe John Broadus Watson(1) (1879–1958) anzusehen. Watson wollte die Psychologie zur Lehre von der Kontrolle und Voraussage von menschlichem und tierischem Verhalten machen. Bei der Erklärung solchen Verhaltens lehnte er »mentalistische« oder »internalistische« Begriffe wie Bewusstsein(2), Wille und Absicht radikal ab. Verhalten kann und muss nach Watson(2) ausschließlich über die Beziehung von Reiz und Reaktion erklärt werden und über die sich daraus ergebende Ausbildung von Gewohnheiten (habits). Diese sind nichts anderes als komplexe Verkettungen einfacher, konditionierter Verhaltensweisen. Nach Watson gelten für tierisches und menschliches Verhalten dieselben »objektiven« Gesetze; deshalb gibt es auch nur eine einzige Art von Psychologie, und zwar die Lehre von der Veränderung des Verhaltens nach den Prinzipien der klassischen und operanten Konditionierung(1)(1), die für tierisches und menschliches Verhalten gleichermaßen zutrifft. Jedes Verhalten ist hierdurch gezielt veränderbar, wenn man nur genügend Geduld und Umsicht aufbringt.
Andere Behavioristen(4)(1), wie Clark Hull (1884–1952), betonten gegenüber dem reinen Erlernen der Verkettung von Ereignissen die Bedeutung eines Reizes als Belohnung(1)(2)(1) (reward). Nach Hull liegt jedem Lernen das Streben zugrunde, ein bestimmtes Bedürfnis zu befriedigen bzw. einen sich daraus ergebenden Triebzustand zu beseitigen (need reduction): Kein Lernen ohne Belohnung! Diese Überzeugung übernahm auch der letzte große und vielleicht bedeutendste Behaviorist Burrhus F. Skinner(1) (1904–1990). Sein Hauptwerk ist das Buch »Science and Human Behavior« von 1953 (dt. 1973 »Wissenschaft und menschliches Verhalten«). Skinner erlangte in der Lernpsychologie und Verhaltensbiologie allein schon dadurch große Bedeutung, dass er die experimentellen Bedingungen der Erforschung menschlichen und tierischen Verhaltens stark verbesserte und verfeinerte sowie das Konzept der operanten Konditionierung(2) zu seiner klassischen Form entwickelte, die uns noch beschäftigen wird. Jedes willkürliche (also nicht reflexbedingte) Verhalten von Mensch und Tier – so lautet das Glaubensbekenntnis von Skinner(2) und seinen Anhängern – wird über (1)Verstärkungs- und Vermeidungslernen(1) gesteuert, und zwar über die Konsequenzen des Verhaltens. (3)Skinner verwandte große Sorgfalt darauf, die Wirkung unterschiedlicher Verstärkungsschemata oder Verstärkungsprogramme auf den Lernerfolg zu analysieren.
(5)Alldem liegt ein ungehemmter Erziehungsoptimismus zugrunde, der lautete, dass jedes Tier und jeder Mensch zu jedem erwünschten Verhalten erzogen werden kann, vorausgesetzt, die körperlichen Fähigkeiten dazu sind gegeben. Dies passte wunderbar in die USA der 1940er bis 1960er Jahre und hatte entsprechend einen großen Einfluss auf Pädagogik, Didaktik und Politik. (6)Auch in Deutschland wurde dieser Ansatz mit der entsprechenden Verzögerung sehr populär, vornehmlich in Form der »kybernetischen(1) Pädagogik«, wie sie von Felix von Cube(1) und Helmar Frank(1) proklamiert wurde, sowie in Form »programmierten Lernens«. Derzeit gibt es kaum Vertreter dieser pädagogischen Richtung, auch wenn sie im Zusammenhang mit der Einführung digitaler Medien(3) in die Schulen wieder interessant werden könnte.
In den USA und in Großbritannien begann in den 1960er Jahren der Niedergang des Behaviorismus(7), während er zur selben Zeit in Deutschland erst richtig Fuß zu fassen begann. Dieser Niedergang, den man als die »kognitive Wende« in der Psychologie bezeichnet, wurde durch Arbeiten des Linguisten Noam Chomsky(1) und der Psychologen Albert Bandura(1), Donald Broadbent(1) und Eric Neisser(1) eingeleitet. Zu den Prozessen, die man nun untersuchte, gehörten komplexe Wahrnehmung, Denken, Vorstellen und Erinnern(1) – also genau das, was der Behaviorismus(8) als Untersuchungsgegenstand strikt abgelehnt hatte. Die so entstehende Kognitionspsychologie, auch Kognitivismus(1) genannt, befasste sich mit der Frage, wie Menschen ihre Erfahrungen strukturieren, ihnen Sinn beimessen, und wie sie ihre gegenwärtigen Erfahrungen zu vergangenen, im Gedächtnis gespeicherten Erfahrungen in Beziehung setzen. Interessanterweise geschah dies nicht wirklich empirisch-experimentell, wie dies heutzutage Psychologen im Verein mit Neurobiologen tun, wenn sie Hirnaktivitäten messen, die bei kognitiven Leistungen auftreten.
Eine typische Schwierigkeit des Kognitivismus(2) bestand und besteht darin, dass ganz unklar bleibt, was bei kognitiven Leistungen mit »Information« gemeint ist. In der Informationstheorie(1) der Nachrichtentechnik und elektronischen Datenverarbeitung geht es um elektrische Signale bzw. Ladungszustände und etwa darum, auszurechnen, wie solche Signale schnell, verlässlich und kostengünstig übertragen bzw. wie viele solcher Signale auf einer Festplatte gespeichert werden können. All dies hat – wie Informationstheoretiker seit Shannon(1)(1) und Weaver stets betonen – nichts mit »Information« im Sinne von bedeutungshaften Inhalten zu tun. Solche Signale sind grundsätzlich bedeutungsfrei, und ihre Bedeutung ergibt sich daraus, dass ein kognitives, d.h. mit Nervensystem bzw. Gehirn ausgestattetes System diese interpretiert.
Natürlich geht es bei den Flussdiagrammen der kognitiven Psychologie um die Verarbeitung bedeutungshafter Inhalte und nicht nur um »Nullen und Einsen« wie im Computer, aber kein Kognitionspsychologe hat bisher aufgrund eines rein kognitivistischen Ansatzes erklären können, wie aus Signalen Bedeutung wird. Abgesehen von diesem Grundproblem besteht zugleich die große Unzulänglichkeit des Kognitivismus(3) darin, dass »Symbolverarbeitung« allein als logisch-begriffliche, d.h. regelgeleitete Operationen verstanden wird (Anderson 1996). Wir werden hingegen sehen, dass es Bedeutungen nicht ohne Prozesse der internen Bewertung gibt, die im limbischen System des Gehirns ablaufen und die wir als Emotionen(1) und Motive erleben. Ohne Emotionen und Motive gibt es kein Lernen.
Es ist deshalb kein Wunder, dass viele Kognitionspsychologen auf eine Theorie der Informationsverarbeitung(1) zurückgegriffen haben, die ebenfalls aus der Regelungstechnik und Kybernetik(1) stammte und als Konnektionismus(1) bezeichnet wird. Es handelt sich um »künstliche Netzwerke«, die im einfachsten Fall aus einer Eingabe- und einer Ausgabeschicht bestehen, die miteinander verknüpft sind und logische Operationen ausführen wie »und«, »oder«, »nicht«, »größer«, »kleiner« usw. Im komplexeren Fall gibt es eine »Zwischenschicht« (auch »verborgene Schicht« genannt) oder mehrere davon, was dazu führt, dass die sich ergebenden Verbindungen zwischen Eingabe- und Ausgabeschicht beliebig komplex werden und die Operationen solcher Netzwerke nicht mehr explizit verstehbar sind.
(1)(2)(2)Die Hinwendung der Psychologie zum Konnektionismus(2) und zur subsymbolischen Informationsverarbeitung(2) innerhalb künstlicher neuronaler Netzwerke ermöglichte eine ungeheure Steigerung der Leistungsfähigkeit, wie sie heute überall in der Technik und Industrie genutzt wird. Zugleich stößt man jedoch auf Schallmauern, wenn es um das Verständnis komplexerer Ereignisse geht, z.B. beim Erfassen des Sinnes gehörter oder geschriebener Worte und Sätze, bei der Interpretation bildlicher Darstellung, bei komplexen Analysen und Entscheidungen etwa im Bereich der Ökonomie. Menschen und viele Tiere nehmen anders wahr, lernen, erinnern und entscheiden anders als rein kognitive Informationsverarbeitungssysteme. Insofern erscheint heute die kognitive Psychologie auch mithilfe des Konnektionismus(3) oder einer Verbindung symbolischer und subsymbolischer Informationsverarbeitung(3) als das Modell für Lernen wenig brauchbar. Das ist allerdings ein großes Problem angesichts der immer lauter werdenden Forderung, Verfahren der »Künstlichen Intelligenz« sollten in Verbindung mit geeigneten digitalen Medien(4) in die Schulen eingeführt werden, um die Schüler »fit für die Zukunft zu machen«.
(3)Aber welchen Weg soll man einschlagen? Woran können und sollen sich Pädagogik und Didaktik halten? Soll man weiterhin von traditionellen Vorstellungen einer geisteswissenschaftlich-hermeneutischen(2) Pädagogik und Didaktik ausgehen? Von denen, die in der Nachfolge von Wilhelm Dilthey(1) von Hermann Nohl, Eduard Spranger und Theodor Litt dem naturwissenschaftlichen »Erklären« das geisteswissenschaftliche »Verstehen« entgegensetzten? Aus diesen Konzepten entwickelten sich dann vornehmlich mit dem Pädagogen-Didaktiker Wolfgang Klafki(1) und zahlreichen Nachfolgern und Schülern eine »bildungstheoretische Didaktik(2)« und später eine kritisch-konstruktive Didaktik(3). Oder soll man dem – ebenfalls geisteswissenschaftlich ausgerichteten – »Berliner Modell« Paul (1)Heimanns oder dem daraus entwickelten stark sozialkritischen »Hamburger Modell« von Wolfgang Schulz(1) folgen?
Anfang der 1980er Jahre trat eine scheinbar völlig neue Denkrichtung, der Konstruktivismus(1), auf den Plan, der vielen Autoren als Vermittlungsversuch zwischen geisteswissenschaftlich-hermeneutischen(3) und biologisch-psychologisch-informationstheoretischen Ansätzen erscheint. Begründet wurde er – von zahlreichen Vorläufern, insbesondere dem Biologen und Entwicklungspsychologen Jean Piaget(1) abgesehen – teilweise unabhängig voneinander vom österreichisch-amerikanischen »Kybernetiker(4)« Heinz von Foerster, den chilenischen Neurobiologen und Systemtheoretikern Humberto Maturana(1) und Francisco Varela(1) und dem österreichisch-amerikanischen Psychologen Ernst von Glasersfeld(1), dem Begründer des »radikalen Konstruktivismus« (von Glasersfeld 1995).
Der radikale Konstruktivismus(2) stellt den Behaviorismus(9), für den es ja nur Input- und Output-Beziehungen, aber keine erfahrbaren internen Geschehnisse gibt, auf den Kopf. Für ihn gibt es keinen Input und Output, alles sind nur interne Geschehnisse. Insofern stellt er für Didaktik und Pädagogik eine große Herausforderung dar, denn eine Wissensvermittlung und -übertragung von einem Lehrenden zu einem Lernenden und eine objektive Überprüfung des vermittelten Wissens kann es nicht bzw. nicht im eigentlichen Sinne geben. Der Konstruktivismus erfreut sich innerhalb der Pädagogik und Didaktik(4), besonders im Zusammenhang mit Konzepten des »selbstorganisierten(1)« oder »selbstbestimmten« Lernens, einer großen Beliebtheit.
Teils im Zusammenhang mit der Übernahme konstruktivistischer Konzepte durch Pädagogen und Didaktiker, teils unabhängig davon erleben seit einigen Jahren Pädagogik und Didaktik die vorerst letzte Welle von Versuchen, sich ein wissenschaftlich-empirisches Fundament zu verschaffen, und zwar in Form einer »Neuropädagogik(1)(1)« bzw. »Neurodidaktik«. Dies stimmt überein mit Darstellungen von Prozessen des Lehrens und Lernens durch Neurowissenschaftler. Diese Autoren gehen so weit, dass sie der herkömmlichen Pädagogik und Didaktik die Existenzberechtigung absprechen und sie durch die direkte Anwendung neurowissenschaftlicher Erkenntnisse in der Schulpraxis ersetzen wollen.
Diese doppelte Bewegung hin auf eine »Neuropädagogik/Neurodidaktik« genießt nach wie vor eine erhebliche Popularität unter den Lehrerinnen und Lehrern, die sich von der klassischen Pädagogik und Didaktik nicht angesprochen fühlen. Es wird aber zu prüfen sein, in welchem Maße Neurowissenschaftler einschließlich der empirisch-experimentell arbeitenden Psychologen Prozesse des Lehrens und Lernens, der Gedächtnisausbildung und des Gedächtnisabrufs, der Aufmerksamkeit(1) und der Art, wie diese Leistungen von Emotionen(2) und Motivationszuständen(1) bestimmt werden, bereits so weit verstehen, dass daraus konkrete Schlüsse für die Unterrichts- und Bildungspraxis gezogen werden können.
Bei all diesen Versuchen der gegenwärtigen Pädagogik und Didaktik, sich »von außen« mit einem theoretischen Fundament zu versorgen, wird ein eklatantes Defizit bei der Kenntnisnahme derjenigen Erkenntnisse sichtbar, die in den vergangenen Jahren in den Bereichen der Persönlichkeits-, Emotions- und Motivationspsychologie ebenso wie in der Intelligenz- und Begabungsforschung gewonnen wurden. Hierzu gehören auch die Erkenntnisse über die Entwicklung der Psyche und Persönlichkeit(1) des Säuglings, Kindes und Jugendlichen einschließlich der Ergebnisse der Bindungsforschung (vgl. hierzu S. Pauen(1)(1)(1) 2000; Strüber 2016; Roth und Strüber 2019). Insgesamt versucht diese Forschung, die Entwicklungsbedingungen und Entwicklungsmuster der Persönlichkeit(2) eines Menschen im Spannungsfeld zwischen genetischer Determination, früher psychosozialer Prägung und sich anschließender Sozialisation aufzuklären. Die Neurowissenschaften haben sich in den letzten Jahren verstärkt dieser psychologischen Forschung im Rahmen von entwicklungsneurobiologischen, neuropharmakologischen und neurophysiologischen Untersuchungen einschließlich der funktionellen Bildgebung angeschlossen, so dass inzwischen ein zunehmend einheitliches psycho-neurobiologisches Konzept der Persönlichkeit entsteht (Roth und Strüber 2019). Dieses Konzept ist in Pädagogik und Didaktik bisher kaum bekannt, und es wird die Hauptaufgabe dieses Buches sein, es so zu vermitteln, dass es für Theorie und Praxis des Lehrens und Lernens nutzbar wird.
(2)Halten wir fest: Pädagogik und Didaktik müssen ohne Wenn und Aber gesicherte Erkenntnisse der Psychologie und Neurobiologie über »Lehren und Lernen« aufnehmen und in ihre Konzepte einbringen. Gleichzeitig müssen sie sich intensiv um die Alltagspraxis des »Lehrens und Lernens« kümmern und Antworten auf diejenigen Fragen suchen, die dieser Alltagspraxis entstammen. Dies gilt für die Schule genauso wie für andere Bildungsinstitutionen. Die Schule steht hier meist nur deshalb im Vordergrund, weil hierzu sehr viel geschrieben und auch ausprobiert wurde. Dies lässt sich für die Erwachsenenbildung und Weiterbildung leider nicht in diesem Ausmaß sagen. Das meiste von dem, was ich in diesem Buch an Erkenntnissen und Einsichten vorstellen werde, ist aber für beide großen Bereiche des Bildungssystems gültig. Nötig ist eine fruchtbare Dreiecksbeziehung zwischen (1) Psycho-Neurowissenschaftlern als empirisch arbeitenden Wissenschaftlern, (2) den Pädagogen-Didaktikern und (3) den Schul-, Erwachsenen- und Weiterbildungspraktikern, wobei der Prüfstein ein empirisch überprüfter Lehr- und Lernerfolg ist und nicht die Eleganz eines Konzeptes.
(3)Obwohl ich als Neurobiologe von der großen Bedeutung empirisch-experimenteller neurobiologischer und psychologischer Erkenntnisse zur Persönlichkeit und zum Lehren und Lernen überzeugt bin, vertrete ich nicht die Meinung, diese Erkenntnisse könnten direkt in den Schulalltag hineingetragen werden. Solche Erkenntnisse bedürfen der kritischen Diskussion der Pädagogen, Didaktiker und Lehr- und Lernpraktiker. Nichtsdestoweniger ist dieses Buch aus Sicht der Psycho-Neurowissenschaften geschrieben, auch wenn ich mich hierbei mit Gegenständen der Pädagogik, Didaktik und Praxis der Wissensvermittlung beschäftige.
(4)Andererseits teile ich auch nicht die oben erwähnte Auffassung, jeder Lehrende müsse für sich selber durch »Versuch und Irrtum« herausbekommen, wie ein erfolgreicher Unterricht aussieht. Bei aller nötigen Flexibilität des Schul- und Bildungsalltags und der großen Variabilität in den Eigenschaften der beteiligten Personen gibt es klar darstellbare psychologisch-neurobiologische Rahmenbedingungen für einen erfolgreichen Unterricht, die vielen Lehrerinnen und Lehrern und leider auch vielen Pädagogen und Didaktikern nicht bekannt sind. Wären sie das, würde man sich viel Reibung und Misserfolg ersparen. Dass letztendlich jeder Lehrende seine eigene Adaptation solcher in pädagogisch-didaktische Konzepte eingebrachten Erkenntnisse erbringen muss, wird zugleich von mir nicht angezweifelt.
(5)An diesen Grundüberzeugungen orientiert sich das vorliegende Buch in seinem Aufbau. Das 1. Kapitel befasst sich mit der grundlegenden Frage »Was soll Bildung, was kann Schule?«. Über die Ziele der Schule und des weiteren Ausbildungssystems gibt es bekanntlich große Meinungsverschiedenheiten. Kommt es darauf an, möglichst viel Wissen zu vermitteln? Wenn ja, welches Wissen soll vermittelt werden? Ist es ebenso wichtig, gesellschaftliche Bildung zu vermitteln – und wenn ja, welcher Art? Gehört zur schulischen und nachschulischen Aus- und Weiterbildung auch die Förderung einer »reifen Persönlichkeit« – und wenn ja, wie soll diese denn aussehen?
Das 2. Kapitel baut auf der Grundthese des Buches auf, dass Lehren und Lernen im Rahmen der Beziehung zwischen den Persönlichkeiten des Lehrenden(1) und des Lernenden(1)(1) geschieht, und dass über den Erfolg des Lehrens und Lernens die Merkmale dieser Persönlichkeit(1) entscheiden, seien diese kognitiver, emotional-motivationaler oder psychosozialer Natur. Ich werde deshalb im 2. Kapitel erläutern, welche psychologischen Konzepte der Persönlichkeit es gegenwärtig gibt und welche Erkenntnisse hierzu in den Neurowissenschaften vorliegen. In diesem Zusammenhang werde ich ein neurobiologisch fundiertes Modell der Persönlichkeit präsentieren, das ich in den vergangenen Jahren zusammen mit Psychologen und Psychiatern entwickelt habe. Hierauf aufbauend gehe ich im 3. Kapitel auf Emotionen(3) und das Entstehen von Motivation(2) ein.
Die Kapitel 4 und 5 befassen sich mit den psychologischen und neurobiologischen Grundlagen des Lernens und der Gedächtnisbildung. Die Erkenntnisse auf diesem Gebiet sind wichtig für die Antwort auf die Frage, wie man einen nachhaltig erfolgreichen Unterricht(1) gestaltet.
Das 6. Kapitel befasst sich mit Intelligenz und ihren neurobiologischen Grundlagen. Dies ist ein in der Psychologie und Pädagogik besonders umstrittenes Thema, und deshalb ist es nötig, diejenigen Erkenntnisse hierzu aus der psychologischen und neurobiologischen Forschung zu präsentieren, die als gesichert gelten können. Auch hier wird die enge Verschränkung der Intelligenzentwicklung mit den emotional-motivationalen und psychosozialen Merkmalen der Persönlichkeit(2) sichtbar werden. Das 7. Kapitel untersucht den Einfluss emotionaler Zustände und Begleitumstände auf den Lernerfolg. Dies führt uns im 8. Kapitel zu der Frage, welche Faktoren den schulischen, akademischen und beruflichen Erfolg bedingen. Wir werden sehen, dass Intelligenz(1) ein wichtiger, aber neben Motivation(3) und Fleiß(1) eben nur ein Faktor für den Erfolg ist.
Das 9. Kapitel befasst sich mit dem Sprachverstehen beim Hören und Lesen(1) als der Grundlage jeder Ausbildung. Es wird sich zeigen, dass das hörende und lesende Verstehen von Sprache einen überaus komplizierten Prozess der individuellen Bedeutungskonstruktion(1) darstellt, bei dem die wichtigste Voraussetzung die Vorerfahrung ist. Dies führt uns dann im 10. Kapitel zur Entwicklung einer psychologisch-neurobiologischen Theorie der Bedeutungsentstehung und des Verstehens.
(2)Im 11. Kapitel geht es um die Darstellung und Bewertung gängiger pädagogischer und didaktischer Konzepte. Hierzu gehören die geistes- und sozialwissenschaftlich ausgerichteten Konzepte der bildungstheoretischen(1) und kritisch-konstruktiven Didaktik(1) Klafkis(2), der lerntheoretischen Didaktik(1) des »Berliner« bzw. »Hamburger Modells« sowie der kommunikativen Didaktik(1) in Anlehnung an Jürgen Habermas(1) und seiner »Theorie kommunikativen Handelns(1)«. Ebenso (5)gehören dazu die konstruktivistischen(1) Pädagogiken und Didaktiken und schließlich die verschiedenen Erscheinungsformen einer »Neuropädagogik« und »Neurodidaktik(2)«. Neuropädagogische und neurodidaktische Konzepte sind natürlich deshalb besonders interessant, weil hierbei in der Regel unterstellt wird (oft in Form von pädagogischen »Ratgebern«), man könne Erkenntnisse der Neurowissenschaften bzw. das, was hierfür ausgegeben wird, direkt in die Schul- und Bildungspraxis übertragen.
Am Ende dieses Kapitels werde ich ausführlich auf das Buch von John Hattie(3) »Lernen sichtbar machen« eingehen, das seit seinem Erscheinen in englischer Sprache (Hattie 2009) und in der deutschen Übersetzung (Hattie 2013) großes Aufsehen erregt hat und immer noch erregt und zu zahlreichen zustimmenden wie auch kritischen Stellungnahmen aus pädagogisch-didaktischen Kreisen geführt hat (vgl. (4)Terhart 2014).
Dies leitet im 12. Kapitel zur zentralen Frage des Buches über, wie aus Sicht der in diesem Buch präsentierten Erkenntnisse und Einsichten der Psychologie und Neurobiologie ein guter Unterricht(2) aussehen könnte. Natürlich steht hierbei schon aus rein quantitativen Gründen der schulische Unterricht im Vordergrund, aber es werden Schlüsse gezogen, die für jeden Bildungs- und Ausbildungsprozess wichtig sind. Das 13. Kapitel widmet sich der sehr aktuellen Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen der Einführung digitaler Medien(5) in den Schulunterricht, insbesondere hinsichtlich der Faktoren, die zuvor in diesem Buch als grundlegend für einen erfolgreichen Unterricht(3) genannt wurden.
Diesen Kapiteln folgt als erster Anhang eine Darstellung des Aufbaus und der Funktionen des menschlichen Gehirns. Ich habe mich zu dieser Anordnung entschlossen, um den Leser auf seinem Weg durch die Kapitel nicht mit zu vielen neurobiologischen Details zu belasten. Der zweite, kurze Anhang besteht aus Ratschlägen zur Verbesserung der Lern- und Gedächtnisleistungen. Solche hilfreichen Maßnahmen sind zum Teil seit dem Altertum bekannt, werden aber im heutigen Schul- und Ausbildungsbetrieb aus mir nicht bekannten Gründen nicht gelehrt, was bedauerlich ist.
Es sollte klar geworden sein, dass mein Buch sich als Aufforderung zu einem vertieften Dialog zwischen Psychologen, Neurobiologen, Pädagogen-Didaktikern und Schul- und Bildungspraktikern versteht, nicht als Ausdruck von Dogmatik und Besserwisserei.
Kapitel 1
Was soll Bildung, was kann Schule?
Schule und Ausbildung haben in der neuzeitlichen Gesellschaft stets mehreren Zwecken gedient, nämlich erstens der Vermittlung von speziellen Kenntnissen und Fertigkeiten für eine bestimme Berufstätigkeit (Verwaltung, Militär, Rechts-, Gesundheits-, Verkehrssystem usw.), zweitens der Vermittlung umfassenderer, wissenschaftlich abgesicherter Kenntnisse auf diesem Gebiet (in der Regel an Hochschulen und Universitäten), drittens der Vermittlung von Basiswissen über Staat und Gesellschaft und viertens der Ausbildung des Kindes oder Jugendlichen zu einer »reifen Persönlichkeit(3)«. Mit diesen Zielen sind keine bestimmten Inhalte verbunden, diese werden von den jeweiligen gesellschaftlichen und politischen Verhältnissen bestimmt, und dies betrifft natürlich vornehmlich das dritte und vierte Ziel. Was das Basiswissen über Staat und Gesellschaft umfasst, so hängt dieses selbstverständlich von der jeweiligen Staatsideologie ab und war im Deutschland des Kaiserreiches, des Nationalsozialismus, des Nachkriegsdeutschlands in BRD und DDR und ist im heutigen wiedervereinigten Deutschland sehr verschieden. Kaum etwas wurde und wird so sehr politisiert wie das Schul- und Bildungssystem, und dies zeigt sich auch an den unterschiedlichen Schul- und Bildungsplänen der einzelnen Bundesländer.
In diesem Rahmen ist nach wie vor umstritten, worauf der Hauptakzent der Schulbildung denn eigentlich liegen soll: Steht die Vermittlung praxisnaher Kenntnisse und Fertigkeiten im Vordergrund, etwa einer »Medienkompetenz(1)« der Schülerinnen und Schüler? Kommt es auch wesentlich auf das gesellschaftliche und politische Basiswissen an – und wie sieht dieses aus? Hat die Schule überhaupt die Aufgabe bzw. den Auftrag, die Persönlichkeit(4) der Kinder und Jugendlichen zu formen, oder greift sie damit in die Rechte der Eltern oder das Selbstbestimmungsrecht(1) der Schülerinnen und Schüler ein?
Die Tatsache, dass Schule einschließlich der Vorschule einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung der Persönlichkeit(5) der Schülerinnen und Schüler leisten darf und sogar muss, wird nur noch selten kategorisch bestritten – dazu sind die Defizite in der familiären Unterstützung(1)(1) der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder viel zu offensichtlich –, aber es herrscht verbreitet Ratlosigkeit, wie dies geschehen sollte. Gleichzeitig existiert über ihre Grundlagen unter den Lehrerinnen und Lehrern, aber auch unter vielen Schulpsychologen ein eklatantes Nichtwissen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass an ein und derselben Schule Lehrerinnen und Lehrer einen höchst unterschiedlichen Akzent auf die Vermittlung des Unterrichtsstoffes, auf die Vermittlung sozialer Kompetenzen(1) und auf die Persönlichkeitsentwicklung setzen(6). Dies ist nicht die Schuld dieser Lehrer, sondern des Systems, in dem sie ausgebildet bzw. nicht ausgebildet wurden, und natürlich auch Ausfluss der Tatsache, dass die staatlichen Bildungsbehörden sich über den »Zweck der Schule« ausschweigen.
Die hier vertretene Sicht lautet, dass Schule einen umfassenden Bildungsauftrag hat, der sich auf die Förderung der kognitiven, psychischen und psychosozialen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler bezieht. Wie ich im weiteren Verlauf dieses Buches zeigen werde, ist die kognitive Entwicklung der Kinder und Jugendlichen als Grundlage des Erwerbs von Wissen aufs Engste mit ihrer emotional-motivationalen Entwicklung verbunden. Die nach dem PISA-Schock von 2001 häufig zu hörende Feststellung, die Schulkinder (besonders im Norden und Osten Deutschlands) »wüssten zu wenig«, wird oft massiv von der Forderung begleitet, man müsse sowohl den Umfang des Unterrichtsstoffes als auch den Leistungsdruck erhöhen. Dies widerspricht aber den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen über die Bedingungen erfolgreichen Lehrens und Lernens(4). Der Grundsatz »weniger ist oft mehr« trifft auch hier in dem Sinne zu, dass ein Stoff begrenzten Umfangs, systematisch aufbereitet, vermittelt bzw. angeeignet und überprüft, einen wesentlich höheren Behaltensgrad besitzt als ein immer umfangreicherer Stoff, der mit Hochdruck durch den kognitiv-emotionalen »Flaschenhals« des Schülers durchgepresst werden soll.
Alles Lehren und Lernen findet im Rahmen der Persönlichkeit des Lehrenden und des Lernenden und damit im Rahmen ihrer kognitiven, emotionalen und motivationalen Fähigkeiten statt. Darauf nicht Rücksicht zu nehmen, mindert den Bildungserfolg dramatisch. Wie aber sollen die Persönlichkeit eines Lehrenden(2) und die eines Lernenden(2) aussehen?
Der Lehrende hat eine Kindheit und Jugend sowie eine fachliche und pädagogisch-didaktische Ausbildung und ein freundliches oder weniger freundliches Schicksal hinter sich, und daran ist meist wenig, aber doch etwas zu ändern. Hier geht es um fachliche(1) und pädagogisch-didaktische Kompetenz(1), in Grenzen um die weitere Ausformung der eigenen Persönlichkeit, insbesondere in Richtung auf Selbstvertrauen(1), Selbst-(1) und Fremdmotivation, um die Einsicht in den Zweck des eigenen Tuns und um Feinfühligkeit(1) im Umgang mit den Schülerinnen und Schülern, aber auch um Stressmanagement(1) bei sich selbst und bei anderen. Hier liegt vieles im Argen, aber da es sich bei Lehrern um Erwachsene handelt, sind positive Änderungen schwer zu erreichen, und zwar umso schwerer, je mehr sie die Kernpersönlichkeit betreffen, und umso leichter, je mehr sie allein kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten angehen. Die positive Botschaft lautet hier zugleich: Auch Erwachsene können sich ändern, wenn sie einen starken Leidensdruck empfinden, durch bestimmte Umstände stark motiviert sind und schließlich über längere Zeit denselben Einwirkungen ausgesetzt sind (vgl. Roth 2019). Dies ist der zu wählende Ansatzpunkt, nicht die momentane Begeisterung oder Belehrung.
Bei Kindern ist hingegen viel zu erreichen – aber in welcher Richtung? Ohne familiäre Zustände früherer Zeiten romantisieren zu wollen (die meisten davon waren nur oberflächlich gesehen »heil« und in Wirklichkeit von Unterdrückung, Bevormundung und Strafandrohung gekennzeichnet), ist zuzugeben, dass heute viele Kinder und Jugendliche mit erheblichen psychischen und psychosozialen Schwierigkeiten bis hin zu latenten oder gar offenen psychischen Erkrankungen in die Schule gehen. Man kann aufgrund der Ergebnisse der Bindungsstudien(1) zwar davon ausgehen, dass rund 60 % der Kinder »sicher gebunden« sind und damit eine hohe Widerstandkraft gegenüber psychischen Belastungen besitzen (vgl. Kapitel 2), und abgeschwächt lässt sich dies auch für die Gruppe der »Unsicher-Vermeidenden« sagen, aber es bleiben dann immer noch 20 % Kinder mit erheblichen psychischen Problemen übrig, die meist aus der frühen familiären Erfahrung herrühren. (1)Dieser Prozentsatz ist bei Kindern aus Familien mit Migrationshintergrund(1) z. T. noch höher, und er wird aufgrund der Schrumpfung der Kernfamilie, der größeren Zahl von Einelternfamilien, der häufigeren Berufstätigkeit der Mütter, der größeren Mobilität und einer Langzeitarbeitslosigkeit der Eltern weiter deutlich anwachsen. Gleichzeitig sind diese Herkunftsfamilien(2) oft außerstande, diese Defizite auszugleichen, so dass notgedrungen Kindergarten, Vorschule und Schule kompensatorisch einspringen müssen. Dabei geht es keineswegs nur um emotional-psychische, sondern auch um kognitive Defizite, die sich in Lern- und Gedächtnisschwierigkeiten niederschlagen.
Was müssen die Ziele solcher kompensatorischen Maßnahmen(1)(1) sein? Selbstverständlich geht es um das allgemeine Ziel, den jungen Menschen zu einer »autonomen Persönlichkeit« werden zu lassen. Das ist leicht dahingesagt und schwer genau festzulegen, denn es handelt sich – wie wir noch sehen werden – hierbei um ein kompliziertes Gleichgewicht zwischen Egozentriertheit und Sozialität, zwischen Stresstoleranz(2)(1) und Feinfühligkeit(2), Flexibilität und Durchsetzungsvermögen. Die Kindergarten- und Schulzeit ist diejenige Periode der »sekundären Sozialisation«, in der die Sozialisation über die engere Familie hinaus stattfindet, in welcher sich die »primäre Sozialisation« vollzieht. Freunde und Kameraden sind dabei sehr wichtig, insbesondere weil es sich hierbei um eine gleichberechtigte (reziproke) und nicht um eine hierarchische Beziehung wie mit den Eltern handelt. Nach Ansicht von Fachleuten hat die Entwicklung von Freundschaften einen hohen diagnostischen Wert; es gibt – so heißt es – kein Merkmal, das psychisch auffällige und unauffällige Kinder und Jugendliche so gut voneinander trennt wie das Vorhandensein oder Fehlen von Freunden. Freunde haben eine schützende (protektive) Funktion, und die Unterstützung durch Freunde trägt in hohem Maße zum Wohlbefinden und zur Stressminderung bei. Manche Kinder und Jugendliche erfinden sogar Phantasiefreundinnen oder -freunde, wenn sie unter Einsamkeit, Verlust, Verlassenwerden oder Zurückweisung leiden. Gleichzeitig besteht hierdurch auch die Gefahr, sich zu konform zu verhalten, um »zur Gruppe zu gehören«, und die Bereitschaft zu risikoreichem Verhalten (Jugendstreiche in »Banden«) ist groß. Zum Glück verringert sich diese Gefahr beim Übergang zum Erwachsenenalter, aber ein fortdauerndes Bedürfnis nach starker Gruppenbindung ist ein wichtiger Risikofaktor der weiteren psychischen Entwicklung.
Die Ausbildung sozial-emotionaler Kompetenzen(1) beinhaltet die Fähigkeit zur Emotionsregulation(1)(4), d.h. zum Umgang mit Wut und Zorn, und zur Impulshemmung(1), insbesondere zur Kontrolle aggressiver Impulse (vornehmlich bei Jungen) und zur Kontrolle verbaler Gewalt(1) und Beziehungsgewalt (vornehmlich bei Mädchen). Weiterhin gehören hierzu die Entwicklung einer Theory of Mind, (1)d.h. der Fähigkeit, sich in das Denken und Fühlen der anderen hineinzuversetzen und die Gefühle und das Verhalten anderer antizipieren zu können, Signale des Gegenübers korrekt wahrzunehmen, Empathie(1) auszubilden, Aushandeln und Tauschen anstelle von bloßer Durchsetzung eigener Interessen usw. (vgl. Kapitel 2). Bei Mädchen ist der Umgang mit dem Körperselbstbild höchst wichtig; es besteht die Gefahr von Essstörungen in Form von Bulimie und Anorexie. Es geht zugleich um die Entwicklung des Selbstwertgefühls(1), das richtige Einschätzen der eigenen Kräfte und der Art und Stärke der Herausforderungen(1), um Selbstmotivation(2), ein ausgewogenes Verhältnis zu Lob und sonstiger Anerkennung, Durchhaltevermögen, Fleiß(2), Konzentration und Zielbewusstsein(3). Schließlich geht es um Offenheit(1) und Toleranz, ohne wankelmütig oder opportunistisch zu werden, um Neinsagen-Können, um die Fähigkeit zum Belohnungsaufschub und gelegentlich um Belohnungsverzicht, und vor allem um Gerechtigkeitssinn: »Würdest du wollen, dass andere so mit dir umgehen, wie du mit anderen umgehst?«
Das alles sind große Aufgaben, aber zum Glück findet die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen den Weg zu einer reifen und ausgeglichenen Persönlichkeit selbst und in der Interaktion mit ihren Freunden und Schulkameraden. Jedoch ist die Hilfe der Schule sehr wichtig als anregender und gegebenenfalls eingrenzender Faktor.
Die Schule muss natürlich auch ein Ort der Herausforderung(2) zur Leistung und der Selbstbewährung sein. Wie wir noch sehen werden, ist milder Stress als Herausforderung förderlich für das Lernen, genauso wie die drei Hauptfaktoren Intelligenz(2)(3), Motivation(4) und Fleiß. Jedes Gehirn lernt nur dann bereitwillig, wenn es den Sinn des Lernens begreift und wenn es eine Belohnungserwartung(1) damit verbindet. Zugleich werden wir erfahren, dass Belohnungen(2) sich nur dann nicht schnell abnützen, wenn sie als verdient empfunden wurden. Dies alles bürdet den Lehrenden eine hohe Verantwortung auf, gleichgültig, ob sie vor der Klasse stehen und unterrichten oder Gruppen(1)(1)- und Einzelarbeit überwachen.
Kapitel 2
Persönlichkeit
Die Hauptthese dieses Buches lautet, dass Lehren und Lernen stets im Rahmen der Persönlichkeit des Lehrenden(3) und des Lernenden(3) und ihrer Beziehung zueinander(2) stattfinden, also der höchst individuellen Art des Wahrnehmens, Denkens, Fühlens, Wollens, Handelns sowie der Bindungs- und Kommunikationsfähigkeit eines Menschen. Mit anderen Worten: Die Art, wie jemand lehrt und lernt, wird bestimmt durch seine Persönlichkeit. Dies ist jedoch eine komplexe Angelegenheit – es gehört zu den großen Herausforderungen der Psychologie und der Neurowissenschaften, zu erklären, wie man die Persönlichkeit eines Menschen bestimmt, warum jemand so ist, wie er ist, warum er das tut, was er tut, und wie man ihn eventuell darin ändern kann.
Diesen Fragenkomplex will ich in diesem Kapitel behandeln. Zuerst gehe ich auf die gängigen Verfahren der Psychologie ein, mit denen man die Persönlichkeit eines Menschen zu erfassen versucht, und zeige, dass sie mit erheblichen Schwächen behaftet sind, wenn sie nicht mit den Erkenntnissen der Hirnforschung über die Verankerung der Persönlichkeit im Gehirn zusammengebracht werden. In diesem Zusammenhang werde ich das Vier-Ebenen-Modell der neurobiologischen Grundlagen der Persönlichkeit vorstellen und zeigen, wie die beteiligten Hirnzentren über die neuromodulatorischen Systeme zusammenwirken. Wir werden sehen, dass sich hierdurch der Aufbau der Persönlichkeit eines Menschen besser verstehen lässt. Schließlich werde ich in Grundzügen die psychische und kognitive Entwicklung des Kindes und Jugendlichen darstellen. Das für das Thema dieses Buches wichtige weitere Persönlichkeitsmerkmal »Intelligenz« werde ich in Kapitel 6 ausführlich behandeln.
Persönlichkeit aus Sicht der Psychologie
Beim wissenschaftlich-systematischen Erfassen der Persönlichkeit eines Menschen gibt es grundsätzlich unterschiedliche Ansätze. Ein Ansatz besteht darin, das »Wesen« einer Person zu erfassen, indem man sie einem festen Persönlichkeits- oder Charaktertyp zuordnet. Am bekanntesten ist die »Lehre von den Temperamenten(1)«, die seit dem Altertum die Einteilung in vier Grundpersönlichkeiten kennt, nämlich in aufbrausende Choleriker, trübsinnige Melancholiker, träge Phlegmatiker und lebhafte Sanguiniker – man denke an Dürers Darstellung der vier Temperamente anhand der vier Apostel Markus, Paulus, Johannes und Petrus.
Eine zweite und in der modernen Persönlichkeitspsychologie dominierende Vorgehensweise besteht darin, die Persönlichkeit von Menschen nicht starren Typen zuzuordnen, sondern sie als ein individuelles Mosaik vieler einzelner Persönlichkeitsmerkmale(3) anzusehen, die wiederum unterschiedliche Ausprägungen aufweisen (»jemand ist oder hat mehr oder weniger von …«); man nennt solche Merkmale oder Größen »dimensional«, weil ihre Ausprägungen auf einer Achse zwischen zwei Extrempunkten angeordnet werden können. Menschen unterscheiden sich dann im individuellen Mosaik der Ausprägungen relevanter Persönlichkeitsmerkmale.
(4)Aber welche Merkmale sind geeignet für einen solchen differenziellen Ansatz? Hier hat man das sogenannte lexikalische Verfahren angewandt, das zuerst vom US-amerikanischen Psychologen Gordon Allport(1) entwickelt wurde und darin besteht, dass man aus gängigen Lexika alle nur erdenklichen Vokabeln nimmt, mit denen menschliche Eigenschaften beschrieben werden (Allport(2) und Odbert 1936). Dabei handelt es sich um viele Tausende von solchen Wörtern, die natürlich in ihrer Bedeutung erst einmal hochgradig redundant sind, d.h. mehr oder weniger dasselbe ausdrücken – man denke nur daran, wie viele Wörter es für den Umstand gibt, dass eine Person geistig etwas beschränkt ist. Man kann nun diese Fülle durch wiederholtes Zusammenfassen mithilfe mathematisch-statistischer Verfahren, z.B. der sogenannten Faktorenanalyse, auf immer weniger Grundmerkmale der Persönlichkeit reduzieren, bis sich schließlich je nach Autor eine Liste von wenigen, z.B. zwei bis sieben Grundmerkmalen als optimal herausstellt. Die jeweiligen Autoren nehmen an, dass die entsprechenden Grundmerkmale weitestgehend überschneidungsfrei sind.
(5)Besonders einflussreich war in der modernen Persönlichkeitspsychologie der deutsch-britische Psychologe Hans Jürgen Eysenck(1) (1916–1997). Er vertrat anfangs die Meinung, es gebe zwei Grunddimensionen der Persönlichkeit, nämlich zum einen die Dimension »Neurotizismus(1)«, welche in unterschiedlicher Ausprägung die Merkmale Instabilität, Ängstlichkeit(1) und Besorgtheit umfasst, und zum anderen das Gegensatzpaar »Extraversion(1)-Introversion«, welches die Spannbreite von einer gesellig-offenen(2) bis hin zu einer zurückgezogen-verschlossenen Persönlichkeit bezeichnet. Später nahm er noch das Merkmal »Psychotizismus« hinzu, das Aggressivität, Gefühlskälte, aber auch Impulsivität(1) und Kreativität umfasst. Diese Dimension wird aber häufig aus der Beschreibung einer »normalen« Person herausgenommen und der Psychopathologie zugeordnet, z.B. zur Kennzeichnung der sogenannten Psychopathen.
(6)(3)(2)(2)(2)(1)(1)(1)In der Weiterentwicklung dieses Ansatzes kamen die Psychologen Paul Costa(1) und Robert McCrae(1) zu den bekannten fünf Grundfaktoren, »Big Five(2)« genannt, die Extraversion(3), Verträglichkeit(2), Gewissenhaftigkeit(2), Neurotizismus(3) und Offenheit(4) umfassen und nach Meinung vieler Experten eine Persönlichkeit am ehesten zu charakterisieren vermögen (Costa(2)(2) und McCrae 1992; dt. Borkenau und Ostendorf 2008). Diese »großen Fünf« können positiv (im Sinne »trifft eindeutig zu«) oder negativ (»trifft nicht zu«) ausgeprägt sein, natürlich mit Zwischenstufen entsprechend der sogenannten Likert-Skala (trifft eher zu, teils-teils, trifft eher nicht zu).
(7)(5)(4)(3)(3)(3)(3)(4)So umfasst der Faktor Extraversion(5) in seiner positiven Ausprägung die Eigenschaften gesprächig, bestimmt, aktiv, energisch, offen, dominant, enthusiastisch, sozial und abenteuerlustig, und in seiner negativen Ausformung die Eigenschaften still, reserviert, scheu und zurückgezogen. Der Faktor Verträglichkeit(4) bezeichnet im positiven Sinne die Eigenschaften mitfühlend, nett, bewundernd, herzlich, weichherzig, warm, großzügig, vertrauensvoll, hilfsbereit, nachsichtig, freundlich, kooperativ und feinfühlig und im negativen Sinn die Eigenschaften kalt, unfreundlich, streitsüchtig, hartherzig, grausam, undankbar und knickrig. Der Faktor Gewissenhaftigkeit(4) bezeichnet in seiner positiven Ausprägung die Eigenschaften organisiert, sorgfältig, planend, effektiv, verantwortungsvoll, zuverlässig, genau, praktisch, vorsichtig, überlegt und gewissenhaft und im gegenteiligen Sinne die Eigenschaften sorglos, unordentlich, leichtsinnig, unverantwortlich, unzuverlässig und vergesslich. Der Faktor Neurotizismus(5) bezieht sich in seiner positiven Ausprägung (im Sinne von »trifft zu«) auf die Eigenschaften gespannt, ängstlich(2) nervös, launisch, besorgt, empfindlich, reizbar, furchtsam, selbstbemitleidend, instabil, mutlos und verzagt, und in seinem Gegensatz auf die Eigenschaften stabil, ruhig und zufrieden. Der Faktor Offenheit(6) schließlich umfasst im positiven Sinne die Eigenschaften breit interessiert, einfallsreich, phantasievoll, intelligent, originell, wissbegierig, intellektuell, künstlerisch, gescheit, erfinderisch, geistreich und weise, und im negativen Sinne gewöhnlich, einseitig interessiert, einfach, ohne Tiefgang und unintelligent. Die Persönlichkeit eines Menschen kann also als ein Mosaik unterschiedlicher Ausprägungen der genannten Persönlichkeitsmerkmale verstanden werden.
(5)(8)(7)(6)(5)(4)Die Diskussion geht in der Persönlichkeitspsychologie nun seit Langem darum, wie trennscharf diese Big Five tatsächlich sind. So gibt es klare Überlappungen zwischen »Extraversion(6)« und »Offenheit«(8): Ein geselliger Mensch ist oft auch für Neues (z.B. neue Bekanntschaften) offen. Zwischen »Neurotizismus«(7) und »Gewissenhaftigkeit«(6) existieren ebenso Verknüpfungen: Vorsichtig-ängstliche(3) Menschen sind oft auch sehr pingelig. Deshalb gibt es in der Persönlichkeitspsychologie Bemühungen, die Big Five wieder zu reduzieren. Auch wird Intelligenz(3) von vielen Persönlichkeitspsychologen inzwischen als unabhängiges Persönlichkeitsmerkmal angesehen (vgl. Kapitel 6).
(6)(9)(9)(8)(7)(5)Der britische Psychologe Jeffrey A. Gray(1) (1934–2004), ein Schüler Eysencks(2), unternahm deshalb eine wichtige Abänderung von Eysencks Persönlichkeitstheorie. (2)Gray ersetzte die Grunddimensionen »Extraversion(7)« und »Neurotizismus«(9) durch die Merkmale »Impulsivität(4)« und »Ängstlichkeit(4)«. Er deutete dabei »Impulsivität« als eine Kombination von hohem Neurotizismus und hoher Extraversion(8) im Sinne Eysencks(3) und »Ängstlichkeit(5)« als eine Kombination von hohem Neurotizismus und niedriger Extraversion(9)(3) (Gray 1990).
(7)(10)(10)(10)(8)(6)Hierauf aufbauend entwickelte Gray(4) seine »Verstärkungs-Empfänglichkeits-Theorie«. Danach ist Impulsivität(5) korreliert mit einer hohen Empfänglichkeit für Belohnung(3): Verhalten, Gefühle und kognitive Funktionen werden durch Belohnungen wie Essen, soziale Anerkennung, Geld, sexuelle Lust und einen attraktiven Partner und ebenso durch die Aussicht auf derartige Belohnungen(4) verstärkt. Belohnungsempfängliche(1) Menschen suchen aktiv nach solchen Verstärkern und nehmen dabei das Risiko eines Scheiterns oder Misserfolgs in Kauf (»Manches geht eben schief, aber es lohnt sich, was zu riskieren!«). Ängstlichkeit(6) ist hingegen gekoppelt mit einer besonderen Empfänglichkeit für Bestrafung(1), entweder in Form schmerzhafter oder anstrengender körperlicher Zustände bzw. ihrer Erwartung oder in Form psychischer Zustände wie Enttäuschung, Verlust oder soziale Missachtung. Bestrafungssensitive(1) Menschen gehen immer auf »Nummer sicher« und vermeiden deshalb riskante Situationen, auch wenn ihnen dadurch viele Chancen entgehen.
(8)(11)(11)(11)(9)(7)(5)Der amerikanische Persönlichkeitsforscher Marvin Zuckerman(1) entwickelte hingegen ein Modell der »alternativen Fünf«, das als Grundfaktoren der Persönlichkeit Geselligkeit, Neurotizismus-Angst, Aggression-Feindseligkeit(2), impulsive Sensationslust(1), Neugier und Aktivität annimmt, allerdings mit engem Bezug auf die originalen »Big Five« von Costa(3) und McCrae(3) (Zuckerman 2005). (2)Zuckerman sieht die vier ersten Faktoren seines Modells eng verbunden mit Extraversion(10), Neurotizismus(12), Verträglichkeit(9) und Gewissenhaftigkeit der Big Five(8). Impulsive Sensationslust(2) ist allerdings neben Extraversion und intellektueller Offenheit(12) auch oft verbunden mit einer geringen Ausprägung von Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit. Das Merkmal »Aktivität« wiederum ist stark verbunden mit Extraversion(11) und einer geringen Ausprägung von Gewissenhaftigkeit.
(13)(10)Ein weiterer bekannter Ansatz in der Persönlichkeitspsychologie stammt von dem amerikanischen Psychologen C. Robert Cloninger(1), der eine »Sieben-Persönlichkeitsfaktoren-Theorie« entwickelte (Cloninger 2000). Hierbei unterscheidet Cloninger(2) zwischen Temperament(2) und Charakter. Temperament ist für ihn bestimmt durch drei weitgehend genetisch determinierte Grundmerkmale, nämlich Erlebnishunger bzw. Abwechslungssucht(1) (novelty seeking), Frustrationsvermeidung(1) (harm avoidance) und Belohnungssucht(1) (reward dependence). Erlebnishunger ist charakterisiert durch ein ständiges Bedürfnis nach Abwechslung, neuen und neuartigen Erlebnissen und die Bereitschaft, zu deren Erlangung große Risiken einzugehen, sowie durch mangelnde Ausdauer(1), d.h. Aufgeben, wenn der Erfolg sich nicht schnell einstellt. Frustrationsvermeidung(2) ist verbunden mit großer Angst vor Misserfolgen und dem Ausbleiben von Belohnung(6) und mit einer Abneigung gegenüber neuartigen Dingen. Belohnungsabhängigkeit schließlich ist charakterisiert durch eine hohe Empfänglichkeit