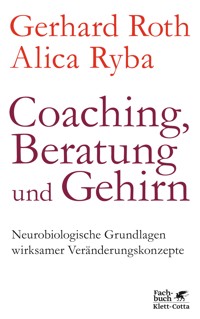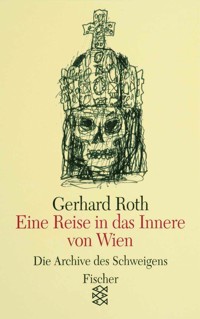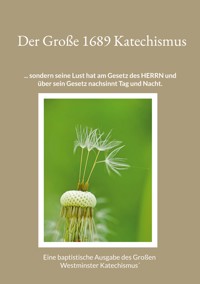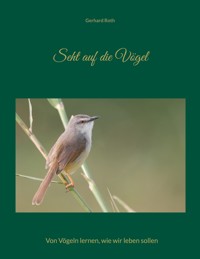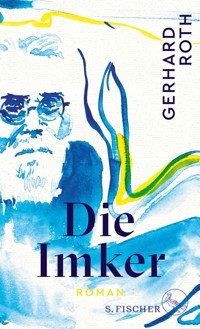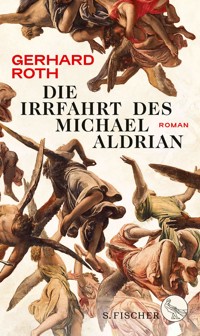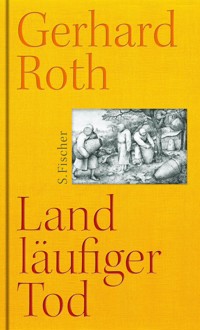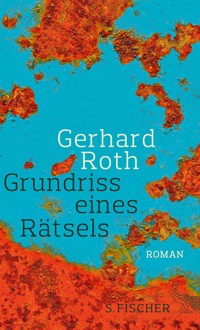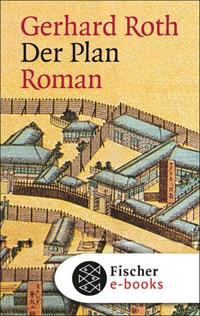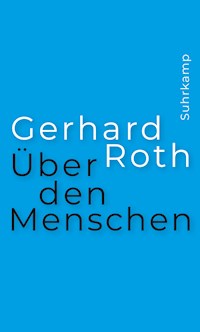
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Kaum ein Forschungsgebiet hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten so stürmisch entwickelt wie die Neurowissenschaften. Sie sind aber auch zum Gegenstand heftiger interdisziplinärer Debatten geworden, die sich vor allem um eine Frage drehen: Zwingen uns die neurowissenschaftlichen Erkenntnisse zu einer Revision unseres etablierten Menschenbildes? Entschieden verneint wird das vor allem von Philosophen, die den Neurowissenschaften mitunter sogar die Berechtigung absprechen, Aussagen über die geistig-kulturelle Welt des Menschen zu treffen. Sinnhaftes Verstehen, Geschichtlichkeit, Lebensweltlichkeit, Willensfreiheit sowie Sprache als Grundlage von Soziabilität können, so ihr Argument, prinzipiell nicht mit naturwissenschaftlichem Besteck untersucht werden.
Gerhard Roth zeigt in seinem neuen Buch, dass diese Auffassung den neurowissenschaftlichen Einsichten über die Beziehung zwischen Gehirn und Geist, Anlage und Umwelt sowie über die Bedingungen von Entscheiden und Handeln nicht gerecht wird. In Anknüpfung an seinen Bestseller Aus Sicht des Gehirns entwirft er auf zugängliche und elegante Weise ein Bild des Menschen als geistig-soziales, auf Erfassung des Sinnes seiner selbst und seiner Lebenswelt ausgerichtetes Wesen. Der Mensch in seiner Komplexität, so sein Fazit, ist weder allein von den Neurowissenschaften noch allein von den Geistes- und Sozialwissenschaften erfassbar – und fügt sich dennoch ein in die Einheit der Natur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Titel
3Gerhard Roth
Über den Menschen
Suhrkamp
Widmung
7Für Ursula
Übersicht
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
5Inhalt
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Vorwort
Einleitung: Ein neues Menschenbild?
Erstes Kapitel Vom Wunsch des Menschen, etwas Besonderes zu sein
Seelenlehre und Vitalismus
Auf der Suche nach dem Sitz der Seele
Die biologische Einheit der Natur
Antinaturalistische Strömungen in Geistes- und Sozialwissenschaften
Ist die menschliche Sprache einmalig?
Was sagt uns das?
Exkurs: Vom
spiritus animalis
zur funktionellen Bildgebung
Zweites Kapitel Wie wir werden, was wir sind
Die genetische Weichenstellung
Die Entwicklung des Gehirns
Das limbische System
Die psychoneuralen Grundsysteme
Stressverarbeitung
Selbstberuhigung
Bewertung und Motivation
Bindung und Empathie
Impulshemmung
Realitätssinn und Risikowahrnehmung
Welche Persönlichkeitstypen gibt es?
Der Dynamiker und seine Varianten
Der Stabile und seine Varianten
Was sagt uns das?
Drittes Kapitel Was uns antreibt
Triebe, Motive und Ziele
Sozialpsychologische Motivationstheorien
Motivation und Gehirn
Appetenz und Aversion
Das Ungleichgewicht zwischen Freud und Leid
Von der Belohnung zur Motivation
Unsicherheit und Risiko
Motiv- und Zielkonflikte
Was sagt uns das?
Viertes Kapitel Wie veränderbar sind wir?
Typische Erfahrungen bei Veränderungsmaßnahmen
Die erste Situation
Die zweite Situation
Die dritte Situation
Die vierte Situation
Die vier Grundvoraussetzungen für Veränderungen
Wie belohnen wir richtig?
Die Macht der Gewohnheit
Die »lieben« Gewohnheiten und der Starrsinn
Was sagt uns das?
Fünftes Kapitel Das Bestreben, die Anderen zu verstehen
Die Sprache als Kommunikationsmittel
Der Umgang mit Missverständnissen
Das Gehirn und sein Sprachvermögen
Sprache und Gedächtnis
Die Rolle des Unbewussten bei der Kommunikation
Formen der nonverbalen Kommunikation
Sprache, Lebenswelt und Kommunikation
Das Modell der »konsensuellen Bereiche«
Was sagt uns das?
Sechstes Kapitel Das Ich – Herr oder Knecht?
Das Ich in der neuzeitlichen Ideengeschichte
Ich-Zustände und Cortexmodule
Die erlebte Einheit des Ichs
Der vermeintlich privilegierte Zugang zum eigenen Ich
Schmerzerleben
Das Ich als Konfabulator
Macht und Ohnmacht des Willens
Wozu brauchen wir das Ich?
Was sagt uns das?
Siebtes Kapitel Was macht uns Menschen so intelligent?
Über menschliche Intelligenz
Wie geht man bei der Bestimmung des Intelligenzgrades vor?
Ist Intelligenz angeboren oder umweltbedingt?
Der Einfluss der Umwelt nach der Geburt
Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede?
Wie lässt sich Intelligenz steigern?
Intelligente Menschen gebrauchen ihr Gehirn effizienter
Wie intelligent sind Tiere?
Die neurobiologischen Grundlagen von Intelligenz
Menschliche Intelligenz und Sprache
Was sagt uns das?
Achtes Kapitel »Warum tun Menschen das anderen Menschen an?«
Was macht Menschen gewaltkriminell?
Chronische Gewalttäter
Bekannte Psychopathen
»Verbrecher-Gen« und Freisetzungshypothese
Was bedeutet dies für Schuld und Strafe?
Schuld, Strafe und Prävention
Was sagt uns das?
Neuntes Kapitel Krankes Gehirn – kranke Seele?
Gehirn, Psyche und Psychotherapie
Die drei Bereiche der psychotherapeutischen Interventionen
Die Macht der Worte
Die Macht der Konditionierung
Die Macht des Körpers
Die therapeutische Allianz
Was sagt uns das?
Zehntes Kapitel Das Geist-Gehirn-Problem: »Gelöst, lösbar oder unlösbar?«
Was ist das »Wesen« des Bewusstseins?
Was kommt zuerst – der Geist oder das Gehirn?
Gibt es neurobiologisches Gedankenlesen?
Gibt es im Gehirn spezielle bewusstseinserzeugende Strukturen?
Das »Bindungsproblem«
Ist Bewusstsein etwas Physikalisches?
Geist und Bewusstsein als Selbstbeschreibung corticaler Netzwerke
Was sagt uns das?
Elftes Kapitel Wie sicher ist unsere Erkenntnis?
Erkenntnistheoretische Positionen
Erkenntnistheoretische Positionen in den Naturwissenschaften
Evolutionäre Erkenntnistheorie – ein Ausweg?
Kann unser Gehirn überhaupt die Welt objektiv wahrnehmen?
Realität und Wirklichkeit
Die Dreiteiligkeit meiner Erlebniswelt
Willkürliche Konstrukte?
Was sagt uns das?
Zwölftes Kapitel Das Gehirn im Streit der Fakultäten
Der Kampf um die Deutungshoheit über den Menschen
»Neurodeterminismus«
Ursachen und Gründe
»Ich entscheide, nicht mein Gehirn!«
»Das Gehirn kann keine moralischen Urteile fällen«
»Der Mensch ist nicht sein Gehirn!«
Was sagt uns das?
Dreizehntes Kapitel Ein neues Menschenbild?
Weiterführende Literatur
Namenregister
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
3
7
5
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
357
358
359
9Vorwort
Das vorliegende Buch war bereits länger geplant und wurde aufgrund der plötzlich verfügbaren Zeit in den ersten sechs Monaten der Corona-Pandemie geschrieben. Es stellt eine Art Fortsetzung meines Buches Aus Sicht des Gehirns dar, das im Jahre 2003 im Suhrkamp Verlag erschienen ist. Die Kapitel des Buches behandeln zum Teil allgemeine Aspekte des Menschseins, es geht aber auch um klassische philosophische Fragen wie die nach der Natur des Bewusstseins und den möglichen Grenzen der Erkenntnis. All dies wird aus der Sicht der Neurowissenschaften und der empirisch-experimentellen Psychologie behandelt im Sinne eines »psychoneurowissenschaftlichen« Ansatzes, wie er umfassend in einem gerade erschienenen Lehrbuch dargestellt wird, an dem ich als Herausgeber und Autor beteiligt bin.
Über manche dieser Themen habe ich bereits verschiedentlich geschrieben, jedoch wurden einige dieser Texte teilweise als schwere Kost empfunden. Deshalb wollte ich dasjenige, was ich bisher zu den genannten Themen gesagt habe, und noch einiges Neue dazu, auf eine verständlichere Weise darstellen, und zwar ohne allzu großen terminologischen Ballast und ganz ohne Abbildungen und Fußnoten. (Wer Abbildungen heranziehen möchte, kann sie meinen Büchern Fühlen, Denken, Handeln und Aus Sicht des Gehirns entnehmen.) Auch ging es darum, in manchen Dingen eine inzwischen etwas veränderte Sichtweise zu erläutern. Wichtig war es mir dabei, den jeweiligen ideengeschichtlichen Kontext darzustellen, denn fast alle dabei auftauchenden Proble10me und angeblichen oder tatsächlichen Lösungen sind nur aus dem historischen Zusammenhang verständlich. Das gilt auch für eine so junge Disziplin wie die Neurowissenschaften, die in Wirklichkeit ihre tiefen ideengeschichtlichen Wurzeln hat.
Ich habe die Gelegenheit genutzt, mich kritisch mit Positionen auseinanderzusetzen, welche die Erkenntnisse der Hirnforschung als falsch oder gar gefährlich, zumindest jedenfalls als überzogen ansehen. Vieles an der vorgebrachten Kritik ist klug und bedenkenswert, anderes zeigt, dass von neurowissenschaftlichen Autoren, mich eingeschlossen, wichtige Zusammenhänge bisher nicht verständlich genug dargestellt wurden, und in einigen Fällen wird deutlich, dass den Kritikern die ganze Richtung nicht passt, weil sie für ihre Deutungshoheit als bedrohlich empfunden wird.
Die Beschäftigung mit dieser aus meiner Sicht teils berechtigten, teils unberechtigten Kritik war für mich auch eine Zeitreise zurück in meine Studienzeit und die ersten Jahre meiner Lehrtätigkeit im Fach Philosophie. Anfang und Mitte der 1960er Jahre war die Philosophie, mit der ich es zu tun hatte, beherrscht von dem »Viergestirn« Karl Marx, Sigmund Freud, Theodor W. Adorno und Jürgen Habermas, und für uns gab es nichts anderes als die – meist begeisterte – Auseinandersetzung mit diesen Autoren. Insofern nehme ich für mich in Anspruch, etwas von ihnen zu verstehen, wobei mich Marx und Freud noch viel länger beschäftigt haben, im Falle von Freud bis heute, während es mir Mühe bereitet hat, mich wieder mit dem Werk von Habermas vertraut zu machen, wenn ich von meinem Disput mit ihm zur Willensfreiheit vor einigen Jahren absehe. Später kam Konrad Lorenz hinzu, den ich anfangs ebenfalls mit Begeisterung las, bald aber als großen Konfabulator erkannte. Seine tiefbraune Vergangenheit war mir und den meisten Zeitgenossen damals nicht bekannt, er selbst hat sie stets geleugnet.
11Der Titel meines Buches wurde von dem berühmten, aber selten gelesenen Werk De homine, auf Französisch Traité de l'homme, des französischen Philosophen und Mathematikers René Descartes (1596-1650) übernommen. Dieses Werk erschien posthum, denn Descartes hatte, obwohl er im protestantischen Ausland (Niederlande, Schweden) lebte, berechtigte Angst vor der katholischen Inquisition und wagte es deshalb nicht, diese Schrift zu publizieren. Sie wurde vom Autor auf Französisch geschrieben, aber nicht vollendet, dann in holpriges Latein übersetzt und erst 1662 veröffentlicht, wenig später auch auf Französisch. Das Werk landete, wie von Descartes befürchtet, umgehend auf dem Index der katholischen Kirche, obwohl der Autor sich stets als frommen Christen betrachtete. Zum Glück gibt es heute keine heilige Inquisition mehr, und auch der Index verbotener Bücher wird in der katholischen Kirche seit einigen Jahrzehnten nicht mehr weitergeführt.
Descartes ging es um die zentrale Frage, wie man die zu seiner Zeit vorhandenen naturwissenschaftlichen, das heißt für ihn mechanistischen Erkenntnisse mit der damals herrschenden, noch sehr mittelalterlichen Theologie wie auch mit der in hohem Ansehen stehenden aristotelischen Philosophie vereinbaren und dabei dem Scheiterhaufen entgehen könne. Er versuchte sich sein Leben lang an der Lösung derjenigen Frage, die auch heute noch von vielen Philosophen und Wissenschaftlern als »unbeantwortbar« angesehen wird, nämlich wie die Beziehung von Geist und Gehirn beschaffen ist. Es ging ihm aber auch um eine Rechtfertigung der »Einzigartigkeit« des Menschen, die er mit dem Besitz eines rationalen Geistes und der Sprache verband. Die Leser meines Buches mögen beurteilen, ob wir inzwischen unter Beteiligung der Neurowissenschaften über Descartes und seine Philosophie hinausgegangen sind.
Danken möchte ich meiner Frau und Kollegin Prof. Dr. 12Ursula Dicke, die in Corona-Zeiten mit großer Sachkenntnis und Geduld die vorliegenden Texte kritisch gelesen hat. Voltaires Candide folgend, haben wir in dieser Zeit unsere beiden Gärten in Deutschland und in Italien bestellt. Außerdem danke ich meinem Bruder Dr. Jörn Roth (Psychologe und Mediziner), meinem Freund Georg Hoffmann (Psychologe) und unseren Freunden, den Psychotherapeuten Annette Goldschmitt-Helfrich und Werner Helfrich, für intensive und erkenntnisreiche Diskussionen über einige der Themen dieses Buches sowie meinem langjährigen Freund Prof. Dr. Herbert Striebeck für seine Anmerkungen zum achten Kapitel. Nachdrücklich danken möchte ich Eva Gilmer, der Leiterin des Wissenschaftslektorats im Suhrkamp Verlag, für die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit, die nun schon fast zwei Jahrzehnte andauert. Mein Dank gilt darüber hinaus dem Philosophen Prof. Michael Pauen und dem Neurobiologen Prof. John Dylan Haynes sowie ganz summarisch denjenigen Psychologen, Psychiatern, Philosophen und Neurowissenschaftlern, mit denen ich in den vergangenen 20 Jahren die Frage nach der Beziehung zwischen den Neurowissenschaften und den Psychowissenschaften diskutiert habe, vor allem dem leider viel zu früh verstorbenen Psychiater und Psychotherapeuten Manfred Cierpka.
Lilienthal und Brancoli, im Oktober 2020
13Einleitung: Ein neues Menschenbild?
Seit rund zwei Jahrzehnten wird teils sachlich, teils polemisch die Frage diskutiert, ob die Erkenntnisse der Neurowissenschaften beziehungsweise der Hirnforschung zu einer Revision des in unserer Kultur vorherrschenden Menschenbildes zwingen. Diese Diskussion leidet allerdings unter der Tatsache, dass es in unserer Gesellschaft und Kultur gar kein allgemein akzeptiertes Menschenbild gibt, das durch die Neurowissenschaften »bedroht« sein könnte. Ich will mich daher an das Menschenbild halten, das die geistes- und sozialwissenschaftlichen Kritiker der Neurowissenschaften vertreten und das zumindest im akademischen Bereich immer noch das am weitesten verbreitete ist. Dieses Menschenbild geht von einem fundamentalen Gegensatz von Naturgesetzlichkeit und geschichtlicher Individualität, von Erklären und Verstehen, Gründen und Ursachen, Determinismus und Freiheit sowie von Objektivität und Subjektivität aus. Freilich gibt es auch nicht »das« Menschenbild der Neurowissenschaften. Die meisten Neurowissenschaftler befassen sich gar nicht mit dieser Frage, oder sie hüten sich davor, Stellung zu beziehen. Nur vergleichsweise wenige von ihnen tun dies, wie wir sehen werden, und sie vertreten dabei oft deutlich voneinander abweichende Meinungen.
Dieser Disput wurde ideengeschichtlich lange vorbereitet durch die Auseinandersetzung der kontinentaleuropäischen Philosophie mit der stürmischen Entwicklung der Technik und der Naturwissenschaften seit dem Ende des 18. Jahrhunderts sowie der nicht mehr überhörbaren Forderung von 14Philosophen wie Auguste Comte (1798-1857), Wissenschaft müsse sich immer an empirischen Evidenzen ausrichten, also daran, wie die Dinge als solche und an und für sich sind. Einem solchen »Positivismus« versuchten Philosophen wie Edmund Husserl und Wilhelm Dilthey eine Philosophie als Wissenschaft entgegenzusetzen, die sich mit der Welt, wie sie »für uns Menschen« ist, befasst. Davon wird im nächsten Kapitel ausführlicher die Rede sein. Dies hat dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zur Ausformung der Geistes- und Gesellschaftswissenschaften und ihrer Abgrenzung von den Natur- und Biowissenschaften geführt.
Die universitären Natur- und Biowissenschaften auf der einen Seite und die Geistes- und Gesellschaftswissenschaften auf der anderen Seite haben sich über lange Zeit mit dieser Trennung abgefunden, die ja das Gute hatte, einen »Streit der Fakultäten« um den Weg zu sicherer Erkenntnis zu unterbinden. Daran änderten die Revolutionen in der Physik in Form der speziellen und allgemeinen Relativitätstheorie oder der Quantenmechanik ebenso wenig wie das Aufkommen der Molekularbiologie und Genetik in den Biowissenschaften. Selbst die großen Fortschritte in den Neurowissenschaften, wie sie etwa in der Neuroanatomie oder der Neurophysiologie im Laufe des 20. Jahrhunderts erzielt wurden, fanden weder in der Philosophie noch in den Sozialwissenschaften größere Beachtung, weil diese Erkenntnisse mit dem aus ihrer Sicht eigentlich Menschlichen vermeintlich nichts zu tun hatten. Renommierte Philosophen, bei denen ich studierte, äußerten sich abfällig über die »kindischen Versuche« von Naturwissenschaftlern, darunter nicht wenige Nobelpreisträger, ihre Erkenntnisse und Methoden philosophisch zu hinterfragen, es sei denn, es handelte sich um Physiker und Neurophysiologen, die etwa in der Quantenphysik eine Bestätigung der Existenz eines immateriellen Geistes und des freien Willens sahen.
15Diese Situation änderte sich grundlegend, als es vor rund 30 Jahren durch neue neuroanatomische und neurophysiologische Erkenntnisse und insbesondere durch die Entwicklung von Methoden wie der Vielkanal-Elektroenzephalographie und der sogenannten bildgebenden Verfahren (etwa der Positronen-Emissions-Tomographie, PET, oder der funktionellen Magnetresonanz-Tomographie, fMRI) gelang, nicht nur an Patienten, sondern auch am »normalen« Menschen ohne Öffnen des Schädels geistig-kognitive und später auch emotionale Vorgänge und Leistungen zu untersuchen (siehe dazu den Exkurs am Ende des ersten Kapitels). Plötzlich schien es möglich zu sein, der Arbeit des menschlichen Geistes und dem Wirken von Gefühlen und Motiven im Gehirn buchstäblich zuzuschauen. Die ersten, noch sehr groben PET- oder fMRI-Bilder waren eine Sensation, und man glaubte, jetzt sehen zu können, was im Gehirn einer Person geschieht, wenn sie ihre Aufmerksamkeit beispielsweise auf einen bestimmten Gegenstand im linken Gesichtsfeld richtet oder den Worten der Lehrerin oder Professorin konzentriert lauscht. Von einem Gedankenlesen, das heißt der Erfüllung eines alten Menschheitstraums, war das noch weit entfernt. Aber schnell verfeinerten sich die Methoden, und insbesondere konnten immer mehr neurophysiologische und neurochemische Erkenntnisse darüber gesammelt werden, wie die mit den genannten bildgebenden Methoden erfassten neuronalen Prozesse im Detail ablaufen. Zu untersuchen, ob das Geschehen im Gehirn bei sensorischen, kognitiven, emotionalen und motorischen Prozessen lückenlos deterministisch abläuft, oder ob sich Anzeichen für die Einwirkung des »bewussten Geistes« auf die Gehirnprozesse entdecken lassen, wie manche Philosophen annahmen, war zur realen Forschungsmöglichkeit geworden. Journalistisch entstand eine wahre Euphorie der »bunten Gehirnbilder«, an der sich auch mancher seriöse Neurowissenschaftler beteiligte.
16Ein wahrer Paukenschlag waren die 1983 veröffentlichten Untersuchungen des US-amerikanischen Neurobiologen Benjamin Libet (1916-2007) und seiner Mitarbeiter zum Zusammenhang zwischen der sogenannten freien Willensentscheidung zu einer bestimmten Handlung einerseits und diversen neuronalen Prozessen wie dem schon länger bekannten »Bereitschaftspotenzial« andererseits. Dabei handelt es sich um ein aus dem EEG gefiltertes neuronales Signal der Großhirnrinde, das willentlichen Bewegungen vorhergeht. Als gläubiger Katholik wollte Libet eigentlich die Existenz einer rein geistigen Willensfreiheit neurophysiologisch beweisen. Was er jedoch fand, war die irritierende Tatsache, dass bei sehr einfachen Bewegungen das damit zusammenhängende Bereitschaftspotenzial eindeutig dem entsprechenden subjektiven Willensentschluss nicht folgte, sondern ihm vorausging. Er meinte herausgefunden zu haben, dass der Mensch »rein geistig« motorische Reaktionen, wenn schon nicht auslösen, so doch in letzter Sekunde verhindern konnte, was sich allerdings später als Irrtum herausstellte, denn auch diesem »Veto« geht ein Bereitschaftspotenzial voraus.
Heerscharen von Philosophen und geisteswissenschaftlich orientierten Psychologen fielen über den persönlich bescheidenen Professor Benjamin Libet her und behaupteten, das Ganze sei experimenteller Murks, zudem handele es sich ja nicht um echte Willensentscheidungen, sondern um eine einfache und stereotype Bewegung. Aber auch seriöse Psychologen und Neurobiologen äußerten Kritik am methodischen Vorgehen Libets, und zwar ganz unabhängig von dessen philosophischen Schlussfolgerungen. Methodische Verbesserungen wurden daher vorgenommen, komplexere Entscheidungssituationen wurden benutzt, aber im Prinzip wurden Libets Befunde eher bestätigt als widerlegt.
Diese und ähnliche Experimente, gefolgt von solchen zu anderen geistig-kognitiven und emotionalen Prozessen ein17schließlich der Sprache, des Denkens, des Bewusstseins, der Empathie und der Fairness, wurden und werden von zahlreichen Theologen, Philosophen und geisteswissenschaftlich orientierten Psychiatern vornehmlich in der Nachfolge von Karl Jaspers als Angriff auf die ihnen traditionell zustehende Deutungshoheit über den Menschen und seine psychisch-geistige Wesenheit gewertet. Verstärkt wurde dieser Eindruck eines »Neuro-Imperialismus« (sic!) durch Bücher aus der Feder von Neurowissenschaftlern, welche die Meinung vertraten, man wisse jetzt so viel vom Menschen und seinem Geist, dass man die Neurowissenschaften einfach an die Stelle des traditionell geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen Menschenbildes setzen könne.
Zu diesen in den vergangenen Jahrzehnten erschienenen Büchern gehören unter anderem L'homme neuronal (dt.: Der neuronale Mensch) des französischen Neurobiologen Jean-Pierre Changeux, The Astonishing Hypothesis. The Scientific Search for the Soul (dt.: Was die Seele wirklich ist) des britischen Physikers und Molekularbiologen Francis Crick, Descartes' Error. Emotion, Reason, and the Human Brain (dt.: Descartes' Irrtum. Fühlen, Denken und das menschliche Gehirn) des portugiesischen Neurowissenschaftlers Antonio Damasio, The Quest for Consciousness. A Neurobiological Approach (dt.: Bewusstsein – ein neurobiologisches Rätsel) des deutsch-amerikanischen theoretischen Neurobiologen Christof Koch und Consciousness and the Brain (dt.: Denken – Wie das Gehirn Bewusstsein schafft) des französischen Neurobiologen Stanislas Dehaene. Auch einige Schriften des Frankfurter Neurobiologen Wolf Singer schienen nahezulegen, dass er aufgrund der Erkenntnisse der Neurowissenschaften die Notwendigkeit eines neuen Menschenbildes sieht. Ich selbst habe seit meinem 1994 erstmals erschienenen Buch Das Gehirn und seine Wirklichkeit. Kognitive Neurobiologie und ihre philosophischen Konsequen18zen sowie in nachfolgenden Publikationen versucht, einen brachial reduktionistischen Standpunkt zu vermeiden und differenzierter zu argumentieren, und zwar vor allem aus meiner Kenntnis der Philosophie und der sonstigen Geisteswissenschaften heraus. Das wurde aber nicht immer wahrgenommen, obwohl es für mich in den vergangenen 20 Jahren zu einer sehr fruchtbaren Zusammenarbeit mit Philosophen, Psychologen, Psychiatern und Psychotherapeuten gekommen ist.
Fehler gab und gibt es auf beiden Seiten zur Genüge. Auf Seiten der Neurobiologen fehlte und fehlt es oft an einer Vertrautheit mit dem sehr komplexen Stand der Diskussion innerhalb der Philosophie des Geistes, auch wenn es hier sehr gut lesbare zusammenfassende Darstellungen gibt, zum Beispiel aus der Feder des Berliner Philosophen Michael Pauen (*1956). Fast jedes Jahr behaupten irgendwelche Neurobiologen oder Neurophilosophen, sie hätten das Geist-Gehirn-Problem gelöst, was bei näherem Hinsehen nicht der Fall ist. Auf Seiten der Geisteswissenschaftler fehlt es oft an dem nötigen Fachwissen und der Vertrautheit mit dem gegenwärtigen Stand der Neurowissenschaften.
Da der neurobiologische »Szientismus« immer näher zu rücken scheint, wird oft zu Argumentationen gegriffen, die nicht besser sind als die Bemühungen, die Willensfreiheit quantenphysikalisch erklären zu wollen. So sprechen einige Kritiker von einem »neuen Dualismus der Hirnforschung«, da die Neurobiologen das Gehirn künstlich vom »Leib« trennten, wo dieser doch eindeutig vergeistigt sei. Die Neurowissenschaftler – so ein anderer Vorwurf – missachteten die Gesellschaftlichkeit des Menschen, die Einmaligkeit des menschlichen Geistes, die überaus wichtige Funktion der Sprache usw. Bei vielen, die solcherart Kritik äußern, hat man zwar den Eindruck, dass sie die Schriften, die sie angreifen, nur oberflächlich gelesen haben. Dennoch und bei aller 19Schärfe ihrer Kritik ist zu konzedieren, dass sie oft auf schwerwiegende inhaltliche Lücken oder zumindest Mängel in neurowissenschaftlichen Darstellungen aufmerksam macht.
In diesem Buch versuche ich, jenseits allen Kampfes um die Deutungshoheit über den Menschen und in Respekt vor den Argumenten geisteswissenschaftlicher Positionen zu untersuchen, ob und in welcher Weise neurowissenschaftliche Erkenntnisse, die meist nicht von psychologischen Erkenntnissen zu trennen sind, dazu beitragen können, ein umfassenderes Menschenbild zu entwerfen. Dies führt dann zur Frage nach der angeblichen Einzigartigkeit des Menschen und seiner Lebenswelt, dem Verhältnis der biologischen und sozialen Bedingungen der Persönlichkeitsentwicklung, dem Entstehen bewusster Ziele und unbewusster Motive, dem Grad der Veränderbarkeit unseres Fühlens, Denkens und Verhaltens, der Rolle des Ich in unserer Selbstempfindung und unserem Handeln, der Rolle der Intelligenz und ihren Wurzeln, den Entstehungsbedingungen gewalttätigen Tuns sowie den Möglichkeiten und Grenzen von Psychotherapie aus neurowissenschaftlicher Sicht. Schließlich geht es um eine Zentralfrage der Philosophie, nämlich die nach dem Verhältnis von Gehirn und Geist beziehungsweise nach der Natur des Bewusstseins, und um die Existenz einer mentalen Kausalität, das heißt einer Einwirkung des Geistes auf das Gehirn jenseits der Naturgesetze.
Die Fortschritte der Neurowissenschaften sowie die technischen und medizinischen Anwendungen der dabei gewonnenen Erkenntnisse durchdringen mittlerweile zutiefst unseren Alltag, aber in die Köpfe der meisten Menschen ist naturwissenschaftliches Denken und Handeln, verstanden als ein hypothesen- und empiriegeleiteter sozialer Erkenntnisprozess, kaum eingedrungen. Ich werde nie vergessen, dass führende Politikerinnen und Politiker unseres Landes, teilweise noch heute tätig, angesichts des Amoklaufs in Win20nenden sagten: »Warum der Täter das getan hat, wollen wir gar nicht wissen!«, und: »Da hilft nur noch Beten!« Als einige Kollegen und ich mit Unterstützung einer renommierten Wissenschaftsförderung und auf Bitten der Justiz jugendliche Intensivstraftäter auf mögliche psychologische, neurobiologische und soziale Gründe ihres Tuns untersuchen und ebenso die Wirkung therapeutischer Maßnahmen überprüfen sollten, stellte sich die Berliner Innenbehörde anfangs quer mit der Begründung, ein solches Projekt sei »unmenschlich«. Wir konnten es dann dennoch ausführen.
Es geht in diesem Buch nicht um einen »Neuro-Imperialismus« und auch nicht um eine Reduktion von Geist und Kultur auf Gehirnprozesse, sondern um die Frage, wie weit sich eine – vielleicht zunächst sehr provisorische – Brücke zwischen den Neurowissenschaften einschließlich einer empirisch arbeitenden Psychologie und den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften schlagen lässt. Dass dies nur unter Respekt vor den Eigengesetzlichkeiten der unterschiedlichen Betrachtungsebenen geschehen kann, versteht sich meines Erachtens von selbst. Freilich hängen menschlicher Geist und menschliche Kultur nicht in der Luft, sondern werden über das Gehirn als Organ des Körpers vermittelt. Das Gehirn wird dabei nicht nur durch genetische und epigenetische Faktoren beeinflusst, sondern die primäre und sekundäre soziale Umwelt prägt, wie wir sehen werden, bereits vorgeburtlich und dann massiv nach der Geburt die neuronalen Netzwerke, die das Fühlen, Denken und Handeln einschließlich der Kommunikation ermöglichen.
21Erstes Kapitel Vom Wunsch des Menschen, etwas Besonderes zu sein
In diesem Kapitel geht es um die Stellung des Menschen in der Natur. Speziell befassen wir uns mit der Frage, ob der Mensch etwas besitzt, was ihn einzigartig macht – und falls ja, was dieses Etwas ist: seine biologische Ausrüstung, sein Verstand, sein Gehirn, seine Sprache oder seine Gesellschaftlichkeit?
In Joseph Haydns Oratorium Die Schöpfung heißt es gegen Ende in etwas holprigem Deutsch:
Mit Würd' und Hoheit angetan, mit Schönheit, Stärk' und Mut begabt, gen Himmel aufgerichtet steht der Mensch, ein Mann und König der Natur. Die breit gewölbt' erhab'ne Stirn verkündt' der Weisheit tiefen Sinn, und aus dem hellen Blicke strahlt der Geist, des Schöpfers Hauch und Ebenbild.
Kein Wunder, dass die Uraufführung im Jahre 1798 in Wien ein Riesenerfolg wurde! Denn hier wird, begleitet von herrlicher Musik, dargestellt, wie der Mensch, namentlich der Mann, seine Stellung in der Natur sieht: Er ist ein Ebenbild Gottes, der ihm den unsterblichen Geist eingehaucht hat; er steht an der Spitze der Natur und reicht, aufrecht stehend, gleichzeitig über sie hinaus; seine gewölbte Stirn deutet, das vermutete man schon damals, auf ein großes Gehirn hin, mit dem er die Weisheit der Schöpfung und natürlich auch seine eigene erkennen kann.
22Die hier unterstellte Einzigartigkeit des Menschen ist fundamentaler Bestandteil der meisten Religionen und insbesondere in der jüdisch-christlich-muslimischen Tradition. Hier hat der Mensch als einziges Geschöpf auf der Erde Anteil am Göttlichen. Diese Auffassung hat in der abendländischen Ideengeschichte tiefe Spuren hinterlassen, und zwar auch dort, wo sich Philosophen von einer religiösen Letztbegründung der Einzigartigkeit des Menschen befreiten. Auch für sie war und ist der Mensch mit besonderen Fähigkeiten und auch mit besonderen Rechten ausgestattet. Eine solche Sicht war – wie wir sehen werden – auch grundlegend für die Entwicklung des Konzepts der Geisteswissenschaften ab Mitte des 19. Jahrhunderts. Aber selbst in den Natur- und Neurowissenschaften vertreten bis in die Gegenwart hinein renommierte Autoren diese Überzeugung. So heißt es in Human. The Science Behind What Makes Us Unique, dem 2008 erschienenen Buch des US-amerikanischen Neuropsychologen Michael Gazzaniga (*1939), die geistigen Fähigkeiten des Menschen seien »Lichtjahre von denen seines nächsten biologischen Verwandten, des Schimpansen« entfernt. Einen ähnlichen Standpunkt nimmt der deutsch-neuseeländische Psychologe Thomas Suddendorf (*1967) in seinem 2013 erschienenen Buch The Gap. The Science of What Separates Us From Other Animals ein.
Zweifellos ist die Frage, welche Stellung der Mensch aus welchen Gründen in der Natur einnimmt, zentral für unser Menschenbild. Sie wird seit dem Altertum gestellt, und mit Blick auf die darauf gegebenen Antworten lassen sich drei Grundpositionen unterscheiden.
Die erste Position geht von unterschiedlichen Seins- oder Wesensstufen in unserer Welt aus, so etwa den Stufen der unbelebten Dinge, der Pflanzen, der Tiere und schließlich der des Menschen. Bei Letzterem kommt es zu der Besonderheit, dass er – und nur er – über Seinsmerkmale verfügt, die über 23die Natur hinauszuweisen scheinen, beispielsweise eine unsterbliche Seele oder Verstand und Vernunft, von denen man annahm, dass sie dem Menschen – und nur ihm – vom Schöpfergott verliehen wurden. Der Mensch ist einerseits verbunden mit der übrigen Natur, ragt aber gleichzeitig über sie hinaus. Es ist dieser Position zufolge deshalb unmöglich, den Menschen nur über seine physisch-materiellen Eigenschaften zu begreifen, denn er ist auch ein Geistwesen. Wenn die Naturwissenschaften diejenige Disziplin sind, welche die natürlichen Dinge und Vorgänge zu erklären versuchen, dann sind sie, so die Schlussfolgerung, per se ungeeignet, das spezifisch Menschliche zu erfassen, welches als Geist seine Natur transzendiert. Es handelt sich bei dieser Position um einen ontologischen Antinaturalismus.
Die zweite Position sieht den Menschen hingegen als Teil der Natur, nimmt jedoch an, dass es im Verlauf der Evolution hin zum Menschen Sprünge gegeben hat, bei denen etwas völlig Neues entstanden ist. Hierzu gehören Verstand, Vernunft, Bewusstsein, Intentionalität, Sprache, Kunst, Wissenschaft und Gesellschaftlichkeit. Diese Merkmale machen den Menschen einzigartig, auch wenn sie auf evolutive Weise entstanden sein mögen. Im philosophischen Diskurs bezeichnet man diese Position als »starke Emergenztheorie« (von »emergieren«, auftauchen). Auch ihr zufolge lassen sich die genannten Merkmale mit den Methoden der Naturwissenschaften grundsätzlich nicht erklären, weil der Mensch qua Geist nicht den geltenden Naturgesetzen unterliegt.
Die dritte Position ist die des Naturalismus. Dieser ist der Überzeugung, dass es innerhalb der Natur weder Wesensunterschiede noch stark emergente Eigenschaften gibt, die sich einer naturwissenschaftlichen Welterklärung prinzipiell entziehen. Alles, was beim Menschen bisher als einzigartig angesehen wurde, stellt sich – so der Naturalismus – bei genauer Forschung als Fortentwicklung bereits vorhande24ner Strukturen und Merkmale heraus. Es gibt dieser Position zufolge also eine Kontinuität der Entwicklung, und das gilt selbst für geistig-bewusste Tätigkeiten, die aufgrund von Wechselwirkungen natürlicher, das heißt in diesem Fall: durch die Naturwissenschaften potenziell erfassbarer Prozesse entstehen. Erkenntnistheoretisch schlägt sich dieser Naturalismus meist in einer Identitätstheorie nieder, womit gemeint ist, dass Natur und Geist des Menschen identischen Grundprinzipien unterliegen.
Jede dieser Positionen liegt in zahllosen Versionen und Abwandlungen vor, und jede hat ihre bekannten erkenntnistheoretischen Vor- und Nachteile, von denen noch zu sprechen sein wird.
Seelenlehre und Vitalismus
Systematisch haben sich mit der Frage nach der Einzigartigkeit des Menschen die Philosophen des griechischen Altertums, vornehmlich Platon (ca. 428-348 v. Chr.) und Aristoteles (384-322 v. Chr.), beschäftigt. Typisch war die Überzeugung, das gesamte Universum sei »beseelt« – und zwar von einem Urprinzip, pneuma genannt, auf Deutsch: Odem. Dieses Urprinzip ging von einem göttlichen Wesen aus oder war identisch mit ihm. Ein Grundproblem der antiken Philosophie war die Herkunft beziehungsweise der Ursprung der allumfassenden Bewegung, der die Sterne, die Monde, aber auch die Ozeane, die Pflanzen und Tiere und schließlich auch der Mensch unterliegen. Es musste jemanden geben, der diese Bewegung hervorgerufen hatte, und zwar ohne sich selbst zu bewegen – denn die Ruhe ist der göttliche Primärzustand. Diese Vorstellung von Gott als dem »unbeweg25ten Beweger« war bis weit in die neuzeitliche Physik gängig.
Bewegung war aber nicht das einzige Rätselhafte. Es gibt ja offensichtliche Unterschiede zwischen der unbelebten und der belebten Natur und innerhalb der belebten Natur zwischen den Pflanzen, den Tieren und dem Menschen. Dies wurde durch die sogenannte »Drei-Seelen-Lehre« erklärt, die von Platon und Aristoteles vertreten wurde. Innerhalb der Natur gebe es nach dieser Anschauung eine Lebenskraft, eine anima vegetativa, die sich bei allen Lebewesen findet, also bei Pflanzen, Tieren und Menschen als den drei damals bekannten Arten von Lebewesen. Heute noch klingt dies übrigens in der Biologie in dem Begriff des »vegetativen Nervensystems« nach.
Tiere sind nach dieser Lehre den Pflanzen darin überlegen, dass sie sich von Ort zu Ort bewegen können, Sinnesorgane wie Augen, Ohren und Nase und sogar bestimmte kognitive Fähigkeiten besitzen, die denen der Menschen teilweise sehr ähnlich sind. Überdies erweisen sich einige Tiere, etwa Affen, Hunde, Papageien und Rabenvögel, als gelehrig. Dies alles werde bewirkt durch eine »tierische Seele«, eine anima animalis. Der Begriff »Tierseele« war noch Ende des 19. Jahrhunderts sehr geläufig, um die rein physiologischen Abläufe im Nervensystem zu beschreiben. Beide Seelenarten – die anima vegetativa und die anima animalis – wurden als stofflich und sterblich angesehen.
Der Mensch gelte im Reich der Lebewesen insofern als einzigartig, als ihm neben der vegetativen und tierischen Seele ein dritter Typ von Seele, nämlich die anima rationalis beziehungsweise der spiritus rationalis – die »Vernunftseele« – zukomme. Diese bildet die Grundlage seiner geistigen Fähigkeiten, die von ganz anderer Art seien als die Gelehrigkeit der Tiere. Tiere haben demnach weder Verstand noch Vernunft, sondern werden von Instinkten geleitet. Zudem wur26de die anima rationalis schon von antiken Philosophen wie Platon mehrheitlich als unsterblich angesehen. Das frühe Christentum hat dann diese ursprünglich ihm fremde Idee übernommen, worin ihm auch der Islam gefolgt ist.
Diese Lehre von den drei Seelen besaß auch in den Naturwissenschaften bis weit in die Neuzeit hinein Gültigkeit und war deshalb so erfolgreich, weil sie auf ganz einfache Weise den Aufbau der Welt der Lebewesen und die offensichtliche Sonderstellung des Menschen erklären konnte. Es galt bis ins 19. Jahrhundert als ausgemacht, dass es einen fundamentalen Unterschied zwischen der unbelebten, also der anorganischen, und der belebten, der organischen Materie gibt. Im Jahre 1828 wies der deutsche Chemiker Friedrich Wöhler mit der Synthese von Harnstoff, einer »organischen« Verbindung, nach, dass es einen solchen Unterschied nicht gibt. Es zeigte sich, dass Pflanzen, Tiere und Menschen aus chemischen Grundbausteinen aufgebaut sind, die sich auch in der »toten« Natur finden.
Diese revolutionäre Erkenntnis passte der damaligen romantischen Naturphilosophie ebenso wenig in den Kram wie den meisten damaligen Naturforschern. Die Idee einer speziellen immateriellen Lebenskraft, später auch vis vitalis genannt, hielt sich deshalb lange weiter und erlebte sogar Ende des 19. Jahrhunderts einen neuen Aufschwung, wesentlich befördert von Anschauungen des Entwicklungsbiologen Hans Driesch (1867-1941), der von zielgerichteten (teleologischen) Naturkräften ausging. Diese Sicht gilt aber heute als völlig überwunden, denn anstelle einer mystischen Lebenskraft kann man mit molekularbiologischen Mitteln die Ontogenese von Lebewesen auf der Grundlage von Signalmolekülen ziemlich genau nachweisen.
27Auf der Suche nach dem Sitz der Seele
Wie gehört, vertraten Platon und wohl auch Aristoteles die Vorstellung, der Mensch – und nur er – habe eine unstoffliche und unsterbliche Seele. Wie aber etwas Immaterielles wie Geist und Seele mit dem materiellen Gehirn (Platon) beziehungsweise Herzen (Aristoteles) interagieren kann, darüber haben sich die beiden Philosophen keine Gedanken gemacht, denn sie wussten noch nichts vom Prinzip der Erhaltung von Energie und Impuls als Grundlage physikalischer Wechselwirkung.
Der griechisch-römische Arzt Claudius Galenos (129-199 n. Chr.) hat als einer der Ersten eine Theorie darüber entwickelt, wie Gehirn und Geist miteinander interagieren. So nahm er an, dass der spiritus animalis (identisch mit der oben genannten anima animalis) aus dem universalen Odem (pneuma) über die Atemluft ins Blut gelangt. Das Blut gelange vom Herzen über die Schlagadern ins Gehirn und dann in ein Geflecht aus feinen Arterien, »Wundernetz« (rete mirabile) genannt. Dort werde, ähnlich wie der Weingeist (»Spiritus«!) aus dem Wein, die tierische Energie aus dem Blut in das Gehirn destilliert, genauer: in die Hirnventrikel, wo sie geistige Prozesse bewirkt. Über das Rückenmark werde die Energie im Körper verteilt und steuere seine Bewegungen. So weit Galenos.
René Descartes kannte die Schriften von Galenos gut und versuchte, das zu erklären, was Galenos nicht erklären konnte oder wollte, nämlich wie Gehirn und Geist tatsächlich miteinander interagieren. Er tat dies in verschiedenen Schriften, insbesondere in seinem bereits erwähnten Werk De homine, wo er einen radikalen wesensmäßigen Unterschied zwischen Geist und Materie propagierte und damit zum Begründer des neuzeitlichen Dualismus wurde, der 28ebendiese Trennung zum Programm gemacht hat. Ebenso radikal unterschied er in der Nachfolge Platons und im Rahmen der christlichen Lehre zwischen dem Menschen und allen anderen Lebewesen, indem er postulierte, dass nur der Mensch im Besitz einer unsterblichen »Vernunftseele« (anima rationalis) sei. Allerdings umfasste diese Seele anders als für dualistische Philosophen vor und nach ihm nur rein gedankliche Akte. Ansonsten seien der Mensch einschließlich seines Gehirns genauso wie alle anderen Lebewesen »Automaten« und funktionierten rein mechanisch, das heißt nach Druck und Stoß – der einzigen physikalischen Wechselwirkung, die er kannte. In dieses rein mechanische Geschehen schloss er auch Abläufe ein, die wir heute »psycho-physiologisch« nennen würden, das heißt die Steuerung aller Handlungen, die keinen bewussten Willen benötigen, also Reflexe, Instinkt- oder Routinehandlungen, aber auch Wahrnehmungsprozesse, die Ausbildung von Gedächtnisinhalten und sogar Gefühle.
Anders als die Philosophen vor ihm erkannte Descartes das Fundamentalproblem jeglichen Dualismus, nämlich die Erklärung der offensichtlichen Wechselwirkung zwischen dem materiell-mechanischen Gehirn und Körper und dem immateriellen Geist. Einerseits hatte für Descartes der Geist die Möglichkeit, das Gehirn als Instrument zu nutzen, um sich in der materiellen Welt zu »manifestieren«. Dazu muss er auf das Gehirn Einfluss nehmen, wie dies ein Pianist hinsichtlich des Klaviers oder Flügels tut – und deshalb nennt man diese Art von Dualismus »interaktiv«. Der Geist ist aber nach Descartes nicht allmächtig. Wie viele seiner Zeitgenossen nahm er fälschlich an, die Nerven seien Röhren, in denen der spiritus animalis fließe. Bei einem rein geistigen Willen, eine Bewegung auszuführen, müssen die Nervenröhren offen sein, damit der von der Epiphyse als »Sitz« des Geistes produzierte spiritus animalis hineinfließen könne. 29Manchmal jedoch verschließe sich das Gehirn auch dieser Einwirkung (so wie wenn eine Klaviertaste fehlt oder klemmt), so dass die rationale Seele nichts bewirken könne. Das ist übrigens für Descartes immer dann der Fall, wenn sich der Mensch aufgrund von »Leidenschaften«, die er ja als mechanisch entstanden ansieht, dem rationalen Verstand verweigert.
Wie aber setzt der rationale Geist seine Intentionen, beispielsweise in Form des freien Willens, in die Bewegung des Spiritus animalis um? Descartes kannte oder besser erahntedas fundamentale Naturprinzip der Erhaltung von Energie und Impuls, physikalisch-mathematisch wurde es aber erst später formuliert. Dieses Prinzip bedeutete für ihn: Bei allen physikalischen Interaktionen gibt es immer einen Netto-Ausgleich. Er nahm an, Gott habe im Akt der Schöpfung der Welt ein festes Quantum an Bewegungsenergie mitgegeben und dies seither nicht mehr verändert. Gott müsse daher, um eine Verletzung der von ihm erlassenen Erhaltungssätze zu vermeiden, auch der rationalen Seele eine rein geistige Bewegungsenergie in Form des Willens als Teil der gesamten Bewegungsenergie des Universums verliehen haben.
Das könnte nach Materialismus riechen. Descartes fürchtete nichts so sehr wie einen solchen Vorwurf und beeilte sich zu sagen, diese Seelenkraft sei so klein, dass sie bei Messungen überhaupt nicht ins Gewicht falle und praktisch gar nicht physikalisch existiere – ein Argument, das uns noch bei einem anderen Dualisten, dem Neurophysiologen John Eccles (1903-1997), wiederbegegnen wird. Auf Descartes folgende Philosophen wie Arnold Geulincx (1624-1669) und Nicolas Malebranche (1638-1715) widersprachen allerdings diesem Notbehelf und erklärten, es gebe überhaupt keine Wechselwirkung zwischen Geist und Gehirn, die beobachtete Parallelität geistiger und neuronaler Prozesse sei ein von Gott bewirktes Wunder. Aber auch eine solche Anschauung 30gefiel der katholischen Kirche nicht, die ja an das sichtbare Wirken Gottes in der Welt glaubte (und bis heute glaubt), und so setzte sie die Bücher von Malebranche (immerhin einem Ordenspriester) auf den Index. Diese Patentlösung des Geist-Gehirn-Problems wurde dann von einem der bedeutendsten Philosophen der Neuzeit, Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), in seiner Monadologie übernommen.
Descartes setzte also einerseits die traditionelle ontologische Unterscheidung zwischen dem Menschen und allen anderen Lebewesen fort, machte diesen Unterschied aber entgegen der geschilderten antiken Seelenlehre am Besitz der Vernunftseele, also des reinen Denkens, und der Sprache fest. Alles andere ordnete er den Naturgesetzen unter und ebnete damit den Weg zu einem naturwissenschaftlichen Verständnis des Gehirns einschließlich der Wahrnehmungs- und Gedächtnisleistungen, der Emotionen und der Handlungsplanung. In diesem Sinne war er auch einer der Väter einer naturalistischen Theorie des Menschen.
Die biologische Einheit der Natur
Kaum etwas hat die Anschauung von der Stellung des Menschen in der Natur so verändert wie zwei Bücher von Charles Darwin (1809-1882), nämlich das 1859 erschienene Buch On the Origin of Species by the Means of Natural Selection (dt.: Über die Entstehung der Arten) und das 1871 erschienene Buch The Descent of Man (dt.: Die Abstammung des Menschen). Was der Autor in ihnen schrieb, brachte die über 2000 Jahre herrschende Meinung einer qualitativen Rangfolge der Lebewesen, der scala naturae, auf welcher der Mensch ganz oben und abgesondert steht, zum Einsturz. Freilich fie31len Darwins Anschauungen nicht vom Himmel, sondern die seit Ende des 18. Jahrhunderts heftig diskutierte Grundfrage lautete, ob – wie die biblische Schöpfungsgeschichte behauptete – die Lebewesen der Erde getrennt und nacheinander erschaffen worden waren, das heißt zuerst das Licht, das Firmament sowie Land und Meer, dann die Pflanzen, die Himmelskörper, die wasserlebenden Tiere, die Landtiere und schließlich der Mensch, alle nach ihrem eigenen Bauplan. Was die unterschiedlichen Tiergruppen und den Menschen betraf, so wurde es mit fortschreitenden Kenntnissen von deren Körperbau immer schwieriger zu erklären, woher die große Ähnlichkeit zwischen einzelnen Tiergruppen, zum Beispiel den Landwirbeltieren kommt, von der anatomischen Ähnlichkeit des Menschen mit den Primaten ganz zu schweigen.
Im 19. Jahrhundert kam es zu einer dramatischen Auseinandersetzung zwischen der Annahme einer von Beginn an getrennten Fortentwicklung der Arten auf der einen Seite, maßgeblich vertreten durch den französischen Paläontologen Georges Cuvier (1769-1832), und der Idee, dass alles Leben einen gemeinsamen Ursprung haben müsse und sich die existierenden Arten durch Veränderungen aus gemeinsamen Vorfahren auseinanderentwickelt hätten, auf der anderen, maßgeblich vertreten durch den Biologen Étienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844). Charles Darwin beendete wie erwähnt diesen Streit, als er zeitgleich mit Alfred Russel Wallace (1823-1913) in Über die Entstehung der Arten nicht nur überzeugende Beweise für den gemeinsamen Ursprung aller lebenden (und ausgestorbenen) Arten lieferte, sondern auch einen Mechanismus beschrieb, mit dem man die Abwandlung der Merkmale von Lebewesen über die Zeit erklären konnte, den er »natürliche Selektion« (natural selection) nannte.
Das Darwin'sche Konzept der gemeinsamen Stammesgeschichte aller Lebewesen gilt heute als gesichert und lässt 32sich bis in die Entstehung der einfachsten Lebewesen, der Bakterien und Archaebakterien, hinein verfolgen. Nur so kann man die große Übereinstimmung aller Lebewesen in vielen strukturellen und funktionalen Eigenschaften, beispielsweise im Aufbau der Zelle, bei den Reproduktionsmechanismen, beim Energiestoffwechsel usw. erklären.
In Über die Entstehung der Arten hatte Darwin vorsichtigerweise die Frage umgangen, ob denn das Konzept der gemeinsamen Stammesgeschichte aller Lebewesen auch für den Menschen gelten solle. 22 Jahre später hat er sie in Die Abstammung des Menschen bejaht. Der Mensch – so Darwin – sei definitiv eine abgewandelte Form affenartiger Vorfahren. Mit aller Radikalität vertrat er zudem die Auffassung, dass es seitens der geistigen Fähigkeiten zwischen dem Menschen und den anderen, nichtmenschlichen Tieren nur quantitative, aber keine qualitativen Unterschiede gebe. Er präsentierte dafür eine beeindruckende Fülle von Argumenten in so unterschiedlichen Themenbereichen wie Nachahmung, Aufmerksamkeit, gedankliche Reflexion, Wahlhandlungen, Werkzeuggebrauch, Gedächtnis, Einbildung, Ideenassoziationen, Selbstbewusstsein und Verstand, aber auch Eifersucht, Ehrgeiz, Dankbarkeit, Großherzigkeit, Betrug, Rache, Humor, Sprache, Liebe, Altruismus, Gehorsam, Scham, Moral, Ethik und sogar Religiosität. Das war ein Frontalangriff auf das damalige und teilweise auch heute noch verbreitete Bild von der geistig-kulturellen Einzigartigkeit des Menschen.
Darwins große Leistung bestand in der Begründung der Einheit der Natur hinsichtlich ihrer Abstammung. Die heutige Sicht geht weit über die biologische Evolution hinaus zu einem Bild der Gesamtevolution unseres Kosmos, in das sich die Evolution der Lebewesen einfügt. Es kann keinen Zweifel daran geben, dass Leben aus unbelebten Vorstufen entstanden ist. Die in Lebewesen anzutreffenden komplexen molekularen Strukturen sind Zusammenfügungen von 33Elementen, die auf der Erde seit ihrer Entstehung vor rund 4,5 Milliarden Jahren als Überreste von »Sternenstaub« vorhanden waren, wie Wasserstoff, Sauerstoff, Kohlenstoff und Schwefel, dazu einige Metalle und Schwermetalle. Leben ist aus heutiger Sicht eine spezifische Organisationsform von Atomen und Molekülen, welche die drei Grundleistungen der Selbstherstellung, der Selbsterhaltung und der Selbstvervielfältigung (Fortpflanzung) ermöglicht.
Auch in der langen, sich über einen Zeitraum von mindestens 700 Millionen Jahren erstreckenden Evolution der Gehirne hat es nur relativ wenige größere Veränderungen gegeben. Solche Prozesse gab es vor allem bei den Weichtieren (Mollusken), den Gliederfüßern (Arthropoden) einschließlich der Insekten und bei derjenigen Tiergruppe, der wir Menschen angehören, nämlich den Wirbeltieren. Je näher wir Menschen mit den anderen Primaten biologisch-genetisch verwandt sind, desto ähnlicher ist unser Gehirn denen dieser Tiere. Unser Gehirn, auf dessen Leistungen wir so stolz sind, unterscheidet sich von dem unserer nächsten Verwandten, den Schimpansen, in fast nichts außer in seiner Größe. Der Mensch (Homo sapiens) ist genetisch nahezu identisch mit dem Schimpansen (Pan troglodytes) und bildet mit ihm und dem Bonobo (Pan paniscus) eine natürliche Abstammungseinheit. Der moderne Mensch – Homo sapiens sapiens – entstand vermutlich vor rund 160 000 Jahren in Ostafrika, und ein Teil seiner Nachfahren brach vor rund 100 000 Jahren in kleinen Gruppen in die restliche Welt auf. Allerdings trug der moderne Mensch das Erbgut anderer Menschen aus Süd-, West- und Nordafrika in sich, die genetisch hinreichend miteinander verwandt waren, so dass sie fortpflanzungsfähige Nachkommen haben konnten. Die neueste Forschung hat ergeben, dass es zwischen dem modernen Menschen und dem Neandertaler (Homo neanderthalensis), der außerhalb Afrikas entstand, eine enge genetische Ver34wandtschaft gab, und alle Menschen außerhalb Afrikas tragen einige Prozente des Neandertal-Erbguts in sich. Auch in der langen Stammesgeschichte zeigen sich Einheit und Kontinuität in der Vielfalt, wie Darwin dies sah.
Antinaturalistische Strömungen in Geistes- und Sozialwissenschaften
Seit dem Ende des 18. Jahrhunderts beschleunigte sich im engen Zusammenhang mit den rasanten Fortschritten auf dem Gebiet der Technik und der Industrialisierung die Entwicklung der Natur- und Biowissenschaften. Das machte einen tiefen Eindruck auf die damalige Philosophie. Es wurden Forderungen laut, insbesondere aus dem Munde des großen Immanuel Kant (1724-1804), die Philosophie, die bis dato nur ein »bloßes Herumtappen« gewesen sei, solle sich methodisch wie inhaltlich an der Mathematik (Logik) und der Physik (Beobachtung und Experiment) ein Beispiel nehmen, wenn es um objektive Erkenntnis gehe. In den sich formierenden Vereinigten Staaten von Amerika entwickelte sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts der philosophische Pragmatismus, vertreten durch Charles S. Peirce (1839-1914), William James (1842-1910), John Dewey (1859-1952) und George Herbert Mead (1863-1931), in Frankreich trat relativ früh der bereits erwähnte »Positivismus« mit seinem Hauptvertreter Auguste Comte auf mit der Ansicht, die Philosophie und die sich daraus entwickelnden Sozialwissenschaften sollten sich wie die Naturwissenschaften auf sinnlich Erfassbares, Messbares und experimentell Untersuchbares, also die »Tatsachen« – eben das Positive – beschränken, und das gelte auch für alle Eigenschaften des Menschen und seiner 35Gesellschaft. Dies rief vornehmlich im deutschsprachigen Raum scharfen Protest hervor, und im Rahmen des sogenannten Historismus als der Betonung der Geschichtlichkeit des Menschen kam es zu einer Konzeption der Geisteswissenschaften, die bis in die Gegenwart hinein Gültigkeit beansprucht. Der wichtigste Protagonist dieser Bewegung war der Theologe, Philosoph und Pädagoge Wilhelm Dilthey (1833-1911). Dem vermeintlichen Paradigma einer erklärenden Wissenschaft, die sich auf die scheinbar unhistorische nichtmenschliche Natur bezieht, versuchte er eine verstehende Wissenschaft des menschlichen Lebens und Geistes und seiner besonderen, geschichtlich bedingten Leistungen entgegenzusetzen. Zentrale Tätigkeit der Geisteswissenschaften waren für Dilthey und seine Nachfolger das interpretierend-nacherlebende (»hermeneutische«) Verstehen der Welt des Geistes und seiner Schöpfungen.
Parallel zu Dilthey wandte sich der Philosoph und Mathematiker Edmund Husserl (1859-1938) schon früh gegen eine rein beobachtend-experimentelle Psychologie und entwickelte die »Phänomenologie« als die Methode der Philosophie, die geeignet sein soll, die Dinge so zu erfassen, wie sie sich im bewussten Erleben und nicht im kalten Experiment darstellen. Dieser phänomenologische Ansatz sollte nach Husserl die Philosophie wieder zur »ersten Wissenschaft« machen – eine Rolle, die sie im Triumphzug der Naturwissenschaften und Technik verloren zu haben schien. Zentral war dabei der Gedanke, dass alles, was der menschliche Geist erfasst, und wie er es erfasst, in der Lebenswelt des Menschen verankert ist. Diese Lebenswelt umfasst alles, was sowohl im Alltag als auch beim Denken und Handeln das typisch Menschliche ausmacht, nämlich das historisch Gewordene, Anschauliche, Konkrete, Sinn- und Bedeutungshafte sowie das Intentionale und Gesellschaftliche einschließlich der Sprache.
36Der Lebenswelt-Begriff von Husserl und Dilthey hat großen Einfluss auf die typisch kontinentaleuropäische Entwicklung der Geisteswissenschaften genommen und ist bis heute wirkmächtig. Das sieht man zum Beispiel in der Philosophie-Soziologie von Jürgen Habermas (*1929), vornehmlich in seinen wohl bedeutendsten Werken Erkenntnis und Interesse und Theorie des kommunikativen Handelns, der Begriff findet sich aber auch in weiten Bereichen der jüngsten deutschsprachigen Philosophie. Von Husserl und Dilthey übernahm Habermas zumindest in den genannten Werken auch den dezidierten Antinaturalismus und »Anti-Szientismus«, also die Ablehnung der Anschauung, Philosophie müsse sich an dem Vorgehen der Naturwissenschaften orientieren. Stattdessen müsse Philosophie, wenn sie über den Menschen rede, die »Totalität« der menschlichen, insbesondere gesellschaftlichen Existenz erfassen, und zwar mithilfe der »kommunikativen Vernunft«. Davon wird später noch die Rede sein.
Kritik an einem »positivistischen« Bild der Wissenschaft auf der Basis der Induktionsmethode (Hypothese-Experiment-Schlussfolgerung) übte auch der österreichisch-britische Philosoph Karl R. Popper (1902-1994). Er wurde bekannt für seine »Falsifikationstheorie«, das heißt die Annahme, wissenschaftliche Hypothesen könnten durch empirische Befunde niemals endgültig bestätigt, sondern nur widerlegt werden, sowie für seine Lehre von den drei Welten. Poppers drei Welten sind die physikalisch-materielle Welt (»Welt 1«), die Welt der psychischen Zustände, also der Emotionen, Empfindungen, Wünsche, bewussten und unbewussten Zustände (»Welt 2«), und schließlich die Welt der Erzeugnisse des menschlichen Geistes wie Denken, Sprache-Kommunikation, Musik und insbesondere auch die Wissenschaft (»Welt 3«). Nichtmenschliche Tiere besitzen keine solche Welt Nr. 3. Sie ist für Popper genauso wie für 37Husserl und Dilthey in ihrem Status einzigartig. Sie wird zwar von einzelnen Menschen geschaffen, verselbständigt sich aber als Welt des »intersubjektiven Geistes«. Dies stellt, wie Popper selbst eingeräumt hat, eine Art von Platonismus im Sinne einer unabhängig existierenden Welt des Geistes und der Ideen dar, man könnte auch sagen: einen Dualismus in Reinkultur.
Diese Vorstellungen führten Popper zu einer Zusammenarbeit mit dem Neurophysiologen John Eccles (1903-1997). In ihrem einflussreichen gemeinsamen Buch The Self and Its Brain, erschienen zuerst 1977 (dt.: Das Ich und sein Gehirn), nehmen beide Autoren zur Evolution des Geistes Stellung. Für beide steht fest, dass nur der Mensch ein vollumfängliches Bewusstsein in Form eines Ich- oder Selbstbewusstseins hat, sie gestehen aber Tieren einfachere Formen des Bewusstseins zu, etwa sinnliche Aufmerksamkeit. Das Ich- beziehungsweise Selbstbewusstsein sei beim Menschen unabdingbar mit der Evolution der Sprache verbunden, die zugleich die »Welt 3« erschaffe. Ihre Entstehung sei ein »Sprung« der Evolution zu etwas völlig Neuem im ontologischen Sinne.
In eine ganz ähnliche Richtung bewegte sich der österreichisch-deutsche Forscher Konrad Lorenz (1903-1989) in seinem 1977 veröffentlichten und sehr populären Buch Die Rückseite des Spiegels. Versuch einer Naturgeschichte menschlichen Erkennens