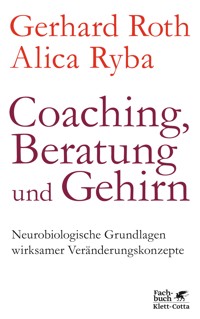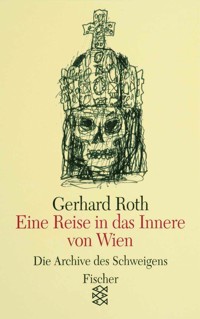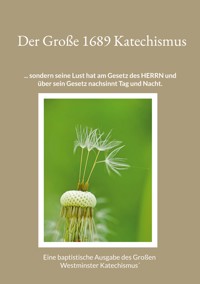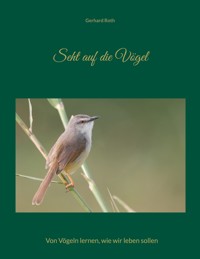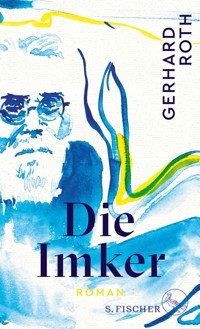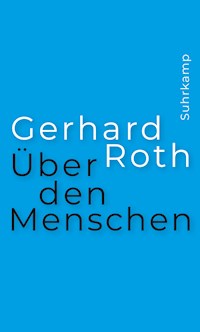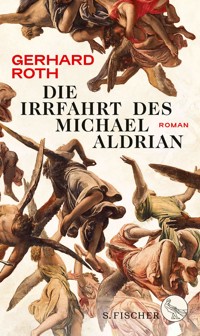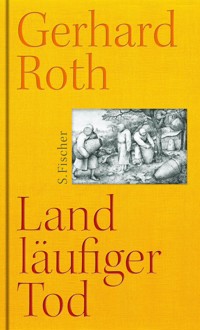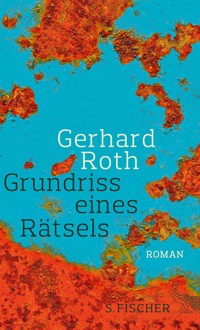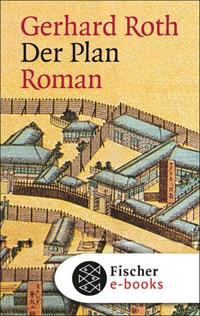9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein grandioses Porträt der Stadt Wien und ihrer Bewohner: ein literarischer Reiseführer, eine Erkundung der menschlichen Seele. In den fast zwanzig Jahren nach Erscheinen seines legendären Essaybands »Eine Reise in das Innere von Wien« hat Gerhard Roth unermüdlich weiter die Stadt erforscht, in der er seit vielen Jahren lebt. Seine neuen Erkundungsgänge führen ihn hinter die Kulissen des Naturhistorischen Museums und der Nationalbibliothek, durch das k.k. Hofkammerarchiv und die Wunderkammern der Habsburger, ins Josephinum und in das der Öffentlichkeit unzugängliche Gerichtsmedizinische Museum – grandiose Essays über menschlichen Größenwahn, Sammelwut und den Kampf gegen die Vergänglichkeit. Das Uhrenmuseum und der Zentralfriedhof – die Zeit und der Tod – sind die Leitmotive dieses Schreibens, im Mittelpunkt aber steht immer der Mensch: Gerhard Roths präzise Beschreibungen des Wiener Blindeninstituts und des Bundes-Gehörloseninstituts weiten sich zu einer bewegenden Geschichte der Ausgrenzung, und sein Besuch des Flüchtlingslagers Traiskirchen wird zur Studie über Menschlichkeit in einer globalisierten Welt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 637
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Gerhard Roth
Der Stadt
Entdeckungen im Inneren von Wien
Über dieses Buch
In den fast zwanzig Jahren nach Erscheinen seines legendären Essaybands »Eine Reise in das Innere von Wien« hat Gerhard Roth unermüdlich weiter die Stadt erforscht, in der er seit vielen Jahren lebt. Seine neuen Erkundungsgänge führen ihn hinter die Kulissen des Naturhistorischen Museums und der Nationalbibliothek, durch das k.k. Hofkammer-Archiv und die Wunderkammern der Habsburger, ins Josephinum und in das der Öffentlichkeit unzugängliche Gerichtsmedizinische Museum – grandiose Essays über menschlichen Größenwahn, Sammelwut und den Kampf gegen die Vergänglichkeit. Das Uhrenmuseum und der Zentralfriedhof – die Zeit und der Tod – sind die Leitmotive dieses Schreibens, im Mittelpunkt aber steht immer der Mensch: Gerhard Roths präzise Beschreibungen des Wiener Blindeninstituts und des Bundes-Gehörloseninstituts weiten sich zu einer bewegenden Geschichte der Ausgrenzung, und sein Besuch des Flüchtlingslagers Traiskirchen wird zur Studie über Menschlichkeit in einer globalisierten Welt.
Das Naturhistorische Museum – Die Kunst- und Wunderkammern der Habsburger – Das Wiener Uhrenmuseum – Das Josephinum und das Museum der Gerichtsmedizin – Das k.k. Hofkammer-Archiv und Franz Grillparzer – Die Nationalbibliothek – Das Wiener Blindeninstitut – Das Bundes-Gehörloseninstitut – Das Flüchtlingslager Traiskirchen – Der Neusiedler See – Der Zentralfriedhof
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Covergestaltung: hißmann, heiilmann, hamburg
Coverabbildung: © Bildersammlung, Sammlungen der MUW
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2011
© 2009 Gerhard Roth
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-401320-6
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Prolog
Die Welt in einer Nussschale
Mozarts Schädel
Kleine Expedition in das Universum der Schöpfung
Das Archiv
Hinter den Kulissen
Der begehbare Traum
Eine Reise in die vierte Dimension – ein fraktaler Bericht
Zeit und Wahn
Franz Joseph Gall, Laurence Sterne, Marquis de Sade und Albert Einstein
Kurze Beschreibung des Museums
Ein Rundgang mit Abschweifungen
Erinnerung an Rechenmaschinen
Kleine Geschichte der Uhr
Zeitreisen
Fortsetzung des Rundganges. Zeit und Kirche.
Intermezzo
Das Ende der Zeit, ein uhrenphilosophischer Abriss Erster Teil
»Blaubart«
Das Ende der Zeit, ein uhrenphilosophischer Abriss Zweiter Teil
Eine Enzyklopädie des menschlichen Körpers
Das Gedächtnis aus Papier
Mozarts Requiem und der Sarg von Wien
Der Sarg von Wien
Mozarts Requiem
Nachtschrift
Erich Schmid Schreiben ist Denken – Erfahrungen aus meiner Schreibbiographie
Die fliegenden Hände
Ein Vorfall
Kindheitserfahrungen, Begegnung auf dem Land
Das Handalphabet
Meine Mutter
Die Geschichte der Taubstummen
Medizin und Gehörlose
Besuch in der Maygasse
Das Leben im Institut in der Zeit der Monarchie und danach
Das Geburtstagsfest
Ins Ungewisse
Das Meer der Wiener
Epilog
Drucknachweise
Wien, Am Heumarkt 7
Prolog
Ich schlich hinunter in die Keller …
Ich habe Wien seit 1986 durchforscht. Mehrere Jahre schrieb ich Essays für das ZEIT- bzw. das FAZ-Magazin, die dann unter dem Titel »Eine Reise in das Innere von Wien« als Buch erschienen. Seither habe ich mich auf andere Schauplätze konzentriert, beispielsweise das Haus Am Heumarkt 7, in dem ich seit 1988 wohne. Mich faszinierte an ihm besonders der Zustand seines Verfalls. Das Gebäude ist eigentlich ein Palais, das der Oberbefehlshaber der k.u.k. Armee Conrad von Hötzendorf erbauen ließ. Deshalb hat es auch einen kasernenartigen Charakter. Es besteht aus zwei Höfen mit alten, hohen Bäumen: Kastanien und Platanen vorzugsweise. Der Ast einer Platane wuchs, bis man ihn abschnitt, direkt vor das Fenster meines Arbeitszimmers, stieß zuletzt an das Glas und scharrte leise bei Wind. Ich hatte vom Schreibtisch aus das Gefühl, in der verlängerten Baumkrone zu sitzen, und war dadurch immer zum Schreiben animiert. Der Baum zeigte mir die Jahreszeiten besser an als jeder Kalender, und ich versank nicht in jenen abstrakten Zeit-Raum, den ich seit einem einjährigen Aufenthalt in einem Hamburger Haus am Holzdamm fürchte: Vom Fenster aus sah ich dort nur eine Ziegelwand mit einer Uhr und der Überschrift »Normalzeit«. Es gibt seither für mich keinen schlimmeren Ausblick als eine öde Hauswand mit einer Uhr, die immer gnadenlos die vergehende und vertrödelte Zeit registriert. Ein Baum hingegen altert mit mir, und in den Jahreszeiten, den sich verfärbenden und abfallenden Blättern spiegelt sich nicht nur der Tod, sondern im frühlingshaften Grün auch die Wiedergeburt.
Das Gebäude Am Heumarkt 7 war damals, wie gesagt, verfallen, der Verputz abgeblättert, Feuchtigkeit stieg im Erdgeschoss hoch, und es machte einen verwahrlosten Eindruck. Trotzdem fühlte ich mich als Bewohner wohl, ich hatte meine Wohnung renoviert und genoss den Blick vom zweiten Stock, sozusagen aus der Vogelperspektive, auf die malerischen Mauerflecken. Im Nebenhof hatte Ingeborg Bachmann zwei Jahre gewohnt, und ich entdeckte auch ein Ehepaar mit Namen Malina (dem Titel von Ingeborg Bachmanns gleichnamigem Roman), das mir gegenüber auf der anderen Seite des Hofes wohnt.
Ein Stück weiter vom Gebäude befindet sich ein verschlafenes Café, das Café Heumarkt, das nur leidenschaftliche Besucher oder leidenschaftliche Nichtbesucher kennt. Ich gehörte zu den leidenschaftlichen Besuchern, ich fand dort zunächst gerade das, was ich bei meinem Fenster in Hamburg zu hassen gelernt hatte: Eine Uhr aus den fünfziger Jahren hing an einer Wand, allerdings war es immer drei viertel zwölf. Das ist eine gute Stunde, und das Zusammentreffen des Interieurs aus den fünfziger Jahren mit der stehengebliebenen Uhr vermittelte mir stetig den Eindruck, in Sicherheit zu sein. Das Café Heumarkt war lange Zeit aus diesem Grund für mich ein Fluchtpunkt. Ich schrieb in meinem Versteck nicht, sondern las Zeitung, aß zu Mittag oder trank mit Freunden wie Michael Schottenberg, Karlheinz Kratzl und Peter Pongratz hin und wieder mehrere Gespritzte. Aber es war immer nur mein Stammcafé, niemand kam dort mehr als einmal hin (und schon gar nicht regelmäßig), was mir recht war. Ich nannte es in meinem Kopf »Vorzimmer des Todes«. Mit Günter Brus machte ich einmal am Schließtag ein Interview für eine Kunstzeitschrift, das bezeichnenderweise nie erschien. Der Besitzer händigte uns die Schlüssel aus und gestattete uns, uns selbst zu bedienen, wir mussten nur die Getränke auf einem Block notieren, und ich würde am nächsten Tag die Rechnung begleichen. Natürlich stellte sich die Tonbandaufzeichnung der sechsstündigen Sitzung im ansonsten leeren Café als Dokument des allmählich einsetzenden Schwachsinns und alkoholbedingten Wiederholungszwanges heraus, aber es passte zum Café, obwohl es nicht typisch für die ansonsten stille Atmosphäre war, die nur von knackenden Parketten, dem Klicken der Billardkugeln und dem Scheppern von Metalltassen auf den Marmortischen unterbrochen wurde.
Ich fing an, die Mauerflecken des Gebäudes Am Heumarkt 7 zu fotografieren, stromerte an anderen Tagen in der Stadt herum, betrachtete mit wachsender Begeisterung in verschiedenen Bezirken Wiens die Mauerflecken und die in ihnen verborgenen Bilder, verglich sie mit dem Hintergrund von Gemälden im Kunsthistorischen Museum und fotografierte sie schließlich, bis ich eine eigene Stadtkarte der österreichischen Hauptstadt beisammen hatte. Manche Bezirke oder Gebäude sind darauf sofort zu erkennen, wie zum Beispiel Schönbrunn an seinem unverwechselbaren Gelb oder der 2. Bezirk an seinem melancholischen Grau. Ich hatte auch das Glück, die Schönheit von Rostflecken auf einer eisernen Tür oder auf Scharnieren zu entdecken, die bezaubernde Anmut eines chemischen Prozesses, die mich an Flechten auf Baumstämmen oder Steinen erinnert, und in manches alte Wiener Haus schlich ich hinein, und es gelang mir auch immer wieder, bis in den Keller vorzudringen und dort schöne Flecken zu studieren, woraus allmählich ein phantastischer Atlas aus imaginären Landkarten in meinem Kopf entstand, die eine rätselhafte Welt zum Vorschein brachten.
Die Wiener bestehen in der Regel aus einer Mischung aus Missmut und schlechtem Gewissen. Die offenbar nur beim Heurigen und privat anzutreffende Lustigkeit ist im Alltag zumeist vom Nieselregen einer chronisch schlechten Laune getrübt, die aber wiederum wie abblätternder Verputz ist und deshalb auch ihre verborgenen Reize hat. (Wie ja auch die Muräne ein bissig aussehender Fisch ist, dessen Fleisch aber als Delikatesse gilt.)
Die mir mitunter von einer fremden Hausmeisterin gestellte Frage nach meinem Grund und der Erlaubnis, die ihrer Meinung nach hässlichen Mauern zu fotografieren, konnte ich nicht wahrheitsgemäß beantworten, da es mir bei noch so angestrengten Bemühungen vermutlich nicht gelungen wäre, Übereinstimmung zu erzielen, dass sie schön seien, etwa wie eine Schwarz-Weißfotografie des Sternenhimmels. Stattdessen stellte ich barsch die Gegenfrage, seit wie lange die Mauern schon in einem solchen Zustand seien, und machte nebenbei eine weitere Aufnahme. Mein schroffes Auftreten zeigte immer die gewünschte Wirkung. Misstrauen und schlechtes Gewissen verstärkten sich zwar, aber die üble Laune verlegte sich sichtlich von der Sprache in die Physiognomie der Betreffenden. Das Verstummen und angestrengte Nachdenken meines jeweiligen Gegenübers war dann das Zeichen zum raschen Aufbruch.
Es war übrigens richtig, dass ich mit meinen Recherchen frühzeitig begann, denn die schöne Gemäldeausstellung der Mauerflecken droht zu verschwinden. Am Heumarkt 7 wurde zum Beispiel das gesamte Gebäude frisch verputzt und generalsaniert, gleichzeitig wurde die Miete erhöht. Dort, wo ich früher aus Begeisterung auf der Stiege am Steinboden kniete, um zu fotografieren, wo ich vor einem schimmeligen Stück Mauer in Entzücken geriet, niederkniete und eine Aufnahme machte, finde ich jetzt auswechselbare Farben. Und von der einstigen Aschenputtel-Schönheit des Gebäudes spüre ich nur noch etwas, wenn ich, in nostalgische Gedanken an die vormalige Pracht des Platanenastes versunken, plötzlich erkenne, dass er wieder auf mein Arbeitszimmer zuwächst, fast unmerklich, aber doch. Und vor allem, wenn im Winter die Krähen kommen und sich im Schnee im Hof niederlassen. Sie krächzen und schnarren wie Aufziehtiere. Ich studiere, wie der Schwarm sich stetig in seinen Bewegungen verändert. Als Verfechter der Chaos-Theorie und ewiger Student der fraktalen Geometrie, die seit meinem Roman »Landläufiger Tod« mein Schreiben und literarisches Denken beeinflusst und inspiriert, als Bewunderer von Vergrößerungen der schönen Randdetails und beglückter Betrachter von Darstellungen der selbstähnlichen Struktur der sogenannten Mandelbrotmenge, kann ich die Krähenschwärme lange, um nicht zu sagen stundenlang betrachten, in der Absicht, eine unbekannte Ordnung im Schwarm zu entdecken, der sich im Schnee wie lebendig gewordene Noten auf einer weißen Seite Papier hüpfend ausbreitet und wieder zusammenzieht. Welche unhörbare Musik komponieren sie? Und wenn sie hörbar wäre, wie klänge sie? Und wenn es keine Noten sind, sondern tierische Hieroglyphen, in die Luft gekratzt oder beim Fressen mit dem Schnabel in den harten Winterboden gemeißelt, was verkünden sie? Und sind es Zeichnungen, was stellen sie dar? In diesen Krähenschwärmen ist ein großes Rätsel verborgen, das die Naturwissenschaft, genauer gesagt die Ornithologen, offenbar nicht interessiert. Vom Ankommen im November bis zum Abflug im Februar, von der Sitzordnung auf Bäumen bis zum lautstarken Anflug des Schlafplatzes am Steinhof wird bei den Krähenschwärmen eine Ordnung, ein inneres Wissen sichtbar, die mich fasziniert. Ich sah einmal, wie eine vermutlich kranke Krähe im Hof zurückblieb, als der Schwarm im März zum Rückflug aufbrach. Tage später flog eine Nachhut mehrmals laut krächzend über die Dächer und nahm mit der kranken Krähe Kontakt auf. Zwei Tage lang wiederholte sich dieser Vorgang, diesmal nur von zwei Krähen, bis am dritten die Krähe mit den beiden anderen »Wächtern«, wie ich sie für mich selbst nannte, davonflog.
Ich habe Hunderte Bilder von den Krähen im Hof aufgenommen, die Form ihrer Flügel beim Auffliegen und beim Landen ist wunderschön. Begeistert fotografierte ich auch die Spuren der Krähen im Schnee und Eisblumen auf den Fenstern des ungeheizten Vorzimmers zu meiner Schreibwohnung. Die Bilder gehören zu den anregendsten, die ich gemacht habe, allerdings habe ich nicht oft Gelegenheit dazu, denn die kalten und niederschlagsreichen Winter sind selten geworden – die Klimaforscher finden Erklärungen dafür. Aber auf irgendeine seltsame Weise gehören alle beschriebenen Fotografien zusammen: die Mauerflecken, die Krähen, die Eisblumen, ja selbst die des alten Cafés, die ich später nachholte.
Die Welt in einer Nussschale
Das Naturhistorische Museum
Mozarts Schädel
Im Winter 1989 ging ich einmal spät abends, als die Krähen längst zu ihrem Schlafplatz am Steinhof geflogen waren, in Begleitung eines Beamten durch das Naturhistorische Museum in Wien. Ich hatte erfahren, dass der Schädel des Komponisten von der Internationalen Stiftung Mozarteum an die Anthropologische Abteilung »zur Überprüfung der Identifizierung« übergeben worden sei, und es war mir durch Vermittlung eines Journalisten gelungen, eine sogenannte inoffizielle Erlaubnis zu erhalten, die geheimnisvolle Reliquie zu sehen. Der mir unbekannte Beamte, der kurz vor der Pensionierung stand, erwies sich dabei als ein zwar eigenartiger, aber kundiger Gesprächspartner über Mozarts Oper »Die Zauberflöte« und die Geschichte des Naturhistorischen Museums. Er bot mir, halb im Scherz, eine »Nachtführung« mit Taschenlampe an, wie sie vorwiegend für Schulklassen, aber auch für Neugierige, die eine Vorliebe für romantische Schauer haben, abgehalten werden. Wir stiegen im Halbdunkel die breite Marmortreppe, die sogenannte »Prunkstiege«, hinauf bis zum großen Gemälde des Kaisers Franz I., vormals Franz Stephan von Lothringen, des Gemahls Maria Theresias und Vaters ihrer fünf Söhne und elf Töchter. Oben angekommen, wies der Beamte mit seiner Taschenlampe auf den im Stil des Rokoko mit einem roten, goldbestickten Gehrock, roten Kniehosen, weißen Strümpfen, schwarzen Schnallenschuhen und einer weißen Perücke gekleideten Monarchen hin und hob ihn dadurch gleichsam aus der Dunkelheit heraus wie eine Heiligenerscheinung. Durch den Ankauf der berühmten, 30 000 Objekte umfassenden Sammlung Johann von Baillous, der als späterer Direktor des »Naturalien-Cabinets« mit Perücke und in blauer Artilleriestabsuniform hinter dem an einem Tisch sitzenden Kaiser dargestellt ist, habe Franz I., wie der Beamte außer Atem und stockend ausführte, den Grundstein »für die heute mehr als zwanzig Millionen Objekte umfassende Kollektion des Naturhistorischen Museums« gelegt. Die zu Zeiten Kaiser Franz I. noch bestehenden Kunst- und Wunderkammern der Habsburger, gleichfalls unüberschaubar groß (vor allem durch die Gier des wahnsinnig gewordenen Rudolf II. in Prag), hätten zwar Seychellennüsse, Panzer von Karettschildkröten, Elfenbein, Nashörner oder Narwalzähne, die fälschlicherweise für die Waffen des legendären Einhorns gehalten wurden, beinhaltet, doch seien diese sogenannten Exotica und Curiosa wegen ihrer vermeintlich magischen Wirkung und nicht wegen des wissenschaftlichen Wertes geschätzt worden. Baillous Sammlung, die in der Hofburg aufgestellt worden sei, fuhr der Beamte noch immer heftig atmend fort, habe vor allem aus Mineralien, Fossilien, Korallen sowie Schnecken- und Muschelschalen bestanden. Pflanzen und Tiere seien damals – nicht zuletzt wegen der zum Teil noch ungelösten Präparationsprobleme – lebend in botanischen Gärten und Menagerien gehalten worden. Allerdings habe man vom Ausstopfen bald nicht genug kriegen können und sogar die Häute des angesehenen Hofmohren Soliman sowie dreier weiterer nach Europa verschleppter und hier verstorbener Afrikaner aufgespannt und zur Schau gestellt, bis die Menschenpräparate im Revolutionsjahr 1848 auf dem Dachboden im Augustinertrakt der Hofburg, wohin man sie letztendlich aus Platzgründen geschafft habe, verbrannt seien. Der Beamte machte eine Pause und fuhr dann fort, dass das Gemälde vor uns erst acht Jahre nach dem Tod des Kaisers entstanden sei. Die Franz I. umgebenden Möbel – Schränke mit verglasten Türen – hätten nie existiert, und die dargestellten Säle im Augustinertrakt seien erst später bezogen worden.
Die Archivarin des Hauses, Frau Professor Riedl-Dorn, fand übrigens noch weitere Merkwürdigkeiten an diesem zunächst wenig auffallenden Gemälde, wie sie mir in einem Gespräch mitteilte. Neben dem Kaiser und dem Leiter des »Naturalien-Cabinets« Baillou sei der Leibarzt Maria Theresias und Präfekt der Hofbibliothek Gerard van Swieten – ein Buch an die Brust gedrückt – dargestellt. Außerdem der mit Perücke und Gehrock bekleidete Leiter des »Münz-Cabinets« Valentin Duval und der geistlich-schwarzgekleidete Abbé Johann Marcy, Direktor des »Physikalisch-Mathematischen-Cabinets«. Infrarot- und Röntgenuntersuchungen hätten zu Tage gebracht, dass das Bild zumindest viermal übermalt worden sei, wobei mehrere Personen weggelassen und einzelne Gegenstände hinzugefügt worden seien. Nachgewiesen im oberen Teil seien beispielsweise noch die Köpfe fünf weiterer, jetzt verschwundener Personen, von denen eine ein Kolar trug. »Vermutlich«, sagte Riedl-Dorn, habe es sich dabei um den Jesuitenpater und Physikprofessor Joseph Franz gehandelt. 1773 nämlich, im Jahr, in dem das Gemälde vollendet worden sei, war auch der Jesuitenorden durch Kaiser Joseph II. in Österreich aufgelöst worden. Dafür sei der Leibarzt und Zensor van Swieten in der ursprünglichen Vorzeichnung noch gar nicht vorhanden gewesen. Der große Kristall rechts im Vordergrund und zu den Füßen des Abbé Marcy wiederum sei weder auf den um 1900 entstandenen Fotos noch auf einem Wochenschaubeitrag aus dem Jahr 1935 zu sehen und also erst später hinzugefügt worden. Auch die Länge des dargestellten Teppichs habe man dabei verändert.
Da kaum anzunehmen ist, dass es sich bei dem Bild um das erste selbstmalende und sich selbst verändernde Ölgemälde der Welt handelt, sozusagen um einen Vorfahren des mystischen Bildnisses des Dorian Gray, müssen wohl politische Anschauungen ihre Spuren darauf hinterlassen haben. Durch Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel sei es darüber hinaus, erklärte Riedl-Dorn weiter, zur »Erblindung von Firnis« gekommen. Vor allem aber sei das Gemälde beim erwähnten Brand des Augustinertraktes während der Revolution 1848 in Mitleidenschaft gezogen worden, weshalb es zu Kraterbildungen und Brandblasen gekommen sei.
Inzwischen erreichten wir, der Beamte und ich, im nächsten Stockwerk den Eingang zu den Zoologischen Schauräumen, und gleich nachdem der Beamte aufgesperrt hatte, stellte sich heraus, dass wir uns im letzten, dem Primatensaal befanden, wie der im Kegel des Taschenlampenlichtes auftauchende Affe in der großen gläsernen Vitrine mir zeigte. Der Beamte sperrte die Tür hinter uns zu, atmete durch, ließ kurz das Taschenlampenlicht auf die ausgestopften, doch lebendig wirkenden Gorillas, Schimpansen und Orang-Utans schweifen und richtete dann den Lichtstrahl auf den Fußboden. Die Affen im ersten Saal und später Füchse und Wölfe und noch später die einheimischen und fremdländischen Vögel waren nur als Schattenrisse in den wuchtigen gläsernen Schränken und Terrarien und in den langen, mit Scheiben versehenen Wandregalen erkennbar. Wir gingen über den dumpf knarrenden Parkettboden an den endlos sich aneinanderreihenden Vitrinen entlang, in denen die Tierpräparate im Tod verharrten. Zumeist war es nur die Straßenbeleuchtung von draußen, die die Dunkelheit in den Sälen erhellte, und bald hatte ich die Orientierung gänzlich verloren, zumal der Beamte wieder begann, von der Geschichte des Hauses zu sprechen und damit meine Aufmerksamkeit in Anspruch nahm. Kaiser Franz I., sagte er, während wir an Raubtieren, einem Löwen, aber auch an Seehunden und Robben, wie ich zu sehen glaubte, vorbeigingen, sei seit 1731 Freimaurer und ein an den Naturwissenschaften besonders interessierter Mann gewesen. Er habe auch in Laboratorien mit gelehrten Jesuiten alchemistische Experimente durchgeführt und dabei versucht, mit Hilfe von Silberspiegeln und der Kraft des konzentrierten Sonnenlichts, kleinere Diamanten zu einem größeren zusammenzuschmelzen. Dabei seien die Edelsteine jedoch verkohlt. Unbeabsichtigt habe er damit den Beweis erbracht, dass Diamanten verbrennen. Ein anderes Mal habe er mit seinem Bruder Carl in Brüssel Rubine und Diamanten im Wert von 6000 Gulden – damals das doppelte Jahresgehalt eines Hofrates – in Tongefäße gesteckt und 24 Stunden in stärkstes Feuer gehalten. Die Diamanten seien dabei zwar verschwunden, die Rubine jedoch – selbst nachdem man sie noch dreimal 24 Stunden der großen Hitze ausgesetzt hatte – unverändert erhalten geblieben. Der Kaiser, setzte der Beamte fort, habe in Wien zwei Laboratorien einrichten lassen, eines davon in der Menagerie in Schönbrunn. Im Untergeschoss eines achteckigen Pavillons, der heute als Restaurant diene, habe es einen durch geheime Gänge mit anderen Gebäuden verbundenen Raum gegeben, in dem er mit Hilfe einer kostbaren handschriftlichen Broschüre nach dem Stein der Weisen gesucht habe. In Schönbrunn hätten auch die Rosenkreuzer, eine esoterische Gruppe der Freimaurer, ihren Sitz gehabt. Man könne an der Architektur des Pavillons unschwer den freimaurerischen Geist erkennen, vor allem an der »Zahlenmystik«, wie er sagte, beispielsweise bei der Anzahl der Stufen, welche zur Plattform führten. Neun sei nämlich eine magische Zahl und stehe für Vollendung und Klugheit. Franz I. habe sich außerdem eine sogenannte »Planetenmaschine« konstruieren lassen, die den Umlauf der Planeten um die Sonne sowie die Bewegungen der Erde im Tierkreis, Jahreszeiten, Datum und Uhrzeit anzeigte und heute im Meteoritensaal im Hochparterre zu sehen sei, ursprünglich aber im sogenannten »Physikalisch-Astronomischen Cabinet« des Kaisers ihren Platz gefunden hätte. Franz I. habe sich übrigens von Anfang an bemüht, seine Sammlung zu vergrößern und sich dafür des erwähnten Chevalier de Baillou bedient, dessen Fähigkeiten als Sammler, Physiker und Erfinder er äußerst geschätzt habe. Baillou habe nämlich auch Automaten entworfen und konstruiert, wie eine hydraulisch betriebene Maschinerie, die er als »Die Zaubergrotte von Colorno« bezeichnet habe. Sie habe Blitze, Donnergrollen, den Gesang von Vögeln und Flötenspiel erzeugt und bewegliche Figuren aus der griechischen Mythen- und Götterwelt, wie den Sänger Orpheus, vorgeführt. Die Sammlung habe einzig dem Studium der Natur, der Suche nach Wahrheit und der Aufdeckung von Scharlatanerie und Aberglauben gegolten, sagte mein Begleiter. Vermutlich sei es auch Baillou gewesen, der Maria Theresia beraten habe, als sie den berühmten »Edelsteinstrauß« für ihren Gemahl habe anfertigen lassen. Zwar berichte Goethe, so der Beamte, im vierten Buch des ersten Bandes seiner Autobiographie »Dichtung und Wahrheit«, dass der Juwelier Lautensack in Frankfurt an einem derartigen Edelsteinstrauß für Kaiser Franz I. gearbeitet habe, doch nehme man an, dass ihn der Wiener Juwelier Grosser zumindest vollendet habe. Zur Herstellung des Straußes wurden 2102 Diamanten und 761 andere Schmucksteine wie Rubine, Smaragde, Saphire, Chrysolithe, Opale, Türkise, Hyazinthe und Granate verwendet, die zu 61 Blumen und 12 unterschiedlichen Tierarten zusammengesetzt wurden, erklärte mir später die Archivarin Riedl-Dorn. Leider seien aber im Laufe der Jahre die aus Seide angefertigten Blätter völlig ausgeblichen. Der Edelsteinstrauß, fuhr der Beamte inzwischen fort, zeige, wie sehr die Kaiserin die Neigungen ihres Mannes teilte. Nach seinem Tod habe sie ihren Sohn Joseph II. zum Mitregenten ernannt und den Siebenbürgischen Mineralogen und Geologen Ignaz von Born als Leiter des Mineralien-Cabinets nach Wien berufen. »Und damit«, rief der Beamte triumphierend und mit der Taschenlampe auf mehrere ausgestopfte Nashörner zeigend, »kennen Sie schon zwei Figuren und ihre Beziehung zur Freimaurerei, die mit der Entstehung von Mozarts Oper ›Die Zauberflöte‹ zu tun haben – den unglücklichen Hofmohren Angelo Soliman, der, wie Sie wissen, ausgestopft wurde, und den scharfzüngigen Ignaz von Born.« Bevor der Beamte sich jedoch weiter der »Zauberflöte« zuwandte, zeigte er mit der Taschenlampe auf ein kleines Nashorn und wies mich darauf hin, dass es sich um eines der besterhaltenen und ältesten Stopfpräparate der Welt handle, ein männliches Java-Nashorn, das vierzehn Monate alt und für den Tiergarten in Schönbrunn vorgesehen gewesen sei. Es sei jedoch 1801 auf dem Transport gestorben.
Es roch süßlich nach Bodenwachs und abgestandener Luft. Wir waren von Tod und Schatten umgeben und beinahe zur Gänze in den Tiefen der Geschichte versunken, die uns jetzt gegenwärtiger erschien als das Leben draußen. In diesem Augenblick war mir auch, als ob wir uns in einem Panoptikum befänden und uns durch die Dioramen vergangener Zeiten bewegten. Der arme Angelo Soliman, begann mein Begleiter wieder, sei eine stadtbekannte Persönlichkeit gewesen, habe fließend Italienisch, Deutsch, Französisch, Tschechisch, Englisch und Latein gesprochen und hervorragend Schach gespielt. Außerdem sei er Mitglied der Loge »Zur wahren Eintracht« und zuletzt sogar deren Zeremonienmeister gewesen. Es sei bekannt, dass Ignaz von Born auf seinen Antrag hin von den Freimaurern aufgenommen und schon bald danach zum »Meister vom Stuhl« gewählt worden sei. Der Freimaurer Emanuel Schikaneder, der das Libretto der »Zauberflöte« von Wolfgang Amadeus Mozart, der ebenfalls ein Freimaurer gewesen sei, verfasste, habe Soliman als Vorlage für den liebestollen Mohren »Monostatos« und Born als Vorbild des Sonnenpriesters »Sarastro« genommen. Mit Ignaz von Born sei ein besonders streitbarer Mann von den Freimaurern aufgenommen worden. Er sei aber auch ein ebenso hervorragender Wissenschaftler gewesen.
In seiner »Mönchologie«, ergänzte später Frau Riedl-Dorn, habe er in lateinischer Sprache Mönche nach Art der Linné’schen Beschreibung von Insekten dargestellt und in der Satire »Die Staatsperücke« mit Swift’scher Bosheit die Geschichte einer Perücke beschrieben, die für einen König hergestellt wird, zuletzt aber nur noch als Polsterfutter dient. Das habe nicht gerade zu seiner Beliebtheit beigetragen. Born habe die kaiserlichen Sammlungen im »Naturalien-Cabinet« neu aufstellen lassen und sich besonders um die Mineralien verdient gemacht. Er habe vor allem die Meteoriten, die sich damals unter der Bezeichnung »Luftsteine« oder »Aerolithen« als Curiosa in der kaiserlichen Schatzkammer befunden hätten, in das »Naturalien-Cabinet« überführen lassen. Damals habe die Wissenschaft noch heftig daran gezweifelt, dass Steine vom Himmel fallen könnten, so sei auch der berühmte, 39 Kilogramm schwere Eisenmeteorit, der am 26. Mai 1751 in Hraschina bei Agram auf der Erde aufgeschlagen sei, mit Argwohn betrachtet worden, obwohl unter Aufsicht eines Bischofs ein genaues »Fallprotokoll« erstellt worden sei. Born habe damit die heute älteste Meteoritensammlung der Welt begründet. Im Laufe von mehr als 200 Jahren wuchs sie immer mehr an und nimmt jetzt im Hochparterre den ganzen Saal V ein.
In Gedanken versunken waren wir bis zu den Sälen der Vögel gegangen, die in der Dunkelheit alle krähenschwarz über die toten Gelehrten und Adeligen zu wachen schienen, welche mein Begleiter mit seiner Erzählung heraufbeschworen hatte. Hierauf gelangten wir, wie ich mich zu erinnern glaube, in den großen Saal mit dem vielleicht sechs Meter langen Skelett eines Finnwal-Jungen. Der Beamte zeigte mit der Taschenlampe jedoch auf die langen Kiemen eines ausgewachsenen Tieres, die an der Wand zu sehen waren, und fügte hinzu, dass daraus früher Kämme gemacht worden seien. Ich könne mir anhand der Größe der Kiemen vorstellen, welche Ausmaße ein ausgewachsenes Exemplar habe.
Gleich darauf öffnete er eine Tür, und wir traten wieder hinaus auf den dämmrigen Gang. Treppe um Treppe stiegen wir hinauf zur »Anthropologischen Abteilung«, wie ich endlich in verschnörkelten Buchstaben über der hohen Tür las, und mein Begleiter sperrte, während nun ich die Taschenlampe hielt, das Schloss auf. Sodann lief er hastig – noch immer mit der Taschenlampe in der Hand – den sogenannten »Schädelgang« entlang, auf dem sich an der linken Seite bis zur Decke reichende Regale mit Glasscheiben befanden, in denen sich Hunderte oder sogar Tausende menschliche Totenschädel dicht aneinanderreihten. Plötzlich blieb mein Begleiter stehen, wartete, bis er wieder zu Luft gekommen war, und stieß dann hervor, dass die Sammlung von Skeletten im Naturhistorischen Museum »mit 40 000 Objekten« Wiens zweitgrößter Friedhof sei. »Was sagen Sie dazu?«, flüsterte er erwartungsvoll. Ich schwieg erstaunt. Der Strahl der Taschenlampe war jetzt auf den Boden gerichtet, ich konnte daher das Gesicht meines Begleiters nicht erkennen, lediglich seine dunkle kleine Gestalt, die vor mir stand. Das reflektierte Licht ließ mich die ungeheure Anzahl von Schädeln erahnen, und es war mir, als hätten wir ein anderes Erdzeitalter betreten, in dem die Menschen ausgestorben und ihre Reste nur noch als archäologische Fundstücke vorhanden waren.
»Mozarts Schädel«, sagte der Beamte, nachdem er sich gefasst hatte, »gelangte erst 77 Jahre nach seinem Tod 1791 an die Öffentlichkeit. Er stammte aus dem Besitz des Anatomen Josef Hyrtl, einer Koriphäe in seinem Fach«, wie mein Begleiter betonte. »Erstmals wurde der Schädel nach dem Tod des Anatomen 1901 im Hyrtl’schen Waisenhaus in Mödling ausgestellt.« Seither sei seine Echtheit abwechselnd bestätigt oder angezweifelt worden. 1902 sei er dann in Mozarts Geburtshaus nach Salzburg gekommen und habe schließlich 1940 im Mozarteum seinen endgültigen Platz erhalten. Die Herkunft, fuhr der Beamte fort, habe der Anatom, der den Schädel von seinem Bruder, einem Bildhauer, geerbt habe, auf einem Papierstreifen über der Stirn vermerkt. Demnach solle der Totengräber am St. Marxer Friedhof, Rothmayer, bei der Umgrabung des Schachtgrabes, das die sterblichen Überreste enthalten habe, »das Relikt« geborgen und trotz strengsten Verbotes an sich genommen haben. Unter rigoroser Geheimhaltung sei das wertvolle Exemplar dann von Rothmayer auf seinen Nachfolger Löffler, von diesem an einen gewissen Radschopf und zuletzt an dessen Enkel Franz Braun weitergegeben worden. Jeder Totengräber habe sich vor den drohenden gesetzlichen Folgen gefürchtet, und keiner habe seine Vorfahren verraten und damit den Namen der Familie in Unehren bringen wollen. Trotzdem seien gerade zur Zeit von Mozarts Tod und auch später immer wieder Schädel gestohlen worden. »Joseph Haydn zum Beispiel«, brauste der Beamte plötzlich auf, »ist zuerst 150 Jahre ohne seinen Kopf und später mit einem falschen Schädel in seinem Grab gelegen, bevor man ihm endlich wieder den eigenen aufgesetzt hat!« Bei der geplanten Überführung des Leichnams von Haydn nach Eisenstadt, elf Jahre nach seinem Tod, habe man erst festgestellt, dass der Kopf fehlte. »Was weiter gefolgt ist, war eine einzige Schädel-Odyssee!«, resignierte mein Begleiter. Mit Schädeln und Gebeinen sei damals überhaupt »Schindluder« getrieben worden, er sage nur: Schubert und Beethoven. Hierauf machte er eine Pause und wartete darauf, was ich dazu zu sagen hätte. Ich schwieg jedoch, worauf er sich plötzlich umdrehte, mir vorauseilte und mich in einen Saal führte, ohne dort aber das Licht einzuschalten. Der Saal war, konnte ich im Halbdunkel erkennen, an drei Wänden mit Schränken ausgestattet, in denen wie am Gang Totenschädel lagerten, einer neben dem anderen. Eine Zeit lang kramte der Beamte im Nebenzimmer herum und rief währenddessen: »Schuld war hauptsächlich der Gall, ein Genie und ein Narr!« Gall sei davon überzeugt gewesen, durch Abtasten und Vermessen von Köpfen Diagnosen über den Charakter der Menschen erstellen zu können. Er habe Ende des 18. Jahrhunderts vor allem Geisteskranke aus dem Narrenturm obduziert und Menschen- und Tierschädel vermessen und daraus zwei Dutzend Grundeigenschaften abgeleitet, die er an der Gehirnrinde lokalisiert sehen wollte – »natürlich alles Blödsinn«, bis auf die Entdeckung des Sprachzentrums. Diese sei ihm aber nur zufällig geglückt. Seine Lehre, die »Phrenologie«, habe in ganz Europa Aufsehen erregt, und man habe, wo immer es möglich gewesen sei, Gräber geöffnet und Totenschädel entfernt, um sie zu vermessen. Das sei eine Zeit lang wie eine Seuche gewesen, die die feine Gesellschaft und insbesondere die Ärzte befallen habe. Gall selbst habe eine große Sammlung von Schädeln, Büsten, Totenmasken und in Wachs nachgebildeten Gehirnen von Menschen und Tieren besessen, darunter einen Gipsabguss des österreichischen »Nationaldichters« Ferdinand Raimund, der 1836 Selbstmord verübte. Nachdem der damalige Kaiser Franz I. (II.) Galls Vorlesungen per kaiserlichem Dekret verboten hatte, habe sich Gall auf eine Vortragsreise begeben und schließlich in Paris niedergelassen. Ein Teil seiner Sammlung sei übrigens in Österreich, genauer gesagt in Baden geblieben, der andere in das Musée de l’Homme in Paris gelangt, wo sich auch Galls eigener Schädel, den einer seiner Schüler präpariert habe, befände. Übrigens sei in der »Wiener Allgemeinen Tageszeitung« schon im Jahr 1853 zu lesen gewesen, dass Gall, als er Mozarts Schädel erblickte, die Entwicklung des musikalischen Organs in Entzücken versetzt habe. Das passe aber zeitlich nicht mit den anderen Daten zusammen. Während der Beamte jetzt seinen Redeschwall abrupt beendete, schwieg auch ich zu seinen Bemerkungen über Gall, den ich für einen bedeutenden Mann halte, den Begründer einer auf die Erforschung der Triebe aufgebauten Psychologie und damit Vorläufer Sigmund Freuds und der gesamten Gehirnforschung überhaupt. Außerdem wusste ich, dass er einer Intrige von Franz’ I. (II.) reaktionärem Leibarzt Stifft zum Opfer gefallen war, der ihn nach Paris vertrieb.
Der Beamte eilte plötzlich aus dem Nebenzimmer zu mir heraus, den Schädel Mozarts – wie er gleich darauf betonte – in beiden Händen und legte ihn in der Dunkelheit auf einen Tisch, bevor er seine Taschenlampe aus der Jacke holte und den Lichtstrahl auf ihn richtete. Auf dem Tisch lag auch zumindest ein Dutzend anderer Schädel. Angesichts der Hunderten, ja Tausenden in den Regalen des Saales und des langen Ganges der Anthropologie war dieser Schädel vor mir nichts Besonderes mehr. Ich konnte zuerst auch nicht glauben, dass es wirklich der Kopf des Komponisten war. Trotzdem berührte ich ihn. Mir kam dabei der banale Gedanke, dass Mozart in meinen Gedanken lebte, während sein Knochenschädel jetzt vor mir lag. Doch ohne lange zu fragen, nahm der Beamte das Heiligtum wieder in seine Hände, stellte es in das Nebenzimmer zurück und führte mich nach einigen Minuten über die endlos sich um den Lift schlingende Hintertreppe ins Freie. Erst Monate später erfuhr ich von dem Journalisten, der mir die Führung vermittelt hatte, dass der Beamte mich getäuscht und mir einen falschen Schädel gezeigt hatte, weil der echte in einem Safe eingesperrt lag, zu dem er keinen Schlüssel besaß.
Kleine Expedition in das Universum der Schöpfung
Nach dem ersten Besuch im Naturhistorischen Museum vor dreißig Jahren blieb in meinem Kopf nur eine Spirale in Form der marmornen Prunktreppe zurück und Hans Canons Deckengemälde aus nackten Menschenleibern »Der Kreislauf des Lebens«, das sich, wie ich mir einbildete, über der Stiege selbst im Kreis drehte und einen Sog auf mich ausübte, der mich scheinbar in die Luft hinaufziehen wollte. Die weißen Marmorstatuen von Naturforschern am Ausgang zur großen Kuppelhalle – darunter Aristoteles, Johannes Kepler, Alexander von Humboldt, Isaac Newton und Carl von Linné – waren wie Figuren eines Ringelspiels in diese Drehbewegung eingeschlossen und riefen in mir zusätzlich Schwindelgefühle hervor.
Dachte ich an die Säle, so waren es die mehr als hundert Ölbilder aus der Gründerzeit an den Wänden, das braune Mobiliar, das seit der Eröffnung des Hauses im Jahr 1889 durch Kaiser Franz Joseph unverändert geblieben ist, und die stillen, weiten und hohen Räume selbst, die ich vor mir sah – insgesamt 39 in zwei Etagen, dem erwähnten Hochparterre und dem ersten Stock. In meiner Vorstellung bildeten sie einen Korridor, in dem ich vergeblich nach einem Ausgang suchte, weil sich hinter jeder Ecke ein neuer Korridor mit einer weiteren Ecke öffnete, so dass ich allmählich nicht mehr wusste, wo ich mich befand. Die Kuppel im ersten Stock mit den acht ovalen Fenstern und dem reichen Dekor erschien mir damals wie ein überdimensioniertes Kaleidoskop, das aus buntem, gefrorenem Wasser zusammengesetzt war und sich stetig veränderte.
Lange lag ich damals mit geschlossenen Augen auf meinem Hotelbett, bis ich in der Sekunde des Einschlafens begriff, dass mich das Museum schon in einen Traum versetzt hatte, bevor ich mich jetzt anschickte, den Traum im Traum weiterzuträumen.
Erst im Laufe der nächsten Jahre begann ich das von Gottfried Semper und Carl Hasenauer gebaute Museum zu entschlüsseln. Ich erfuhr, dass das gewaltige, im Stil der Neorenaissance entworfene Bauwerk – ebenso wie das spiegelbildliche Kunsthistorische Museum – ursprünglich als Teile eines Kaiserforums geplant waren, die durch Triumphbögen über die Ringstraße hinweg jeweils mit einem der beiden neuen Trakte der Hofburg verbunden werden sollten. Aber das Kaiserforum blieb unvollendet, denn nur einer der Hofburgtrakte wurde errichtet, und die zwei Triumphbögen kamen nie über das Stadium von sorgfältig ausgeführten Architekturzeichnungen hinaus. Schon zu Zeiten Kaiser Franz Josephs bezeichnete man das Naturhistorische Museum, wie ich las, als eine »Kathedrale der Naturwissenschaften«, denn es ist bis zum Dach hinauf und dort sogar noch auf dem First übersät mit unzähligen Statuen berühmter Forscher und Entdecker, gleich Schutzheiligen. Der Generaldirektor des Naturhistorischen Museums, Bernd Lötsch, schrieb darüber: »Beobachter von einem anderen Stern würden es … für das Zentrum eines seltsamen Mumienkultes halten – mit Hohepriestern, Tempelwächtern und Pilgerströmen«, und er bezeichnete den Bau schließlich als »Tempel der Evolutionsidee«.
Heute besteht es, nach baulichen Erweiterungen, aus neun Geschossen, fünf über und vier unter der Erde, 240 Mitarbeiter sind in diesem als »Museum eines Museums« bezeichneten Gebäude beschäftigt, das den romantischen Wissenschaftsgeist der Gründerzeit ausstrahlt, wie ihn Jules Verne in seinen Büchern beschworen hat. Und da ich schon als Kind ein hingerissener Leser von »20 000 Meilen unter dem Meer«, »Reise zum Mittelpunkt der Erde« und »Von der Erde zum Mond« war, erlebte ich bei jedem meiner Besuche eine Summe kurzer Déjà-vus, die mich beglückte. Wahrscheinlich hätte Jules Verne aber eine genaue Größenangabe des Gebäudes gegeben, die ich somit nachliefere: sowohl das spiegelbildliche Kunsthistorische Museum als auch das Naturhistorische Museum sind 170 Meter lang, siebzig Meter breit und mit der Spitze ihrer Kuppel 65 Meter hoch.
Es dauerte einige Zeit, bis ich begriff, dass die Säle im Sinne der Evolutionstheorie angeordnet waren und dass meine anfängliche Verwirrung daher kam, dass ich nicht auf die ohnedies durch die Saalnummern ersichtliche Reihenfolge geachtet und einmal diesen, einmal jenen Raum aufgesucht hatte, weshalb die Eindrücke, die schon für sich genommen überwältigend sind, schließlich ein chaotisches Durcheinander in meinem Kopf hervorriefen und wie zufällige Gegenstände in einer Windhose durcheinanderwirbelten: eine militärische Parade toter Käfer hinter einer Glasscheibe, das Fossil eines Trilobiten, verschiedene Kristalle, die ausgestopfte Giraffe, die Pflanze in einem Herbarium, das gläserne Modell einer Meeresqualle oder das zuckende Leben in einem Wassertropfen im verdunkelten »Mikrotheater«. Dazu vermengten sich auch die Ölgemälde, die die Säle schmücken und die Sammlungen illustrieren, in meiner Erinnerung: Wo befand sich das »Panorama von Rio de Janeiro« von Robert Russ, wo die geheimnisvollen »Mundurucu-Indianer« von Julius von Blaas, wo die comichaft-schönen »Tempelruinen von Angkor Wat« von Emil Jakob Schindler? Ich liebe diese Gemälde, seit ich in meiner Mittelschulzeit Karl-May-Bildchen sammelte, die sich in Kaugummiverpackungen befanden und im selben neoromantischen Stil wie die Gemälde gehalten waren. Allerdings hatte man bei der Ausstattung des Naturhistorischen Museums darauf geachtet, dass das Dargestellte auch präzise der Wirklichkeit entsprach, und deshalb die Maler auf kostspielige Reisen geschickt oder von den gewünschten Motiven zumindest Skizzen und Fotografien besorgt, an die die Künstler sich halten mussten.
Meine Orientierung wurde mir noch dadurch erschwert, dass die Ethnographische Sammlung des Museums im Jahr 1927 in die Neue Hofburg gebracht wurde und dort den Grundstock für das heutige Völkerkundemuseum bildete. Die Objekte, die nun an deren Stelle ausgestellt werden, Gegenstände aus der Frühgeschichte oder der Anthropologie, passen daher nicht mehr zum entsprechenden Wandschmuck. Hatte ich ohnedies nichts anderes vorgehabt, als einen Nachmittag im Museum zu verbringen und herumzuschlendern, bereitete mir meine Verwirrung Vergnügen – war ich jedoch bereits müde vom Schauen, begann ich zunehmend Unruhe zu verspüren, die mich schließlich resigniert das Café Nautilus aufsuchen ließ und einmal sogar zu einem fluchtartigen Verlassen des Gebäudes veranlasste. Dabei ist es keine Kunst, sich zurechtzufinden: In den 19 ineinander übergehenden Sälen des Hochparterres werden zuerst in beleuchteten Vitrinen, die eine übersinnliche Aura verbreiten, Minerale und Gesteine gezeigt – der Beginn der Evolution, Diamanten aus Südafrika, deren größter 82,5 Karat wiegt, ein sechs Kilogramm schweres Platin-Nugget aus dem Ural, die siebenbürgische Goldstufe, des Weiteren ein wasserklarer Bergkristall, groß wie ein dicker Holzpfosten und spitz wie ein Bleistift, Goldklumpen aus Australien, Hessite, Bornite, Alexandrite, rosettenförmige, zu einer »Eisenrose« verwachsene Hämatitblättchen, Edelopale, Wulfenitkristalle, ein mit haarfeinem Byssolith durchwachsener Apatit, Topas aus Alabaschka, die miteinander verwachsenen schwarzgrünen Kristalle eines Epidot, Smaragde, Turmaline oder die bizarr verästelte Form eines Aragonits vom steirischen Erzberg, wie eine weiße Perücke, die lange im Wasser gelegen und nun unordentlich, zu einzelnen steifen Büscheln verformt, ans Tageslicht gelangt ist. Der berühmte Edelsteinstrauß Maria Theresias – kleiner als in meiner Vorstellung, doch auch komplizierter und kunstvoller – befindet sich in einem verglasten Wandtresor des Saales. Die Mineraliensammlung umfasst mehr als 300 000 Objekte, wovon 20 000 in Vitrinen ausgestellt sind.
Im Meteoritensaal liegt ein Teil der 4,6 Milliarden Jahre alten Gesteine, über 7000 Exemplare besitzt das Museum von 800 Meteoritenfällen und -funden. Neben dem erwähnten aus Hraschina ist das in lateinischer Sprache abgefasste »Fallprotokoll« mit den Zeugenaussagen ausgestellt, und in einer der Vitrinen finden sich auch die kugelig oder länglich geformten schwarzen Tektite von den Philippinen, die überwiegend aus Glas bestehen – erstarrte Tropfen irdischen Gesteins, welche bei Meteoriteneinschlägen in »schmelzflüssigem Zustand« verspritzt werden.
Die anschließende Geologisch-Paläontologische Abteilung mit einer Auswahl aus zwei Millionen Objekten führt zu den frühen Spuren des Lebens. Man erkennt paläozoische Seeigel, die Stammoberfläche eines Schuppenbaumes, die Abdrücke von Schachtelhalm und Farnkraut, das vergessene Skelett eines zwanzig Zentimeter kleinen Pachypleurosauriers, die sternförmigen Kelche von Korallen aus Alt-Aussee in der Steiermark, versteinerte Ammoniten – Kopffüßler des Erdaltertums, die seit 65 Millionen Jahren ausgestorben sind –, des Weiteren einen zwei Meter langen versteinerten Fisch und die Reste eines Flugsauriers, eine Riesenschildkröte, den Schädelteil eines versteinerten anthropomorphen Affen, der in Neudorf an der March gefunden wurde, einen Haifischzahn aus dem Kalk des Leithagebirges, Purpurschnecken, Pilgermuscheln, fossile Mücken, Fliegen, Vogelfedern oder das Skelett eines eiszeitlichen Höhlenbären.
In den prähistorischen Sälen wird in einer Auswahl aus mehreren 100 000 Einzelstücken das Auftreten des Menschen in der Evolutionsgeschichte dokumentiert: Skelettfunde, Werkzeug, Keramik, Gerätschaften, Schmuck und Kultgegenstände. Das berühmteste Stück ist die etwa 25 000 Jahre alte Venus von Willendorf. In einer abgedunkelten Kammer ruht die winzige, nur elf Zentimeter große Figur beleuchtet und hinter Sicherheitsglas wie ein versteinerter Embryo längst ausgestorbener Lebewesen. Die Figur ist aus feinem Kalkstein und stellt eine beleibte Frau mit starken Hüften, vorstehendem Bauch, schweren Brüsten und einer erkennbaren Vulva dar. Auf den Schultern sitzt ein monströs großer Kopf ohne Gesicht, der von parallelen Lockenreihen bis in den Nacken bedeckt ist. Ober- und Unterschenkel sind stark verkürzt, die Arme nur angedeutet, die Füße weggelassen, als handle es sich um eine Fehlgeburt, doch dargestellt ist vermutlich ein mythologisches Wesen, eine heidnische Fruchtbarkeitsgöttin, die am 7. August 1908 bei archäologischen Grabungen in der Wachau vom damaligen Leiter der Prähistorischen Abteilung des Museums, Josef Szombathy, ans Tageslicht gebracht wurde. Die anthropologische Schau, die letzte im Hochparterre, widmet sich mit ihren Totenköpfen und Skeletten vorwiegend der Entwicklungsgeschichte der Menschheit und ihren verschiedenen Rassen, wovon noch die Rede sein wird. Neben frühen Funden des Homo sapiens, wie dem fast schwarzen, 35 000 Jahre alten Schädel eines jungen Mannes aus Lautsch in Tschechien, der der »Cro-Magnon-Rasse« zugeordnet wird, oder einem künstlich deformierten Schädel eines Goten mit einem hohen, spitzen Hinterkopf (angeblich Kennzeichnung hochgestellter Familien oder zur Abschreckung eines Feindes) und präparierten Totenköpfen finden sich auch blankpolierte Köpfe von Tasmaniern, Melanesiern und Feuerland-Indianern, die zumeist unter »merkwürdigen« Umständen in das Museum gelangten. Die Anthropologische Abteilung besitzt ferner eine große Anzahl von Skeletten und bemalten Schädeln aus Hallstatt aus den Beinhäusern der Kirche. Besonders in der Biedermeierzeit war es Brauch, die Schädel aus den Beinhäusern zu bemalen und mit Hinweisen zu versehen, die Aufschluss über Person und Lebensalter gaben. Manche sind von der Stirn ausgehend rund um den Kopf mit rosa, roten und blauen Rosen und grünen Blättern bemalt, als hielten sie ewige Hochzeit mit dem Tod.
Außerdem finden sich in einer Vitrine ein Tasterzirkel für Kopfmessungen, ein Ergometer zur Messung der Muskelkraft und eine Federwaage zur Bestimmung des Körpergewichts, die der Schiffsarzt bei der Weltumseglung der »Novara« 1857 bis 1859 verwendete. Durch eine Kunststoffglocke schaut man einige Schritte weiter in ein Erdgrab hinunter, das vermutlich aus der Zeit 400 bis 800 vor Christus stammt: es handelt sich um die vollständig erhaltenen Skelette von drei Erwachsenen und vier Kindern aus Stillfried an der March in Niederösterreich. Weder gerichtsmedizinische noch anthropologische Untersuchungen haben Hinweise auf ihre Todesursache ergeben. Der Fund ist umso rätselhafter, als zur angeführten Zeit in der Region Feuerbestattungen üblich waren.
Im Saal XX des ersten Stockwerks, der jetzt vom »Mikrotheater« eingenommen wird, war ursprünglich die Botanik untergebracht, mit kostbaren Herbarien, handgeschriebenen Kräuterbüchern, Blumenaquarellen, naturgetreu präparierten Orchideenblüten, Lehrtafeln, exotischen Seychellennüssen und Lianen. Vier Millionen »Herbarbelege« aus allen Teilen der Welt besitzt die Abteilung, dazu kleinere Bestände von Hölzern, Früchten und Samen, Flüssigkeits- und mikroskopischen Dauerpräparaten. Besonders groß ist der Reichtum »nomenklatorischer Typen«, Herbarpflanzen, die als Grundlagen zur Beschreibung neuer Arten dienen. Die Kaiser waren oft gut unterrichtete Botaniker – Christa Riedl-Dorn, die gelehrte Archivarin, beschrieb in einem Buch diese Vorliebe und nannte es »Die grüne Welt der Habsburger«. Schon Franz Stephan von Lothringen und Maria Theresia begeisterten sich für Pflanzen und schickten den Botaniker Jacquin mit Gärtnern auf weite Reisen, um fremde Gewächse für den Botanischen Garten in Schönbrunn zu sammeln, darüber hinaus gaben sie Aufträge für wissenschaftliche und reich illustrierte botanische Prunkwerke. Kaiser Franz I. (II.) hieß im Volksmund sogar der »Blumenkaiser«. Sein Gartenwerkzeug »aus handgeschmiedetem Stahl mit Mahagonigriff« ist noch in den Bundesmobilien-Sammlungen zu sehen. Der Kaiser soll einmal, heißt es, auf allen vieren im k.k. Burggarten arbeitend, von einem Hauptmann, der zur Audienz geladen war, mit einem Gärtner verwechselt und grob angeschnauzt worden sein. Der Irrtum klärte sich wohl rasch auf. Auch Franz’ I. (II.) Sohn, der spätere Kaiser Ferdinand der Gütige, teilte diese Leidenschaft. Er fertigte unter anderem mehrere erhalten gebliebene Präparate von Moosen zwischen Glas zur mikroskopischen Untersuchung an. Zu den besonders schönen Objekten der angeblich wegen zu großer Licht- und Temperaturempfindlichkeit nicht frei zugänglichen Sammlung gehörten auch aus Wachs geformte Pilze.
Anstelle der Botanik findet sich jetzt, wie gesagt, ein bühnenhaft mit stilgetreuen Kulissen ausgestattetes »Mikrotheater« in den Räumlichkeiten, das in das Ambiente der Gründerzeit passt. Die Fenster des Saales sind mit Illustrationen aus Ernst Haeckels wunderbaren »Kunstformen der Natur« abgedunkelt. Auf mit Samt bezogenen Klappstühlen folgt man den durch das Mikroskop gefilmten Prozessen der Mikrowelt, die mehrtausendfach vergrößert auf der Leinwand ein abstraktes Schauspiel zeigen. Oder man experimentiert selbst mit bereitgestellten Präparaten an Forschungsmikroskopen, die an einer Wand aufgestellt sind. Hier denke ich am intensivsten an meine Kindheit zurück, an die Verfilmung von »20 000 Meilen unter dem Meer« mit James Mason als Kapitän Nemo, und an die Luken des Unterseebootes, durch die man auf den Meeresgrund sah.
Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Sammlung der »Niederen Tiere«, heute »Wirbellose Tiere« der Zoologischen Abteilung, zur größten der Welt. Ein merkwürdiger Attaché, Freiherr von Ransonnet, der dem Naturhistorischen Museum eine umfassende Korallensammlung vermachte, fertigte vor der Küste von Ceylon um die Wende zum 20. Jahrhundert in einer Taucherglocke ein einzigartiges Unterwassergemälde an. Es erforderte, heißt es, tagelange Beobachtungen am Meeresboden. Das Bild verzichtet zwar nicht auf einen Totenschädel, der verloren im Sand liegt, zeigt aber auch mit großer Genauigkeit und in braun-gelben Farbtönen eine Felswand mit verschiedenen Korallenarten und davor gestreifte kleine Fische, von denen einer ein sogenannter »Seebader« und der andere ein »Borstenzähner« ist. Eine lebensgroße Puppe des Malers ist in einer Taucherglocke vor dem Café Nautilus zu sehen.
In den hohen Schaukästen und Vitrinen begegnet man Meeresschwämmen wie dem Neptunsbecher oder dem Glasmodell einer Bougainvillea ramosa, einem strauchförmigen, auf einem Felsen ruhenden Tier, das mit den auf den Ästchen sitzenden Polypen durch »ungeschlechtliche Knospung frei schwimmende Medusen entstehen lässt«, die ihrerseits durch geschlechtliche Fortpflanzung Polypen zeugen. Das formvollendete Tier, das mich an ein feines geometrisches Eisgebilde, eine Art dreidimensionale Eisblume erinnert, überfordert den Verstand eines Laien, der es für ein harmloses Unterwasserpflänzchen hält. Endlose Reihen von herrlichsten Molluskenschalen, Meeresschnecken und Muscheln, Korallen und Quallen bieten sich dem Auge dar, so dass man sich auf dem Grunde eines Schauaquariums wähnt. Die auffallende australische Stachelauster mit unterschiedlich langen geschwungenen Stacheln ist so etwas wie das Igeltier unter den Muscheln und wechselt häufig ihre kräftige Farbe. Ein besonderes Stück der Sammlung ist die Tabakdose des Kronprinzen von Brasilien, Dom Pedro von Braganza, die er seinem Schwiegervater Franz I. (II.), anlässlich der Vermählung mit dessen Tochter Erzherzogin Leopoldine im Jahr 1817 zum Geschenk machte. Das wertvolle Präsent besteht aus den polierten Schalenklappen einer Süß- und Brackwassermuschel, die mit Gold verziert wurde. Ein anderes, ebenso schönes Stück ist die südamerikanische Miesmuschel, aus der eine Tabatière mit Fischkopf geformt wurde. Zu den Wirbellosen Tieren gehören auch die Crustaceen, Krebse, Skorpione, Tausendfüßler und Spinnen wie die japanische Riesen-Meeresspinne, eigentlich eine Krabbenart, die vorwiegend in der Tiefsee lebt. Ein großes Männchen ist in der Kuppelhalle des Naturhistorischen Museums zu sehen, es hat eine Rumpflänge von vierzig Zentimetern, und seine Arme sind über ein Meter fünfzig lang. Das Weibchen daneben nimmt sich hingegen klein aus. Die Molluskensammlung enthält zehn Millionen Einzelstücke, 470 000 Proben und 22 300 Flüssigpräparate – nicht zu vergessen die sagenhafte Wurmsammlung, die der Direktor des »Naturalien-Cabinets«, Karl Franz von Schreibers – ein gelernter Arzt, der die Präparatoren beauftragte, alle Tiere beim Ausbalgen auf Eingeweidewürmer zu untersuchen und diese in Alkohol aufzubewahren –, und der Arzt Johann Gottfried Bremser begründeten. Nahezu alle bekannten Arten sind in der Kollektion vertreten, beschrieben und konserviert, wie auch ein vier Meter langer Menschenbandwurm – man kann ihn, wenn man will, anhand anschaulicher Wachsmodelle, die für die Wiener Weltausstellung 1873 angefertigt wurden, in allen Einzelheiten studieren – oder Trichinen, die sich mit ihrer Länge von einem bis vier Millimetern im Darm des Menschen, aber auch in dem von Füchsen, Dachsen, Hunden, Ratten und Hausschweinen einnisten. Der Naturforscher und Präparator Johann Natterer, der 1817 an der österreichischen Brasilien-Expedition anlässlich der Hochzeit von Dom Pedro mit Erzherzogin Leopoldine teilnahm, war ein besonders emsiger Sammler von Eingeweidewürmern. Eines der zahlreichen Exemplare, die er nach Wien übersandte, stammt sogar aus seinem eigenen Darm. Das handgeschriebene Etikett auf dem Glasfläschchen trägt die Aufschrift: »Ascaris lumbricoides, von Natterer erbrochen.«
Endlich gelange ich zu den Insekten, den Tausenden und Abertausenden von Mücken, Fliegen, Käfern, Schmetterlingen – sechs Millionen Objekte sind es, allein 2,8 Millionen Käfer, 1,4 Millionen Schmetterlinge, 1,1 Millionen Hautflügler, 400 000 Zweiflügler, 300 000 Heuschrecken, Libellen, Netzflügler, Wanzen und andere sowie Sammlungen von Gallenbildungen und Insektennestern. Die Wiener Kollektion ist besonders reich an Originalexemplaren, den sogenannten Typen, also Insekten einer neuen Art, die hier zum ersten Mal beschrieben worden sind. Auf zahlreichen Expeditionen wurden die seltensten Tierchen gefangen, allein der erwähnte Naturforscher und Tierpräparator Johann Natterer, der sich nach der bereits beendeten Brasilienexpedition noch achtzehn Jahre lang in dem Land aufhielt, brachte 32 000 Insekten nach Wien, kunstvoll präparierte Schmetterlinge und Käfer – von denen jedoch bei der Revolution am 31. Oktober 1848 ein bedeutender Teil verbrannte, als der Augustinertrakt der Hofburg in Brand geriet. Auf dem in Flammen aufgegangenen Dachboden befand sich auch ein Teil der Insektensammlung, der wegen Raummangels ausgelagert worden war.
Wir sehen in der Vitrine die Grüne Kaffeeheuschrecke, die bis zu neun Zentimeter groß wird und bei Gefahr ein stechend riechendes Wehrsekret absondert, und eine Gottesanbeterin mit Spiralzeichnungen auf den Flügeldecken. Ihre Larven, so erfahre ich, sitzen auf Blüten, denen sie durch ihre Färbung täuschend ähnlich sind. Sodann der Große Laternenträger, eine Zikade mit überdimensionalem und erdnussförmigem Kopffortsatz, der nachts leuchtet, und deren Flügel mit auffallend großen starren Augen gezeichnet sind, so dass das Insekt einer Maske gleicht; oder der zehn Zentimeter lange Goliathkäfer, außerdem Wespen und Bienen – und in einem gläsernen Behälter sogar ein lebendiger Schwarm. Der Stock ist durch eine Plastikröhre mit der Außenwelt verbunden, und während ich die Bienen in ihren wächsernen Waben betrachte und ihre getanzte Sprache beobachte, die mich immer an die Gebärdensprache der Gehörlosen erinnert, fällt mir der blinde, bayerische Pfarrer und Imker Huber ein. Er ließ sich von seinem Gehilfen schildern, was dieser gerade beobachtete, und zog daraus seine Schlüsse. Hätte er selbst sehen können, denke ich, hätte er vielleicht mit den Bienen gesprochen. Ich betrachte auch den Querschnitt durch einen Termitenbau, das Kunststoffmodell einer Fliege, die groß ist wie ein ausgewachsener Hund, und die wunderbarsten Falter, die mich sofort an den russischen Dichter Vladimir Nabokov erinnern und seine große Passion, die Lepidopterologie. Vor allem bestaune ich den Eulenschmetterling. Mit 28 Zentimetern hat er die größte Flügelspannweite. Er fliegt nur in der Nacht, tagsüber versteckt er sich mit seiner Rindenfärbung und -zeichnung gerne auf Bäumen und wird deshalb nur schwer entdeckt. Und neben all den bunten, ästhetisch gezeichneten südamerikanischen, indischen oder australischen Faltern entdecke ich auch das Große oder Wiener Nachtpfauenauge, dem ich im Laufe der Jahre in der Südsteiermark einige Male begegnet bin, einmal hatte sich ein Exemplar sogar auf meiner alten Eingangstür niedergelassen und war dort mehr als eine Stunde lang sitzen geblieben.
Das anschließende Reich der Wirbeltiere nimmt den größten Raum ein. In den Sälen XXVII und XXVIII sind Amphibien und Reptilien ausgestellt, an den Wänden Skelette von Schlangen befestigt – auch präparierte Schildkröten oder ihre Panzer. In einer der Vitrinen befinden sich die Glattstirnkaimane, die der Präparator Johann Natterer seinerzeit in Brasilien im Amazonasbecken fing. In den Sälen XXIX bis XXXII trifft man auf in- und fremdländische Vögel, darunter die Nebel- und die Saatkrähe, Letztere die Botin des Winters in Wien, und den sogenannten »letzten Adler von Kronprinz Rudolf«. Gemeint ist, dass er das letzte Tier war, das der unglückliche Sohn Kaiser Franz Josephs vor seinem Tod in den Donau-Auen erlegte. Der Kronprinz war nebenbei ein ausgezeichneter Ornithologe und arbeitete mit dem populären Naturforscher Brehm zusammen. Auch der ausgestorbene Riesenvogel Moa aus Neuseeland ist vertreten. Der österreichische Geologe Hofstetter brachte ihn von einer seiner Expeditionen mit. Die Beuteltiere, Nagetiere, Schuppen- und Gürteltiere sind im Saal XXXIII versammelt, die Wale, Elefanten, Giraffen und Flusspferde im Saal XXXIV, während man die Pferde, Tapire und Nashörner im Saal XXXV betrachten kann. Im Saal XXXVI bilden ausgestopfte Gazellen und Hirsche mitunter ein Rudel in den Vitrinen, im Saal XXXVII findet man die Krallenäffchen und im Saal XXXVIII die Raubtiere zu Wasser und zu Lande, wie Löwen, Tiger und Robben. Ganz zuletzt, im Saal XXXIX, dem Primatensaal, der früher auch für Vorträge bestimmt war, blickt man den brüderlichen Gorillas, den Schimpansen und Orang-Utans in die gläsernen Augen, die – obwohl künstlich hergestellt – Trauer auszudrücken scheinen, wie ich mir unsinnigerweise immer wieder einbilde.
500 000 Objekte umfasst die Sammlung der Wirbeltiere, deren Größe vom zwölf Millimeter langen Millionenfischchen bis zum dreißig Meter langen Walskelett reicht. Sie enthält 210 000 Fische, 120 000 Amphibien und Reptilien, 90 000 Vögel, 40 000 Säugetiere und 40 000 Objekte der Archäologisch-Zoologischen Sammlung.
Einer der wertvollsten Ankäufe des Museums war die 1806 in London erstandene Privatsammlung Sir Ashton Levers, die 28 000 Objekte enthielt, darunter auch mehrere auf James Cooks großer Weltumseglung in den Jahren 1772 bis 1775 entdeckte Fische.
Ich habe für die Beschreibung meiner Wanderung durch das Gebäude das längst vergriffene Buch »Das Naturhistorische Museum in Wien« von Friedrich Bachmayer und Ortwin Schultz aus dem Jahr 1979 herangezogen und daraus zitiert, denn es wäre mir ansonsten unmöglich gewesen, die Fülle der angeführten Details zu erfassen.
Einige Tiere habe ich mir auch besonders gemerkt, ohne dass ich mir darüber im Klaren bin, weshalb:
Der Bandfisch oder »Heringskönig« von der Küste Neuseelands. Er ist 550 Zentimeter lang und 47 Zentimeter hoch, wie ich nachlese, ein Tiefseetier, das an einen gewaltigen fliegenden Fisch in Form eines Säbels denken lässt, am Kopf mit Flossen bestückt, wie ein Wiedehopf mit Federn.
Die Krokodilschwanzhöckerechse, die lediglich in der Provinz Kwangsi (im Südwesten von China) zu finden ist. Sie kann schwimmen und tauchen und bevorzugt zu ihrer Ernährung Kaulquappen.
Die Dronte, ein truthahngroßer, flugunfähiger Vogel. Sie kam nur auf der Insel Mauritius vor und war für die frühen Seefahrer eine leichte Beute. Bereits um 1860 war sie völlig ausgerottet.
Die Blauen Paradiesvögel. Ihre Federn waren zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Modeartikel begehrt.
Der Riesenalk, der von Island bis zur Küste Neufundlands beheimatet war – und zuletzt auf dem kleinen Eiland Eldey totgeschlagen wurde.
Alles deutet auf eine Suche nach Relikten aus dem verlorenen Paradies hin, die neben anderen Motiven zumindest anfangs eine Rolle gespielt haben dürfte.
Dieser Sammelleidenschaft für Naturalien und Exotica fiel beispielsweise auch Rembrandt van Rijn anheim, denn er besaß in der Zeit von 1639 bis 1658 in seinem Amsterdamer Haus, wie ich sah, neben Gemälden italienischer und holländischer Maler und antiken Büsten eine nicht unbeträchtliche Kollektion von Antilopen- und Widderhörnern, ausgestopften Krokodilen, präparierten Schmetterlingen, die Panzer eines Gürteltieres und einer Schildkröte, kostspielige Muschel- und Schneckenschalen, den Schädel eines Walrosses, Korallen, ausgestopfte Kugelfische, das Horn eines Sägefisches bis hin zu afrikanischen Wurfspießen und Schilden, die er bei Bedarf als Vorlage für seine Arbeit benutzte. Sein finanzieller Ruin war nicht zuletzt auf dieses Naturalienkabinett zurückzuführen.
Auf einem Gemälde im Mauritshuis in Den Haag schließlich haben Peter Paul Rubens und Jan Brueghel »Adam und Eva im Paradies« gemalt. Schon der erste Blick auf das Ölbild mit seinen Pfauen, Tigern und Löwen, dem Kamel und dem Elefanten, den Papageien und Paradiesvögeln, dem Hausgetier und den Fischen, mit Schwan und Ente, Rehbock, Schildkröte und natürlich der Schlange auf dem Apfelbaum und dem nackten ersten Menschenpaar, schon der erste Blick darauf also erinnert an die Kunst- und Wunderkammern der Habsburger, die Anfänge des systematischen Sammelns und Anhäufens von seltenen und kostbaren Schätzen der Natur und scheinbaren Fundstücken aus dem verschwundenen Garten Eden.
Das Archiv
Das freundliche, beim Dachausbau neu geschaffene Archiv strahlt Ruhe und Distanz zum Universum unter unseren Füßen aus. Es ist, als existiere alles, was ich gerade gesehen habe, die zu Objekten gewordenen Minerale, Pflanzen, Tiere und Menschen, in Wirklichkeit schon längst nicht mehr, oder als seien es Fundstücke von einem anderen, weit entfernten Planeten. Nur die Krähen über uns, am Himmel und auf dem Dach, scheinen die Erde noch zu bewohnen. In einer Ecke sitzt ein älterer Mann an einem Tisch und entziffert geduldig das in Kurrentschrift abgefasste Expeditionstagebuch Ritter Georg von Frauenfelds aus dem 19. Jahrhundert, das der Zoologe während der Forschungsreise der österreichischen Fregatte »Novara« Mitte des 19. Jahrhunderts geführt hat. Der Mann am Tisch, Herr Kirchmayer, ist Pensionist und verrichtet unbezahlt diese Arbeit, weil ihn die Aufgabe reizt und er ohne geistige Tätigkeit, wie er sagt, in Depressionen verfallen würde.
Professorin Riedl-Dorn muss auf nicht wenige unbezahlte Helfer zurückgreifen, um alles aufzuarbeiten, was sich seit Jahrzehnten angesammelt hat. In ihrem fabelhaften Buch »Das Haus der Wunder« und im Katalog zur Ausstellung über österreichische Forscher, Sammler und Abenteurer, »Die Entdeckung der Welt und die Welt der Entdeckungen«, hat sie die Geschichte des Naturhistorischen Museums erforscht und penibel festgehalten. Mehr als dreißig Millionen Tiere, sagt sie, an die vier Millionen gepresste und getrocknete Pflanzen, 3,5 Millionen Fossilien sowie 250 Tonnen Gestein würden in den Depots aufbewahrt. Die Sammlung sei durch Ankauf oder Tausch der Kaiser sowie Schenkungen von Forschungsreisenden, Mitarbeitern und Gönnern zustande gekommen, die dem Kaiserhaus ethnographische Gegenstände, Münzen, Mineralien, Heilpflanzen, Tierbälge und Präparate anboten oder verehrten. Vor allem Jesuitenmissionare hätten aus Tibet, von den Philippinen, aus Mexiko oder Paraguay wertvolles Material mitgebracht. Die Objekte stammten aus allen Teilen der damals bekannten Welt, unter anderem aus Sumatra, Borneo, China, Afghanistan, Persien oder Konstantinopel. Die erste wissenschaftliche Expedition sei von Nikolaus Joseph von Jacquin unternommen worden. »Jacquin stammte aus dem niederländischen Leiden«, sagt die Historikerin, »studierte Theologie und scholastische Philosophie und später Medizin. Gerard van Swieten, der Leibarzt Maria Theresias, berief ihn nach Wien. Jacquin legte einen großen Teil des Weges zu Fuß zurück und schloss an der Universität sein Medizinstudium ab. Daraufhin schickte sein Mentor ihn auf eine Forschungsreise nach Westindien, die der junge Arzt um 1754 antrat. Die Route führte ihn zu den Kleinen und Großen Antillen, 1758 nach Jamaika und erst 1759 wieder nach Triest zurück.« Ausdrücklich habe Kaiser Franz I. Jacquin verboten, Affen von seiner Expedition mitzubringen, fährt Frau Riedl-Dorn fort, mit der Begründung, dass es davon in Wien ohnedies genug gebe. Aber auch keine Raubtiere und Papageien seien erlaubt gewesen, umso mehr jedoch wünschte man Gewächse mit genießbaren Früchten oder schönen und wohlriechenden Blüten, ferner Münzen und ethnologische Gegenstände. Reisen sei damals gefährlich gewesen, auf See habe Krieg zwischen verschiedenen Nationen geherrscht, dazu seien häufig tödliche Krankheiten wie das Gelbfieber und Angriffe von Piraten gekommen. Einmal, erzählt Frau Riedl-Dorn, sei Jacquin sogar gefangen genommen und auf die kleine Insel Gonave vor Haiti verschleppt worden. Auf der Fahrt in Richtung des südamerikanischen Festlandes sei er später auch gezwungen gewesen, ein Sklavenschiff zu benutzen, wo er Zeuge der rohen Behandlung gefangener Schwarzer durch die Mannschaft geworden sei. Er habe bei seiner Rückkehr für die Menagerie in Schönbrunn unter anderem einen Roten Flamingo, Singvögel, einen zahmen Puma, ein Opossum und mehrere Flughörnchen mitgebracht, dazu eine Sammlung von mehreren hundert Fischen – zum Teil in Weingeist –, eine große Menge Mineralien, Seeigel und Conchylien. Besonders wichtig sei aber seine Ausbeute für die Botanik gewesen. Jacquin habe sich durch sein 36 Bände umfassendes wissenschaftliches Werk, das mit 3000 schönen Kupfertafeln nach kolorierten Originalen ausgestattet sei, einen Namen gemacht. Die Historikerin zeigt mir einige der Zeichnungen von Pflanzen, wie die eines Liliengewächses, die der Wissenschaftler während der Reise in der Karibik selbst anfertigte, nachdem sein Herbarium von Insekten aufgefressen worden war. Nutzpflanzen, die von Forschern nach Europa gebracht worden seien, hätten immer mehr an Bedeutung gewonnen, fährt Frau Riedl-Dorn fort. Im 16. und 17. Jahrhundert habe der »Mann von Welt« noch die Blüte eines Erdapfels im Knopfloch getragen, und das Paprikagewächs sei noch im 18. Jahrhundert als Zierpflanze im Botanischen Garten von Schönbrunn gewachsen. Besonders in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sei dann das Pflanzensammeln Mode geworden. Der österreichische Schiffsarzt Heinrich Wawra habe beispielsweise 1872 von seiner Weltreise mit den beiden Prinzen Philipp und August von Sachsen-Coburg berichtet, dass sie in Australien für die Mitreisenden einen Zug gemietet, den sie an pflanzenreichen Gegenden einfach angehalten hätten. Dort sei dann die gesamte Reisegesellschaft aus dem Wagen gestürzt und habe so viele Gewächse als nur möglich eingesammelt, die sie hierauf ihm, Wawra, zum Aussortieren und Bestimmen in sein Coupé gebracht hätten. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hätten Auswüchse dieser Art zum Aussterben ganzer Pflanzengruppen geführt. Man habe auch große Geldbeträge für seltene und ungewöhnliche Arten gezahlt. Ein bestimmter Kaktus sei beispielsweise in Gold aufgewogen worden. Die Jagd nach Orchideen und Rhododendronpflanzen habe sogar zu Mord und Totschlag geführt. Und über den Tulpenwahn seien bekanntlich schon Bücher geschrieben worden.