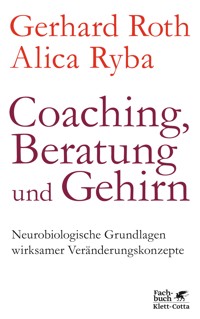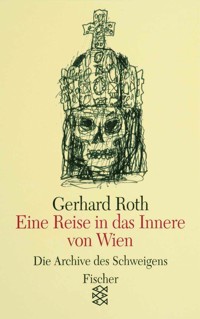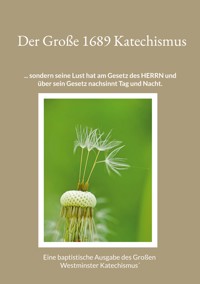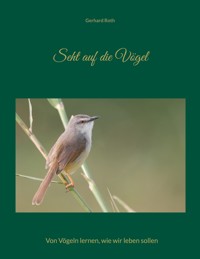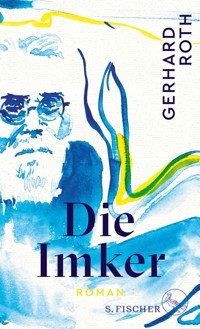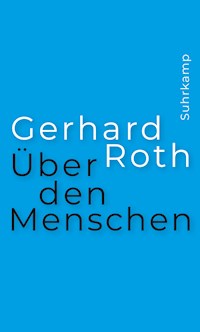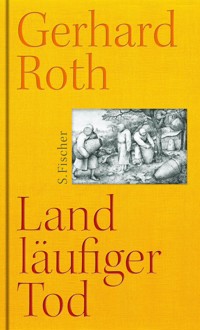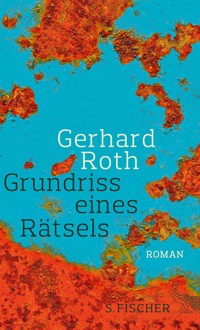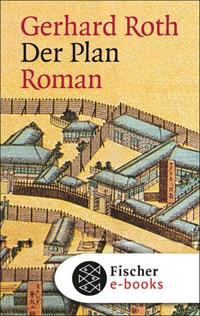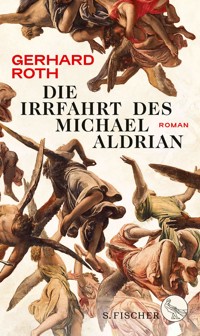
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Michael Aldrian, der lange bei der Oper als Souffleur gearbeitet hat, reist im Winter nach Venedig, um seinen dort lebenden Bruder zu besuchen. Der aber scheint mitsamt seiner Frau spurlos verschwunden zu sein. Aldrian, der eigentlich vorhatte, einen Reiseführer über Venedig zu schreiben, macht sich in der vom Hochwasser heimgesuchten Stadt auf die Suche. Aber irgendjemand will ihn offenbar davon abhalten. Nacheinander erhält er eine Morddrohung, ein Paket mit Falschgeld und eines, in dem sich eine abgeschnittene Hand befindet. Unaufhaltsam und fast ohne sein Zutun wird er in eine Geschichte hineingezogen, in der er immer mehr vom Zuschauer zum Täter wird. Wie in einem Albtraum bewegt er sich durch die Stadt und erledigt fast nebenbei mehrere Menschen, die sich ihm in den Weg stellen. Ist er selbst wahnsinnig geworden oder ist es die Welt? »Man hat Venedig oft genug als eine Märchenstadt bezeichnet. Das stimmt nur insofern, als es nicht nur verklärende, sondern auch grausame Märchen gibt.« Gerhard Roth
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 541
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Gerhard Roth
Die Irrfahrt des Michael Aldrian
Roman
Über dieses Buch
Michael Aldrian, der lange bei der Oper als Souffleur gearbeitet hat, reist im Winter nach Venedig, um seinen dort lebenden Bruder zu besuchen. Der aber scheint mitsamt seiner Frau spurlos verschwunden zu sein. Aldrian, der eigentlich vorhatte, einen Reiseführer über Venedig zu schreiben, macht sich in der vom Hochwasser heimgesuchten Stadt auf die Suche. Aber irgendjemand will ihn offenbar davon abhalten. Nacheinander erhält er eine Morddrohung, ein Paket mit Falschgeld und eines, in dem sich eine abgeschnittene Hand befindet. Unaufhaltsam und fast ohne sein Zutun wird er in eine Geschichte hineingezogen, in der er immer mehr vom Opfer zum Täter wird. Wie in einem Albtraum bewegt er sich durch die Stadt und erledigt fast nebenbei mehrere Menschen, die sich ihm in den Weg stellen. Ist er selbst wahnsinnig geworden oder ist es die Welt?
»Man hat Venedig oft genug als eine Märchenstadt bezeichnet. Das stimmt nur insofern, als es nicht nur verklärende, sondern auch grausame Märchen gibt.«
Gerhard Roth
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Dieses Buch wurde gefördert mit einem Stipendium des Deutschen Literaturfonds, Darmstadt.
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2017 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
© 2017 by Gerhard Roth
Covergestaltung: KOSMOS, Büro für visuelle Kommunikation, Münster
Coverabbildung: Mondadori Portfolio/Getty Images
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-402858-3
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Motto
Erstes Buch
Reise in den Kontinent der Erinnerung
Zweites Buch
In Atlantis
Im Mesokosmos
Im Archivio di Stato di Venezia
Die Pest in Venedig
Beatrice
Auf dem Fischmarkt
Ein langer Abend
Schnee
San Servolo
Verdacht
Wassermusik
Der Dogenpalast
Eine Verfolgungsjagd
Engel und Dämonen
Carpaccio
Gefälschte Wirklichkeiten
Geld verbrennen
Die Biblioteca Marciana
Fibonaccis lange Reise
Drittes Buch
Dies irae
Ein weiteres Verhör
Chioggia Sottomarina
Wer ist Beatrice?
Auf der Suche nach Rodolfo Boscolo
Funiculì funiculà
Viertes Buch
1 In Mailand
2 Die Nachricht
3 Beatrices Abschied
4 In der Questura
5 Das Wiedersehen mit Jakob
6 Allein
7 Ein letztes Gespräch
8 Ca’ d’Oro
9 Beatrices Wiederkehr
10 Beatrice, Aldrian und Emilio
11 Das letzte Kapitel
[Kapitel]
Da nahm der Engel eilig ihre Hand
und führte rasch die Zaudernden zum Tor
im Osten und die Klippe dann hinab
auf ebne Flur – dann schwand er ihrem Blick.
Sie wandten sich und sah’n des Paradieses
östlichen Teil, noch jüngst ihr sel’ger Sitz,
von Flammengluten furchtbar überwallt,
die Pforte selbst von riesigen Gestalten
mit Feuerwaffen in der Hand umschart.
JOHN MILTON, Das verlorene Paradies
Erstes Buch
Reise in den Kontinent der Erinnerung
Ich war ein Wunderkind, jetzt bin ich ein Niemand, dachte Michael Aldrian, als er am späten Abend an der Wiener Staatsoper vorbei zum Bahnhof fuhr und dabei aus dem Seitenfenster des Taxis blickte.
Als Kind, fiel ihm ein, hatte er sich jede Note, jede Melodie, jeden Text nach einmaligem Anhören gemerkt, was großes Staunen hervorgerufen hatte. Schon damals war der Besuch von Opernaufführungen während der Salzburger Festspiele seine liebste Beschäftigung gewesen. Mit der Zeit war ein großes Opernreservoir in seinem Kopf entstanden, das er später mit den Kostümen der Sänger, den Gesichtern der Dirigenten und der Musiker im Orchestergraben bis ins Detail abrufen und vor seinem inneren Auge sehen konnte.
Die Staatsoper war hell erleuchtet und kam ihm jetzt wie ein urzeitliches Raumschiff vor, in das die Menschen strömten, um eine ferne, andere Welt kennenzulernen. Er hatte 25 Jahre als Maestro Suggeritore in dem kleinen Souffleurkasten unter der Bühne verbracht, bis ihn ein Hörsturz zwang, das Raumschiff zu verlassen und in die Außenwelt zurückzukehren. In der Staatsoper hatte ihm die Abdeckung des Souffleurkastens wie ein riesiger Helm Schutz geboten. Jetzt führte er ein Insektenleben, ähnlich einer Solitärwespe, die sich versteckte und darauf achtete, keinen Fehler zu begehen. Seine Aufgabe war es gewesen, aus der Staubkornperspektive die Fehler der Sänger und des Dirigenten auszubessern oder vermeiden zu helfen. Je länger er darüber nachdachte, desto einseitiger sah er sich jetzt als einen Im-Stich-Gelassenen, denn er hatte sich über Nacht von seiner Illusion, unersetzlich zu sein, verabschieden müssen. War es ihm während der Einstudierung einer Oper oder bei einer Aufführung »mit Bravour« gelungen, wie man ihm versichert hatte, die Unsicherheiten der Sänger oder fehlende Einsätze der Dirigenten zu korrigieren, bekam er nun plötzlich das bittere Gefühl der Bedeutungslosigkeit zu verspüren, denn sofort nach seiner Rückkehr aus dem Krankenhaus hatte man ihm nahegelegt, sich einen anderen Beruf zu suchen.
Er hatte zuerst in Salzburg Kapellmeister und Gesang studiert und war schließlich im Souffleurkasten gelandet, doch hatte ihn das nur am Anfang verunsichert, bald schon war er ein leidenschaftlicher Maestro Suggeritore geworden. Und jetzt hatte man ihn wie das kaputte Schräubchen einer riesigen Maschine gegen ein Ersatzteil ausgetauscht.
Der Nebel war so dicht, dass die Staatsoper gleich einer geisterhaften Erscheinung hinter ihm verschwand. Zurück blieb ein Gefühl der Wertlosigkeit, das seinen Zorn hervorrief. Sein Zorn, dem er sich allerdings nur selten überlassen hatte, war in der Staatsoper gefürchtet gewesen, da er sich wie ein unerwartetes Gewitter entlud und es manchmal sogar ein oder zwei Tage dauerte, bis er sich endlich wieder beruhigte.
Den ganzen Februar über hatte es in Wien geschneit, es war kalt und neblig gewesen, weshalb Aldrian früher als geplant nach Venedig reiste, wo er im Haus seines Bruders Jakob eine Garçonnière bewohnte. In den letzten Jahren war er immer zu Weihnachten nach Venedig gefahren und hatte mit Jakob den Heiligen Abend und die Silvesternacht verbracht, diesmal aber war seine Schwägerin krank geworden.
Während er noch immer aufgewühlt seinen Gedanken nachhing, fiel ihm ein, dass er vielleicht vergessen hatte, das Balkenschloss seiner Wohnung Am Heumarkt zu verriegeln, und er versuchte jetzt, während der Taxichauffeur viel zu schnell zum Bahnhof fuhr, sich jeden Handgriff, den er vor der Abfahrt gemacht hatte, ins Gedächtnis zu rufen. Zuerst war er noch dem Schriftsteller Philipp Artner, der im Stockwerk über ihm wohnte und gerade die Treppen herunterkam, begegnet.
»Fahren Sie wieder nach Venedig?«, hatte Artner Aldrian gefragt, und als Aldrian mit »ja« geantwortet hatte, hatte er hinzugefügt: »Ich arbeite gerade an einem Kriminalroman, der in Venedig spielt, in dem Sie vorkommen. Dabei kann ich endlich über Ihre Tätigkeit in der Oper und vielleicht auch über Ihre Begegnungen mit den berühmtesten Sängerinnen, Sängern und Dirigenten schreiben.« Bevor er sich verabschiedet hatte, hatte er noch hinzugefügt: »Sie haben mir im Café Heumarkt so vieles über die Staatsoper erzählt, wissen Sie noch?«
Michael Aldrian war ein virtuoser Erzähler bösartiger Anekdoten, die er aus der Perspektive des Souffleurkastens sozusagen als vergessener oder versteckter Beobachter vortrug. Er war von seiner Arbeit, wie man sagt, besessen gewesen, hatte sich in ihr geradezu aufgelöst wie Stickstoff in der Luft. »Urlaubstage« hatte er immer gehasst, weil er bei seiner Rückkehr in den Alltag zurückgeworfen war, weshalb er schon seit Jahren im Sommer ein Engagement bei den Salzburger Festspielen angenommen hatte, wo seine Tätigkeit als Souffleur vor fast dreißig Jahren begonnen hatte. In der Wiener Staatsoper hatte man ihn dann seiner Fähigkeiten als Maestro Suggeritore wegen einen »Mephisto« genannt, der von der Unterwelt aus die Oberwelt beeinflusste und mit scheinbarer Allwissenheit und sprachlicher Gewandtheit jede Situation meisterte. Denn zu seiner unheimlichen Gedächtnisleistung kam hinzu, dass er alle Schwächen der Künstler kannte, ihre Vergesslichkeiten und Unsicherheiten, ihre Ängste und Abneigungen auch ihm gegenüber. Manche Sängerinnen und Sänger wollten sich ihm, wie sie sagten, nicht ausliefern, was er höflich zur Kenntnis nahm. Es war dann eine Genugtuung für ihn, wenn er ihnen bei Textlücken oder unsicheren Einsätzen wie selbstverständlich zu Hilfe kam und nach der Aufführung den mitunter mürrischen, oft aber überschwänglichen Dank höflich entgegennahm. Ein weiterer stiller Triumph waren für ihn seine Auftritte bei Premierenfeiern und im engeren Kreis als Zauberer gewesen.
Bereits als Jugendlicher hatte er sich für Zauberkunststücke interessiert und später in seiner ihm aufgezwungenen Freizeit jeden Handgriff so lange eingeübt, bis er es schließlich mit einem professionellen Magier aufnehmen konnte. Es war nicht verwunderlich, dass seine Ehe mit einer Schminkmeisterin der Staatsoper nur kurz währte, denn er pflegte auch zu Hause in Verkleidung aufzutreten und für seine Vorführungen Tricks einzustudieren. Im Nachhinein betrachtet, war die Begeisterung für Zauberkunststücke sogar sein Glück gewesen, denn so konnte er als Magier seine finanzielle Lage verbessern und dabei die Spannung eines abendlichen Auftritts verspüren. Er zeigte sich auf der Bühne nie unmaskiert: Manchmal verkleidete er sich als Hase, ein anderes Mal als Hund oder Vogel. Entsprechende Masken und Kostüme hatte er aus dem Depot der Staatsoper zum Abschied geschenkt bekommen. Anfangs waren ihm die Requisiten wie eine stumme Schmähung vorgekommen, aber dann, als er über den Opernsänger Hesse ein Engagement in einem Hotel in Spotorno erhielt und über seinen Bruder anlässlich einer Weihnachtsfeier im Hotel Cipriani in Venedig ein weiteres, fing er an, Spaß an seinen Verwandlungen zu finden. Seine herausragende Fähigkeit war, Menschen aus dem Publikum auf die Bühne zu bitten und sie dort öffentlich zu bestehlen, ohne dass sich jemand erklären konnte, wie er das machte oder der Betroffene es merkte. Dieses Kunststück hatte er mehr als 20 Jahre lang geübt. Er hatte festgestellt, dass keiner seiner Tricks die Menschen so belustigte und begeisterte wie der öffentliche Taschendiebstahl. Manchmal hatte er sogar während des Taschen- oder Uhrendiebstahls an einem unbekannten Zuschauer die Ouvertüre zu »Die diebische Elster« von Rossini gepfiffen und damit sein »Opfer« und das Publikum zusätzlich abgelenkt. Sein nächstes Engagement war für den Sommer im Hotel Miramar in Opatija – er sagte immer noch Abbazia – an der kroatischen Küste vereinbart.
Aldrian konzentrierte sich jetzt wieder auf die Frage, ob er bei der Abreise die Wohnung auch mit dem Balkenschloss verriegelt hatte. Jedenfalls hatte er die Fototasche und den gerahmten Druck von Adalbert Stifters Gemälde »Blick in die Beatrixgasse« als Geschenk für seinen Bruder und dessen Frau auf die Fensterbank im Gang gestellt. Seine Notizbücher hatte er in der anderen Hand gehalten – er machte nämlich schon seit mehr als zehn Jahren Notizen und Fotografien in Venedig, denn er beabsichtigte, eines Tages einen unkonventionellen Reiseführer über die Stadt herauszubringen. Anschließend hatte er die Tür verschlossen: Er erinnerte sich jetzt ganz genau daran, dass er auch das Balkenschloss verriegelt hatte. Mit einem jähen Ruck hielt das Taxi vor dem Westbahnhof, und Aldrian schleppte, nachdem er bezahlt hatte, sein Gepäck über die Rolltreppe bis zum Schlafwagenabteil, das – ebenso wie das Taxi – nicht viel größer war als sein Souffleurkasten in der Staatsoper. Leise fluchend über die Anstrengung, verstaute er sein Gepäck und nahm auf dem unteren Bett Platz. Hoffentlich kommt niemand, mit dem ich das Abteil teilen muss, dachte er gerade, als die Schiebetür geöffnet wurde und ein massiger Mann eintrat. Er trug einen schwarzen Mantel, einen schwarzen Hut und hatte zwei Koffer, die er nur mit Mühe in das enge Abteil quetschte. Schwitzend, keuchend und mit einer Alkoholfahne nahm er neben Aldrian Platz und fragte ihn, ob er nicht das obere Bett nehmen wolle, er fürchte, dass die nicht sehr starke Leiter unter seinem Gewicht zusammenbrechen könne. Aldrian schüttelte den Kopf und antwortete, dass ihm leicht schwindlig würde.
»Aha«, entgegnete der korpulente Mann. »Wie mir. Ich muss mich dann übergeben«, fügte er in drohendem Tonfall hinzu. Da Aldrian keine Anstalten machte, ihm zu antworten, stellte er sich unvermittelt als Gottlieb Heinzl vor, Optiker aus Zwettl. Er fahre nach Mestre, erklärte er, um dort optische Geräte wie einen »Scheitelbrechwertmesser« und einen »Hand-Autorefraktometer« »zu verscherbeln«, wie er sagte, und Brillenfassungen zu kaufen.
»Sie sehen, wie ich schwitze«, fügte er hinzu.
Und als Aldrian noch immer schwieg, fragte er ihn gereizt: »Und mit wem habe ich es zu tun?« Herr Heinzl griff in seine Brusttasche, holte einen Flachmann hervor und bot seinem Gegenüber einen Schluck an.
»Quittenschnaps«, erklärte er.
Da Aldrian nur den Kopf schüttelte, nahm er allein einen kräftigen Schluck und begann, sich auszukleiden.
Aldrian verstand zuerst nicht, was Herr Heinzl vorhatte und sah interessiert zu, wie sich der Fahrgast seines Mantels und Sakkos entledigte, die er auf Aldrians Bett warf, und dann seine Schuhe auszog, seine Krawatte löste und zuletzt das Hemd, die Hose und die schwarzen Socken abstreifte und nur mit einer weißen Unterhose bekleidet vor ihm stand. Als Herr Heinzl Anstalten machte, auch diese abzustreifen, legte sich Aldrian auf das Bett mit dem Blick zur Wand.
»Mein Mantel!«, hörte er den Optiker protestieren, »und mein Sakko!! Wo soll ich sie hinlegen?« Er schnaufte, musste aber doch eine Lösung dafür gefunden haben, denn Aldrian hörte ihn einen weiteren Schluck aus seinem Flachmann nehmen und sodann laut atmend die Leiter hinaufklettern und sich auf dem krachenden Oberbett ausstrecken. Er furzte schwer und zog den Rotz in seiner Nase hoch, Sekunden später rührte er sich nicht mehr. Ein furchtbarer Gestank breitete sich langsam im Abteil aus, weshalb Aldrian die Tür zum Gang aufschob und das Fenster öffnete. Er verspürte einen Ruck, als der Zug sich in Bewegung setzte, und sah, wie der Perron und die sich auffächernden Geleise an ihm vorbeizogen. Das Licht brannte noch immer, und bevor Aldrian es abschaltete, schloss er wieder Fenster und Türe und nahm eine 10 mg-Valium-Tablette mit einem Schluck »Sparkling«-Mineralwasser aus einer der beiden kleinen Flaschen, die der Schlafwagenschaffner auf das Klapptischchen unter dem Fenster gestellt hatte. Er entledigte sich nur seiner Schuhe und seines Sakkos und streckte sich auf dem schmalen Bett aus, das ihn durch das Oberbett wieder an seinen Souffleurkasten erinnerte. Über ihm lag »Falstaff«, fiel ihm ein, und er verband diesen Gedanken mit der herrlichen Musik Giuseppe Verdis. Schon fühlte er, dass er einschlief, doch gerade in der Phase seines Hinüberdämmerns begann Herr Heinzl, laut und unregelmäßig zu schnarchen. Es klang, als erstickte er. Aldrian erhob sich, schaltete das Licht ein, sah, dass Heinzl tief, nahezu ohnmächtig schlief, und beobachtete neugierig, wie er schnarchte. Dann kehrte er in sein Bett zurück. Er konnte in Eisenbahnen ohnehin nur schwer Schlaf finden, und obwohl er die Tablette eingenommen hatte, verspürte er keine Müdigkeit. Das Schnarchen von Heinzl erinnerte ihn an seinen Großvater, der in St. Gilgen am Wolfgangsee ein Haus gehabt hatte und ein Friseurgeschäft. Seine Frau war Perückenmacherin für die Salzburger Oper und die Festspiele gewesen. Beide waren lebhafte, umtriebige Menschen gewesen und hatten einen Sohn, seinen Vater, gehabt, der diese Tradition fortsetzte. Seine Mutter war im nahe gelegenen Bad Aussee zur Welt gekommen, wo sein Großvater in der Direktion des Salzbergwerks beschäftigt gewesen war und 1945 mit verhindert hatte, dass die ungeheuren Schätze aus dem Kunsthistorischen Museum in Wien, die im Zweiten Weltkrieg in den Stollen versteckt worden waren, durch mehrere vom NS-Gauleiter befohlene Sprengungen zerstört wurden. Es war ein lebensgefährliches Unternehmen gewesen, an dem sein Großvater zusammen mit einigen Bauern und Mitgliedern der Direktion teilgenommen hatte, und oft genug hatte er seine Enkel Michael und Jakob in das Innere des Bergwerks geführt, um ihnen zu zeigen, wo sich die Rembrandts und Pieter Brueghels d. Ä., Velázquez’ und Dürers, Caravaggios und die »Malkunst« Vermeer van Delfts befunden hatten. Zuvor hatte er ihnen anhand dicker Kunstbände, die er mit der Zeit erstanden hatte, erklärt, wer Parmigianino gewesen war und wer Arcimboldo, Holbein oder Gainsborough, Frans Hals, Ruisdael, Hieronymus Bosch oder Raffael, Tizian, Tintoretto, Giorgione oder Giovanni Bellini. Sein Bruder Jakob war so begeistert von den Bildern und dem Leben der Maler gewesen, dass er ihren Großvater immer wieder gebeten hatte, sie ihm in den Kunstbüchern zu zeigen, während er selbst mehr von der Fahrt mit dem Aufzug in die Stollen, in die Unterwelt hinunter, fasziniert gewesen war. Schließlich war Großvater mit ihnen nach Wien in das Kunsthistorische Museum gefahren und hatte sie durch die Säle mit den unzähligen großen und kleineren Gemälden geführt. Von da an hatte Michael die Ölbilder, die er sich gemerkt hatte, vor allem aber den Saal Pieter Brueghels d. Ä., mit den Stollen des Bergwerks verbunden und später mit Sigmund Freuds Lehre des Unbewussten und noch später mit seinem Beruf als Souffleur. In seiner Vorstellung hatte er sich, fiel ihm ein, im Souffleurkasten des Salzburger Festspielhauses oder der Wiener Staatsoper gefühlt wie in einem Stollen des Ausseer Salzbergwerks. Die kostümierten Sängerinnen und Sänger vor den Kulissen waren die versteckten Gemälde gewesen, die zum Leben erwacht waren. Auch seine Träume hatte er damit verglichen. Jakob hingegen hatte angefangen, die Bilder aus den Büchern Großvaters abzuzeichnen, und dabei erstaunliche Fertigkeiten entwickelt. Durch die Beziehungen seines Großvaters erhielt Jakob sogar die Erlaubnis, an bestimmten Tagen während der Sommerferien Gemälde im Kunsthistorischen Museum zu kopieren. Er selbst hingegen hatte schon früh mit dem Klavier- und Geigenspiel begonnen und aufgrund seiner außerordentlichen Merkfähigkeiten bald Kompositionen von Mozart, Hummel und Bach auswendig gespielt. Aber sowohl er als auch sein Bruder waren bei ihren künstlerischen Übungen nur Kopisten geblieben. Beiden fehlte die schöpferische Kraft, die Eigen-Art, dem einen die persönliche Note, dem anderen der originelle Pinselstrich. Weder konnte Michael auf den Musikinstrumenten etwas Eigenes erschaffen, noch vermochte sein Bruder originelle Bilder zu entwerfen. Jakob malte später Wolkenstimmungen und die Stoffmuster aus Gemälden stark vergrößert ab und gelangte so zu abstrakten Bildern, während Michael die einstudierten Musikstücke nur variieren konnte. Ihr Vater war jedoch von seinen beiden Söhnen so begeistert gewesen, dass er sie schon als künftigen Dirigenten beziehungsweise Bühnenbildner bei den Salzburger Festspielen gesehen hatte, für die er, wie seine Eltern, Perücken flocht und Frisuren kreierte, wofür er auch ein Friseurgeschäft mit Atelier in Salzburg besaß. Ihre Mutter, Lehrerin an einer Salzburger Volksschule, war ebenso vom Ehrgeiz für ihre Kinder beseelt gewesen wie der Vater.
Ein lautes Schnarch- und Furzgeräusch ließ Aldrian hochfahren. Die Bilder aus seinem Kopf verschwanden, er taumelte im Halbschlaf zum Abteilfenster und riss es hinunter. Jetzt erst, während er seinen Kopf in die Dunkelheit der Nacht hinausstreckte, ordneten sich die Fragmente seiner Erinnerungen in eine chronologische Reihenfolge, und als genügend eisigkalte Frischluft in den Raum geströmt war, schloss er das Fenster wieder und rüttelte Gottlieb Heinzl wach. Der Optiker stank nach Alkohol und Schweiß und setzte sich erschrocken auf. Als Aldrian ihm wütend erklären wollte, dass er laut schnarche und furze, ließ er sich auf das Kopfkissen zurückfallen und fing bald wieder mit seinem stockenden Schnarchen an.
Da Aldrian immer noch keinen Schlaf fand, gingen ihm wieder wahllos Erinnerungen durch den Kopf. Er überließ es jedoch nicht mehr seinem Gehirn, ihn mit Bildern in willkürlicher Reihenfolge zu überschwemmen, sondern fragte sich – sobald ein Bild vor seinem inneren Auge erschien –, was damals als Nächstes geschehen war. Dadurch wurden die Geschehnisse nicht mehr kaleidoskopisch durcheinandergeschüttelt, sondern bildeten stattdessen kleine Erzählzyklen, ähnlich Wandmalereien oder Darstellungen auf Tapisserien der Romanik.
Er sah, auf dem schmalen Bett liegend, jetzt die eigenen klavierspielenden Finger hinter seinen geschlossenen Augen und die Buntstifte in den Kinderhänden seines zeichnenden Bruders.
Die erste Opernaufführung, die er bei den Salzburger Festspielen gesehen hatte, war Mozarts »Die Hochzeit des Figaro« gewesen, und ihm fiel ein, wie er am folgenden Abend mit seinen sechs Jahren die gesamte Oper sogar mit verschiedenen Stimmen und ausführlichen Textpassagen im Wohnzimmer vor seinen begeisterten Eltern nachgestellt hatte.
Von da an hatten sie ihn wie einen kleinen Heiligen behandelt, ähnlich wie seinen älteren Bruder. Nicht selten war es ihm jedoch peinlich gewesen, wie sie ihren Bekannten gegenüber mit den Fähigkeiten ihrer Kinder angegeben hatten.
Eines Tages in einem Sommer, den sie in St. Gilgen am Wolfgangsee verbrachten – inzwischen waren er und sein Bruder vierzehn und sechzehn Jahre alt geworden –, berichtete ihr Vater, dass er dem greisen Nobelpreisträger Karl von Frisch die Haare geschnitten habe. Er habe ihm von seinen Söhnen erzählt, und dieser habe sie daraufhin – wohl aus Neugierde – zu sich in den Brunnwinkl eingeladen. Von Frisch hatte die Sprache der Bienen erforscht, und in den nächsten Tagen hatte der Vater das Buch des Nobelpreisträgers »Aus dem Leben der Bienen« gelesen und dessen Inhalt jeden Abend nach dem Essen seinen Kindern in vereinfachter Form nahegebracht.
Als sie am darauffolgenden Sonntagvormittag das Auto vor dem nur Fußgängern vorbehaltenen Weg abstellten und hinunter zum Brunnwinkl gingen, sprach keiner von ihnen ein Wort. Der Brunnwinkl war eine bezaubernde Gegend. Michael und Jakob hatten sie auch später mehrmals aufgesucht und Karl von Frischs Erinnerungsbuch »Fünf Häuser am See« gelesen.
Das Schlafwagenabteil war inzwischen endgültig zu einem rüttelnden Souffleurkasten geworden. Während auf der dunklen Bühne über ihm Falstaff schnarchte, blätterte Aldrian unter ihm weiter in der Partitur seiner Erinnerungen … Bis auf das zweite, das Fischerhaus, waren alle fünf Gebäude im Brunnwinkl mit der Zeit Eigentum der Familie von Karl von Frischs Großeltern und Eltern geworden. Die kleine Siedlung lag in einem versteckten Teil am Ufer einer bewaldeten Bucht. Im hintersten, vom Wald durch eine Wiese getrennten Gebäude – einer ehemaligen Mühle –, hatte der Bienenforscher fast jeden Sommer seines langen Lebens verbracht, während er zu den anderen Jahreszeiten seiner Profession als Biologe an der Münchner Universität nachging. Von 1945 bis 1950 hatte er allerdings – da die Münchner Universität im Zweiten Weltkrieg von Bomben zerstört worden war – in Österreich an der Grazer Universität Vorlesungen gehalten. Jakob, erinnerte sich Aldrian, war besonders neugierig auf den Mann gewesen, der die Sprache der Bienen entziffert hatte. Auch die Wiese, auf der von Frisch einen großen Teil seiner Bienenexperimente durchgeführt hatte, wollte Jakob unbedingt sehen, während Aldrian befürchtete, der Besuch würde ihn langweilen.
Der Brunnwinkl war im Juli voller Leben. Die Gebäude waren weiß verputzt, einige, wie das zweite, das Fischerhaus – hatte Michaels Vater vom Professor erfahren – waren mit einem oberen Stockwerk aus Holz ausgestattet. Jedes der Häuser wies wenigstens einen Balkon auf. Hinter dem zweiten Bauernhaus stand eine große Linde mit einer Bank rund um den Stamm herum. Dort saß – mein Vater flüsterte es voller Ehrfurcht – Karl von Frisch und wartete bereits auf sie. Er trug eine Lederhose, eine Brille und ein weißes Hemd. Als er aufstand, um ihnen entgegenzukommen, erkannte Aldrian, dass er nicht viel größer war als er selbst.
»Sind das die beiden Wunderkinder?«, fragte er lächelnd und schüttelte den Brüdern die Hände. Sein silberweißes Haar schimmerte im Sonnenlicht. Aldrians Vater, der wie üblich einen Regenschirm bei sich trug, öffnete diesen ein wenig und zog ein Blatt Papier heraus, das er Jakob rasch übergab, und dieser streckte es scheu dem berühmten Mann hin. Von Frisch warf einen Blick auf die, wie Michael vermutete, Bleistiftzeichnung, dann sagte er: »Das hast du nach einer Fotografie von mir gemacht, nicht? Ich kenne das Bild!«
Jakob war so aufgeregt, dass er nicht antwortete.
»Und die Bienen … Du hast sie aus einem Insektenbuch abgezeichnet.« Er betrachtete das Bild genau, sagte dann: »Kein Fehler!« und hob es kurz in die Luft. Aldrian hatte zu Hause gar nicht bemerkt, dass sein Bruder ein Portrait des Professors gezeichnet hatte, und nun sah er das Wunderwerk: der Professor und ein Dutzend Bienen, die das Bild schmückten. Ein Jahr später hatte Jakob ein zweites Portrait von Karl von Frisch gemalt, mit einem den Kopf des Professors umkreisenden Bienenschwarm als Heiligenschein. Er hatte es Michael zum Geburtstag geschenkt und seither hing es in seiner Wohnung. Aber nicht nur für Jakob, sondern auch für ihn selbst war Karl von Frisch zu einer Leitfigur geworden, jedoch aus anderen Gründen …
Zuerst hatten sie sich zur Mühle begeben, wo sie Himbeerlimonade getrunken und Honigbrote gegessen hatten, dann hatte der Professor ihn in einen bäuerlich möblierten Raum geführt, mit Stühlen, deren Lehnen – wie üblich – herzförmige Ausschnitte aufwiesen, und einem großen Tisch, an dem vielleicht zu Mittag gemeinsam gegessen wurde. Von Frisch legte »Die Macht des Schicksals« von Giuseppe Verdi auf den Plattenspieler – in unangenehmer Lautstärke, da der Biologe, wie sich herausstellte, schwerhörig geworden war –, und sie folgten gemeinsam dem ersten Akt. Für Michael war die Oper neu, denn sie hatten zu Hause zwar einen Plattenspieler, aber keine Aufnahme von »Die Macht des Schicksals«, und so hörte er mit größter Aufmerksamkeit zu, und da er seit drei Jahren bei einer Nachbarin in Salzburg Italienischstunden nahm, gelang es ihm, größere Teile des Textes singend, oder indem er statt der ihm entfallenen Wörter nur »lalala« sang, vorzutragen. Als er geendet hatte, fragte von Frisch erstaunt: »Siehst du auch Farben, wenn du singst?«
»Ja«, antwortete Michael wahrheitsgemäß. »C ist gelb, D grün …« – er berichtete vom Zusammenhang der Noten und Geräusche mit den Farben, und der Professor machte sich indessen Notizen.
Dann lehnte er sich zurück und sagte: »Die Musik wandelt sich in einem fort. Sie ist in permanenter Verwandlung begriffen. Die Metamorphose ist das Lebensprinzip der Natur. Der Verwandlungsprozess läuft einmal langsamer, einmal schneller ab, doch er wirkt in uns weiter, auch wenn wir vermeinen, es herrsche Stillstand. Insekten nehmen zuerst ihr Dasein in Eiform auf, dann verwandeln sie sich in Raupen, verpuppen sich und schlüpfen zuletzt als Imago, in der Gestalt, in der wir sie kennen, aus. Du siehst die Schönheit und Vielfalt der Verwandlungen am besten beim Schmetterling. Was für eine Überraschung, wenn die Imago in den schönsten Farben erscheint, der Zitronenfalter, der Kohlweißling, der große und der kleine Fuchs, der Schwalbenschwanz.« Michael fühlte sich wie verzaubert. Noch nie hatte jemand so mit ihm gesprochen, und als der Professor hierauf die Metamorphose des Menschen vom Kind zum Erwachsenen bis zum Greis und vom Schüler zum Lehrer, Künstler oder Mörder umriss, begriff Michael, dass er etwas Neues gehört hatte, das er paradoxerweise schon wusste, ohne aber zu wissen, dass er es wusste, jedoch sah er von nun an alle weiteren Entwicklungen in seinem Leben wie die Melodien in der Musik als fortlaufende Verwandlungsprozesse. Später, als Aldrian erwachsen war, zweifelte er nicht mehr daran, dass die Worte des Professors ihn auch deshalb so tief beeindruckt hatten, weil er noch in der Pubertät gewesen war, jener besonderen Zeit, aus der die Menschen wenigstens ein Stück in ihr weiteres Dasein zu retten versuchen, um nicht schon vor ihrem Tod zu sterben.
Der Professor lobte ihn, als sie wieder hinaus auf die Veranda gegangen waren. Er beschrieb vor Michaels Eltern das »Experiment«, wie er sagte, voller Begeisterung und hoffte auf eine weitere Begegnung – zu der es allerdings nicht mehr kam. Dann wandte er sich Jakob zu und bat auch ihn, ihm zu folgen. Es dauerte mehr als eine Stunde, bis sie zurückkehrten. Geradezu triumphierend zeigte der Nobelpreisträger ihnen die Zeichnung, die Jakob in der Zwischenzeit angefertigt hatte. Aus einem zoologischen Lehrbuch hatte er ein Chamäleon in zwei Stadien seiner Färbung vergrößert und in allen Einzelheiten abgezeichnet und zum Teil mit Buntstift bemalt. »Wir sehen hier etwas ganz anderes als die Metamorphose, die Verwandlung, von der ich mit Michael gesprochen habe. Das Chamäleon ist ein Meister der Mimikry, der Verstellung. Seit Darwin wissen wir, dass der Mensch seinen Ursprung bei den wunderbaren Affen genommen hat, ich glaube aber, dass er aus den Chamäleons entstanden ist.« Er lachte, und wir anderen lachten auch – wohl aus Anspannung und Überreizung. Das war die zweite Lebenslehre, die Aldrian aus der Begegnung gewann. Die Sätze Karl von Frischs gingen ihm nie wieder aus dem Kopf. Genauso wenig wie die Wörter »Metamorphose«, »Mimikry« und der Vergleich des Menschen mit dem Chamäleon.
Die im Brunnwinkl lebenden Kinder und Jugendlichen hatten ein Segelboot, ein Ruderboot und eine Badestelle am Ufer, von wo aus sie in das Wasser hinausschwammen. Auch Michael hatte sich das insgeheim gewünscht, aber der Entdecker der Bienensprache ging inzwischen schon zum Dachboden des vorderen Hauses voraus, wo sie Hunderte von ausgestopften und präparierten Tieren sahen, die alle von ihm und der großen Familie gefangen und erlegt worden waren: Füchse, Dachse, Murmeltiere oder Hasen, Rotwild ebenso wie Schlangen, Salamander oder Eulen. Außerdem verglaste Kästen mit Schmetterlingen, Nachtfaltern, Libellen, Bienen, Käfern, Heuschrecken, Grillen und anderen Insekten. Alles war von Hand beschriftet, und der Professor lud Jakob schließlich ein, den Tag über bei ihm zu bleiben und zu zeichnen.
Während Aldrian mit seinen Eltern das Mittagessen in einem nahe gelegenen Gasthaus einnahm, speiste Jakob, wie sie von ihm am Abend erfuhren, mit dem Professor und seiner Familie im Brunnwinkl. Der Professor habe, erzählte Jakob, ihn immer wieder aufgefordert, lauter zu sprechen, da er schlecht höre. Jakob sprach von Natur aus leise, im Gegensatz zu ihm, seinem Bruder. Manchmal flüsterte Jakob nur, dass sogar er ihn kaum verstand und sich darüber ärgerte.
Am Nachmittag führte Karl von Frisch die Besucher dann auf die Wiese hinter dem alten Mühlhaus, wo mehrere Bienenstöcke standen. Um ihnen eine Freude zu machen, erklärte er in kurzen Worten, wie er die Sprache der Bienen erkundet hatte, und zuletzt durften die beiden Brüder auch noch den Badesteg benutzen.
Inzwischen musste Aldrian eingeschlafen sein, denn als er, geweckt von einem besonders lauten Schnarchgeräusch, die Augen öffnete, glaubte er zuerst, geträumt zu haben. Falstaff im Oberbett setzte sich plötzlich auf, kletterte schwerfällig die Leiter hinunter, machte Licht und trat in Unterhosen auf den Gang. Die Groteske, die Aldrian aus seinem wackelnden, zitternden, schaukelnden »Souffleurkasten« missmutig beobachtete, ging also weiter. Im schwachen Deckenlicht kam ihm die vergangene Zeit unendlich weit zurückliegend vor. Er dachte an seinen Bruder, an sein damaliges Aussehen, wie er es im Kopf behalten hatte, und daran, dass dieser durch das Beispiel Karl von Frischs selbst mit dem Biologiestudium und dem Sammeln von Käfern begonnen hatte. Er war ein wunderbarer Zeichner nach der Natur geblieben. Aldrian fiel weiter ein, wie sein Bruder auf Erkundungsmärsche durch Wiesen und Wälder gegangen war, während er selbst sich am liebsten im Wasser vergnügt hatte. In seiner knappen freien Zeit hatte Aldrian den Motorboot- und Segelschein gemacht und während des Kapellmeisterstudiums aus Freude daran sogar die Ausbildung zum Steuermann des Ausflugsschiffes. Er saß hin und wieder bei dem mit ihm befreundeten Schiffsunternehmer auf der Brücke und durfte das Schiff über den Wolfgangsee steuern.
Dann war jener Abend bei den Salzburger Festspielen gekommen, an dem ihn der verzweifelte Direktor des Festspielhauses bat, für eine erkrankte Souffleuse einzuspringen …
Die Abteiltür wurde aufgerissen, und Herr Heinzl kehrte mit gequälter Miene zurück. Während er wieder die Leiter zum Oberbett hinaufkletterte, konnte Aldrian ihn fluchen und stöhnen hören, bis es allmählich wieder still wurde.
Schon glaubte Aldrian, jetzt wenigstens einige Stunden dösen zu können, als »Falstaff« wieder mit seinem Schnarchen anfing und er zurück in seine Gedankenwelt floh.
Sein Bruder war inzwischen Assistent in der insektenkundlichen Abteilung der Entomologie in Wien geworden, fiel ihm ein, und hatte das erste von ihm illustrierte Buch, einen Insektenführer, herausgebracht. In der Folge illustrierte Jakob einen Vogelführer mit Aquarellen, ein botanisches Werk über Orchideen und einen Atlas der Meeresmuscheln. Aldrian sah im Halbschlaf die Bilder vor sich, die Jakob ihm damals geschenkt hatte und die jetzt gerahmt in seiner Wohnung hingen … Sie waren von großer Schönheit, fand er. Bei längerem Hinsehen ging etwas Magisches von ihnen aus, er empfand dabei eine ungewohnte Nähe zu den Lebewesen und selbst den Pflanzen. Die Besuche in den Stollen des Salzbergwerks in Aussee hatten in ihm und Jakob auch eine anhaltende Neugierde auf Höhlen geweckt, und ihm fiel ein, wie sie bei einer Besichtigung der Eisriesenwelt in Werfen Jakobs spätere Frau kennengelernt hatten. Sie war drei Jahre älter als Jakob, wie sich herausstellte, groß, dunkelhaarig, elegant und hieß Elena. Schon während der Wanderung durch das ausgedehnte Stollenlabyrinth war Jakob ihr nähergekommen, und nachdem sie alle drei müde ins Freie getreten waren, hatten sie von ihr bei einem Glas Wein erfahren, dass sie Restauratorin in der Tate Gallery war, nachdem sie bereits zwei Jahre im Louvre gearbeitet hatte. Ihre Eltern besaßen ein Geschäft für große Muscheln und Meeresschnecken, Fossilien, Schmuck und vor allem Perlen in Venedig und waren, wie sich herausstellte, sehr wohlhabend. Auch Aldrian hatte sich in Elena verliebt, aber da Jakob für sie schon die ersten Muscheln, Vögel und Schmetterlinge gezeichnet hatte, bevor er selbst noch Gelegenheit fand, sie in der Bar ihres Hotels mit seinem Klavierspiel zu beeindrucken, und da er außerdem auch jünger war als sein Bruder, setzte er die geplante Wanderung in die Tropfstein- und Wasserhöhlen Dorfgasteins und Lamprechtsofens allein fort. Sobald er damals aus der Dunkelheit der Höhlen wieder ans Tageslicht getreten war, erinnerte er sich jetzt, war er von der grellen Sonne geblendet worden.
Diesmal jedoch war es der Schaffner, der ihm mit der Taschenlampe ins Gesicht leuchtete … Zuerst fand Aldrian sich nicht zurecht, dann sah er, dass »Falstaff« die Bühne verlassen hatte und die Oper zu Ende war. Er war, sagte er sich, im rüttelnden Souffleurkasten – wohl aus Erschöpfung – endlich eingeschlafen. Der Zug hielt gerade in Mestre und würde in zwanzig Minuten nach Venedig weiterfahren, erklärte ihm der Schaffner. Draußen war es noch dunkel, und seine Erinnerungen verflüchtigten sich dorthin, woher sie gekommen waren.
Zweites Buch
In Atlantis
Fast 25 Jahre wohnte er schon, wenn er in Venedig war, in einem Dachzimmer mit Kochnische im Haus seines Bruders. Bei seinen meist kurzen Aufenthalten hatte er vor allem die Oper, das Teatro La Fenice, besucht, von dem er einen der Maestri Suggeritori, Lorenzo Verra, kannte.
Oft hatte ihn sein Bruder auf Ausflüge mitgenommen – zum Lido oder nach Murano, Burano und Torcello –, um mit ihm auf Bummelwegen die berühmten Cafés und volkstümlichen Ostarias aufzusuchen. Jakob hatte ihm gerne von der Geschichte der Stadt erzählt, ihn mit Venedig-Büchern beschenkt und ihn überredet, gemeinsam Kirchen anzuschauen und in der Accademia Gemälde zu betrachten. Dabei waren Aldrian auch der Markusdom, der Campanile und der Dogenpalast vertraut geworden. Was sein Bruder nicht ahnen konnte, war der Umstand, dass Michael religiöse Renaissance-Gemälde und Kirchen als bedrückend empfand. Er verglich sie mit Grüften und Albträumen. Ihm genügte das Leben in der künstlichen Welt als Maestro Suggeritore der Oper, in der die Musik Zeit und Raum aufhob und so den Geschehnissen etwas Einzigartiges gab. Aus seinem Souffleurkasten heraus erblickte er dann nur Beine, Bäuche, Brüste und darüber Gesichter, wie selbständige, fremde Wesen. Die religiösen Renaissance-Bilder hingegen bestanden für ihn darauf, als Zeugnisse von Tatsachen aufgefasst zu werden, als Beweise, dass das Dargestellte nicht zu leugnen war. Tatsächlich hatten ihn die sakralen Gemälde, die in den Kunstbänden seines Bruders abgedruckt waren, bis in den Schlaf verfolgt. Für ihn litten Gläubige an einer Art von Verfolgungswahn, da sie sich in einem fort von Gott, der alles sah und wusste, beobachtet und durchschaut fühlten. Sie lebten, sagte er sich, in einem geheimen Überwachungsstaat, ohne den Überwachenden zu sehen, zu hören oder gar zu kennen. Jetzt aber, nachdem ihm die Oper genommen worden war, wollte er sich diesen Bildern stellen, ja, er wollte der »Wasserstadt«, wie er sich scherzhaft sagte, auf den Grund gehen. Für die nächsten Tage hatte er unter anderem einen Termin im Dogenpalast, den er in- und auswendig kannte, dessen »geheime Wege« er aber noch einmal sehen wollte. Als Erstes jedoch musste er eine Verabredung im Archivio di Stato di Venezia einhalten, die ihm der Direktor des Wiener Staatsarchivs, Dr. Mikoletzky, vermittelt hatte. Ein kunstinteressierter Psychiater, Dr. Feilacher, hatte ihm außerdem die Möglichkeit verschafft, das ehemalige Irrenhaus auf der Insel San Servolo zu betreten, und nicht zuletzt hatte ihm die Direktorin der Nationalbibliothek, Dr. Rachinger, den Zugang zur Biblioteca Marciana am Markusplatz ermöglicht. Auch sein Bruder und seine Schwägerin hatten schließlich verschiedene Genehmigungen für Besichtigungen eingeholt, die sie ihm per Mail zugeschickt hatten.
Er hob den Koffer über die Stufen, die vom Waggon zum Bahnsteig führten, und schritt dann, das Gepäckstück hinter sich herziehend und den gerahmten Druck von Adalbert Stifter unter einen Arm geklemmt, durch die Halle, in der ihm Menschen mit gelben Kunststoffsäcken an den Beinen entgegenkamen. Ihm war klar, dass es Hochwasser, Acqua alta, bedeutete. Er hatte es schon einmal, in der Adventszeit 2008, auf drastische Weise erlebt. Damals hatte er seinen Bruder mit dem Vaporetto zum Markusplatz begleitet, wo sie mit Gummistiefeln, die ihre Beine bis zu den Hüften bedeckten, zum Caffè Florian gestapft waren und dort in den mirakulösen Räumen »Spritz« getrunken hatten. Er wusste nicht einmal mehr, wie sie damals nach Hause gekommen waren.
Diesmal fiel das Acqua alta zu seiner Überraschung noch höher aus. Der Weg zu den Kiosken, an denen die Fahrscheine für die Vaporetti zu lösen waren, führte bereits durch knöcheltiefes Wasser, und vor den Stufen des Bahnhofs standen fliegende Händler, die ihre provisorischen Stiefel – zwei gelbe Kunststoffsäcke mit Sohlen und Absätzen – anboten. Während er auf das nächste Vaporetto wartete, streifte er ein Paar über – sie reichten bis zu den Knien – und begab sich zur Anlegestelle. Dort rief er mit seinem Smartphone die Nummer seines Bruders an, dieser meldete sich jedoch nicht. Auch Elena, dessen Frau, konnte er nicht erreichen, aber da er ihnen mitgeteilt hatte, dass er diesmal länger bleiben würde, hatten sie es vielleicht nicht so eilig, ihn zu begrüßen.
Das nächste Vaporetto war fast leer, nur ein altes Ehepaar mit seinem weißen Schoßhündchen saß in der Mitte des Schiffs: der Mann geschmückt mit einer Perücke und schwarzem Dreispitz, die Frau mit einem riesigen Federhut und Lorgnon. Ihr Gesicht war weiß gepudert, der Mund grellrot mit Lippenstift nachgezogen, weshalb ihre Zähne dunkelgelb wirkten. Die beiden Kostümierten wirkten wie aus dem Museum entsprungen. Als er das Abteil betrat, starrten sie ihn an, bis er das Bild zu Boden stellte, das Schoßhündchen kläffte kurz, dann blickten sie wieder gelangweilt aus dem Fenster. Obwohl Aldrian Müdigkeit verspürte, blieb er stehen und betrachtete die Palazzi des Canal Grande, die er schon so oft gesehen hatte. Bisher waren es für ihn romantische Kulissen gewesen, diesmal aber erschienen sie ihm wie ein neues Zuhause. Selbst der Palazzo Vendramin, das Sterbehaus Richard Wagners, jetzt das Städtische Casino, an dem das Vaporetto vorbeifuhr, war für ihn nicht mehr bloß eine von vielen Sehenswürdigkeiten, sondern er verband das Gebäude mit einer Aufführung von »Tristan und Isolde«, die ungerufen mit Bühnenbild und Musik in seinem Kopf erschien, aber, da er sich sagte, dass er ein anderes Leben beginnen müsse, gleich wieder verschwand. Er drehte sich nach dem maskierten Paar um, das ihm jetzt wie zwei verwirrte Mitglieder des Staatsopernchors erschien, die den Weg zur Bühne nicht fanden, und stellte fest, dass der Mann mit dem weißen Hündchen im Arm seinen Platz verlassen und sich eine Reihe vor seiner Frau niedergelassen hatte, um wie sie am Fenster zu sitzen. Dabei bemerkte er, dass auch der Mann gelbe, provisorische Stiefel trug, die seinem karnevalesken Aussehen zusätzlich etwas Skurriles verliehen. Seine Frau musste gleichfalls mit provisorischen Stiefeln ausgerüstet sein, schloss er, und er dachte an zwei giftige Blumen in gelben Porzellanvasen. Von jedem der Palazzi ging ein romantisches Flair aus, das in ihm den Wunsch erzeugte, die Zeit überwinden zu können. Er befand sich, hatte er kurz das Gefühl, zugleich in der Gegenwart und in der Vergangenheit. Da er diesmal mit bestimmten Absichten in die Lagunenstadt gekommen war und Erwartungen daran knüpfte, beschäftigte er sich überdies auch mit der Zukunft. Die Palazzi, die ebenfalls Vergangenes und Gegenwärtiges repräsentierten und auch noch in Zukunft existieren würden, zumindest solange es die Stadt noch gab, erschienen ihm jetzt wie Beweise seiner Gedanken. Er hatte die Empfindung der Zeitlosigkeit schon als Kind gesucht und zuerst im Kasperltheater und dann im Theater und schließlich in der Oper verspürt. Auf eine unbestimmte Weise, für die er sich ihrer Lächerlichkeit wegen schämte, war ihm sein eigenes Leben zu einer endlosen Oper geworden, mit Unterbühne, Schnürboden, Publikum, Dirigenten, Darstellern und nicht zuletzt seinem Souffleurkasten, der ein Taxi, ein Eisenbahnabteil, ein Vaporetto oder ein Zimmer sein konnte. Aber er fürchtete, eines Tages zum Gespött zu werden, wenn er sich nicht gegen die Vorstellung wehrte. Er lächelte. Wenn er schon Teil einer riesigen Opernaufführung war, dann höchstens wie ein unsichtbares Sauerstoffatom in der Luft, sagte er sich. Die Gondeln am Ufer schwebten im Acqua alta wie vergessenes Riesenspielzeug, und der Canal Grande war nur wenig befahren.
An der nächsten Station stiegen zwei Männer mit Gummistiefeln ein, die bis zur Hüfte reichten. Sie trugen Anoraks, Jeans und Aktentaschen und gaben der Fahrt dadurch einen Anstrich von Alltäglichkeit. Ihre Gesichter drückten Gleichgültigkeit aus, als handle es sich bei allem, was geschah, um längst Gewohntes, und als sich einer von ihnen setzte, eine Zeitung aus seiner Ledertasche nahm und zu lesen begann, fiel Aldrian der Fischmarkt ein, den er überqueren musste, um zum Haus seines Bruders und dessen Laden »Jurassic Park« zu gelangen. Die Auslagen des Geschäfts waren mit Skelettschädeln von Tieren dekoriert – zuletzt von einem Krokodil, einem Sägefisch und einem Affen – sowie den Gehäusen von Meeresschnecken, Muscheln und kostbarem Perlenschmuck. Sie sahen bizarr, aber auf eine raffinierte Weise elegant und seriös aus. Natürlich verkaufte Jakob auch die Knochenschädel, Muscheln und sogar seltene kostbare Schmetterlinge und Kristalle, doch den größten Gewinn erzielte er mit den Perlen aus China. Das hatte er von ihm öfters gehört. Aldrian hatte keine Ahnung, wie die Geschäfte abliefen. Selten begegnete er Käufern im Laden, meistens nur Neugierigen, die sich umschauten. Von weitem sah er jetzt die Rialtobrücke und einige Gondeln mit asiatischen Besuchern, die jeden Quadratzentimeter der Stadt fotografierten. Wie alle Touristen hasste Aldrian die übrigen Touristen, besonders jene, die sich auf der Suche nach Romantik mit Gondeln durch die Kanäle fahren ließen. Sie glaubten wohl, das wahre Venedig zu erfahren. Aber das wahre Venedig gab es nicht mehr, dachte Aldrian schadenfroh.
Auf der Rialtobrücke war niemand zu sehen, auch sonst schien alles langsam im Meerwasser unterzugehen. Und da er vom Vaporetto aus nur die Rückseiten der Geschäfte auf der Rialtobrücke erkennen konnte, war er unsicher, ob die Läden überhaupt geöffnet hatten. Die aus Holzbänken zusammengesetzten Hochwasserstege jedenfalls waren großteils unter der dunkel schillernden Oberfläche des Acqua alta versunken, nur einzelne Abschnitte ragten noch heraus. Er stieg an der Station »Rialto Mercato« aus und fand sich sofort bis zu den Knien im übergetretenen Wasser aus dem Canal. Der Fischmarkt war offensichtlich geschlossen. Auch auf dem Gemüsemarkt war kein Betrieb. Nur an einem Stand mit Leinendach bot ein Verkäufer in grünen Gummistiefeln seine Ware an. Ein einsamer alter Fußgänger – ebenfalls in Gummistiefeln und mit einem schmalkrempigen Regenhut auf dem Kopf – ließ sich gerade vier oder fünf Orangen abwiegen. In seinem Einkaufsnetz sah Aldrian Zwiebeln, Rucolasalat und Melanzane. Der sonst so lebendige Fischmarkt mit der großen, gelben Verkaufshalle war leer. Von ihren Arkaden hingen wie immer die roten Planen, die gegen das Sonnenlicht und den Wind schützten. Selbst an Sonntagen und Montagen war noch der Geruch von toten Meerestieren wahrzunehmen, so auch diesmal. Als er die Halle durchquerte, stand Aldrian das Wasser nur noch bis zu den Schienbeinen. Plötzlich sah er zwei Schritte vor sich ein Tier unter der Oberfläche, einen Rochen, wie er feststellte. Er blieb stehen und erkannte, dass er tot war. Das Meerestier schwebte mit dem gelbgrauen Bauch nach oben über dem Boden und bewegte sich jedes Mal schwach mit, wenn Aldrian sich bewegte. Mit Sicherheit war er beim letzten Fischmarkt irgendwo liegen geblieben und durch das Acqua alta herangeschwemmt worden. Hinter einer Säule waren schwere Rollwagen für die Waren, Tische und Geräte abgestellt. Das Wasser wurde zum Haus mit dem Ladenschild »Jurassic Park« hin immer seichter, und der Eingang lag bereits im Trockenen. Von weitem machte das Geschäft mit den beiden Schaufenstern auf Aldrian einen verlassenen Eindruck, aber das war schon öfter der Fall gewesen, auch wenn sein Bruder zu Hause war. Im Laden war es zumeist dämmrig, denn nur die verglaste Verkaufstheke war von unten her beleuchtet, und die Deckenlampen wurden erst eingeschaltet, wenn Kunden eine bessere Sicht wünschten. Auf diese Weise versuchte sein Bruder zu verhindern, dass nur Neugierige eintraten.
Nachdem er die Eingangstür geöffnet und mehrere Poststücke, Briefe, Prospekte und eine Zeitung vom Boden auf einen Tisch vor der Garderobe gelegt hatte, zog er die provisorischen Regenstiefel aus. Er war über die Stille im Haus verwundert und fragte sich, wo sein Bruder sei. Dann nahm er einen tiefen Atemzug, bevor er mit seinem Koffer und dem gerahmten Bild in der Kunststofftasche die drei steilen Treppen bis zum letzten Stockwerk hinaufstieg. Dabei bemerkte er, dass die Tür zur Wohnung seines Bruders nur angelehnt war. Er rief hinein, dass er gerade angekommen sei, erhielt aber keine Antwort. Vermutlich war Jakob rasch irgendwohin gelaufen … und Elena auf Reisen, beruhigte er sich … Dennoch war es merkwürdig … Erschöpft und verschwitzt kam er oben an, stellte das Gepäck auf den Fußboden und schloss die Tür zu seiner Garçonnière auf. Drinnen war es eisig kalt, er kannte das von seinen winterlichen Besuchen her, während es im Sommer zumeist unerträglich heiß war. Immer hatte Elena vor seiner Ankunft eingeheizt beziehungsweise die Fenster geöffnet. Diesmal aber musste er anhand einer bereitliegenden Gebrauchsanweisung erst umständlich die Heizung und den Boiler einschalten, eine Tätigkeit, die ihn in wachsende Wut versetzte, da er mit Bedienungsanleitungen nichts anzufangen wusste. Entweder verstand er sie falsch oder gar nicht. Als er noch Maestro Suggeritore in der Staatsoper gewesen war, hatte er sich beim Kauf eines technischen Geräts immer an einen Bühnenarbeiter gewandt, der alles in seiner Wohnung zusammenbaute und, wie er annahm, hinter seinem Rücken über ihn lachte. Da er ihn großzügig entlohnte, verspottete er ihn wenigstens nicht, sagte er sich, sondern respektierte ihn für seine musikalischen und sprachlichen Fähigkeiten. Aber jetzt, mit der auf Italienisch verfassten Bedienungsanleitung, spürte er, wie beschränkt er in Wirklichkeit war. Er akzeptierte das zwar, aber seine Ungeduld, seine Abneigung und die vergeblichen Versuche brachten ihn schließlich so weit, dass er alles hinwarf und aus Zorn die Nische in der Küche verließ, die eigenen hüfthohen Stiefel hinter dem Schrank hervorholte, in seinen Anorak schlüpfte, und, ohne seinen Koffer auszupacken, das Haus verlassen wollte, als er bemerkte, dass die Heizung sich eingeschaltet hatte. Er konnte es zuerst nicht glauben, aber es wurde allmählich warm in der Garçonnière.
Giorgio de Chirico: Geheimnis und Melancholie einer Straße. Aus: Maurizio Faggiolo dell‘Arco: L’opera completa di de Chirico 1908–1924
Nachdem er aus Gewohnheit seinen Pass mit der Bankomatkarte und dem Großteil seines Geldes unter dem Packpapier, mit dem der Schrank ausgelegt war, versteckt hatte, warf er einen Blick aus dem Fenster auf die leere Fischhalle, die ihn an die Einsamkeit in den Bildern de Chiricos erinnerte, und begab sich sodann hinunter auf den Platz, nicht ohne vorher einige Schritte in die Wohnung seines Bruders gemacht und vergeblich seinen Namen gerufen zu haben. Vor dem Haus versuchte er, durch das unbeleuchtete Schaufenster in das Geschäft zu schauen, hinter den Scheiben war es jedoch dunkel und still, und Aldrian stellte jetzt fest, dass die Lichter unter der Verkaufstheke nicht eingeschaltet waren. Er holte sein Telefon aus der Regenjacke und versuchte wieder, seinen Bruder und dann Elena zu erreichen, doch meldete sich abermals keiner von beiden. Er könnte Emilio, ihren Sohn, der in England Kunst studierte, anrufen, überlegte er. Oder Elenas Schwester? – Er steckte das Telefon jedoch wieder ein und nahm sich vor, bis zum Abend zu warten. Jetzt war er frei, ging es ihm durch den Kopf. Ohne Verpflichtung und ohne von irgendjemandem abhängig zu sein. Er wanderte zur Rialtobrücke, zuerst durch die leere Fischhalle, immer das klatschende Geräusch des Wassers unter seinen Stiefeln im Ohr, zwischen den verlassenen Obst- und Gemüseständen hindurch und an der Pferdefleischerei vorbei, aus der er einen süßlichen Verwesungsgeruch wahrnahm. Es zog ihn weg vom Canal Grande in die unübersichtlichen Gassen, in denen das Wasser nur in flachen Pfützen stand. Aber als er zur Rialtobrücke einbog, gelangte er neuerlich in das Acqua alta, das ihm auf einmal bis zum Rand der Stiefel reichte. Die Bänke, die bei Hochwasser für die Fußgänger zusammengeschoben wurden, waren, wie er schon vom Vaporetto aus festgestellt hatte, überschwemmt. Er strauchelte, konnte aber gerade noch das Gleichgewicht wiederfinden. Nirgendwo sah er einen Menschen. Üblicherweise wälzte sich der Touristenstrom, der vom Bahnhof kam, den ganzen Tag lang zur Rialtobrücke und von dort zum Markusplatz. Jetzt aber war alles wie ausgestorben. Aus einem Fenster schaute eine Katze zu ihm herunter. Dann hörte er von weitem ein Vaporetto näher kommen. Ein Lastkahn mit alten Möbeln und drei Männern in orangefarbenen Jacken rauschte inzwischen auf dem Canal Grande vorüber. Möglicherweise, ging es ihm durch den Kopf, sehe ich gerade, wie Venedig im Meer versinkt. Er hatte schon einige Male versucht, das Museo Fortuny zu besuchen, aber jedes Mal war es wegen Renovierungsarbeiten geschlossen gewesen. Fortuny, der Sohn eines spanischen Salonmalers, hatte weltberühmte Stoffkreationen entworfen. Er erwarb den Palazzo Pesaro degli Orfei, in dem er seine Kundinnen – Schauspielerinnen, Prinzessinnen und Millionärsgattinnen – empfing. Vor allem war Fortuny jedoch Bühnenausstatter, Fotograf und Maler gewesen und ein Bewunderer Richard Wagners. Aldrian hatte in der Staatsoper den gesamten Nibelungen-Zyklus souffliert und kannte auch die anderen Opern des Komponisten auswendig. Am meisten schätzte er »Tristan und Isolde«. Und gerade an diese Oper erinnerten ihn die Abbildungen der Stoffmuster Fortunys, die er in Jakobs Büchern gesehen und bewundert hatte. Als er die Treppen zur Rialtobrücke erreichte, spürte er den Wind und einen feinen Hauch von unsichtbaren Wassertropfen im Gesicht. Die Beine bewegten sich, als er die Stufen betrat, fühlbar leichter und vermittelten ihm ein Gefühl von Schwerelosigkeit. Er bildete sich ein, die Brücke noch nie so rasch hinaufgestiegen zu sein. Niemand war zu sehen, und der Großteil der Geschäfte hatte geschlossen. Die Läden verstellten wie immer auf beiden Seiten die Sicht zum Canal. Um einen Ausblick zu haben, hätte er daher eine der seitlichen Treppen nehmen müssen. Dann sah er eine Taube am wolkenbedeckten Himmel über seinen Kopf schweben, die aber vom Wind bei ihrem Flug gestört wurde und sich mit flatternden Flügeln auf dem Dach eines der hüttenförmigen Geschäfte niederließ. Im darunter liegenden Laden waren Masken aller Art ausgestellt. Er kannte längst die »Pestärzte«, die mit ihrer Verkleidung – schnabelförmige Nasen, schwarze Hüte und Umhänge – wie trauernde Raben aussahen, oder die langnasigen weißen Pierrots und die puppengesichtigen Frauenmasken aus der Zeit des Rokoko. Schon als Kind hatten es ihm Masken und Verkleidungen angetan, und er hatte bei seinem Gesangsstudium immer wieder Gelegenheiten gefunden, sich als die verschiedensten historischen Figuren schminken zu lassen. Mitunter ärgerte er sich selbst darüber, was für ein »Traumtänzer« – so hatte ihn seine geschiedene Frau genannt – er zeitlebens war.
Er betrat das Geschäft, kaufte eine unbemalte langnasige Komödienmaske und bat, sie in eine möglichst große Nylontasche zu geben, denn er wusste, dass das Acqua alta rasch zurückgehen konnte und er dann mit seinen hohen Stiefeln lächerlich aussehen würde. Die meisten Venezianer trugen bei Hochwasser eine größere Plastiktasche mit sich, in der sie auch die Stiefel bei Bedarf verstauen konnten. Auf der anderen Seite der Rialtobrücke stand das Wasser ebenso hoch, und die üblichen Andenkenstände fehlten auf dem Platz vor dem ersten Aufgang. Der Canal Grande war seltsam unbelebt. Aldrian verspürte den Wunsch, zurückzugehen und auf den Canal hinunterzuschauen, aber da er das Museo Fortuny besuchen wollte, schlurfte er weiter zum Campo Manin, der von unbewegtem, knöcheltiefem Acqua alta, in dem sich die Gebäude spiegelten wie in einer Glasscheibe, bedeckt war. Die Szene ließ ihn innehalten und um sich blicken. Erst als ein Hund über den Platz rannte und einen Teil der Spiegelungen zerriss, worauf sie sich in Farbstreifen und verzerrte Abbilder auflösten, überquerte er den über die Ufer getretenen Rio di San Luca und gelangte endlich zum Campo San Beneto, wo das Hochwasser bis zu seinen Waden reichte. So schnell er konnte, schritt er zum Eingang des Museums auf der Rückseite des prächtigen Palazzo Pesaro. Sie war aus Holz und hatte eine Außentreppe. Das gab dem Palazzo, der auf der Vorderseite wie ein orientalischer Palast aussah, auf der dem Canal Grande abgewandten Seite ein ländliches Aussehen. Die Pesaros waren eine einflussreiche Familie gewesen und hatten sogar einen Dogen gestellt. Im 17. Jahrhundert war das Gebäude dann ein Theater und im 18. sogar ein Konzerthaus geworden, das die Bezeichnung »Palazzo Pesaro degli Orfei«, »Orpheuspalast«, hatte, ein Name, der Aldrian schon beim ersten Hören angezogen hatte. Erst als er die Holztreppe betrat, fiel ihm ein, dass das Museum wegen des Acqua alta ebenfalls geschlossen sein könnte. Der Garten, die Topfpflanzen und Sträucher, der Ziegelboden und der kleine Brunnen standen unter Wasser, das zwischen den Ziegelmauern, die den Garten umgaben, einen kleinen Teich bildete. In jedem Stockwerk über ihm erkannte Aldrian Loggien mit hölzernen Säulen, woraus er auf die ungewöhnliche Höhe der Säle im Inneren des Gebäudes schließen konnte. Die Schwarz-Weiß-Fotografie einer Frau mit einem Schleier vor dem Gesicht hing in Glas gerahmt als Plakat vor der Eingangstür. Schon beim Betreten des Palazzos stellte er fest, dass er vermutlich der einzige Besucher war. Der Aufseher saß an einem Schreibtisch und schien in Kassenbelege vertieft zu sein, er reagierte nicht auf seine Schritte. Aldrian setzte sich an einen Tisch, der offensichtlich zu den Ausstellungsobjekten gehörte. Der große Saal war mit verschiedenfarbigen floralen Mustern tapeziert – einer Art »Flickwerk« aus farbigen Theatervorhängen – und die Wände darüber mit goldgerahmten Ölbildern im Stil des Symbolismus geschmückt. Das Ambiente der Säle, in die er von seinem Stuhl aus blicken konnte, machte auf Aldrian, wie schon die Vorderseite des Palastes, einen orientalischen Eindruck. Von der Holzbalkendecke hingen wagenradgroße, hutförmige Lampenschirme aus reich gemusterten Stoffen. Er stand auf und machte einige Schritte auf einen nahezu blinden goldgerahmten Spiegel zu und betrachtete, was von ihm selbst noch zu sehen war. Er kam sich jetzt wie eine Geistererscheinung vor. Als er kurz die Augen schloss, hörte er in seinem Kopf Isoldes Verklärung »Sind es Wellen sanfter Lüfte? Sind es Wogen wonniger Düfte? Wie sie schwellen, mich umrauschen, soll ich atmen, soll ich lauschen? Soll ich schlürfen, untertauchen? Süß in Düften mich verhauchen? In dem wonnigen Schwall, in dem tönenden All, in des Welt-Atems wehendem All – Ertrinken – Versinken – Unbewusst – Höchste Lust!«. Dann gaukelte ihm sein Kopf einen Stummfilm vor, in dem er allein im Saal des Museums saß und als einziger Überlebender einer Hochwasserkatastrophe Zuflucht gefunden hatte.
Er befand sich in einem alchemistischen Universum, das aus Kunst geformt war. Es gab alte Fotoalben mit braun verfärbten Aufnahmen, gerahmte Stoffe mit Mustern, die ihm wie mikroskopische Splitter aus Tausendundeine Nacht erschienen, es gab die hutförmigen Lampenschirme, die das Licht in einen Sog kreisender, chinesischer Schriftzeichen verwandelte, daneben Bühnenmodelle wie Zimmer in Puppenhäusern, Entwürfe in der Sprache von Fragmenten, goldgerahmte, überschwängliche Ölbilder von nackten Frauen, alte Schwarzweißfotografien mit venezianischen Motiven, die ihn, da sie aus einem Boot oder einer Gondel aufgenommen waren, an die Sicht aus dem Souffleurkasten erinnerten, und auch Bilder eines Autorennens, das Fortuny gesehen haben musste. Die Schwarz-Weiß-Fotografie zeigte eine Pappelallee, in der gerade ein offener Sportwagen, der eine Staubfahne hinter sich herzog, auftauchte, und am Straßenrand Männer mit Kappen, die neugierig auf das Fahrzeug blickten. Flüchtig las er die Jahreszahl 1902. Es gab ferner gemalte Selbstportraits sowie Darstellungen von männlichen und weiblichen Aktmodellen und ein Gemälde von Fortunys Frau Henriette, daneben Skelette von Gazellen-, Widder- und Stierschädeln, die Büste eines Afrikaners, Totenmasken, Gipsabdrücke von Händen, eine riesige Muschel und ein lose hingeworfenes Stück Stoff mit üppigen Ornamenten. Fortuny hatte versucht, schien es Aldrian, die fließende Zeit selbst einzufangen und Goldkörner aus ihrem Flussbett zu sieben. Es ging ihm nicht darum, seine Gegenwart zu erfassen und zur Schau zu stellen, sondern er wollte einen Nukleus der Schönheit aus ihr herausdestillieren und für immer sichtbar machen. Aldrian blieb vor einer Vitrine stehen, in der eine dunkelgrüne Dalmatik aus Samt und Seide ausgestellt war, und vertiefte sich in ihr goldfarbenes Muster, das aus einem Krug, einem Kreis und Phantasiepflanzen bestand. Von weiter weg gesehen hatte die Dalmatik etwas Prunkvoll-Königliches, aus der Nähe etwas von der Zauberkunst Merlins. Er studierte die Ornamente und Stoffe wie lebendes histologisches Gewebe. Ein Kleid aus Samt und Seide wies ein Schuppenmuster auf, als sei es von einem großen Fisch abgezogen worden, jedoch auf der Seite, die im Dunklen lag, erinnerte es ihn eher an die Darstellung eines Friedhofs mit oben abgerundeten Grabsteinen. Ein anderer Stoff war auf den ersten Blick mit Fußabdrücken eines unbekannten Wesens bedeckt – Doppelkreise in denen einfarbige Blütenblätter und lange Pflanzenstängel mit Knospen zu sehen waren. Samt und Seide ließen in einer weiteren Vitrine violette Phantasieblumen erblühen oder scheinbar in Blutstropfen verborgene Gebilde von botanischer Zartheit sichtbar werden. Schlangen mit Köpfen aus Mohnknospen lagen auf hellbrauner Erde. Es hatte für ihn den Anschein, als sei es Fortuny gelungen, durch einen winzigen Spalt ins Paradies zu schauen und Atome und Moleküle der Schöpfung festzuhalten. Fortuny hatte seine Visionen auf Stoffen verarbeitet, die er mit Hilfe von Druckmaschinen auf der Insel La Giudecca herstellen ließ. Als Nächstes erblickte Aldrian ein großes, dunkelbraunes Ornament, das bis ins kleinste Detail mathematisch berechnet war und ihn aufs neue staunen ließ. Es befand sich auf einem goldenen Hintergrund, der selbst schon mit blassen Pflanzenmustern geschmückt war. Für Aldrian war es gleichsam ein orakelhaftes Zeichen, das alle Buchstaben der Welt enthielt und das auch die Sprache der Pflanzen und Vögel, der Fische und Insekten, der Hunde, Katzen, Frösche und Nashörner umfasste. In den weiteren sibyllinischen und symmetrischen Gebilden, die Aldrian wie Märchen der Geometrie erschienen, erkannte er auf dunkelgrünen, dunkelroten, dunkelblauen, dunkelbraunen Stoffen Weintrauben, Ananasfrüchte, fröhliche Hunde, Wellen, Blumen wie schwarze Kleckse, symmetrische Dornensträucher, Vasen oder Vögel mit langen Zungen, die aus ihren Schnäbeln hingen. Er sah auch von Fortuny entworfene farbige Kissen auf einem Sofa, weiße griechische Skulpturen und Torsi von Jünglingen. In einer anderen Vitrine war Fortunys Fotoausrüstung, ein Holzkasten mit Linse, ausgestellt. Ohne dass Aldrian es bemerkt hatte, war der Aufseher an ihn herangetreten und hatte ihn freundlich gefragt, ob er auch den gesperrten zweiten Stock sehen wolle. Der Mann hatte eine Halbglatze, einen Bart und ein künstliches Gebiss, stellte Aldrian fest. Erfreut zog er seine Gummistiefel aus, ließ sie zusammen mit der Maske in der Plastiktasche neben dem Schreibtisch des Aufsehers stehen und folgte ihm die Treppe hinauf.
Später erinnerte er sich nur an einzelne Details des Künstlerateliers: das kleine Waschbecken mit dem Messinghahn und darüber wie ein üppiger, bunter Blumenstrauß die Pinselspuren von Farbproben, die Fortuny an diesem Teil der Wand hinterlassen hatte. Der Aufseher ging ihm weiterhin voraus, öffnete eine Tür, machte Licht und zeigte ihm die Bibliothek, einen dunkelrot gestrichenen Raum mit Bücherregalen, auf denen wieder weiße Büsten in griechischem Stil standen, die Wand darüber zierte eine mit Symbolen bemalte Bordüre. Neben dem großen Schreibtisch war eine Druckerpresse mit einem sternförmigen Hebelrad abgestellt. Zwischen den Büchern sah er gerahmte Tafeln in arabischer Kalligraphie, aber der Aufseher wusste ebenfalls nicht, was sie bedeuteten. Der Boden war – wie im ersten Stock – aus Stein, Folianten lagen auf dem Tisch: ein alter anatomischer Atlas, ein dickes Fotoalbum und der Grundriss eines Theaters oder eines Opernhauses der Zukunft, wie er las. Auch eine Fotokamera aus hellbraunem Holz mit einem durch Messingblech geschützten Vorderteil bemerkte er und in den Fächern der Regale zwischen den arabischen Schrifttafeln und den Büchern einen Steckkasten mit hundert kleinen Drillbohrern. Daneben anderes Werkzeug, Dosen, Glasbehälter mit Farbpulver, Eprouvetten, Pipetten, Kistchen angefüllt mit kleinen Puppenteilen und einem gelben zusammenklappbaren Meterband. Durch die hohen, mit Butzenscheiben verglasten Fenster fiel graues Tageslicht. Der Aufseher öffnete im Bücherregal hinter Fortunys Schreibtisch eine kleine, unsichtbare Tür zu einem schmalen Vorzimmer mit Holztreppen, die auf das Dach führten. Dort fand Aldrian ein weiteres chaotisches Sammelsurium aus verschiedensten Gegenständen – drei Spazierstöcke, verkorkte, dunkelgrüne Flaschen, in Papier eingewickelte Objekte, Bürsten, Pinsel, Dosen und Kistchen, Medizinfläschchen mit Chemikalien und Farben, Schubladen mit gebrauchten und neuen Buntstiften, alte Glasvasen, weiße Glühbirnen, zugeschnittene flache Brettchen. Er begriff, dass er das verborgene Zentrum von Mariano Fortunys Welt vor sich hatte.