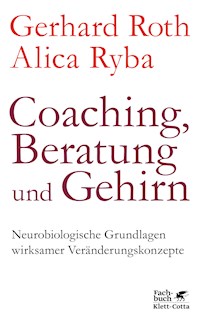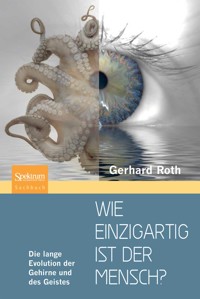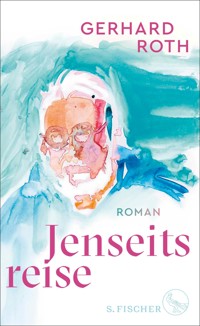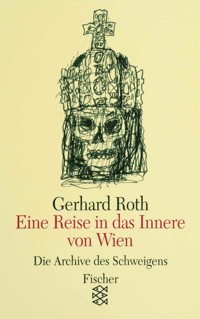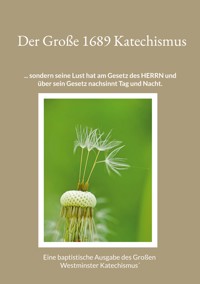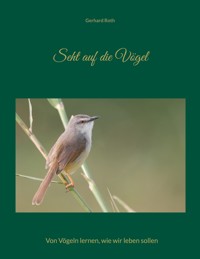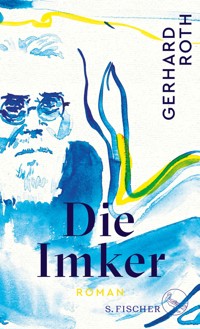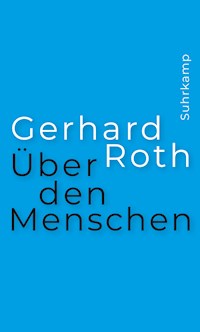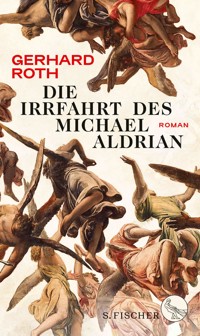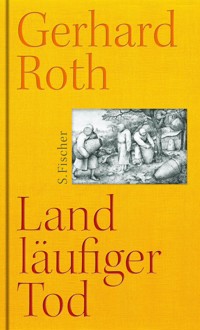19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Die Kunsthistorikerin Lilli Kuck reist nach Venedig, nachdem ihr Mann Klemens dort unter ungeklärten Umständen ums Leben gekommen ist. Jetzt, nach seinem Tod, hat sie plötzlich das Gefühl, nicht mehr zu wissen, wer Klemens – ein berühmter Comiczeichner – wirklich gewesen ist. In Venedig folgt Lilli den Wegen ihres Mannes. Welche Orte hatte er aufgesucht und wo gewohnt? Hatte er eine Geliebte? War er auf der Suche nach seinem Vater gewesen? Lilli lässt sich treiben, folgt Zufällen und ihrer Intuition, sucht nach Zugängen zu einer anderen Wahrnehmung und »zweiten Wirklichkeit«, in der sich ihr die Geheimnisse enthüllen könnten. Als sie den Mord an einem Polizisten beobachtet, gerät sie selbst in Gefahr, setzt ihre Erkundungen aber unbeirrt fort. In einer märchenhaften Welt der Schönheit und des Todes wird der Abschied von der Stadt zum Neubeginn. »Es gibt keinen böseren Engel als die Liebe« ist nach »Die Irrfahrt des Michael Aldrian« und »Die Hölle ist leer – die Teufel sind alle hier« Gerhard Roths dritter Roman über Venedig – eine Stadt, die Roth seit Jahrzehnten durchforscht. »Venedig ist eine steinerne Bibliothek, in der nachzulesen ist, wozu der Mensch fähig ist.« Gerhard Roth
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 268
Ähnliche
Gerhard Roth
Es gibt keinen böseren Engel als die Liebe
Roman
Roman
FISCHER E-Books
Inhalt
Für Senta
Es gibt keine Antwort. Es
Wird keine Antwort geben. Es
Hat nie eine Antwort gegeben.
Das ist die Antwort.
GERTRUDE STEIN, Brewsie und Willie
1Das Begräbnis von Klemens Kuck und Lillis Flucht vor der Wirklichkeit
»Das Erste, was ich über meinen Vater erfahren habe, war der Umstand, dass ihm der Papst die Füße gewaschen hat«, las Lilli. Sie schaffte es nicht mehr, die in Spiegelschrift verfassten Kindheitserinnerungen ihres Mannes weiter zu lesen, denn die Augen waren ihr zugefallen.
Seit dem Tod von Klemens hatte Lilli Beruhigungs- und Schlafmittel genommen, um ihre Angst, den Schmerz, die Trauer und die Gewissheit, ihn nie mehr wiederzusehen, ertragen zu können. Klemens war in Venedig über eine Brückentreppe gestürzt und nach Wien überführt worden, wo er zwei Wochen später auf der Intensivstation starb, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben. Alles an seinem Tod war rätselhaft gewesen. Er war, obwohl er schon die vierte Woche in der italienischen Stadt verbracht hatte, in keinem Hotel und keiner Pension gemeldet gewesen, woraus die Polizei schloss, dass er privat abgestiegen sein musste. Das war seltsam. Denn jeden Tag hatte er sich telefonisch bei ihr gemeldet und behauptet, er wohne im Hotel Diana in der Nähe des Markusplatzes. Natürlich befürchtete sie jetzt, dass er sie betrogen haben könnte, aber darauf gab es keine Hinweise.
Am Morgen des Begräbnistages erwachte sie mit dem Wunsch, selbst nach Venedig zu fahren. Kurz danach wurde ihr ein Kuvert mit Klemens’ schwarzem Notizbuch und den Aufzeichnungen zugestellt, die er in Venedig gemacht hatte – von einem gewissen Guido Alberti, allerdings ohne Angabe der Absenderadresse. Sie packte einen Koffer, teilte ihrem Vorgesetzten im Kunsthistorischen Museum mit, dass sie sich drei Wochen Urlaub nehme, kleidete sich schwarz und fuhr mit ihrem drei Jahre alten Volvo zum Zentralfriedhof, wo Klemens in einem Ehrengrab der Stadt Wien beigesetzt wurde. Zum gemeinsamen Totenmahl nach der Verabschiedung erschien sie – einer spontanen Eingebung folgend – nicht mehr, sondern ließ sich von ihrer Schwester entschuldigen. Die Feierlichkeiten waren nur schwer für sie zu ertragen.
Klemens war ein Comiczeichner und -texter gewesen, der in seinen letzten Lebensjahren Aufsehen erregt hatte. Daher hatten sich andere Künstler, Journalisten, das Fernsehen, Mitarbeiter aus dem Kunsthistorischen Museum sowie zahlreiche Jugendliche und Neugierige eingefunden und außerdem – seinem immer wieder geäußerten Wunsch entsprechend – fünf Musiker der Staatsoper, die den zweiten Satz des Schubert-Quintetts spielten, bevor der Sarg im Grab verschwand.
Nachdem Lilli hinter dem Lenkrad Platz genommen hatte, öffnete sie eines der beiden Hefte mit Kindheitserinnerungen und Zeichnungen von Klemens, die sie am Morgen auf den Nebensitz gelegt hatte, und nahm den Zettel heraus, auf dem er notiert hatte: »Meine Mutter, Maria Pichlmayer, Hallstatt Landungsplatz, Gasthaus ›Zu den Eisheiligen‹« und darunter eine Mailadresse und die Telefonnummer.
Sie fuhr zuerst in Richtung Oberösterreich und Salzburg und hielt dann an einem Parkplatz, um zu telefonieren.
In ihrem Kopf herrschte ein Durcheinander von Bildern, die sich mit den Eindrücken der vorbeiziehenden Landschaft und dem Straßenbelag verbanden: der weiße Sarg, Blumenkränze, bekannte und unbekannte Gesichter, die Musiker, die mit ernster Miene gespielt, und die Redner, die keine Ahnung gehabt hatten, wer Klemens wirklich gewesen war. Nicht einmal sie selbst wusste es. Wenn sie an ihn dachte, fielen ihr die Szenen ein, in denen ihn Dinge, die er gerade wahrgenommen hatte, inspirierten. Unzählige Notizbücher hatte er mit Skizzen vollgekritzelt: angefangen bei den Mustern auf den Flügeln eines Schmetterlings oder orientalischen Teppichen, Bildern in Museen oder Kinderzeichnungen bis hin zu Wolken- und Blattformen, Schneeflocken und sogar Abfall – einer seiner Vorlieben. Er hielt alles sehr rasch und präzise fest – Gesichter von Menschen erfasste er so schnell wie das Aussehen von Tieren. Er zeichnete in Eisenbahnen, Caféhäusern und Hotelzimmern, sogar auf der Straße, in Kirchen oder Parkanlagen. Schönheit erkannte er ebenso wie Lächerlichkeit, Tragödien wie Komödien.
Nachdem sie die Nummer von Klemens’ Zettel gewählt hatte, meldete sich eine Frauenstimme und bestätigte, Frau Pichlmayer sei hier. Lilli beendete kommentarlos das Gespräch und fuhr weiter.
Die Autobahn kam ihr jetzt vor wie ein Film, der vor ihr abgespielt wurde, und ihre Erinnerungen waren darauf in doppelter Belichtung überblendet. Später sah sie die Fahrbahn nur noch fragmentarisch.
Sie stellte den Volvo auf einem Parkplatz über Hallstatt ab und blieb noch kurz im Wagen sitzen. Ihr Mann hatte nie erwähnt, dass seine Mutter, die ihn unmittelbar nach der Geburt zur Adoption freigegeben hatte, dort lebte. Wie und wann er zu ihrer Anschrift gekommen war, hatte er Lilli ebenfalls verschwiegen.
Sie atmete mehrmals tief aus und ein, bis sich das Bild seines Gesichts in ihrem Kopf auflöste. Der Blick auf den Hallstätter See und die alten Häuser waren für sie wie Fenster in die Vergangenheit.
Das Gasthaus »Zu den Eisheiligen« lag direkt am See, dessen Oberfläche sich in einem leichten Wind kräuselte. Der Mühlenteich in der Nähe der Alster in Hamburg kam ihr in den Sinn und die hellen Sommertage, die sie dort als Kind und Jugendliche rollschuhfahrend verbracht hatte.
Im luxuriösen Gasthaus fragte sie einen Kellner nach Frau Pichlmayer. Das Lokal war ländlich und teuer möbliert, aber da es noch früher Abend war, fand sie rasch einen Platz an einem Fenstertisch mit Blick auf die Segelboote und das Passagierschiff im farbenspiegelnden Gewässer. Überhaupt war in Hallstatt alles malerisch. Der Gletschersee sah zwischen den hohen Bergen wie ein Fjord aus, und obwohl er friedlich schien, wusste sie, dass Stürme auf ihm Wellen erzeugen konnten, die Segelboote zum Kentern brachten. Er war, wie sie nachgelesen hatte, mehr als 125 Meter tief, und manche Ertrunkene konnten nie geborgen werden. Sofort waren ihre Gedanken wieder beim Begräbnis ihres Mannes. Das Schubert-Quintett hatte sie ergriffen, als ob jemand zu ihr gesprochen hätte, der alles Leid der Welt kannte.
In diesem Augenblick erschien eine ältere, reich beschmückte Dame an ihrem Tisch, die einen weißen Kittel trug. Lilli war überzeugt, dass es die Gesuchte war, sie stand auf, stellte sich vor und informierte sie, dass ihr Sohn am Vormittag in Wien begraben worden sei.
»Klemens?«, fragte die Dame. Sie machte kehrt und ging ihr fluchtartig voraus in den Gastgarten, wo sie sich an dem vom Eingangstor entferntesten Ecktisch niederließ.
Dort blickte sie auf die Tischplatte.
»Mein Mann weiß nichts von Klemens«, sagte sie zur Tischplatte. Dann hob sie den Kopf und blickte ihr misstrauisch und mit wässrigen Augen ins Gesicht.
»Was wollen Sie von mir?«, fragte sie.
»Wer ist sein Vater?«, antwortete Lilli ernst.
»Klemens hat mir dieselbe Frage gestellt …«
»Davon weiß ich nichts.«
»Er war vor mehr als einem Monat hier, und ich habe ihm den Namen genannt.« Sie räusperte sich und fügte hinzu: »Er heißt Galli und ist Polizist, ich glaube Kommissar in Venedig.«
»Haben Sie seine Adresse?«, fragte Lilli weiter.
»Er hat behauptet, dass er aus Padua stamme. Später hat sich herausgestellt, dass er in Venedig lebt.«
»Sagen Sie mir bitte seinen Vornamen?«
»Francesco … Ich will nichts mehr mit ihm zu tun haben.« Sie blickte zur Seite. »Was ist mit Klemens geschehen?«, fragte sie nach einer kurzen Pause.
Lilli erzählte ihr von dem Unglücksfall und stellte fest, dass Klemens’ Mutter über ihren Sohn kaum Bescheid wusste. Eine Zeitung lese sie nur hin und wieder, behauptete sie, und auch die Nachrichten im Fernsehen interessierten sie nicht.
Lilli hörte jetzt Schritte auf dem Kies, und als sie aufblickte, flüsterte Frau Pichlmayer erschrocken: »Mein Mann!«
Er stand im nächsten Augenblick schon vor ihnen und schnaubte verärgert: »Da bist du!«
Als Lilli ihn erblickte, musste sie sofort an eine runde, weiße Küchenuhr denken. Er hatte ein aufgeschwemmtes Gesicht, einen Glatzkopf und einen Bauch, den eine Schürze zierte, und auf dem Kopf eine weiße Mütze. Es konnte sich auch um eine lebende Taschenuhr handeln mit einem Aufziehrad am Kopf, phantasierte Lilli weiter. Sein Gesicht zuckte, als wollte es verraten, dass er die Welt hasste.
»Die Dame bespricht eine Hochzeit mit mir.«
»Wann soll das sein?«, fragte er misstrauisch.
»Im September.«
»Im September sind wir ausgelastet«, antwortete die große Taschenuhr missmutig, klappte den Deckel zu und eilte unzufrieden davon, drehte sich aber einmal um und stieß »Das musst du eigentlich wissen!« hervor.
Frau Pichlmayer schwieg, bis er verschwunden war. Inzwischen hatte das Wort »Hochzeit« Lilli auf Umwegen wieder an das Begräbnis von Klemens erinnert. Sie stand wie selbstverständlich auf und ging, ohne sich umzudrehen, zum Auto zurück. Die ganze Zeit über dachte sie an Flucht, es fiel ihr aber kein Ort ein, an den sie sich wünschte. Automatisch setzte sie sich in ihren Wagen und fuhr in Richtung Italien los, ohne zu wissen, ob sie wirklich dorthin wollte. Nach Wien zurück jedenfalls nicht und auch nicht nach Hamburg, wo sie ihre Kindheit und Jugend verbracht hatte. Dann fiel ihr ein, dass Klemens manchmal gesagt hatte: »Wenn man nicht weiß, wohin man will, kommt man am weitesten.« »Der Satz stammt von William Shakespeare«, hatte er hinzugefügt …
2Venedig
Unterwegs übernachtete sie schon in Italien. Es interessierte sie nicht, wo sie sich befand, sie folgte nur ihrem inneren Navigator. Klemens war, wenn sie mit dem Auto unterwegs waren, oft neben ihr eingeschlafen und erst am Ziel wieder aufgewacht … Ihr fiel ein, dass er jetzt unter der Erde lag, und sie lenkte sich mit der Landschaft, durch die sie fuhr, ab. Die Sonne schien, Holundersträucher und Akazienbüsche blühten, grüne Alleen säumten die Landstraße, und kristallblitzende Flüsse erweckten in ihr den Eindruck, dass alles nur für sie allein geschaffen sei. Doch fühlte sie sich einsam wie noch nie in ihrem Leben. Plötzlich überkam sie ein lähmendes Gefühl, wie unerwarteter dichter Nebel.
Jedes Mal, wenn sie gemeinsam eine Reise nach Venedig unternommen hatten, waren sie zuerst durch Jesolo gefahren: an den kleinen Pensionen vorbei, an der gewaltigen Wasserrutsche, den Bächen und den Vorgärten, bis sie Punta Sabbioni erreichten und auf einem der bewachten Parkplätze hinter den Villen ihren Wagen abgestellt hatten. Dort bezahlte sie jetzt wieder den Geldbetrag für die Gesamtdauer ihres geplanten Aufenthaltes.
Während sie auf das Passagierschiff wartete, das sie von Punta Sabbioni zum Markusplatz bringen würde, rief sie kurz ihre Familienmitglieder und engsten Freunde an und gab vor, in Padua zu sein, um die Scrovegni-Kapelle mit den Fresken von Giotto anzusehen. Dass sie log, fand sie gut. Bei jedem ihrer Telefonate verwendete sie die gleiche Lüge, und jedes Mal war sie bei dem Gedanken unterzutauchen erleichtert. Als Letztes fügte sie stets hinzu, dass sie sich melden würde, sonst aber ihr Telefon ausgeschaltet sei.
Endlich legte das Schiff, das von Burano kam, an, und sie schleppte ihren Koffer an Bord. Dabei fielen ihr Dinge, die sie zu Hause vergessen hatte, ein, aber es machte ihr nichts aus. Seit Klemens’ Tod fühlte sie sich schrecklich allein, aber sie sagte sich, dass es allen anderen Menschen genauso ging. Die meisten Passagiere, die an Bord waren, hatten vermutlich schon erfahren, wie hässlich Trauer und Schmerz waren. Als sie sich vornahm, die beiden Hefte über Klemens’ Kindheit zu lesen, erinnerte sie sich wieder, dass er alle seine Bücher und Aufzeichnungen in Spiegelschrift verfasst hatte und wie mühsam das Entziffern sein würde. Klemens hatte seine Arbeit gerne mit einem Geheimnis umgeben. Er sperrte die Manuskripte, bis sie fertig waren, in seinen Safe und band sie in Zeitungsseiten ein, die das Etikett trugen »Nicht lesen!« – Obwohl sie neugierig gewesen war, hatte sie sich immer daran gehalten. Sobald er ein Comicbuch abgeschlossen hatte, durfte sie die Manuskriptseiten und die Bilder als Erste in Augenschein nehmen. Manchmal erschrak sie beim Lesen darüber, was in seinem Kopf vor sich ging.
Als sie durch das Fenster schaute, entdeckte sie Paddelboote in der Ferne. Wenn die Sportler die Paddel schwenkten, reflektierten die Ruderblätter in der Sonne das Licht, so dass sie ein fortlaufendes Blinken wie von riesigen Leuchtkäfern wahrnahm, obwohl es taghell war. Der Dampfer, auf dem sie sich befand, hatte beim Ablegen in Punta Sabbioni heftig schwarzen Rauch ausgestoßen. Er war in Fetzen über das Schiffsdach gezogen. Sachlich stellte sie fest, dass auch sie sich gerade auflöste und allmählich verschwinden würde. Das war ihr ein eigenartiger Trost, und sie verband ihn mit dem spontanen Wunsch, nie mehr nach Hause zurückzukehren. In ihrem Zustand ertrug sie vor allem das Vertraute nicht – nur das Fremde schien ihrer Befindlichkeit angemessen. Man hatte ihr gesagt, sie sei eine starke Frau, aber es war schwer genug, ein Mensch und verletzlich zu sein. Gleichzeitig bemerkte sie, dass sie den letzten Gedanken unabsichtlich, wenn auch leise ausgesprochen hatte, sie blickte sich um, ob es jemand bemerkt hatte, doch alle schienen in ihre eigene Welt versunken.
Reste weißer Papiertaschentücher, bemerkte sie, lagen im Passagierraum vor einer Sitzbank, zwei leere Getränkeflaschen aus durchsichtigem Kunststoff rollten mit der Bewegung des Dampfers über den Fußboden. Sie wandte sich ab und musterte die Fahrgäste: Ältere Frauen mit vollen Einkaufstaschen starrten vor sich hin, und neugierige Touristen strengten sich an, beim Fensterschauen nichts zu versäumen, oder sie studierten eine Beschreibung in einem Reiseführer.
Der Dampfer hielt an der Station Santa Maria Elisabetta am Lido. Passagiere stiegen aus, andere gingen an Bord, sie kannte all das schon, doch es schien für sie – warum wusste sie nicht – plötzlich neu zu sein. Gleich darauf erinnerte es sie wieder an ein Gefühl in der Kindheit, wenn sie von der Schule mit der U-Bahn nach Hause gefahren war.
San Zaccaria war die Endstation des Dampfers, der daraufhin wieder nach Punta Sabbioni zurückfuhr. Sie hatte sich nicht einmal erkundigt, ob im Hotel Pandora hinter dem Markusplatz ein Zimmer für sie frei war, aber sie vertraute darauf, dass der Portier sie wiedererkannte, da sie mit Klemens dort mehrfach übernachtet hatte.
Vor San Zaccaria warteten so viele Boote und Vaporetti, dass der Dampfer bereits am Anfang der Riva degli Schiavoni angelegt hatte, weshalb Lilli ihren Koffer über die vier oder fünf Steinbrücken hinaufziehen und wieder hinunterschieben musste. Der Weg erschien ihr endlos lang, und sie war den Tränen nahe. Eine Spur auf den Brücken war mit Brettern für Invaliden, Kinderwagen und Rollkoffer ausgelegt. Trotzdem fühlte sie sich erschöpft.
Endlich nahm sie im Arkadengang des Dogenpalasts auf einer Steinbank Platz. Neben ihr saß ein schwitzender Mann, der die Augen geschlossen hatte, als ob er schliefe. Sie musterte ihn nur mit einem flüchtigen Blick und starrte auf den Markusplatz: Jedes Mal, wenn sie ihn auf einer Reise mit Klemens besucht hatte, war es für sie ein Erlebnis gewesen. Diesmal jedoch war es nur ein gewohnter Anblick, so als würde sie das Areal täglich betreten. Ein Stück weiter erstreckte sich der Markusdom. Der Großteil der Touristen betrachtete ihn als Museum. Doch Klemens war, fiel ihr ein, bei jedem Besuch die steile Treppe in das obere Stockwerk hinaufgeeilt, hatte sich auf einer Bank vor der Brüstung niedergelassen und in die goldenen Mosaikgewölbe mit den heiligen Gestalten gestarrt. Ganz nahe, auf der linken Seite, war die Hölle abgebildet, und Klemens hatte die Darstellung wieder und wieder angeschaut und jedes Mal aufs Neue fotografiert. Auch die Gewölbe hatte er aufgenommen – vor allem das Schöpfungsmosaik in der Basilika – und die Ornamente des alten Fußbodens.
Sie stand auf, nahm den Koffer und zog ihn weiter hinter sich her. Es war so warm, dass sie schwitzte.
Vielleicht war es besser, nicht im Hotel Pandora, sondern im gegenüberliegenden Hotel Diana abzusteigen, überlegte sie, während sie in die Gasse einbog, in der sich beide Hotels befanden. Die Glastür des Hotels Diana, in dem Klemens bei seiner letzten Reise angeblich gewohnt hatte, war jedoch, wie immer am Nachmittag, versperrt … Es gab einen wechselnden Code, den man als Gast eingeben musste, oder man versuchte über das Hotel Pandora, das demselben Unternehmen gehörte, Zutritt zu erlangen.
Vor der Rezeption stauten sich gerade Touristen mit Gepäck, daher wich sie in das angrenzende, beengte Foyer aus. Erschöpft fiel sie in einen mit Rosenmuster bezogenen Fauteuil, wo sie so lange wartete, bis alle Hotelgäste abgefertigt waren.
Man fand für sie schließlich nur noch ein freies Zimmer im Hotel Diana. Ein großer Afro-Europäer in brauner Uniform mit goldenen Schärpen und Knöpfen folgte ihr im Laufschritt über die schmale Gasse und brachte ihr den Koffer, den sie im Hotel Pandora stehen gelassen hatte, nach. Er erklärte ihr lachend, dass die Glastür am Eingang des Hotels mit der Codenummer 113E geöffnet werden konnte. Dann betraten sie das menschenleere Gebäude und fuhren mit dem Lift ein Stockwerk hinauf, ohne einen Menschen zu sehen. Im Hotelzimmer erschrak sie. Als Erstes registrierte sie nämlich, dass der Lärm der von Touristen überschwemmten darunterliegenden Gasse deutlich zu hören war. Sie hob den Kopf und erblickte die nahe Außenwand des gegenüberliegenden Hauses, dessen Fensterläden geschlossen waren. Auch ihr Zimmer war auffallend eng, aber an die vier Meter hoch, und eine der Wände war mit einem etwa drei Meter hohen dunkelbraunen Schrankungetüm verstellt. Sofort dachte sie an einen Sarg … Als sie die Schiebetür öffnen wollte, klemmte sie. Der große, englisch sprechende Afro-Europäer hatte Lillis Koffer inzwischen neben dem Doppelbett, das ein roter Überwurf mit goldenem Karomuster zierte, abgestellt. Dann steckte er eine Kunststoffkarte in einen dafür vorgesehenen Schlitz, worauf sich die Lampen einschalteten. Als Lilli ihm ein Trinkgeld geben wollte, schlug er es zu ihrer Überraschung aus.
Sie legte sich auf das Bett und schloss die Augen.
Erst nach einer halben Stunde erwachte sie wieder, weil es an der Tür klopfte. Sie wollte aber mit keinem Menschen sprechen. Zweimal wurde noch angeklopft, doch blieb sie weiter bewegungslos liegen und starrte zur Decke. Als es wieder still war, stand sie auf, um ihre Kleider in den Schrank zu räumen. Dabei stolperte sie beinahe über einen Koffer. Erst jetzt sah sie, dass es nicht ihr eigener war. Sie öffnete das fremde Gepäckstück, um einen Hinweis auf den Besitzer zu finden, und entdeckte Zauberartikel, darunter einen Totenkopf, Spielkarten, einen Klappzylinder und Schals aus Seide. Sie warf den Kofferdeckel zu und versuchte dann irgendjemanden aus dem Hotel telefonisch zu erreichen. Es hob jedoch niemand ab. Nochmals öffnete sie den Koffer und stieß zu ihrer Verwunderung auf ein künstliches Gebiss, Schachteln mit Beruhigungs-, Schmerz- und Schlaftabletten, eine Pistole, von der sie annahm, dass sie nur für Schreckschüsse gedacht war, Asthmaspray und Fotografien. Ihr kam es vor, dass sie den Mann auf den Bildern kannte. Er hatte wohl wie sie selbst damals mit seiner Frau in der Wohnanlage Am Heumarkt in Wien gewohnt, bevor er aus ihrem Blickfeld verschwunden war, erinnerte sie sich. Dann erst fiel ihr ein, dass er Souffleur an der Wiener Staatsoper gewesen war.
»Verschwunden!«, sie seufzte bei diesem Wort, denn sie empfand ein immer stärkeres Bedürfnis, zu verschwinden oder zumindest unsichtbar zu sein. Vielleicht war im Koffer ein Hinweis zu finden? Mehrere Fotografien zeigten den Mann, der Aldrian hieß, wie sie jetzt wusste, mit einer gut aussehenden Frau – nicht der, die sie von früher kannte, vermutlich seiner Geliebten oder neuen Gattin. Dann entdeckte sie Fotografien, die Plakate zeigten. Darauf stand zu lesen: IL GRANDE MAESTRO SUGGERITORE, was, wie sie wusste, »Der große Souffleur« hieß. Offenbar trat er inzwischen als Zauberkünstler auf. Sie fand in einer Pappschachtel eine Hasen-, eine Hunde- und eine Vogelmaske, und als wäre sie betrunken, setzte sie sich eine nach der anderen auf und betrachtete sich im Spiegel des winzigen Badezimmers. Sie war zu einem Hasen, einem Hündchen und einem Vogel geworden und konnte zum ersten Mal wieder lächeln. Außerdem befand sich im Koffer ein blaues, mit Sternen übersätes Theaterkostüm … Warum sie es tat, wusste sie später nicht mehr, aber sie schlüpfte hinein. Es war viel zu groß und schlotterte an ihr – wodurch sie sich erst recht wie ein Kind fühlte. Sie musste das Vergangene hinter sich lassen, sagte sie sich, und der Gedanke tröstete sie auf seltsame Weise.
Die Schreckschusspistole war schwer. Möglicherweise war es doch eine echte Schusswaffe – auch eine Schachtel mit Patronen fand sie. Sie entnahm dem Koffer schließlich die Schlaf- und Schmerztabletten und versorgte sich für eine Woche. Dabei hatte sie nicht das Gefühl, etwas Unrechtes zu tun und schon gar nicht etwas so Konkretes wie »stehlen«. Von der Zimmerdecke hing ein Glasluster – ein Polyp mit acht Tentakeln, dachte sie, der in der Tiefsee leuchtet, oder eine elektrische Blumenvase, aus der große strahlende Blüten hingen … Jetzt fielen ihr auch die gläsernen, blattförmigen Wandlampen neben dem Bett auf, über denen ein goldgerahmtes Blumenbild mit rosa und weißen Rosen hing. Sie versuchte wieder, den Portier oder den Hausburschen zu erreichen, doch niemand hob ab. Daher schlüpfte sie in ihre Schuhe und verlangte an der Rezeption des gegenüberliegenden Hotels Pandora ein anderes Zimmer. Als Antwort bekam sie eine Vertröstung auf »domani«. Domani, morgen, war ein Wort, das sie seit ihrer Kindheit kannte, ihr Vater hatte immer behauptet, dass es der ewige Kalender der Italiener sei.
In ihrem Zimmer packte sie den eigenen Koffer aus, duschte, schluckte eine Beruhigungs- und eine Schmerztablette und schlief bald darauf ein.
3Ein Mosaiksteinchen im Markusdom
Als sie die Augen aufschlug, stellte sie fest, dass sie keine Kopfschmerzen mehr hatte, was sie verwunderte. Der fremde Koffer lag noch immer geöffnet vor ihr auf dem Boden. Sie staunte über den Zufall, der ihn ausgerechnet zu ihr gebracht hatte. Wenn er überhaupt eine Bedeutung hatte, dann welche?
Da sie ihr iPad mitgenommen hatte, verband sie es mit dem WLAN, tippte Codes ein, bis alles funktionierte, und wandte sich noch einmal dem fremden Koffer zu. Auch eine Partitur fand sich unter den verstreuten Dingen, es handelte sich um die »Diebische Elster« von Rossini. Das war ein weiterer Hinweis, dass der Koffer dem früheren Souffleur Aldrian gehören musste. Sie ging zuerst in das Badezimmer und danach in den Frühstücksraum, der durch eine Zwischenwand aus Holz vom Foyer getrennt war.
Nachdem sie kleines weißes Gebäck und ein weiches Ei, Butter, Marmelade und Streichkäse zu sich genommen hatte, während sie an Klemens hatte denken müssen, suchte sie den Portier auf, der sie nach kurzem Zögern erkannte. Er fragte sie, ob er ihr helfen könne. Automatisch verlangte Lilli ein anderes Zimmer, sie halte es in dem engen Raum nicht aus. Der Portier beeilte sich, im Computer nachzusehen, und erklärte ihr, dass es im Augenblick nur ein freies im zweiten Stock gebe, in dem die Geräusche von der Gasse weniger laut zu vernehmen seien, oder – ab morgen, »domani« – das Zimmer, das sie und ihr Mann schon früher mehrmals gebucht hatten, mit Fenstern zum Hof hinaus. Sie entschied sich, bis zum nächsten Tag zu warten, und brachte die Rede auf den Koffer, der ihr irrtümlich zugestellt worden war. Er werde sich augenblicklich darum kümmern, versprach der Portier, und Lilli begab sich mit dem Lift zurück in das verhasste »Sargzimmer«, wie sie es von Anfang an genannt hatte. Dort holte sie aus ihrer Tasche das schwarze Notizbuch, das ihr ein Guido Alberti ohne Absenderadresse geschickt und in das Klemens in Spiegelschrift Aufzeichnungen und Skizzen über seinen letzten Aufenthalt in Venedig gemacht hatte. Sie stopfte es aber wieder zurück in die Tasche und beschloss, es im Caffè Florian zu lesen. Jedenfalls erhoffte sie sich davon einen Hinweis auf die rätselhaften Geschehnisse, die zu seinem Tod geführt hatten, und außerdem empfand sie den Wunsch, ihm nahe zu sein.
Sie musste nur die schmale Gasse hinuntergehen, zweimal um die Ecke biegen und befand sich schon auf dem Markusplatz, der jetzt von Hochwasser überschwemmt war und dessen Gebäude sich an der Wasseroberfläche spiegelten. Touristen standen am Rand und fotografierten die lachenden Menschen, die sich ihrer Schuhe entledigt und die Jeans aufgekrempelt hatten.
Lilli zog, einer spontanen Eingebung folgend, ihre Sandalen aus und stieg in das kalte Wasser, ohne sich etwas anmerken zu lassen. Klemens hätte sie sicherlich dazu angeregt, dachte sie. »Und jetzt?«, fragte sie ihn stumm, »Was soll ich jetzt machen?« Er schwieg.
Sie ließ sich einfach – die Sandalen in der Hand – bis zum Eingang des Markusdoms treiben, wo sie zusah, wie Arbeiter in orangefarbenen Overalls das Wasser aus dem Dom fegten. »Keinen Menschen fragen!«, hörte sie Klemens in ihrem Kopf, womit er sein oft dreistes Vorgehen begründete, wenn Hindernisse überwunden werden mussten. Sie hörte zwei Arbeiter rufen und sah sie gestikulieren, aber sie eilte, ohne darauf zu achten, die steile Treppe hinter dem Eingang hinauf, noch immer die Sandalen in der Hand. Das Wasser bedeckte die Ornamente des Steinbodens wie eine riesige Lupe, und Lilli stellte sich vor, dass die Männer flüssig gewordene Ornamente aus dem Dom kehrten. Lichtflecken huschten blitzartig über die goldenen Mosaikwände und verliefen sich im Nichts. Sie gelangte zur Galerie im oberen Stockwerk, von der aus sie abermals auf die goldenen Mosaikkuppeln und -wände blickte. Dabei streifte sie sich wieder die Sandalen über.
Die ganze Pracht spiegelte sich, von oben betrachtet, auf dem Wasser, und es war Lilli, als wäre sie in ein Paralleluniversum gelangt. Klemens hatte besonders die Schöpfungskuppel – die Genesiskuppel – über der Vorhalle mit ihren Bildern bewundert. Im ersten Erzählkreis, wusste Lilli, schwebte der Geist Gottes in Form einer weißen Taube über den Wassern, dann trennte der Schöpfer Licht und Finsternis und ließ das Firmament und die Pflanzen entstehen. Der zweite Erzählkreis stellte die Erschaffung der Gestirne, der Vögel, der Bewohner des Meeres, der Landtiere und des ersten Menschen, Adam, dar. Im dritten und letzten Kreis gab Adam den Tieren ihre Namen, wurde Eva erschaffen und von Gott zu Adam ins Paradies geführt. Schließlich erlag Eva der Versuchung und empfing von Satan in Form einer Schlange die Frucht vom Baum der Erkenntnis, die sie Adam reichte und mit ihm verspeiste, womit sich der »Sündenfall« ereignet hatte. Adam und Eva versteckten sich zwar vor Gott, dieser entdeckte sie aber, verfluchte zuerst die Schlange Satan und ließ dann Adam und Eva durch den Erzengel Michael aus dem Paradies vertreiben. Im letzten Bild hackte Adam Holz und Eva spann Flachs. Auf der angrenzenden Wandfläche waren die Geburt ihrer Kinder – Kain und Abel – zu sehen, ihre Opfergaben an Gott und zuletzt, über dem Eingang zur ZEN-Kapelle, die Ermordung Abels durch Kain. Für Klemens war die gesamte Menschheitsgeschichte in den goldenen Mosaiken dargestellt oder, wie er sagte, ihre DNA. Zumeist nahm Klemens dann die Noah-Kapelle in Augenschein, vom Bau der Arche bis zur Sintflut, von der Rückkehr der Taube mit einem Ölzweig im Schnabel bis zum Begräbnis Noahs. Gleich gegenüber sah man den Turmbau zu Babel in einer kindlichen Darstellung und daneben die babylonische Sprachverwirrung.
Einmal, erinnerte sich Lilli, hatte Klemens auch lange das Mosaik mit der Fußwaschung Jesu an den zwölf Aposteln betrachtet, und ihr fielen Klemens’ Aufzeichnungen mit der päpstlichen Fußwaschung an seinem Vater ein.
Der Hauptteil des Doms war dem Lebens- und Leidensweg Jesu gewidmet und seiner Ermordung durch Menschenhand. Klemens hatte das als »die Erklärung des Menschen schlechthin« aufgefasst, der sein Leben im Paradies selbst zerstört und zuletzt den Schöpfer des Alls umgebracht hatte. Jedes Mal hatte er jedoch betont, dass Gott den Menschen und Luzifer nach seinem Ebenbild erschaffen habe.
Obwohl sie den Markusdom mit seinen Kuppeln und Nischen schon als Kind und später während ihres Studiums kennengelernt hatte, hatte erst Klemens sie auf die Darstellung des Jüngsten Gerichts aufmerksam gemacht, das sie in keinem ihrer Bücher abgebildet oder erwähnt gefunden hatte.
Sie erhob sich und blickte auf die Mosaiken über ihrem Kopf, dabei kam sie sich auf beruhigende Weise unwichtig vor. Sie befand sich, hatte sie den Eindruck, im Haupt des Doms und betrachtete seine versteinerten Erinnerungen. Was würden Archäologen aus den Mosaiken schließen, fragte sich Lilli, wenn es keine Erklärungen mehr für die Darstellungen geben würde? … Es beruhigte sie, dass es im Dom keine Zeit gab, auch wenn Glocken läuteten, sie waren nur akustische Dekoration, sagte sie sich. Das Gold um sie herum war nicht blitzend oder leuchtend, sondern geheimnisvoll dunkel, ein Gold – wie sie es für sich formulierte –, das schlief und Mosaiken träumte. Ihr erschien es, als ob sie in eine Welt nach dem Tode blickte. Die Mosaiken begannen sich jetzt in ihrem Kopf lautlos zu bewegen und lebendig zu werden.
Der Fußboden aus bunten Marmorstücken – der steinerne Teppich, wie sie sich sagte – zog sie genauso an wie die Mosaiken, nur blieben sie, wenn kein Wasser sie bedeckte, stets unbeweglich, als seien sie zu Momenten gefrorene Einzelbilder. Dann wieder dachte sie an den schlafenden Kopf eines phantastischen Wesens voller Visionen und Träume. Und sie hatte den Eindruck, dass auch in ihr selbst etwas vorhanden war, das sie erst entdecken musste.
Im Mosaik des Jüngsten Gerichts – direkt neben der Bank, auf der sie inzwischen Platz genommen hatte – zeigten sich graue Wolkenballen, über denen Gott, die Heiligen und Engel schwebten – dicht gedrängt wie auf dem Paradiesbild von Tintoretto im Dogenpalast –, während auf einem grotesk riesigen Teufelsschwanz die zur Hölle Verurteilten zusammengedrängt und aufeinander geworfen in das Inferno stürzten und dabei von Engeln mit Lanzen und Schwertern ins Dunkel getrieben wurden, als wären sie Vieh. Die Gesichter der Sünder drückten Angst, Schmerz, Resignation und Verzweiflung aus.
Nicht nur, dass Lilli auf der Galerie dem Jüngsten Gericht ganz nah war, sie konnte sogar die Mosaiksteinchen berühren – die Goldplättchen, schwarze und weiße Splitter – und so das Kunstwerk aus seinem atomaren Aufbau begreifen. Jedes Mal war sie erstaunt, wie klein die Steinchen waren. Über die pointillistische Malweise eines Georges Seurat oder Paul Signac verstand sie auch die gleichsam spitzengeklöppelte Steinstruktur. Vielleicht war dies das größte Erlebnis, das der Dom ihr vermittelte: die Entstehung eines Ereignisses aus winzigsten Einzelheiten. Hinter ihr befand sich ein Dach aus Plexiglas, durch das sie auf den Eingang hinunterschauen konnte, wo kleine Männchen in orangefarbenen Uniform-Overalls immer noch Wasser ins Freie kehrten. Später würden sich die Touristen dort wie auf einer Ameisenstraße durch den Dom bewegen. Als ihr Blick zufällig auf den Fußboden fiel, entdeckte sie ein Mosaiksteinchen, ein Glasplättchen, überzogen mit Blattgold, das sich von der Wand gelöst haben musste. Rasch bückte sie sich, hob es auf und steckte es, ohne nachzudenken, in die Tasche ihrer Jeans. Sofort begann sie, die Stelle zu suchen, von der es ausgebrochen war, und entdeckte, dass es das Goldsteinchen gerade über dem Kopf eines Engels war, der mit seiner Lanze die zur Hölle Verdammten bedrohte. Ihr war klar, dass der goldene Hintergrund der Mosaiken Ausdruck des Lichtes war, welches im Mittelalter Gott selbst darstellte. Nicht weit davon, über dem Paradies, entdeckte sie auch den siebenköpfigen Drachen. Er bildete, wie sie wusste, ein Zitat aus der Offenbarung des Johannes ab, in dem Satan als Drache, »groß und feuerrot, mit sieben Köpfen und zehn Hörnern und mit sieben Diademen auf seinen Köpfen« beschrieben wird. Dabei ging ihr noch immer das Mosaiksteinchen in ihrer Jeanstasche durch den Kopf. Durfte sie es behalten?
»Signora!«, sprach sie eine Stimme an. Da sie kein Italienisch verstand, radebrechte der Mann im orangefarbenen Overall, der, vom Stiegensteigen noch außer Atem, gerade vor sie hintrat: »You must go … Scusi.«
Lilli dachte weiterhin an das Mosaiksteinchen und folgte dem Arbeiter im Overall eilig die steile Treppe hinunter. Während er sich noch einmal entschuldigte, trat sie erleichtert aus dem Dom.
Immer noch war der Markusplatz von Wasser bedeckt, und immer noch fotografierten die Touristen einander. Eine Taube im Tiefflug streifte ihren Kopf mit einem Flügel, was ihr wie ein mystisches Erlebnis erschien. Automatisch überquerte Lilli – jetzt noch immer die Sandalen in einer Hand – den Platz, wobei sie die beiden Musikkapellen hörte: die eine vor dem Caffè