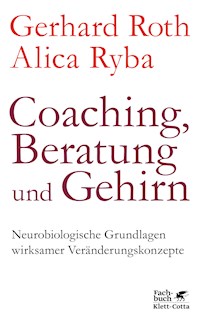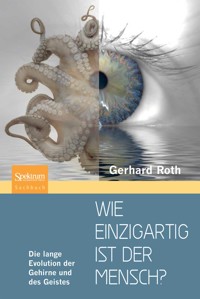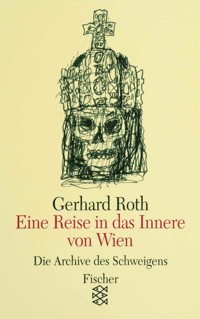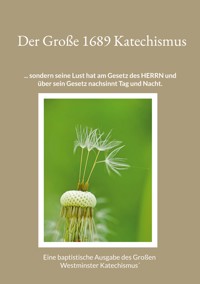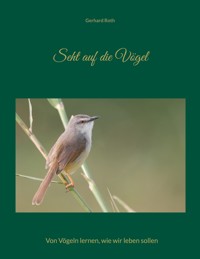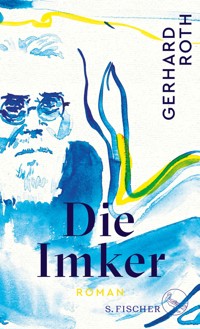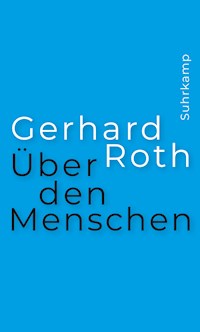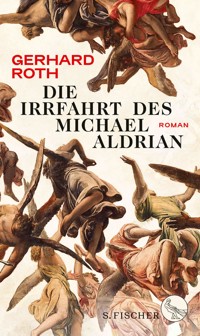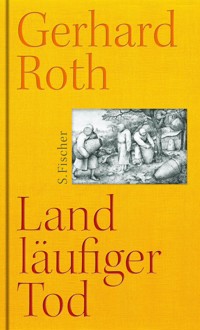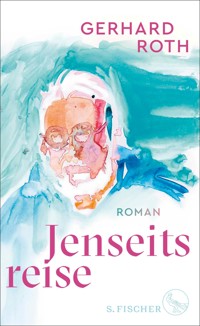
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Als Gerhard Roth im Februar 2022 starb, war sein neues Buch zu etwa zwei Dritteln fertig – in einer handschriftlichen Fassung in seinen Notizbüchern. Es ist eine Reise durchs Totenreich, die der Erzähler Franz Lindner als Verstorbener unternimmt. Die Reise führt durch Ägypten, ein Land, das Gerhard Roth immer wieder bereist hat. Dort, im Fegefeuer der Totenstadt Kairo, begegnet Franz Lindner einer Fülle von realen Figuren – vor allem Künstlerinnen und Künstlern aller Sparten, die Gerhard Roth in seinem Leben wichtig waren. Sein Romanfragment ist eine große Hommage an diese Persönlichkeiten und zugleich ein letztes Nachdenken über den Menschen, seine Hoffnungen, seine Kreativität, seine Grenzen. Und ein Selbstporträt des Autors, der mit diesem Buch – in dem alles möglich ist – das Reich der Freiheit erreicht hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 455
Ähnliche
Gerhard Roth
Jenseitsreise
Roman
Über dieses Buch
Als Gerhard Roth im Jahr 2022 starb, war sein neues Buch zu etwa zwei Dritteln fertig – in einer handschriftlichen Fassung in seinen Notizbüchern. Es ist eine Reise durchs Totenreich, die der Erzähler Franz Lindner als Verstorbener unternimmt. Die Reise führt durch Ägypten, wo er einer Fülle von realen Figuren begegnet – vor allem Künstlerinnen und Künstlern aller Sparten. Roths Romanfragment ist eine große Hommage an diese Persönlichkeiten und zugleich ein letztes Nachdenken über den Menschen, seine Hoffnungen, seine Kreativität, seine Fähigkeit zum Bösen wie zum Wunderbaren. Und es ist ein Selbstporträt des Autors, der mit diesem Buch – in dem alles möglich ist – das Reich der Freiheit erreicht hat.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Gerhard Roth, geboren 1942 in Graz und gestorben 2022, war einer der wichtigsten österreichischen Autoren. Er wurde mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet. Er veröffentlichte Romane, Erzählungen, Essays und Theaterstücke, darunter den 1991 abgeschlossenen siebenbändigen Zyklus »Die Archive des Schweigens« und den nachfolgenden Zyklus »Orkus«. Zuletzt erschienen eine Venedig-Trilogie und, als letztes abgeschlossenes Werk, der Roman »Die Imker«.
Inhalt
[Zitat]
[Motto]
Erstes Buch Mein Tod
Der Steinbruch
Der Elsternflug
In der Wüste
Gedanken
Die Lamarckii-Bienen
Metamorphose
Mord
Die Bootsfahrt
Das Begräbnis
Die vergessene Bibliothek
Der Friedhof der Sandkörner
Zweites Buch Die Wüstenstadt
Die Farm der Tiere und Elias Schneider
Heilige Gebäude
Das Zweiwegebuch
Jonathan Swift
Unter Untermenschen
Ein Spaziergang
Das Papyrusgeschäft
Im Hausboot mit Lewis Carroll und Albert Einstein
Die katastrophale Metamorphose
Karl Marx
Emily Dickinson
Bakterien
Nachtflug
Marcel Proust
Selma Lagerlöf
Diane Arbus und Lisette Model
Dr. Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes und Harry Houdini
James Ensor und die Demonstration
Franz Kafka und Reiner Stach
Das Globe Theatre und William Shakespeare
Die Eishalle der erfundenen Figuren, William Shakespeare und die Straßenbahnfahrt
Das Selbstmörderviadukt, Luis Buñuel, Sylvia Plath, Virginia Woolf und Ingeborg Bachmann
Der Flug, Dalí
Die Oase der Irrenden
Im Gedankenflug – Sigmund Freud
VISITE! VISITE!
Gespräche
Die Bibliothek und das Glashaus
Schliemanns Ausgrabungen
Im Dante-Museum
Nietzsche und die zehn Plagen Gottes
Das Konzert im Pavillon
Die Schneeflocken
Die Predigt
Drittes Buch Die Flussreise
Anhang
Vom Nicht-Verstehen
Vorgeschichte im Diesseits
Übergänge ins Jenseits
Jenseitstopografien und utopische Ausblicke
Nachbemerkung zu dieser Ausgabe
Immer schon wollte ich ein Buch schreiben, das niemand versteht.
Gerhard Roth
Die Erde –
Gleichnisse und Zauber
Als ob ein Tauber
Den Fischen lauscht
So verstehen wir
In unserem Leben
Die Rätsel
Die uns umgeben
Erstes BuchMein Tod
Der Steinbruch
Ohne zu zögern sprang ich in den Abgrund des Steinbruchs. Ich verspürte keine Angst, sondern war ein Kind, das glaubte, fliegen zu können. Während ich die Luft durchpflügte, fiel plötzlich Spielzeug vom Himmel: Stofftiere, Legofiguren, kleine Autos, Schiffe, bunte Märchenbücher, Papierblumen, Karnevalsmasken …
Ich war aus der Welt geflüchtet, in der ich meine Einsamkeit nicht länger ertragen hatte, die Sinnlosigkeit, das Verstummen der Menschen und das Fehlen von Liebe. Ich hatte weder die Kraft noch den Willen verspürt weiterzuleben, und beim Gedanken, aus der Erde zu flüchten, war ich meinem Vorsatz folgend einfach losgelaufen, um ins Jenseits zu gelangen. Mit meinem Sprung über die wildgewachsenen kleinen Bäume und Sträucher, die im Laufe der Jahre unter der verschwundenen Schaukanzel gewachsen waren, vertraute ich mich der Schwerkraft und dem freien Fall an. Plötzlich schwebte ich im dichten Spielzeugregen an die hundert Meter über dem Abgrund, der sich wie der Deckel einer Schachtel von selbst aufklappte. Während ich in der Stille bewegungslos weiter verharrte, bis der Deckel sich schließen würde, erstaunte ich, wie leicht das Sterben ist. Zugleich näherte sich das Summen eines Bienenschwarms, das immer eindringlicher wurde und schließlich mein Gehör überflutete. Ich spürte nicht, dass ich jetzt wieder stürzte und wie ich auf dem Diabasgestein aufschlug, mein letzter Gedanke war, dass der Schöpfer ein Bienenschwarm sei, ein »Bien« aus Tausenden selbständigen Teilchen, die sich zu einem einzigen Wesen zusammenfügten, und dass auch ich, ohne es zu wissen, eine Zelle seines Körpers gewesen war, der seine Gestalt von außen nie zu Gesicht bekommen hatte …
Gleich darauf vergaß ich alles, was an Wissen und Erinnerungen in meinem Kopf gespeichert war, und ich verlor das Zeitgefühl, besser gesagt, die Zeit selbst. Auf diese Weise überschritt ich die Grenze zwischen Leben und Nichtleben, doch ich war nicht tot. Später glaubte ich mich daran zu erinnern, dass sich der Boden des Steinbruchs zu einem schwarzen Loch geöffnet hatte und ich, begleitet vom Summen der Bienen, ins Nichts fiel.
Ich erwachte in einer Zweidimensionalität, als sei ich zu einer Zeichentrickfigur auf einer riesigen, weißen Leinwand geworden. Gleichzeitig befand ich mich in einem ausverkauften Kinosaal, um mich bei meinen vergangenen Lebensabenteuern zu betrachten. Da ich jahrzehntelang Patient in einer Nervenheilanstalt gewesen war, die ich insgeheim als Nervenunheilanstalt bezeichnet hatte, verlief die Vorstellung eintönig, weshalb sich der Großteil des Publikums entfernte, bis ich zuletzt allein zurückblieb. Abgesehen von meinen sexuellen Fluchtversuchen in die Selbstbefriedigung und meiner Verzweiflung, meiner Wut, meinen Lügen und letztendlich meiner Resignation erfuhr ich nichts Neues. Weshalb hatte ich überhaupt gelebt?, fragte ich mich. Wo war die Gerechtigkeit geblieben, die andere Menschen unter ganz anderen Voraussetzungen existieren ließ? Ich wollte nichts mit einer neuen Gerechtigkeit zu tun haben, in der ich jetzt Gott hätte in Gemeinschaft mit unzähligen Seelen preisen dürfen, für das, was er mir angetan hatte. Zuletzt erst hatte ich die Liebe einer Afrikanerin und ihres Kindes erfahren, worauf mir erst recht bewusst geworden war, was ich bisher versäumt hatte. Ich bin kein Ausnahmefall. Zu viele Menschen können den Schöpfer wegen der Ungerechtigkeit anklagen, die sie auf Erden ertragen mussten, und die, die es nicht konnten und sich das Leben genommen hatten, waren auf Gottes Gesetz hin zur Hölle verurteilt worden. Ich habe an einen Teufel weniger geglaubt als an Gott. Hat es der Teufel verursacht, dass in der Natur das Gesetz des Stärkeren herrscht, das Fressen-und-gefressen-Werden? Außerdem war auch Luzifer ein Geschöpf, nein, eine auserlesene Schöpfung Gottes in Engelsgestalt gewesen. Weshalb hatte das Wesen gegen seinen Urvater aufbegehrt? Weshalb hatte der allwissende Schöpfer die missratene Gestalt überhaupt erschaffen? Weshalb hatte er sie nicht ausgelöscht, sondern durch sein Engelsheer in die für das Böse erschaffene Hölle verstoßen lassen, von wo aus sie als Satan die Menschheit angeblich zu Sünden verführte?
Ich hatte einmal eine Novizin bei ihrem Besuch im »Haus der Künstler« gefragt, weshalb Gott Unheil über Unheil auf Erden dulde und die Menschen, die er mit der Sintflut vernichtet habe, im Anschluss daran alles Unheil von Anfang an wiederholt hätten, bis Gottes einziger Sohn ans Kreuz genagelt worden sei? Als Allwissender hätte er ja wissen müssen, dass sich selbst daraufhin nichts ändern würde!
»Gott ist auch böse«, hatte die Novizin geantwortet, worauf ich staunte. Doch je länger ich darüber nachdachte, desto mehr glaubte ich, dass sie recht hatte.
Und noch etwas fiel mir ein: Wie konnte sich Dante anmaßen, in der »Göttlichen Komödie« Menschen zu Hölle oder Fegefeuer zu verurteilen oder für den Himmel freizusprechen? Das sind die wackeligen Beine, auf denen dieser goldene Thron der Dichtung steht, dachte ich.
Als ich das Kino verließ, setzten wieder der Prozess des Vergessens und eine Zeit der Zeitlosigkeit ein. Ich befand mich dort, sagte ich mir später, wo ich vor meiner Geburt gewesen war.
Der Elsternflug
Als ich zu mir kam, stellte ich fest, dass ich winzig klein war und auf einer Wiese lag. Ein Grashalm war für mich ein Baum, die Wiese ein Wald, die Blumen in ihrer Schönheit ein Blick in das Paradies. Gelbe Dotterblumen, weiße Lilien, grüne, im Wind flatternde Fliederbüsche mit blauen Blüten breiteten sich wie steil emporragende Hügel vor mir aus. Erst jetzt bemerkte ich den riesigen Schnabel eines Vogels unmittelbar neben mir. Ich trug übrigens einen roten Kinderanzug und war sieben Jahre, sieben Monate und sieben Tage alt. Um die Hüften trug ich eine silberne Schleife aus Seide, und meine Füße steckten in silbernen Schuhen. Der schwarze Vogelschnabel zog gerade einen Riesenwurm ans Tageslicht, den er sofort aufsog. Bevor ich noch in Tränen ausbrechen konnte, erstarrte ich vor Angst. Langsam näherten sich von der anderen Seite drei Katzen. Eine hatte ein Tigerfell, die anderen beiden waren schwarz. Ich sah ihre Augen, als sie bewegungslos und sprungbereit verharrten. Nicht nur mich, bemerkte ich, auch die Elster, die zum Schnabel gehörte, hatten sie in ihrem Blickfeld.
»Du kannst erst wieder leben, wenn du dich an alles erinnerst«, hörte ich den Vogel denken. Während er überlegte, wusste ich mit einem Schlag wieder alles über mein Leben, doch hatte ich gleichzeitig das Gefühl, dass ich etwas von mir selbst verlor und noch kleiner wurde. Tatsächlich hatte ich die Gestalt einer Raupe angenommen und konnte wie im Traum mich selbst und zugleich das Geschehen sehen, wie vor einem Spiegel. Bevor ich aber noch weiter zusammenschrumpfte, schluckte mich die Elster und erhob sich in die Luft, so dass ich mich augenblicklich in ihrem stockdunklen Magen wiederfand, wo sich der Wurm noch regte. Der Vogel beförderte mich sogleich mit einem Schluckauf zurück in seinen Schnabel, den er leicht geöffnet hatte.
»Du bist keine Raupe«, dachte er laut, »du bist ein Mensch … das heißt, du warst ein Mensch.«
»Und du?«, fragte ich.
»Ich bin Pica-Pica, die Elster. Und wie heißt du?«
»Franz Lindner … und Wilhelm Herman … ich bin zwei Menschen in einem … deshalb lebte ich im ›Haus der Künstler‹, einer Anstalt für geisteskranke, künstlerisch begabte Menschen.«
»Wer fliegt mit mir in meinem Schnabel, Franz Lindner oder Wilhelm Herman?«
»Beide.«
Als ich durch den schmalen Spalt des Schnabels blickte, erkannte ich, dass wir hoch am Himmel flogen. Die Erde unter uns erschien mir wie ein Präparat unter einem Mikroskop. Sie war zusammengeschrumpft wie ich selbst. Ich erkannte Flecke von Grün, Braun, Weiß und Gelb darauf und dazwischen die blaue Farbe des Meeres. Ich verlor unerwartet das Gleichgewicht. Rücklings stürzte ich neuerlich in den Magen der Elster hinunter, doch ein nächster Schluckauf beförderte mich sogleich zurück in den Schnabel, der noch immer leicht geöffnet war. Ich spürte den heftigen Luftzug um mich und hörte, wie die Elster erklärend dachte, dass wir gerade für einen Zeichentrickfilm vom japanischen Farbholzschnittkünstler Hokusai gezeichnet würden. An meinem Körper erkannte ich, dass ich wieder menschliche Gestalt angenommen hatte, doch winzig klein geblieben war. Schwindel packte mich, als ich feststellte, dass wir uns der Erde näherten, und ich suchte Halt an den scharfen Kanten des Schnabels.
Wenn Pica-Pica allerdings den Schnabel schließen würde, wusste ich, würden dabei wohl meine Finger abgehackt werden. Trotzdem konnte ich nicht anders, als mich festzuklammern. Je näher wir der Erdkugel kamen, desto schöner erschien sie mir. Insgeheim hatte ich schon befürchtet, von der Elster ins All getragen zu werden und ein zweites Mal Suizid begehen zu müssen – umso mehr erfüllte mich der Anblick mit Freude.
»Du brauchst dich nicht zu fürchten«, antwortete die Elster auf meine Gedanken.
»Ich will nur Frieden«, entgegnete ich denkend, »das ist alles. Keine Belohnung, keine hierarchischen Welten und Konstruktionen, keine Ewigkeit.«
»Den Frieden«, dachte die Elster, »musst du selbst finden. Es gibt keinen ewigen Frieden. Unser Richter ist, wenn man sich an die Bibel hält, zornig. Er tötet Menschen. Mit der Verstoßung Adams und Evas aus dem Paradies hat er die Todesstrafe für die gesamte Menschheit und Tierheit eingeführt und er lässt die ›Schuldigen‹ in der Hölle ewig sterben … Weshalb war Kain fähig gewesen zu töten?«
»Ich weiß es nicht«, entgegnete ich stumm, »aber ich kenne die Hölle.«
In der Wüste
Erst in der Wüste kam ich wieder zu mir. Nie werde ich erfahren, wie viel Zeit inzwischen verstrichen war. Es stank, wie ich es auf der Erde noch nie erlebt hatte. Vor dem Zelt, in dem ich saß, rauschte ein Meer aus Exkrementen. Es war offenbar so warm, dass es gelben Dunst absonderte. So weit mein Auge reichte, sah ich nur das braungelbe, dampfende Gewässer. Eine riesige Menschenmenge aus fetten Gestalten ruhte am Strand unter Sonnenschirmen auf Liegestühlen und ich hörte die Furzsprache, in der sie sich unterhielten. Wenn ich es richtig verstand, erzählten sie einander obszöne Witze und brachen in Gelächter aus. Andere hingegen weinten laut. Es herrschte gerade Flut, denn großer, gelber Schaum bildete sich auf den Wellen und am Strand lag Kot in allen Formen. Zum Landesinneren hin erstreckte sich eine Ebene aus vertrockneten Exkrementen bis zum Horizont. Mitten darin stand das Zelt, in dem ich Unterschlupf gefunden hatte. Ein Wüstenfuchs war bei mir. Er musste mich die ganze Zeit über beobachtet haben. Seine Ohren waren riesig, sie sahen wie Flügel aus, und das Tier gab ein melodiöses Quieken von sich, das ich sofort verstand.
»Komm!«, rief es mit hoher Stimme, »Wir müssen uns aus dem Staub machen!«
Ich war noch immer Kind, und der Fuchs passte zu meiner Körpergröße. Als wir aus dem Zelt traten, war der Himmel schwarz von Vögeln, die fliegend ihre Notdurft verrichteten und uns zum Strand hinuntertrieben, an dem zahlreiche »Verschmutzer«, wie Fennek, so hatte er sich vorgestellt, sie nannte, in das stinkende Meer liefen, das weiter Dampf absonderte, so dass man an eine heiße Naturquelle und Nebel denken konnte, in dem die Gestalten verschwanden und auftauchten.
Wir hatten den Strandstreifen zwischen der ersten Reihe von Liegestühlen und dem gewaltig stinkenden Meer erreicht, und Fennek war in Laufschritt gefallen, dem ich leicht folgen konnte. Die Neugierigen in den ersten Reihen am Strand richteten sich auf und riefen uns zu, dass wir »abhauen« sollten. Wir seien Arschlöcher und hätten hier nichts verloren, worauf wir immer schneller liefen. Zuerst schien es mir, als sollte ich zur Strafe ewig weiterlaufen müssen.
»Wieso Strafe?«, fragte Fennek.
»Das weiß ich selbst nicht«, gab ich wortlos zur Antwort.
»Ich laufe gerne«, setzte Fennek seine Gedankensprünge fort, »es gehört zu uns wie das Atmen und Fressen. Wir Tiere wurden als Tiere geboren.«
Er lachte.
»Wir waren immer Tiere und nie Menschen. Es gibt keine Wiedergeburt, wie viele glauben. Das Tiersein ist keine Buße für Menschen, die gesündigt haben. Wir gleichen den Menschen – nur dass wir in einer anderen Wirklichkeit leben. Ihr könntet in dieser Wirklichkeit nicht existieren, ihr würdet in ihr jämmerlich zugrunde gehen. Wir fliegen, tauchen, laufen, krabbeln und verfügen über Fähigkeiten, die ihr nicht habt.«
Einige der seltsamen, vor Fett schwabbelnden Badegäste warfen mit Sandbällen, die sie aus dem Boden kratzten, nach uns. Die meisten davon trafen uns. Sie waren auf der Unterseite feucht und stanken, als seien sie aus einer Kloake gefischt. Plötzlich verspürte ich, dass meine Ohren wuchsen. Auch Fenneks Ohren, die ohnedies zu groß waren, nahmen an Umfang zu, bis wir beide wie Dumbo, der Elefantenjunge, sie ausbreiten und fliegen konnten.
Der Zeichentrickfilmkünstler hielt uns in einer Skizze fest, wie wir die Ohren ausstreckten und nach oben hinauf stürzten, bis wir eine Wolke erreichten.
Gedanken
»Wer ist dein Gott?«, fragte ich Fennek.
»Ein Wüstenfuchs«, antwortete er. Und als ich lachte, fuhr er fort, dass der Gott einer Ameise – eine Ameise sei. Der Gott der Vögel – ein Vogel, der Gott der Hunde – ein Hund, der Gott einer Tulpe – eine Tulpe, denn auch Tiere und Pflanzen seien Ebenbilder Gottes.
»Es gibt«, fuhr er fort, »keine einzige Wirklichkeit und Wahrheit, wie die Menschen glauben. Sie haben die Wirklichkeit nur kolonialisiert und zu ihrem Eigentum gemacht.«
Ich begriff, was er meinte. Und zugleich wurde mir klar, dass auch ich nie »real« gewesen war. Nur mein Körper hatte das Aussehen von Wirklichkeit gehabt. Mein Geist aber malte sich eine ganz andere Wirklichkeit aus. Ich konfabulierte insgeheim Tag und Nacht. Schon als Mensch war ich eine Zeichentrickfigur gewesen. Übrigens ist Konfabulieren nicht gleich Lügen. Das Lügen ist zwar eine retuschierende Wirklichkeit, doch ist es eine alltägliche Gewohnheit, daher regt sich darüber kaum jemand auf, weil ohnedies jeder aus Gewohnheit lügt. Die einzige Ausnahme ist, dass es Ärger hervorruft, wenn jemand schlecht lügt. Die Menschen sprechen in der Regel nicht miteinander, sondern tauschen Lügen aus. Es ist für sie normal, sogenannte Halbwahrheiten aufzutischen: in Form von Anspielungen, falschen Geständnissen, hohlen Versprechungen, automatischem Beileid, schmierenkomödiantisch gespieltem Verständnis, emotionalem Streit, aus der Luft gegriffenen Anklagen, angeberischen Hilfsangeboten oder delirierten Träumen und vor allem Ausreden. Konfabulieren hingegen ist etwas Schöpferisches, eine Reise in die Anderswelt. Es braucht nicht die Aufmerksamkeit anderer Personen, es schindet nicht Eindruck. Das Einzige, was Konfabulation mit Lügen gemeinsam hat, ist, dass beides ein gutes Gedächtnis voraussetzt, da man sich den Inhalt der Erzählungen und zugespitzten Übertreibungen merken muss, um nicht später von jemandem, der bereits in die erzählte Geschichte eingeweiht ist, entlarvt zu werden. Doch jetzt, nach meiner Flucht von der Erde, ist es mir gestattet, nicht real zu sein. Was für ein Fortschritt! Mein Ego war bislang nur ein Schatten meiner selbst. Ich kann und konnte mein Ich nie auch nur annähernd sichtbar machen, selbst der Begriff »Schatten« ist übertrieben, zumindest was die Vollständigkeit betrifft. Ich existiere nur in Fragmenten, in Splittern, in Mosaiksteinchen oder in Puzzleteilchen und bilde keinen geschlossenen Bienenschwarm, ja ich finde oder verstehe gar mein reales Ich selbst nicht. Als Bewohner der Erde war ich davon überzeugt, dass es den sogenannten normalen Menschen ebenso geht wie mir und sie sich diesen Umstand nicht eingestehen. Lieber flüchteten sie sich ihr Leben lang in Lügen, um den Schein zu wahren, zur Normalität zu gehören. Ich verstand fremde Menschen oder Tiere, über die ich überhaupt nichts wusste, instinktiv immer besser als mich selbst. Nie besaß ich die Eigenschaft der sogenannten Einbildung, die ja vorgibt, man kenne sein Ich genau. Mit einem Wort, ich bin kein Selbstbetrüger aus Gewohnheit, der sein Leben lang behauptet, nichts als sein Ich darzustellen, sondern ich bin im Gegenteil dazu auserkoren, mich niemals auch nur annähernd kennenzulernen. In Wahrheit sind wir geboren, vermute ich, uns selbst ein Rätsel zu bleiben. Genauso wie wir davon überzeugt sind, stets unschuldig zu sein. Nicht einmal die Schuldigsten gelangen zur Selbsterkenntnis, sondern wähnen sich in der staubkorngroßen Möglichkeit, die ein Verteidiger vorexerziert, vielleicht doch unschuldig zu sein. Niemand und nichts ist real, am wenigsten die Wahrheit. Ein Leben lang halten wir uns in einem vorgeblichen Paradies auf, das in Wirklichkeit ein Irrgarten voller Mimikry ist, und sind Märchenerzähler, die als Einzige an die Geschichten glauben, die sie selbst erfunden haben. Ich zum Beispiel glaube, dass ich zeitlebens ein Insekt im November war, das Zuflucht in einem fremden Haus suchte und sich dort so lange versteckte, bis es erschlagen oder zum Fenster in die Kälte hinausgeworfen wurde. Ich bin ein Nichts unter Nichtsen. Odysseus verwendete die Ausrede, er heiße »Niemand«, um den einäugigen Riesen Polyphem zu täuschen, der ihn nach seinem Namen fragte. Denn als der griechische Held seinem Widersacher das Auge ausgestochen hatte und Polyphem seine Brüder zu Hilfe rief, die ihn nach dem Namen des Täters fragten, konnte er daraufhin nur »Niemand« antworten. Ich bin real ein Nichts, ein Niemand.
»Warum aber hast du Selbstmord begangen«, unterbrach mich Fennek, »obwohl du ohnehin ein Nichts bist?«
»Weil mein gesamtes Leben ein Sterben war«, entgegnete ich.
Ich dachte nach und ergänzte schließlich: »Bis ich Malia und ihre Tochter kennenlernte …«
»Malia … ein afrikanischer Vorname …«, überlegte Fennek.
»Ja, sie war meine Frau. Eine Afrikanerin, wie ihre Tochter. Und ich hoffe, sie eines Tages wiederzusehen.«
»Ist sie tot?«, fragte Fennek.
Ich nickte.
»Und du hoffst, obwohl es dich real nicht gibt?«
»Ein Niemand ist das beliebteste Opfer der Angst, die ihn mit ihren Giftstacheln quält wie ein wütender Wespenschwarm.«
»Du denkst aber, der Schöpfer sei ein Bienenschwarm?«, widersprach er. »Sind die Wespen nicht auch göttlich?«
Ich wusste zuerst keine Antwort auf seine Frage, aber ich wollte unbedingt das letzte Wort behalten. Doch schlief ich ein, während ich nach einer Ausrede suchte. Als ich erwachte, fiel mir endlich ein, was ich antworten wollte: »Die Bienen stammen von den Wespen ab.«
Aber ich lag allein in dem Zelt und rundum waren nur Hitze und gelber Sand.
Die Lamarckii-Bienen
Wie es kam, dass ich auf die Siedlung am Ufer des Nils zuging, weiß ich nicht. Ich erinnere mich bloß daran, dass ich die Apes mellifera lamarckii, die ägyptischen Bienen, suchte. Inzwischen war ich wieder so alt und groß geworden wie zu dem Zeitpunkt, als ich mein Leben beendete. Offenbar war ich zurück in die irdische Wirklichkeit gelangt, denn es lief alles folgerichtig ab. Zumindest hatte es den Anschein. Dann aber fiel mir plötzlich auf, dass ich völlig orientierungslos im Sand vor mich hin stapfte wie ein Kind, das sich noch nie verirrt hat. Ich erinnerte mich später beim endlosen Gehen an das Gespräch mit dem Wüstenfuchs.
Von Anfang an war mir klar gewesen, dass ihm alles, was ich gesagt hatte, unsinnig erschienen war. Und jetzt erst fiel mir ein, was ich ihm hätte antworten sollen. Übrigens eine alte Krankheit von mir: die verspätete Antwort. Erst wenn ich allein bin und ungestört, hole ich nach, was ich bei einer Begegnung zu sagen versäumt habe. Vielleicht schreibe ich mir deshalb so vieles auf, weil mir die Dinge sonst nicht aus dem Kopf gehen. Der Oberarzt erzählte mir einmal die Geschichte vom Schachautomaten des Barons von Kempelen und schenkte mir ein gelbes Buch mit Abbildungen. Ich habe es immer wieder von vorne gelesen und mich endlich selbst erkannt. Als ich es dem Oberarzt mitteilte, klopfte er mir auf die Schulter und lächelte mitleidig. Aus diesem Grund hatte ich es nicht mehr erwähnt und allmählich zur Gänze vergessen. Doch jetzt war ich mir sicher, dass ich mehr über mich gewusst hatte, als er begreifen konnte.
Der Automat aus dem Jahr 1770, erbaut von Herrn von Kempelen, war eine menschengroße Türkenpuppe, die hinter einer Kiste saß, die gleichzeitig als Tisch diente. Darauf lag das Schachbrett mit aufgestellten Figuren. Der Gegenspieler aus dem Publikum musste seine Züge laut aussprechen – »König A4!« – und dann ausführen, daraufhin dachte der Türkenautomat nach und vollführte sodann seinen Gegenzug mit einer Figur auf dem vor ihm liegenden Schachbrett. Seltsamerweise ging der Türke immer als Sieger hervor. Das Schachbrett symbolisierte für mich das normale Leben. Die Figuren wurden nach den strengen Regeln des Spiels bewegt.
Kein anderer als Edgar Allan Poe durchschaute als Erster den Trick, mit dem der maschinelle Türke seine Herausforderer reihenweise besiegte. Ein kleiner Mensch, der ein grandioser Schachspieler war, befand sich im Kistentisch und konnte ungesehen über mechanische Vorrichtungen den Gegenzug auf dem Schachbrett bewerkstelligen. So funktionierte auch das sogenannte normale Leben, dachte ich mir. Ich aber saß vor dem Türken und dem Kistentisch, auch konnte ich kaum Schachspielen. Ich hasste das Schachspiel. Trotzdem musste ich Tag für Tag gegen den automatischen Türken antreten, der mich bloßstellte. Inzwischen kannte mich der kleine Schachspieler in der Kiste ebenso wie ich ihn, er gab mir durch dumpfe Rufe fortlaufend zu verstehen, nach welchen Regeln ich handeln sollte.
»Spiel doch!«, rief er. »Spiel doch!«
Aber ich ließ ihn warten.
Ich sagte dann: »Ich schlage deine Dame!«
Er antwortete ungehalten: »So geht das nicht!«
»Dann schlage ich eben deinen Turm!«
Er: »Stelle den Läufer von X nach Y.«
»Warum?«
»Dann gewinnst du.«
Ich antwortete an dieser Stelle regelmäßig: »Spiel gegen dich selbst und besiege mich.«
Dieser Satz hatte stets das Ende zur Folge, man rollte den Schachautomaten, in dem der kleine Mensch jetzt tobte, wieder hinaus. Ich habe den kleinen Spieler nie gesehen.
Ich marschierte durch die Landschaft am Nil dahin wie ein Trinker, der ein Gasthaus sucht, aber sich nicht in der Gegend auskennt. Schon wollte ich meinen Kopf neben einem kleinen Gebüsch in den Schatten legen, als ich ein weißes Gebäude erblickte. Je näher ich kam, desto mehr Häuser tauchten auf. Schließlich waren es vier, die ich verstreut zwischen den Sandhügeln ausmachte. Eine Fata Morgana? Ich war davon überzeugt. Selbst als ich vor dem ersten Haus stand, glaubte ich, Opfer eines physikalischen Narrenspiels zu sein. Vorsichtig betrat ich durch eine geöffnete Tür einen großen Raum, der mich an einen verlassenen Viehstall erinnerte. Doch in der Mitte lag in einem offenen Sarg, um den brennende Kerzen standen, ein Mensch aufgebahrt.
Da erkannte ich meinen Vater im schwarzen Sonntagsanzug, der sich, als habe er nur darauf gewartet, dass ich endlich erschien, nervös erhob und mich freudig begrüßte. Mit einem Mal war für mich wieder alles selbstverständlich.
»Was machst du hier?«, fragte ich ihn.
»Ich war siebzig Jahre Imker, jetzt kümmere ich mich um die Apes mellifera lamarckii«, antwortete er überrascht, als sei es das Selbstverständlichste der Welt.
Metamorphose
Sogleich schritten wir eine Sanddüne hinauf und blickten von dort aus auf Felder, braune Lehmhäuser und den Fluss. Der Anblick war so schön, dass ich mir einschärfte, ihn nie zu vergessen. Auf dem Rückweg erst fielen mir die Mauern aus Nilschlammröhren hinter den Häusern auf, die wie runde Pappbehälter aufeinandergeschichtet waren, nur waren sie in Durchmesser und Länge größer. Einige Menschen in weißen Anzügen und mit weißen Hüten auf dem Kopf kontrollierten ihre Bienenvölker in den seit 5500 Jahren verwendeten Bauten, wie mir mein Vater erklärte und den Weg zu ihnen hin einschlug.
»Wo ist Mutter?«, fragte ich ihn, ohne nachzudenken.
»Im Paradies«, antwortete mein Vater. »Sie hat mich nicht aufgesucht, und ich durfte sie noch nicht sehen.«
Er wandte sein Gesicht von mir ab. Ich wusste, dass er mir nichts vorspielte.
»Du wirst sie bald sehen«, dachte er schließlich, aber ich schüttelte den Kopf.
»Ich habe Selbstmord begangen«, gestand ich ihm.
»Auch du? Hast du nicht genug gelitten?«
Er schien mich zu bedauern und blieb stehen und umarmte mich.
»Was sollte die Frage ›Auch du?‹«
Ich wusste nicht, was er damit meinte. Aber er ging nicht darauf ein. Stattdessen schlug er mir vor, wir sollten zuerst die Imkeranzüge holen, was ich befolgte.
»Es gibt hier keinen körperlichen Schmerz, er verwandelt sich in seelisches Leid … In Suchen und Nichtfinden, in Unrast und Orientierungslosigkeit … Ich war erleichtert, dass ich diesen Ort entdeckte. Er erscheint mir wie eine Erlösung.«
Schweigend zogen wir uns um, und in der außergewöhnlichen Situation, in der wir uns befanden, kam mir unser weißes Gewand vor, als hätten wir uns für eine Feldmesse als Engel verkleidet.
»Ja«, dachte mein Vater, »wir bewundern die Natur … erinnerst du dich an das Bild des heiligen Franziskus, das ich über dein Bett gehängt habe?«
Ich antwortete, dass es die Kunstpostkarte eines Bildes von Giotto gewesen sei mit der Darstellung des Mönchs bei seiner Vogelpredigt. Es hatte in mir die Sehnsucht geweckt, die Sprache der Tiere zu verstehen.
»Dies wollte ich auch schon als Kind«, antwortete mein Vater.
Von nun an verloren wir kein Wort mehr. Mein Vater war immer schon ein schweigsamer Mann gewesen. Bis zu diesem Moment konnte ich nicht mit Gewissheit sagen, ob er es gewesen war, der mich zum Geisteskranken gemacht hatte, da ich selbst Wochen und Monate meines Lebens kein Wort über meine Lippen brachte.
Draußen vor den Röhren aus Nilschlamm zeigte er mir weiter schweigend die runden Waben an den Innenwänden der Röhren. Plötzlich wusste ich, dass er die stumme Türkenfigur des Schachautomaten gewesen war, vor dem ich gesessen hatte, ohne dass jemals ein Spiel zu Ende gespielt wurde.
»Was meinst du?«, fragte er sofort überrascht und argwöhnisch.
Ich log: »Ich denke an ein Spielzeug …«
»Du lügst!«, fuhr er mich in Gedanken ungehalten an, worauf ich mich bemühte, an nichts mehr zu denken.
»Hier gibt es kein Sprechen«, belehrte er mich. »Es werden immer nur Gedanken, die wir hören können, ausgetauscht, und man verrät sich, weil man daran denkt, dass man lügt.«
Mir fiel ein, während ich das hörte, dass mein Vater mich über das Leben der Bienen und den Umgang mit ihnen unterrichtet und mir dadurch den Zugang zu ihrer Welt ermöglicht hatte. Ja, es war einzig die Anderswelt gewesen, in die ich hatte flüchten können.
»Du warst wie ein Taucher, der in einem Korallenriff die Geheimnisse der Natur erforscht: Die verschiedensten Wesen, die du ansonsten nicht zu Gesicht bekommst, hattest du plötzlich vor Augen: Wildbienen, Hummeln, Hornissen, Wespen … eigentlich die gesamte Insektenwelt, Schmetterlinge und Libellen, Ameisen, Puppen und Raupen. Du hast die gesamte Metamorphose von der Larve über die Puppe bis zum schlüpfenden Tier, der Imago, gesehen … Das ist die Verwandlung, in der du dich jetzt befindest, bis du erwachst.«
Ich bedauerte meine Gedanken. Zu meiner Freude umarmte er mich und ich ihn.
»Jeder hat seine eigene Perspektive, weil er nur sich selbst sieht«, dachte mein Vater. »So entsteht ein Universum der Missverständnisse.«
Sofort fiel mir ein, dass es in der Geschichtsschreibung kein Buch über gegenseitige Missverständnisse gab, die Hass, Angst, Verzweiflung und Wut, aber auch Liebe, Freude oder sogar Frieden erzeugt hatten.
Mein Vater nickte stumm.
Er klärte mich auf, dass die bis zu anderthalb Meter langen Röhren aus dem fruchtbaren Schlamm des Flusses gemacht worden seien und man sie immer in Nord-Süd-Richtung aufgestellt habe. Dass man die Röhren habe stapeln können, sei mit ein Grund ihres Erfolges gewesen, da man auf diese Weise viele Völker auf sehr kleinem Raum habe unterbringen können. Manchmal beherbergen die jeweils vier- bis fünfhundert aufgestapelten Röhren der »Tunnelstöcke« aus Nilschlamm, die sogenannten »Bienenmauern«, bis zu tausend Völker.
»Die Lamarckii-Biene ist, wie du selbst weißt, sehr klein«, dachte mein Vater, »etwa wie eine Fliege, und ihre Königin nicht größer als eine Arbeitsbiene der Apis mellifera carnica … doch ist sie von auffallender Schönheit. Ihre Hinterleibsringe sind rötlich, und die Spitze des Hinterleibes glänzt, ja leuchtet geradezu. Außerdem ist sie nicht stechlustig, und wenn sie schwärmt, dann so übermäßig, dass sie nicht drei, wie die Apis mellifera carnica, sondern bis zu 250 Brutzellen für Königinnen anlegt. Die Röhren der Tunnelstöcke wurden mit dem Schlamm des Flusses verschlossen und mit einem Flugloch versehen, indem man nach dem Verstopfen der Löcher einen Finger in den noch feuchten Schlamm steckte. Für die Honiggewinnung wurde das Ausräuchern angewendet, aber ohne die Bienen dabei zu töten. Der Rauch täuschte den Bienen einen Brand vor und veranlasste sie, sich in Sicherheit zu bringen, wodurch die Imker ungestört arbeiten konnten. Der fruchtbare Schlamm des Flusses habe die Lebensweise der Menschen erst ermöglicht. Dabei sei man von der alljährlichen Überschwemmung des Flusses abhängig gewesen. Diesen Fluss wirst du auf dem Weg zu deiner Metamorphose noch kennenlernen.«
Mir fiel wieder die Frage meines Vaters ein, die er mir bei meinem Geständnis, Selbstmord begangen zu haben, gestellt hatte: »Auch du?«
Kaum hatte ich den Gedanken zu Ende gedacht, stürzte ich wieder zurück in die Zeitlosigkeit, das Nichts.
Mord
Das Hotel war ein ehemaliges Schloss am Rand der Stadt. Einstmals war es auch ein Bordell gewesen, erfuhr ich von einem nackten, bärtigen Mann, der darin wohnte. Er lag in der riesigen, alten Küche auf einem der zahlreichen, langen Zubereitungstische, die an den Wänden unter Neonleuchten herumstanden.
»Was wollen Sie?«, fragte er mich ungehalten.
»Ich weiß es nicht«, antwortete ich.
»Und woher kommen Sie?«
»Wissen Sie auch nicht, wer Sie sind?«
»Nein, ich weiß nicht, wer ich bin.«
Tatsächlich war mir, als erwachte ich aus einem Traum.
»Sie sind von der Polizei?«, dachte er hörbar.
Da ich mich nicht auskannte, schwieg ich.
»Kennen Sie sich wirklich aus oder tun Sie nur so?«
»Beides«, dachte ich zur Antwort.
»Sie haben Gustav und Hubert gekannt?«
Ich schwieg weiter.
Langsam erhob er sich von der Tischplatte. Der Abend brach an, und es wurde dunkler. Die weißen Fliesen an der Wand und die roten auf dem Boden leuchteten im Dämmerlicht. Auch eine Neonröhre, die lose an einem Kabel von der Decke hing, erhellte den Saal, in dem das Mobiliar wahllos aufgestellt war. Berge von Bestecken, Tellern und Schalen, Gläsern und Schüsseln türmten sich in den Waschbecken. Ich erkannte auch mehrere große Messer auf den Zubereitungstischen.
Der nackte, bärtige Mann nahm eines davon in die Hand und erklärte mir, dass damit sechzehn Menschen getötet worden seien.
»Sie haben sich in den Mordbezirk verirrt«, lachte er hämisch.
Ich verspürte Angst und wollte mich davonmachen, aber er stellte sich mir in den Weg und drängte mich zu einem Waschbecken.
»Bevor nicht das Geschirr sauber ist, können Sie nicht das Haus verlassen.«
Er hielt mir Gummihandschuhe hin und eine Brause, die nur kaltes Wasser verströmte.
»Wasser ist kostbar!«, rief er. »Am besten, Sie schalten die Brause nicht ein.«
Als ich begann, das schmutzige Geschirr mit den verkrusteten, stinkenden Speiseresten zu bearbeiten, begann er laut zu denken: »Hubert E. und Gustav S. trafen am 27. April im Hotel ein.« Er öffnete die Tür eines Regals und legte Schwarz-Weiß-Fotografien auf den Tisch. Gustav S. war korpulent, hatte eine Halbglatze, ein aufgedunsenes Gesicht, Brille, war mittelgroß und ca. 50 Jahre alt. Hubert E., 48 Jahre alt, hatte kurzgeschnittenes, angegrautes Haar, war größer als Gustav und geradezu mager. Beide arbeiteten, wie der Nackte erklärte, bei der Wiener Polizei als Inspektoren beziehungsweise Revierinspektoren.
»Sie waren zum sechsten Mal im Hotel abgestiegen. Ich habe die Karten der Gästekartei.«
Der Nackte zeigte die Formulare, aber er war zu weit entfernt von mir, weshalb ich sie nicht entziffern konnte.
»Bei Gustav S. steht:«, erklärte er mir heftig denkend, »Isst auf seinem Zimmer, besuchte nicht unseren kleinen Park. Gibt kein Trinkgeld, vermeidet jedes Gespräch. Ist geradezu unsichtbar. Bei Hubert E: Trinker, sucht Bekanntschaften zu Frauen – auch unter den Hotelgästen. Verschwindet tagelang, bezahlt jedoch die volle gebuchte Zeit.«
»Eines Tages«, fuhr der Nackte fort, »fand ein Zimmermädchen eine tote deutsche Urlauberin in ihrem Hotelzimmer. Sie war, wie die Polizei später feststellte, erwürgt worden. Da beide Männer bereits zum dritten Mal im Hotel und noch dazu Polizeibeamte waren, fiel der Verdacht zuerst nicht auf sie. Als aber nach ihrem sechsten Urlaub eines unserer Serviermädchen erstochen in der Besenkammer des Stockwerks, in dem die beiden Österreicher ihr Zimmer hatten, gefunden wurde, ging die Polizei der Sache auf den Grund. Die Ermittlungen dauerten mehr als zwei Jahre. Die beiden hatten, stellte sich heraus, immer wieder Dienstfahrten in benachbarte Länder: Ungarn, Tschechoslowakei, Deutschland, aber auch nach Italien unternommen. In mühevoller Recherchearbeit gelang es, ihnen nachzuweisen, dass sie zumindest vierzehn Morde auf ihren Reisen begangen hatten. Dabei waren sie immer auf die gleiche Weise vorgegangen. Sie hatten sich einen Campingwagen gemietet und sich dann auf die Suche nach einem Hotel in der Nähe einer größeren Stadt gemacht. Dort waren sie zumindest eine Woche geblieben, hatten sich in der Stadt und der Umgebung umgesehen und dann, ziellos herumfahrend, zumindest anderthalb bis zwei Stunden vom Hotel entfernt auf eine günstige Situation gewartet. Kam diese nach einer Woche nicht, fuhren sie nach Wien zurück und versuchten es bei einem Kurzaufenthalt noch einmal und noch einmal, bis sie eine Gelegenheit fanden, ein Opfer zu betäuben und an einer abgelegenen Stelle zu töten. Die Ermordeten ließen sie entweder liegen, warfen sie nachts in einen Fluss oder versteckten sie unter Laub und Holz beziehungsweise begruben sie. Bei keinem der Morde gerieten sie in Verdacht. Die beiden in unserem Hotel getöteten Frauen waren tatsächlich von anderen Tätern ums Leben gebracht worden. Man hatte die beiden – und das ist das Absurde daran – nur überführt, weil sie als in diesen beiden Fällen Unschuldige verdächtigt worden waren, die Morde im Hotel begangen zu haben.«
Während er gedacht und damit erzählt hatte, hatte der Nackte, ohne sein Gesicht zu verziehen, geschwiegen. Schließlich war er aufgestanden und hatte mich streng, aber wie nebenbei aufgefordert, ihm zu folgen.
Ich zog daher die Gummihandschuhe aus und folgte ihm durch das verlassene und langsam verfallende Hotel. Viele Zimmertüren standen offen und gaben einen Blick auf das dahinterliegende Chaos preis. Mehrmals sah ich große Blutflecken an Wänden, auf Teppichen, Parkettböden oder der Bettwäsche. Es war unheimlich, da es rasch dunkler geworden war und nur aus den wenigen Räumen, die offen standen, elektrisches Licht auf den Korridor fiel. An einem der mutmaßlichen Tatorte hob der Nackte rasch eine Pistole auf und behielt sie in der Faust.
Ich verhielt mich so unauffällig wie möglich und versuchte weiter, seinen Gedanken zu lauschen, aber ich vermeinte stets nur 331 zu hören. Immer 331, 331. Daher nahm ich an, dass es sich um eine Zimmernummer handelte. Tatsächlich befanden wir uns im dritten Stock, wie ich aus einer englischen Wandinschrift schloss, und standen sogleich vor der Tür mit der Nummer 331.
Der Nackte entsicherte die Pistole, richtete sie auf mich und befahl mir einzutreten. Ich zweifelte nicht daran, dass er schießen würde, und hatte keine Ahnung, was daraus folgen konnte, daher drückte ich die Klinke nieder, öffnete die Tür und erkannte die beiden Polizisten von den Schwarz-Weiß-Fotografien, wie sie – nackt wie mein »Fremdenführer«, so nannte ich ihn – in einem öffentlichen, weiß gefliesten großen WC-Raum mit Urinalen und Einzelkabinen einem sterbenden Jugendlichen die Haut abzogen.
»Was macht ihr Idioten!«, schrie ich.
»Wir helfen ihm«, antwortete jener, der vermutlich Gustav war.
»Er ist ein Selbstmörder«, ergänzte der magere Hubert. »Es ist unsere Strafe, wir sind Mörder«, fügte er hinzu.
Dem Opfer waren die Qualen ins Gesicht geschrieben.
Dann nahm ich wahr, dass der »Fremdenführer« die Tür geschlossen und von außen versperrt hatte.
»Du bist der nächste«, sagte Hubert.
Daraufhin lief ich auf ein Milchglasfenster zu, sprang mit ausgestreckten Armen durch die Scheibe, die mit einem lauten Klirren zerbrach, und stürzte in den Hinterhof, der unter mir lag. Diesmal kam der mit Katzenkopfpflaster bedeckte Boden nicht wie der aufgeklappte Deckel einer Schachtel auf mich zu, sondern ich konnte nichts mehr rückgängig machen und fiel und fiel.
Die Bootsfahrt
Es war Nacht. Die Wüste strahlte gelb im Mondlicht, der Himmel jedoch hing tiefschwarz über dem Fluss. Ich stand am Ufer zwischen Palmen und fragte mich, weshalb ich hier bin.
Unerwartet tauchte ein Segelboot auf und legte an. Erst jetzt erkannte ich, dass die Menschen im Boot klein, aber deren Kinder von normaler Größe waren. Niemand verließ das Segelschiff, also sprang ich an Bord. Zwei Männer, drei Frauen und sechs Kinder nickten zur Begrüßung, als sei es das Selbstverständlichste auf der Welt, dass ich an Bord kam. Eine Frau und die beiden Männer verstanden ihr Segelhandwerk, als seien sie auf dem Wasser geboren, dachte ich.
»Das ist ein Irrtum«, korrigierte mich einer der beiden Männer, »der Himmel ist bei uns aus Wasser und der Fluss aus Luft. Wir fliegen also, um es in Ihren Begriffen auszudrücken, unter dem Damoklesschwert des Himmels. Er kann plötzlich zerreißen und das Wasser wie ein Wasserfall auf uns herabstürzen. Ein Gewitter verursacht auch bei uns Blitze, die jedoch durch das Wasser entweder gelöscht werden oder es elektrisieren können, so dass wir, wenn wir ungeschützt sind, tagelang leuchten. Wir sind keine Leuchtkäfer, wir nennen uns Pygmäenteufel und sind auf römischen Kunstfunden abgebildet. Sie kennen die Abbildungen nicht? Das macht nichts …«
»Ich habe von euch noch nie gehört«, gab ich meinen Gedanken preis.
»Wir sind ägyptische Pygmäen. Und zugleich menschliche Irrtümer. Man vermutete, dass wir am Weltrand lebten und gegen Kraniche kämpften. In Wirklichkeit gibt es uns hier nicht, wir sind in den Köpfen von Menschen entstanden und leben dort weiter. Daher seid ihr unsere Götter. Ihr schuft uns nach eurem Ebenbild.«
Ich staunte.
»Wo bin ich?«, fragte ich mich.
»Im Alten Ägypten«, rief eines der Kinder und alle übrigen Passagiere brachen in Gelächter aus.
»Das kann ich nicht glauben …«
»Dann gibt es uns nicht. Alles, woran man glaubt, gibt es, alles, woran man nicht glaubt, gibt es nicht.«
Wieder lachten alle.
»Und wenn du ans Nichts glaubst, gibt es dich auch nicht.«
Wieder folgte Gelächter und auch ich fing an zu lachen, bis ich mich verschluckte und hustete. Mein Husten nahm zu, Brechreiz kam auf, worauf die Pygmäen zu summen anfingen. Es klang, als läuteten Bienenschwärme eine Bienenglocke.
Unvermutet tauchten riesige Krokodile auf, von denen wir nur ihre Rücken sahen, doch die vielleicht anderthalb Meter großen, kupferfarbenen Menschen summten weiter, bis die Krokodile und schließlich ich selbst einschliefen.
Das Begräbnis
Ich erwachte im Pygmäendorf in einer Hütte aus Zweigen und Ästen, in die silberner Schnee fiel.
»Sternenblüten«, sagte eine kleine Frau mit großem Kopf.
Wahrscheinlich handelte es sich um den Samen einer Pflanze, ging es mir durch den Kopf.
»Das ist Schnee vom Himmel«, widersprach die Frau. »In der Nacht sehen wir auf dem Himmelsmeer leuchtende Seerosen schwimmen, deren Blätter, wenn sich etwas zusammenbraut, zu uns herunterschneien.«
Plötzlich hörte ich wieder das laute Summen einer »Bienenglocke«. Ich stand auf und trat vor das Zelt.
Eine Pygmäenfrau wurde in einen aus bemaltem Holz gefertigten Sarg gelegt, der ein Krokodil mit offenem Maul und riesigen Zähnen darstellte. Die wenigen Einwohner des Dorfes scharten sich summend um den Sarg, einige weinten. Ich wollte wissen, weshalb die Frau verstorben war.
Die Frau aus der Hütte, deren großer Kopf nichts Außergewöhnliches hier war, stand jetzt hinter mir.
»Sie war schon alt«, sagte sie.
»Alt?«
»Wir leben höchstens 25 Jahre, viele nur sechzehn oder siebzehn Jahre. Deshalb gibt es die vielen elternlosen Kinder.«
Es regnete dichte Sternenblüten, die im düsteren Licht aufblinkten. Frauen und Männer hoben den Krokodilsarg auf und schritten über den bereits silberfarbenen Boden und durch den vom Himmel fallenden seltsamen Schnee aus Blütenblättern von Seerosen hinunter zum Fluss aus Luft, der infolge des Niederschlags mit einer silberfarbenen Eisschicht bedeckt war.
Auch die auftauchenden Krokodile waren mit silberfarbenem Konfetti übersät, als feierten sie ein Fest.
Alle warfen sich auf den Boden und schlossen die Augen, ebenso die Frau hinter mir, worauf auch ich mich hinlegte, aber den Krokodilsarg im Auge behielt.
Minuten, Stunden, Tage vergingen. Es wurde hell und dunkel und wieder hell und dunkel, bevor sich alle wieder erhoben und den Sarg ans Ufer trugen, von wo aus sie ihn durch das geöffnete Krokodilmaul in den Fluss entleerten, worauf die Krokodile sich auf den Leichnam stürzten. Erst jetzt erschienen mehrere Musiker mit Trommeln und Rinderhörnern, und die Trauernden fingen wieder mit den Summlauten an, die mich so müde machten, dass mir die Augen zufielen.
Die vergessene Bibliothek
»Die historische Bibliothek von Alexandria war mein Zuhause. Ich bin ein zweitausend Jahre altes Papierfischchen, leicht zu verwechseln mit Silberfischchen, nur dass ich auffällig längere Tentakel besitze. Ich bin dreizehn Millimeter groß und meide das Licht. Ja, ich liebe die Dunkelheit. Tagsüber schlafe ich. Ich kann bis zu dreihundert Tage – also fast ein Jahr – ohne Nahrung überleben. Meine Hauptspeise ist, wie mein Name bereits sagt, Papier, aber auch Kartonage gehört zu meinen bevorzugten Lebensmitteln. Unter uns Papierfischchen werde ich »Mythologe« genannt und bin weltbekannt. Wir sind Einzelgänger, und es sind Geruchshormone, die uns zu den für die Fortpflanzung bereiten Geschlechtspartnern führen. Meine Verwandtschaft geht übrigens in die Hunderttausende. Unter meiner Anleitung haben wir die wissenschaftliche Sammlung aus Schriftrollen zur Mathematik, Philosophie und Medizin vertilgt, Buchstabe für Buchstabe. Wir selbst nennen diese Methode »verkotet«. Angezogen haben uns zunächst die Formen der griechischen Buchstaben. Unsere sogenannten »Trüffelspeisen« waren damals religiöse Schriften, abgefasst in Arabisch und Hebräisch, die aus dem Reich der Ägypter, Perser und Inder stammten. Insgesamt verfügte die Bibliothek von Alexandria über 641375 Schriftrollen, die im Laufe von Generationen gewissenhaft mittels Kotpünktchen gezählt wurden. Doch unermüdliche Bibliothekare hatten von den verzehrten Exemplaren bereits Kopien erstellt, bevor wir sie noch verkotet hatten. Daher artete unser Erdenleben bald zu einer einzigen Sisyphosarbeit aus.«
Ich öffnete die Augen und fragte, wo ich bin.
»Im Paradies der Papierfischchen«, gab das Insekt mit Namen »Mythologe« zur Antwort. »Schau!«, rief es.
Und ich erblickte vor mir einen Müllabladeplatz unter freiem Himmel. Auf Bergen aus zusammengequetschten Kotpunkten von Papierfischchen sah ich Fragmente und halbzerstörte Papierrollen sowie nicht wenige Reste von Büchern.
»Bis zu Gutenberg hatten wir vorwiegend Papyrusrollen als Nahrung, später jedoch immer mehr Papierseiten, vor allem von Büchern und Zeitungen.«
Ich antwortete ungehalten: »Ja und?«
Daraufhin bewegte »Mythologe« heftig die Tentakel und belehrte mich: »Ihr habt in euren Köpfen die unsichtbaren Erinnerungsfischchen, die in einem fort euer Gedächtnis verkoten, sofern ihr es nicht selbst durch Lügen auf den Müllplatz entsorgt. Ihr nennt den Vorgang ›Vergessen‹, aber darin ist das Wort ›essen‹ enthalten … ihr verspeist also selbst eure Gedanken und Erlebnisse. Doch vergesst ihr nicht nur mit Absicht, sondern eure Natur erledigt das für euch zumeist mit der Zunahme eures Alters. So wird alles, was ihr getan und geschaffen habt, mit der Zeit verschwinden. Und mit euch die Zeit, das Paradies und die Hölle und ganz zuletzt auch wir und das Vergessen.«
Der Friedhof der Sandkörner
Erstaunt stand ich vor dem Friedhof der Sandkörner. In Wien gibt es einen »Friedhof der Namenlosen«, den ich einmal besucht habe. Doch dieser Friedhof lag mitten in der Wüste und war ohne Grabsteine oder sonst einen Aufmerksamkeit erregenden Hinweis. Während ich an das Schicksal der einzelnen Sandkörner zu denken versuchte, verfinsterte sich plötzlich der Himmel, und es begann Hagelkörner zu regnen. Ich bückte mich, um eines von ihnen in die Hand zu nehmen, doch ich schreckte vor Entsetzen zurück. Die eisigen Körner waren Menschenaugen.
Ich trug einen Tropenhelm und ein Schießgewehr und schaute zu, wie die Augen auf den Sand klatschten und mich verzweifelt anstarrten. Je länger ich dort stand, desto mehr Menschen kamen im Augenhagel herbei, zu Fuß oder auf Kamelen und Elefanten reitend oder in Militärfahrzeugen und Bussen, einige sogar mit Hubschraubern, und stiegen mit Regenschirmen aus den Fahrzeugen oder Sätteln oder hatten die Schirme als Gehstöcke verwendet. Nur ich besaß keinen, dafür aber meinen Tropenhelm. Bald waren wir Hunderte, Tausende, Abertausende, die mit aufgespannten Regenschirmen dem Klopfen der herabprasselnden Augen standhielten. Ich erfuhr, dass wir alle gekommen waren, um das Weinen zu lernen. Zuletzt landete ein weißer Luftballon. Geier hatten sich auf dem Wüstensand in großer Zahl niedergelassen. Sie hatten den Ballon begleitet und pickten nun gierig Augen auf. Auch als eine weißgekleidete Frau – eine Japanerin – aus dem Ballonkorb gehoben wurde, hörten sie nicht zu fressen auf, sondern begannen mit den Flügeln zu flattern, kurz aufzufliegen und Schreie auszustoßen. Immer mehr Stimmen fielen in einen Gedankenchor ein, denn wir alle dachten dasselbe. Der Gedanke bestand nur aus dem einen Wort: »Warum?«
Jeder von uns hatte mit unbeantworteten Fragen gelebt, so dass er eine Antwort hören wollte, doch als Erstes machte uns die weiße Frau klar, dass wir alle Angehörige und Freunde durch Selbstmord verloren oder selbst unserem Leben ein Ende gesetzt hatten. Sofort fühlte ich mich herausgefordert. Ich hatte weder die Absicht zu weinen noch mich davonzustehlen. Ich wollte mich auch nicht verteidigen, sondern anklagen: Warum hatte ich die ganze Zeit seit meiner Jugend in einer Irrenanstalt, wenn auch in einem privilegierten »Haus der Künstler« verbringen müssen? Warum war ich so erschaffen worden, wie ich gewesen war? – Unerwartet trat absolute Stille ein. Niemand gab einen Laut von sich, nicht einmal die Geier, die jetzt aufgehört hatten, Augen zu fressen, auch fielen wie auf einen Schlag keine mehr vom Himmel.
»Die Antwort!«, schrie die Frau, worauf ein ungeheurer Sandsturm losbrach, so heftig, dass niemand mehr Gelegenheit fand zu fliehen. Wir warfen uns auf den Boden, der vollständig mit lebendig gewordenen Augen bedeckt war.
»Wer bist du?«, fragten nicht wenige Wartende und Weinende die Augen. So auch ich.
»Deine Mutter«, hörte ich es trotz des Fauchens und Heulens, das uns im Sandsturm umgab, rufen. Vor Schreck verlor ich meine Sprache.
»Ich habe giftige Schwämme verzehrt«, rief sie weiter und begann zu weinen.
»Warum?«, fragte ich hilflos.
»Dein Vater hatte mich verlassen, weil er eine andere Frau liebte«, ertönte ihre verzweifelte Stimme.
Nun fing auch ich zu weinen an, doch das Geheul des Sandsturmes und der Menschen vermischte sich zu einem Chorgesang, der so mächtig wurde, dass wir uns in die Luft erhoben wie die Geier, die jetzt neben uns herflogen. Vor uns der weiße Ballon war, erkannte ich, selbst ein riesiger Augapfel.
Die weißgekleidete Japanerin hatte, stellte ich zu meinem Erstaunen fest, ihr Gesicht im Sandsturm verloren. Einer der Geier brachte ihr allerdings eine Maske, auf der eine Karikatur ihres Antlitzes abgebildet war.
Und im selben Augenblick trugen auch wir ähnliche Masken und begannen zu lachen. Langsam verwandelte sich das Sandgestöber aus Augen und kreischenden Menschen unter dem Wasser des Himmels in einen Zeichentrickfilm.
Über einer windstillen Oase erhielt ich einen kräftigen Stoß und fiel vom Himmel. Noch im Stürzen sah ich den weißen Ballon und die riesige Sandsturmwolke mit Tausenden von Menschen am Himmel, wie sie mit Schreien und Lachen und dem Heulen des Sturmes hinter den Dünen verschwand und kurz darauf endgültig verstummte.
Zweites BuchDie Wüstenstadt
Die Farm der Tiere und Elias Schneider
Die Wüstenstadt –
Gleichnisse und Zauber
Als ob ein Tauber
Den Fischen lauscht
So verstehen wir
In unserem Leben
Die Rätsel
Die uns umgeben
las ich in arabischer Schrift auf der Wand einer Moschee. Ich hatte das Gedicht nach meiner ersten Liebesnacht mit Malia verfasst – nur hatte ich anstelle von »Die Wüstenstadt« damals »Das Bienendorf« geschrieben – und wunderte mich darüber, dass ich es jetzt in einer Moschee wiederfand und die arabische Schrift lesen konnte. Allmählich begriff ich, dass ich in der Totenstadt war, wo alle alle Sprachen verstanden. Es gab Schilder in den verschiedensten Alphabeten, es gab Tempel, Synagogen, Moscheen und Kirchen – und jeder unterhielt sich mit jedem, auch die Einwohner mit den Tieren und die Tiere mit den Einwohnern.
Ich wollte Malia und Kira finden und irrte seit Tagen und Nächten durch die von Menschenmassen bevölkerten Gassen und Gebäude, durch Kinos und Museen, immer auf einer Suche, die keinen Sinn ergab. Denn wie konnte ich in einer Millionen-, einer Milliardenstadt ohne jeglichen Hinweis einen bestimmten Menschen ausfindig machen?
Ich stieß überall auf ein »Nein«, wo auch immer ich mich befand und wen immer ich auch befragte, denn alle Einwohner, begriff ich langsam, waren ebenso auf der Suche wie ich. Fast jeder verstand meinen Zustand, doch niemand hatte Zeit, und ich reagierte nicht anders. Auffallend war, dass die Bewohner nach den Moden gekleidet waren, die zum Zeitpunkt ihres Todes geherrscht hatten. In den Straßen sah es aus wie in Venedig zur Zeit des Karnevals, nur noch krasser. Es dauerte einige Zeit, bis ich mich daran gewöhnte.
Am Ufer des großen Flusses, das von einer Palmenallee gesäumt war, stieß ich auf das gewaltige Stadttheater, das ich, getrieben von Unruhe, betrat.
»Farm der Tiere von George Orwell« war auf Plakaten vor und im Schauspielhaus zu lesen. Ich hatte diese Fabel noch nie auf der Bühne gesehen, nur einen Zeichentrickfilm, der großen Eindruck auf mich gemacht hatte. Während ich diesen Gedanken nachhing, bemerkte ich plötzlich, dass sich meine Wahrnehmung verändert, ja, ausgedehnt hatte. Nicht das Gehirn spielte mir etwas vor – ich hatte ja keines mehr – sondern ich sah, hörte, verstand besser, was ich früher nicht begriffen hatte. Das mag seltsam klingen, aber mir war es nachträglich, als hätte ich schon in meinem Erdenleben das Jenseits in verschiedenen Situationen erfahren. Ja, ich war verrückt im Sinne verrückter Möbel und verlegter Dinge in einem Zimmer gewesen. Ich hatte mich in der neuen Aufstellung und Ordnung, die zur Unordnung geworden war, oft nicht mehr zurechtgefunden. Doch war es nicht bloß Vergesslichkeit gewesen, sondern etwas anderes, Neues, Unerklärliches. Es war real gewesen und ging über das hinaus, was man Wirklichkeit nennt …
Der Zeichentrickfilm »Farm der Tiere«, der mir zu Lebzeiten auf einer DVD vorgespielt worden war, war für mich viel mehr als nur eine Satire über den Kommunismus gewesen, sondern er betraf alle Ideologien. Es waren die Röntgenaufnahmen chronisch-ideologischer Gehirne gewesen, ein Lehrfilm wie in der Wüstenhölle einer langsam verdurstenden Karawane, vor der die Fata Morgana eines Paradieses auftaucht, die sich, je näher die Karawane ihr kommt, in Nichts auflöst. Dann erst begreifen die Menschen, dass die Oase, die sie zu sehen vermeinten, nur Fiktion ist. Sie springen von ihren Kamelen und fallen übereinander her, um gegenseitig ihr Blut zu trinken.
Es störte mich nicht, allein im Kino zu sitzen, ja es erschien mir im Gegenteil als Luxus, eine Oase der Stille erreicht zu haben und meinen Durst nach Ruhe stillen zu können.
Der Vorhang des Theaters öffnete sich, und die in George Orwells Buch beschriebenen Tiere waren auf der Bühne wirkliche Tiere: Schweine, Pferde, Hunde, Ziegen, Kühe, Katzen – und die wenigen Menschen, die vorkommen, waren Vogelscheuchen, deren Gestalt aus wehenden Kleidern bestand, denn sie waren alle Schreckgespenster.
Auf einem Bauernhof in England vor dem Zweiten Weltkrieg beginnen die Tiere unter der Führung der Schweine einen Aufstand gegen den brutalen Farmer und seine Knechte, wusste ich. Man stellte sieben Gebote auf, dessen letztes »Alle Tiere sind gleich« heißt. Die Schweine als die intelligentesten und skrupellosesten Tiere setzen sich im Lauf von zwei Jahren durch, überschreiten und interpretieren schließlich alle sieben Gebote um und setzen sie jedes Mal außer Kraft. Auf diese Weise verwandelt sich die anfangs erlösende Demokratie in eine niederträchtige Diktatur. So wird aus dem Paradies der Freiheit ein Machtrausch der Schweine. Zum Schluss pflegen sie sogar Kontakt zu den bösen Menschen, den Tierfressern – sie werden zu Partnern, spielen miteinander Karten, aber geraten in Streit, und die Tiere der Farm werden Augenzeugen der Auseinandersetzung: »Nun stand es außer Frage, was mit den Gesichtern der Schweine passiert war. Die Tiere draußen« – vor den Fenstern – »schauten von Schwein zu Mensch und von Mensch zu Schwein und wieder von Schwein zu Mensch; aber es war bereits unmöglich zu sagen, wer wer war«, beendet George Orwell seine Novelle.
Während das Spiel begann und gerade das alte, treue Pferd »Boxer« auftrat, kam ein zweiter Zuschauer in den Saal, und die anfängliche Störung wurde später zum Glücksfall. Es war Elias Schneider, ein Journalist, der einmal bei uns in Obergreith für seine Verwandten und Freunde eine größere Menge Honig gekauft hatte, worauf wir ihm einige Gläser geschenkt hatten. Daran erinnerte er sich noch immer und sprach mich nach der Theateraufführung darauf an. Während des Stücks aber saß er ruhig neben mir, lachte nicht, wenn ich lachte, und seufzte nicht, wenn ich seufzte. Er hatte es schon öfter als einmal gesehen. Erst im Freien trat er auf mich zu, stellte sich vor und erzählte mir die Geschichte unserer ersten Begegnung, an die ich mich nicht erinnern konnte. Nach seiner Pensionierung bei einem Fernsehsender, für den er gearbeitet hatte, war er durch einen Autounfall ums Leben gekommen. Er sei beauftragt worden, fuhr er fort, mein künftiger Begleiter zu sein, denn ich sei kein Bewohner des Jenseits, sondern ein Gast und könne zuletzt selbst entscheiden, wo ich bleiben wolle. Wir würden eine Schiffsreise durch das biblische Land Ägypten machen, wie vor zweitausend Jahren, und dann nachdenken, wie es weitergehen solle. Ich fragte ihn auch, weshalb man mir freie Hand ließe, und er antwortete, weil ich in meinem früheren Leben entmündigt worden sei.
Doch ich verlangte mehr: Ich wollte mit Malia und Kira reisen.
Elias nickte. »Es wird dauern!«, fügte er hinzu. Die Schiffsroute sei »überbelegt«.
Heilige Gebäude
Ein paar Schritte weiter stand eine katholische Kirche, aus der in einem fort Buben in Sonntagsanzügen und weißgekleidete Mädchen mit Haarkränzen strömten, immer paarweise und mit ernsten Gesichtern. Ich blieb stehen und sah zu, aber es wollte und wollte nicht enden. Das Kirchenschiff musste wohl riesig sein, aber dafür war der Bau zu klein. Wir setzten uns unter einer Palme auf eine Bank, doch die Zahl der Kinder nahm nicht ab. Sie liefen, entdeckte ich, weiter oben hinunter zum Fluss und stiegen dort über Fallreeps in die wartenden Schiffe, mit denen sie eine Rundfahrt oder Reise begannen. Ich konnte nicht aufhören zu schauen, erst als die Hitze zu groß wurde, brachen wir auf. Es blieb ein Tag der Kinder …