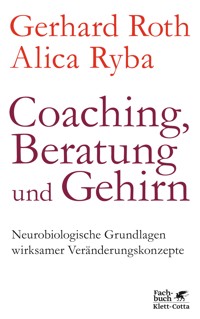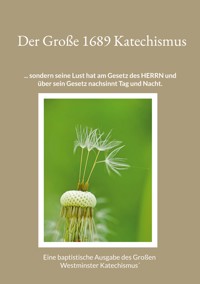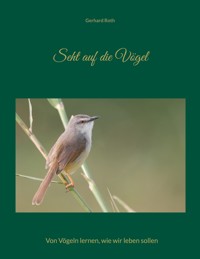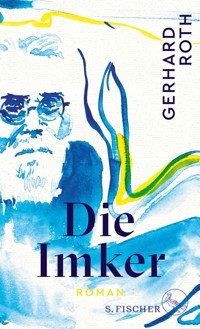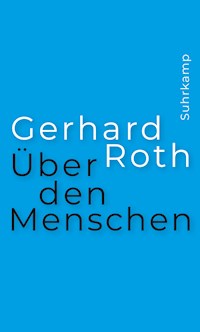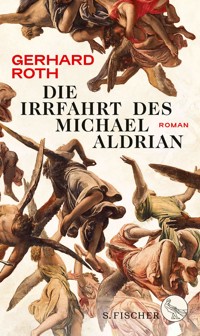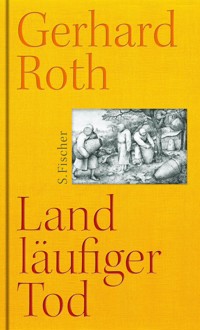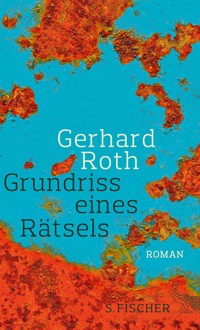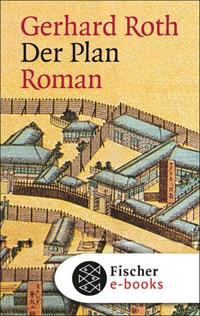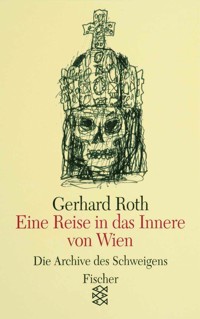
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jahrelang durchforschte Gerhard Roth die lichtabgewandten Bezirke Wiens. Auf seinen Streifzügen durch die österreichische Hauptstadt ließ er sich nicht vom Glanz der ehemaligen k. u. k. Residenzstadt blenden. Er blickte tiefer und fand ihren realen und seelischen Untergrund. Roth berichtet vom ehemaligen »Hetztheater«, in dem im 18. Jahrhundert Tierkämpfe stattfanden, von Katakomben, Grüften und unterirdischen Depots in der Inneren Stadt, von den Geheimnissen des Stephansdoms. Er besucht die geistesverwirrten Künstler in der psychiatrischen Anstalt Gugging, den »Narrenturm« und das Heeresgeschichtliche Museum, berichtet vom ehemaligen Judenviertel in der Leopoldstadt und dem Männerwohnheim in der Meldemannstraße, in dem Hitler fast vier Jahre zugebracht hat. Und unversehens wird dieser Band zu einem faszinierenden Reiseführer durch die Abgründe der österreichischen Seele.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 313
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Gerhard Roth
Eine Reise in das Innere von Wien
Essays
Über dieses Buch
Jahrelang durchforschte Gerhard Roth die lichtabgewandten Bezirke Wiens. Auf seinen Streifzügen durch die österreichische Hauptstadt ließ er sich nicht vom Glanz der ehemaligen k.u.k. Residenzstadt blenden. Er blickte tiefer und fand ihren realen und seelischen Untergrund.
Roth berichtet vom ehemaligen »Hetztheater«, in dem im 18. Jahrhundert Tierkämpfe stattfanden, von Katakomben, Grüften und unterirdischen Depots in der Inneren Stadt, von den Geheimnissen des Stephansdoms. Er besucht die geistesverwirrten Künstler in der psychiatrischen Anstalt Gugging, den »Narrenturm« und das Heeresgeschichtliche Museum, berichtet vom ehemaligen Judenviertel in der Leopoldstadt und dem Männerwohnheim in der Meldemannstraße, in dem Hitler fast vier Jahre zugebracht hat.
Und unversehens wird dieser Band zu einem faszinierenden Reiseführer durch die Abgründe der österreichischen Seele.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books 2016
© 1991 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Buchholz/Hinsch/Hensinger
Coverabbildung: Peter Pongratz
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490348-4
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Motto]
Das k.k. privilegierte Hetztheater
Die zweite Stadt
Das Haus der schlafenden Vernunft
Leopoldstädter Requiem
Das Graue Haus
Die »Hitlervilla«
Der Narrenturm
Der Stephansdom
Im Heeresgeschichtlichen Museum
Abbildungsnachweis
Drucknachweis
[Bildteil]
»Die Menschen sind überhaupt eigener Natur; sobald ein See zugefroren ist, sind sie gleich zu Hunderten darauf und amüsieren sich auf der glatten Oberfläche: aber wem fällt es ein, zu untersuchen, wie tief er ist und welche Arten von Fischen unter dem Eis hin- und herschwimmen?«
Eckermann: Gespräche mit Goethe
Das k.k. privilegierte Hetztheater
Das runde Gebäude war aus Holz, drei Stockwerke hoch und hatte einen gemauerten Haupteingang. Es bot dreitausend Zuschauern Platz. Im Inneren befanden sich eine kreisförmige Arena und ein Wasserbassin mit einem Durchmesser von 42, beziehungsweise 4,5 Metern. In der Mitte der Arena war ein 13 Meter hoher »Steigbaum« aufgestellt, den die sogenannten »Hetzknechte«, die das Spektakel in Gang hielten, bei Gefahr erkletterten. Auf einem Stich aus dem Jahr 1790 ähnelt das Gebäude einem abgeschnittenen Turm oder einem breiten, niederen Schornstein. Der Zeichner hat die Perspektive aufgeklappt, um Einsicht in die Arena zu geben. Bei aller Genauigkeit hat er dadurch eine kindliche Note in das Bild gebracht, so als habe man nicht ein Hetztheater, sondern ein inzwischen in Vergessenheit geratenes Kinderspielzeug vor sich. Die Zuschauergalerien sind in Logen unterteilt und das Publikum ist nur als gesichtslose Masse erkennbar.
Auf der Spitze des Steigbaumes weht eine Fahne. Natürlich ist die Vorstellung von einer Stierkampfarena naheliegend. Die Tiere, die die Arena »bevölkern«, sind unverhältnismäßig groß gezeichnet. Es ist vom ersten Blick an klar, daß der Künstler die Aufmerksamkeit auf sie lenken will. Die Aufsichtsperspektive ist über das Theater geschoben, wie ein geschliffener Briefbeschwerer, der zugleich eine Lupe ist. Insgesamt sind vier Hetzknechte und mehr als zwanzig Tiere zu sehen: Hunde, Bären, ein Löwe, ein Tiger oder Panther, Wildschweine, Auerochsen. An einem Flaschenzug hängt ein Bär. Ein anderer wird im Bassin von Hunden angefallen.
Der Ausschnitt der Umgebung um das Hetztheater ist im Vergleich zu anderen Einzelheiten im Bild mit größerer Genauigkeit festgehalten. Vor dem Gebäude befindet sich ein Holzzaun. Menschen spazieren auf den Eingang zu, zwei Pferdekutschen traben heran. Links vom Gebäude, auf einem kleineren, freien Platz Hundehütten, Hunde und zwei Hetzknechte mit Peitschen, die die Tiere aus dem Zwinger treiben.
Drei Knechte reiten auf großen Hunden durch eines der Tore in die Arena.
Der Eingang, von zwei Soldaten bewacht, hat ein Satteldach, darunter, auf einem Balkon tummelt sich Publikum. Im Theater spielt eine Musikkapelle, »sehr laut, vornehmlich türkische Musik«, wie es heißt. Rechts vom Eingang das Haus des Verwalters, der für die Haltung der Tiere sorgt. Dahinter Bäume. Wie die meisten Fußballstadien heutzutage liegt das Hetztheater auch eher an der (damaligen) Peripherie der Stadt. Zu Beginn des achtzehnten Jahrhunderts gab es in Graz, Preßburg und Regensburg ähnliche Unternehmen. Das Hetzamphitheater auf der Landstraße war das dritte und größte seiner Art in Wien. Das erste befand sich in der Leopoldstadt ab dem Jahr 1708. Es wurde später in den Gasthof »Zum schwarzen Adler« verlegt. 1736 entstand ein größeres am Heumarkt, das aber 1743 wieder aufgelassen wurde. Das letzte und größte, von dem hier die Rede ist, wurde 1755 von einem Franzosen, dem »kays. königl. Theatral Dantzer« Carl Defraine zwischen den heutigen Gebäuden Hintere Zollamtsstraße 13 und Hetzgasse 2 im dritten Wiener Gemeindebezirk errichtet.
Der Name der Gasse erinnert an das Unternehmen, das hier bis 1796 stand. Auch eine Redewendung, die sich in Österreich längst verselbständigt hat und von Alten wie Jungen gebraucht wird, um auszudrücken, daß etwas besonders heiter und anregend gewesen ist, ist darauf zurückzuführen: »Das war eine Hetz«. Das Hetztheater erfreute sich großen Zulaufes, obwohl die Eintrittspreise hoch waren.
Die Vorstellungen fanden vom März bis November statt, begannen am frühen Nachmittag und dauerten zumeist bis zum Einbruch der Dunkelheit. Zwanzig Tierfallen waren im Amphitheater untergebracht, zu denen sechs Aus- und Eingänge in die Arena führten. Auf die Veranstaltung wurde jeweils am Vortag durch einen Umzug aufmerksam gemacht. An der Spitze marschierten zwei Trommler, dahinter folgten auf einem geschmückten Schimmel der »Hetzmeister« und sechs in gelbes Leder gekleidete Männer, die Ankündigungszettel verteilten.
»Gewöhnlich fing man die Vorführung mit Stieren an;«, schreibt Helmut Kretschmer in seinem Buch über den Wiener Bezirk »Landstraße«, »zwei in rote Gewänder gehüllte Strohpuppen waren dazu da, die Aufmerksamkeit des freigelassenen Stieres zu erregen. Daraufhin wurden wilde Hunde in die Arena gelassen, die den wütenden Stier attackieren sollten. Diese Tiere, die Hauptrolle spielten oft auch Bären – wurden nicht nur von Hetzhunden, sondern auch von Menschen gejagt. Sehr häufig gab dies unter dem Publikum Anlaß zu Wettabschlüssen auf den mutmaßlichen Sieger«.
In einem Bericht eines Wienbesuchers aus dieser Zeit wird die Armseligkeit der Veranstaltungen deutlich: »Ich war ganz Aug, das erste streitbegierige Tier zu sehen und was war es? – Ein dürrer, ausgemergelter ungarischer Ochs. Diesem hatte man auf den Rücken einen Strohmann gebunden, und in der Mitte des Hetzplatzes einen ähnlichen entgegengestellt. Es wurden einige Granaten auf ihn geworfen, ihn zu erbittern; man ließ die Hunde los, die ihm aber nichts abgewinnen konnten, bis er endlich auf das kleine Strohmännchen zulief und dem armen Dinge seine Hörner durch den Bauch stieß, sich aber so verwickelte, daß er das Männchen nicht in die Höhe, noch sich losreißen konnte, weil es mit Blei von unten gefüllt war. Die Hunde zerrissen dem Ochsen ganz jämmerlich die Ohren; das arme Tier brüllte vor Schmerzen gegen eine Viertelstunde, bis endlich die Hetzknechte ihm ein Seil um die Hörner warfen, ihn losmachten und zurückführten.
Hierauf kam ein Tanzbär, der sogleich zwei Hunde zusammendrückte und wieder in seinen Kotter schloff. Nach diesem ward ein Wolf ausgelassen, der sich mit drei Hunden herumbiß und nichts weiter tat.
Aber jetzt sollte ein grimmiger Kampf beginnen. Drei Wölfe, drei Waldbären (von denen zwei mit Zangen aus der Falle gezogen wurden), ein Wildschwein, ein Auerochs und ein Esel kamen zum Vorschein – und was geschah? Memorabile dictu! Sie standen da, sahen sich an und wunderten sich über das seltsame Glück, einander in Gesellschaft zu sehen. Der Esel lief umher und schrie I-a I-a I-a I-a. Die Wölfe hüpften in die Höhe, zwei Bären verscharrten sich und ein dritter stieg auf den Fallbaum oder die Steigleiter, und darüber entstand ein so allgemeines Gelächter, daß ich mich über das allgemeine Lachen ärgerte.«
Aus dem Bericht geht hervor, daß man die Tiere zuerst reizen, ihnen einen Schmerz zufügen oder sie hungrig machen mußte, um den gewünschten Effekt zu erreichen. Übrigens gab es neben den Tierhetzen auch Darbietungen von Zirkusartisten. 1776 trat der englische Reitkünstler Simson auf, der auf einem galoppierenden Pferd einen Kopfstand vorführte, auf dem Pferde stehend drei Fuß hoch in die Höhe sprang und vom Sattel aus einen hundert Pfund schweren Gegenstand aufhob.
1768 starb der Besitzer des Hetztheaters und das Etablissement wurde als drittes neben dem Hofburgtheater und dem Theater nächst dem Kärtnertore unter die Verwaltung der »k.k. Obersten Theatral-Direktion« gestellt, und von diesen verpachtet. Die beträchtlichen Einnahmen kamen angeblich der Armenkasse zugute. Am 1. September 1796 brannte das Hetztheater über Nacht ab.
Die Wiener Zeitung vom 3. September 1796 berichtete ausführlich: »Des Abends, nach 8 Uhr, brach in dem Hetz-Amphitheater, unter den Weißgärbern, im Heustadl, ein heftiges Feuer aus, das in diesem ganz von Holz erbauten Gebäude schnell um sich griff und es in Zeit von wenigen Stunden bis auf den Grund abbrannte. Bei der gänzlichen Windstille und den eilig herbygekommenen sehr zweckmäßigen und wirksamen Anstalten war man so glücklich, alle nebenstehenden Häuser, Gärten, Magazine und Holzvorräte vollkommen zu retten, und ist dabey kein Mensch zu Schaden gekommen. Aber in dem Hetzgebäude ist alles von der heftigen Flamme verzehrt worden; bloß einige Hunde und der Auerstier wurden gerettet und in Sicherheit gebracht. Alle übrigen zahlreichen und kostbaren Thiere, zwei Löwen, ein Panther, mehrere Bären, Wildschweine, Ochsen, etc. kamen, unter entsetzlichem Gebrülle, in den Flammen um. Nach 12 Uhr waren diese gelöscht und nach und nach ward auch das Kohlfeuer gedämpft.« Ein anderer Bericht ergänzt: »Der Fuchs rettete sich selbst, indem er unwissend wie, aus seinem Behältnisse entkam, sich mitten auf dem Hetzplatze in die Erde vergrub, und auf solche Art sich den Flammen entzog … Am folgenden Tage sah der Fuchs ganz possierlich aus seiner Höhle heraus und rekognoszierte die Gegend, ob noch Gefahr vorhanden sey, worauf er dann gefangen wurde.«
Der Wert der umgekommenen Tiere wurde auf 24000 Gulden geschätzt.
Ein kolorierter Stich von H. Löschenkohl aus dem Jahr 1796 hält den Brand fest. Es ist ein schwarzes Bild, ein Nachtbild. Die Menschenmenge wird vom brennenden Hetztheater durch zum Teil berittenes Militär mit gezücktem Säbel, zum Teil durch Soldaten mit aufgepflanztem Bajonett ferngehalten. Das Theater selbst stürzt gerade inmitten hoher, orangeroter Flammen ein, nur ein Teil ragt noch als Ruine hervor. Der Steigbaum mit dem Flaschenzug steht wie ein Galgen im Feuer. Rechts vorne das Schattenbild eines Hundes und des geretteten Auerochsen.
Gibt es ein theatralischeres Ende als ein Feuer?
Kaiser Franz II. erteilte keine Bewilligung mehr zur Abhaltung von Tierhetzen. Das »Theater« wurde auch nicht mehr errichtet.
In der Hetzgasse Nr. 4, unmittelbar dort, wo das Amphitheater stand, brannte um die Jahrhundertwende dann ein Feuer, das seinen hellen Schein auf die allgemeine, österreichische Hetz warf. Es war die Redaktion der satirischen Zeitschrift »Die Fackel« von Karl Kraus.
Die zweite Stadt
Als der Wiener Archäologe Pohanka unter der Minoritenkirche das Skelett eines Mannes ausgrub, das auf dem Bauch lag, die Füße über Kreuz, einen Arm vor der Brust, den anderen hinter dem Rücken, stand er vor einem Rätsel. Er ließ einen Sarg kommen und legte sich in derselben Stellung hinein, in der er das Skelett gefunden hatte. Das Ergebnis seines Experiments – der Mann war lebendig begraben worden und hatte versucht, mit dem Rücken den Sargdeckel aufzustemmen – bezeichnete Pohanka als »einen Alptraum, der unbeabsichtigt die österreichische Zerrissenheit« illustriere: außen der scheinbar geordnete Alltag, innen Verzweiflung und Ängste. Der Gedanke ist naheliegend, daß Sigmund Freud seine Entdeckungen zwangsläufig in Wien machen mußte, wo die Erkenntnisse zwar nicht auf der Hand, jedoch auf einer unterirdischen, nur scheinbar »verschwundenen« Ebene lagen. Freud durchforschte diese Ebenen mit ihren Verbindungsgängen und Sackgassen, und es ist nur logisch, daß er sich dabei auch manchmal verirrte.
»Die Verbindungsgänge«, erklärte der Archäologe, ein lebhafter Mensch mit Hornbrille, seien aber nur eine Wiener Legende, die sich hartnäckig halte. Die legendärste dieser Legenden sei der unterirdische Gang zwischen der Hofburg im ersten Bezirk und dem Schloß Schönbrunn im dreizehnten. Von der Hofburg existieren allerdings Verbindungsgänge zu einem »Regierungsbunker« in der Stiftskaserne, zur Oper, zum Burgtheater und dem Messepalast und – so wird vermutet – sogar zur Kapuzinergruft. Auch soll es einen Gang zwischen dem Naturhistorischen und dem Kunsthistorischen Museum geben. Darüber hinaus ist die Ansicht weit verbreitet, daß die ganze Innenstadt von einem unterirdischen Verbindungsnetz durchzogen ist.
Tatsächlich hat es dieses sagenumwobene Labyrinth gegeben. Die Voraussetzungen wurden nach den beiden Türkenbelagerungen von Wien – in den Jahren 1529 und 1683 – geschaffen, als man unterirdische Zysternen und Magazine anlegte, um in Zukunft auf eine Belagerung besser vorbereitet zu sein. Es entstanden Säle, die Ausmaße von mittleren Bahnhofshallen hatten, zweihundert bis fünfhundert Quadratmeter groß, zehn Meter hoch und zwei oder drei Geschosse tief. Der tiefste Keller endete sieben Stockwerke unter der Erde. Im Zweiten Weltkrieg wurden diese Anlagen als Luftschutzräume verwendet. Man brach die Wände zwischen ihnen durch, um Fluchtwege offenzuhalten. Inzwischen sind die Durchgänge wieder zugemauert, aber man findet in manchen Kellern noch Hinweispfeile Richtung Oper oder Urania-Sternwarte.
Ein Atlas des unterirdischen Wien ähnelte den Abbildungen eines Menschen in einem anatomischen Lehrbuch, auf denen die Nervenbahnen, Venen, Arterien und Organe dargestellt sind. Der Kopf, mit dem Gedächtnis dieses von außen unsichtbaren Organismus, wäre die Nationalbibliothek. Sie reicht drei Stockwerke tief unter die Erde und erstreckt sich vom Albertinaplatz bis zum Heldenplatz.
Die mehr als 250 Jahre alte Nationalbibliothek ist so etwas wie ein Bücherbergwerk. In ihren Flözen liegen 2,6 Millionen Bände.
Mit Hilfe von Butten, einer Rohrpost und einer Art Materialseilbahn werden sie aus den Stollen an das Tageslicht gehoben. Um sich zurechtzufinden, haben die Bibliotheksbeamten im Laufe von Jahrzehnten eine eigene Topographie entwickelt. Die Bücher-Förderanlage hält an drei Stationen: Heldenplatz, Josefsplatz und Burggarten, benannt nach den darüberliegenden Orten. Seltsamere Namen haben die Gebiete, die nur für die Bibliotheksbeamten und zu Fuß erreichbar sind: »Numismatik«, »Statistikkeller«, »Segmentgang«, »Musikkammer« oder »Friedrichsküche«. Das »Birnholzzimmer« ist nicht, wie angenommen, mit Möbeln aus Birnenholz ausgestattet, sondern nach einem jüdischen Beamten benannt, der von den Nazis verhaftet und ermordet wurde.
Die »Bergung« ist der tiefstgelegene Bereich der Nationalbibliothek, in der im Zweiten Weltkrieg wertvolle Objekte aufbewahrt wurden. Es gab außerdem den »Sarg«, in dem die nicht erfaßten Bücher lagen. Ganze Bibliotheken jüdischer Flüchtlinge oder die Produktion des Bermann-Fischer Verlages, die selbst im Laufe von Jahren nicht »aufgearbeitet« werden konnten, stapelten sich im »Sarg«. Übrigens war auch die Bibliothek von Schnitzlers Erben darunter. Noch heute findet man, obwohl der Großteil »nach Möglichkeit« zurückgegeben wurde, »verschwundene« Exemplare mit Widmungen an Arthur Schnitzler.
Auf die Frage an den Fachinspektor, einen glatzköpfigen, unruhigen Mann, wie man sich in diesem – um es mit Musil auszudrücken – »Tollhaus von Büchern« zurechtfinden könne, erhielt ich eine ausufernde Antwort, die in der Erklärung gipfelte: »Das Prinzip der Bücheraufstellung ist folgendermaßen: Rechts oben san immer A-Formate und links unten D-Formate … ja? Und nachdem a Christbaum unten auseinandergeht, nennen mir des ›Christbaumaufstellung‹. So kriegen mir des in Griff! Wenn die Signatur auf dem Abgabezettel nicht stimmt, is des oft sehr sinnesverwirrt … dafür is dann wieder gut, wenn man Verfasser und Titel richtig dazuschreibt. Aber heutzutage geht olles nach der ›Numerus currens‹-Aufstellung, des hot mit’n Inhalt überhaupt nix zu tun.«
Insgesamt gibt es sechzig Laufkilometer Bücher in der Nationalbibliothek. Ein falsch eingereihtes wird von der Bibliothek vergessen und kann nur durch einen Zufall wiedergefunden werden. Tausend bis zweitausend sind auf diese Weise im Bibliotheksgehirn »verschwunden«. Ein neuer Beamter, gibt der Fachinspektor Auskunft, brauche ein dreiviertel Jahr, bis er sich halbwegs zurechtfinde. Die Bauarbeiter – es wird immer etwas renoviert – müßten anfangs »regelrecht geführt werden«, da sie allein die Orientierung verlören. Pro Jahr wächst die Bibliothek um 30000 bis 40000 Bücher und Zeitschriften.
»Die Bücher- und Zeitschriftenflut«, resignierte der Fachinspektor, »schwemmt uns fast weg. Es wird jetzt ein neuer Tiefspeicher gebaut. Aber für wie lang?« Schon heute würden von den dreißig Bibliotheksbeamten pro Tag 1500 Aushebungen durchgeführt, und die Entlehner müßten 24 Stunden auf ein Buch warten. Schwierigkeiten habe es durch die Dimension der Bibliothek »am laufenden Band« gegeben. In den Gängen sei es noch vor einigen Jahren so düster gewesen, daß man »die Augen« habe »in die Hände nehmen« müssen. Im Prunksaal oben, erläutert der Fachinspektor, habe man wiederum auf schwankenden Leitern die Bücher(nord)wände besteigen müssen, mit einem Karabiner gesichert und eine Helmlampe auf dem Kopf.
Wie alles in der Welt trägt auch die Nationalbibliothek den Keim der Zerstörung in sich. In den 15 Meter tiefen Stollen gibt es Temperaturen von 13 bis 14 Grad, weshalb sich, begünstigt durch die hohe Luftfeuchtigkeit, der Schimmelpilz in den Büchern bildet. Man hat daher, anstelle von Böden, Gitterroste angebracht, »damit sich ganz unten nicht die feuchte Luft staut«.
An manchen Stellen hört man das Dröhnen und Stampfen der Entlüftungsanlage, so daß man sich im Maschinenraum eines Schiffes wähnt. Von unten sieht man drei Stockwerke höher die Füße des Bibliotheksbeamten, der nach einem Buch sucht. Zwangsläufig fällt einem das Ende von Elias Canettis Roman »Die Blendung« ein: »FEUER FEUER FEUER«, fährt es dem »größten lebenden Sinologen Peter Kien« im Wahn durch den Kopf, als er seine 25000 Bände umfassende Bibliothek anzündet, um schließlich so laut zu lachen, »wie er in seinem ganzen Leben nie gelacht hat«. Kommt die Rede auf die Brandgefahr, erklärt der Fachinspektor allerdings nur knapp, da sei er überfragt.
Feuer und Wahn wüteten bei Bücherverbrennungen schon im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert. Paradoxerweise waren die Zensoren und Oberzensoren gleichzeitig Beamte der Nationalbibliothek – da sie ja am besten Bescheid wußten. Es kursierte aber schon damals der Spruch, daß die Asche weiter trägt als der Gedanke. Die Angst vor einer buchstäblichen Erfüllung dieser weisen Prophezeiung hatte zur Folge, daß die Zensurkommission in ihrem Sitzungszimmer einen eigenen Ofen als Krematorium für Bücherverbrennungen bauen ließ.
In der Zeit des Nationalsozialismus ging die Liste »schädlicher und unerwünschter Literatur« in die Zehntausende. Die davon betroffenen Werke wurden außen mit dem Stempel »Gesperrt« versehen. Heute sind die Stempel durchgestrichen, aber noch als Kainszeichen dieser Ära auf den Deckeln vorhanden. Mit einem Kettenaufzug, der einem Förderkorb nicht unähnlich ist, fahren wir ratternd drei Stockwerke hinauf. Durch den Gitterrost sieht man jetzt von oben in die Bibliothek, wie in eine Katakombenanlage für Bücher.
An das Kabinett des Dr. Caligari erinnert ein Reich, das sich in einem anderen Keller des leopoldnischen Traktes der Hofburg öffnet. Unter einem mehr als zweihundert Quadratmeter großen Gewölbe, früher ein Teil des kaiserlichen Weinkellers, sind sechshundert Denkmäler und Baufresken aus der Zeit von 1870 bis 1918 in der ursprünglichen Gipsform aufbewahrt. Von den vielen Architekturmodellen sind die meisten »verschwunden«. Die weißen Statuen und Figuren, von denen ebenfalls nicht wenige »verschwunden« sind, scheinen wie Requisiten eines Traumes dafür vorgesehen zu sein, in den Köpfen der toten Kaiser zu spuken. Selbstvergessen hockt die Gestalt eines nackten Jünglings auf einem kreissägeartigen Tisch. In einer Öffnung der Ziegelwand ist das eiserne Rad eines Aufzugsmechanismus sichtbar, der durch Ketten angetrieben wird und an eine Foltermaschine denken läßt. Rundherum eine Gruppe von Figuren, erdfarben von Schmutz und Staub. Einem Diskuswerfer ist der Arm abgebrochen. Der liegt zu seinen Füßen zwischen zum Beten gefalteten Händen und einem Kopf – wie Überbleibsel eines stummen Gemetzels. Aus der Wand, an der elektrische Leitungskabel entlangführen, ragt ein verbogenes Eisenrohr in den Raum, und über eine Figur ist eine halb durchsichtige Nylonplane geworfen.
Der Raum ist voller Überraschungen und Rätsel des Schöpfers Zufall: In einer Ecke bilden nackte weiße Frauenkörper, ineinanderverschlungen, eine bedrohlich schöne Menschenwolke aus Gips. In einer anderen wartet eine sinnierende Brahmsbüste, die sich mit der Ewigkeit im Gleichmut zu messen scheint. Kaiser Franz Joseph und Kaiserin Elisabeth stehen verstaubt neben Rembrandt und Leonardo da Vinci. Auf dem Fußboden liegt ein riesiger, scheinbar abgeschlagener Goethekopf neben einem Löwen, der eine Schlange zertritt, und der Trivialfigur eines Wiener Wäschermädels. Schließlich grimassieren von einem Torbogen die Theatermasken des Bildhauers Weyr, wie Wächter, die Zorn vortäuschen, um die Ruhe des unterirdischen Statuenfriedhofs zu behüten.
Ein weiteres Depot für Versatzstücke von Alpträumen befindet sich im Keller des Naturhistorischen Museums am Burgring. 70000 präparierte Fische: Haie, Rochen, Muränen sind dort in Glasgefäßen senkrecht bestattet. In der Fischsammlung ein Stockwerk höher lagern noch einmal 170000 tote Artisten eines vergessenen Naturzirkusses. Die Farbe ist aus ihren Körpern »verschwunden«. Wenn die Pergamenthaut über den runden Glassärgen einen Riß aufweist, muß die Alkoholfüllung ausgetauscht werden. Beim Anblick dieser häufig schon in der Monarchie aus dem Meer gefangenen, seit hundert Jahren aufbewahrten Fische, denkt man an jene schreckhafte Kindheitserfahrung, als man zum ersten Mal mit dem Tod konfrontiert wurde.
Weniger bizarr ist das Bildermausoleum des Kunsthistorischen Museums. Es besteht aus zwei Räumen mit Büsten und ein tausend Portraits umfassendes Depot, in dem vornehmlich Habsburgs langsam abbröckelnder Glanz des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts aufbewahrt ist. Den Verfall – die Portraits »verschwinden« allmählich von der Leinwand – versucht man mit Hilfe von Japan-Papier aufzuhalten, das über die sich auflösenden Stellen der Bilder geklebt wird, bevor sie zum Restaurator kommen.
In Österreich hat jedermann, der tot ist, Anspruch auf einen Glorienschein. Die Todesgloriole der Habsburger ist in der Kaisergruft, auch Kapuzinergruft genannt, zu besichtigen. (Sowohl die Habsburger als auch der Tod sind österreichische Superlative.) Überhaupt die Begräbnisse! In Wien gibt es ein Bestattungsmuseum, und wenn man Schwierigkeiten hat, geht man »probeliegen auf den Zentralfriedhof«.
Es ist daher nicht verwunderlich, daß jeder Habsburger in Ausschöpfung aller Möglichkeiten dreimal bestattet wurde. Der König von Böhmen und Ungarn, Ferdinand IV., führte im siebzehnten Jahrhundert das spanische Begräbniszeremoniell ein, wonach die Leichen geöffnet, die Herzen in silbernen Bechern, Gehirn, Augen und Eingeweide in kupfernen Urnen beigesetzt wurden. Während die Eingeweide von 56 Mitgliedern des Hauses Habsburg in den Katakomben des Stephansdomes ruhen, sind 54 Herzen im »Herzgrüftel« in der Augustinerkirche bestattet. (Allerdings sind drei Becher mit Herzen und zwei Urnen mit Eingeweiden mittlerweile »verschwunden«.)
Die Leichname der Habsburger wurden mit Wachs ausgefüllt, zugenäht und einbalsamiert. Als mir Bruder Gottfried die Werkstatt des Restaurators für die Särge zeigte, die sich ebenfalls in der Gruft befindet, sah ich in einem Päckchen Photos den geöffneten Kaiser Ferdinand III. Vom Kopf des Monarchen, der 1657 starb, war nur der Knochenschädel mit den großen schwarzen Augenhöhlen übriggeblieben.
Die »Zinnpest«, die die Särge befällt, hat Schlampigkeit zur Ursache: Die Handwerker hatten bei der Anfertigung häufig die Gipskerne aus dem Inneren der Gußmasse nicht entfernt. Die Gipsreste quollen auf, da sie Feuchtigkeit anziehen, und erzeugten Risse und Blasen.
Wie Ammoniten liegen die toten Kaiser in ihren metallenen Schalen in der Kapuzinergruft.
Am auffälligsten, größten und höchsten ist der Doppelsarkophag für Kaiserin Maria Theresia und ihren Gemahl, Franz I. von Lothringen, in der Form eines ausladenden Hochzeitsbettes. Auf dem Deckel dieses Sarges ist (für den Besucher nicht sichtbar – er müßte sich in den ersten Stock des Kapuzinerklosters begeben) – das Kaiserpaar dargestellt. Ihm zu Füßen eines seiner 16 Kinder, Kaiser Joseph II., in einem schmucklosen Sarkophag.
In der Kapuzinergruft stehen Rokokosärge, Särge aus der Renaissance und dem Hochbarock, geschmückt mit Brokat aus Zinn, Blumengehängen, Wappenschildern, Reichsäpfeln, Herzoghüten, Kronen und Kreuzen, Särge, die auf Vogelfüßen ruhen oder mit historischen Darstellungen verziert sind, wie dem Einzug Franz Stephans in Florenz.
»Immer wieder ›verschwinden‹ Kreuze und Verzierungen von den Särgen«, klagte Bruder Gottfried. »Touristen haben sogar einen Reichsapfel abgebrochen, ihn aber später wieder zurückgeschickt.« Hitler blieb es vorbehalten, einen vollständigen Sarkophag mit dem Leichnam des Herzogs von Reichstadt aus der Kapuzinergruft verschwinden zu lassen. Der Sohn Napoleons und der Erzherzogin Marie Louise war in Schönbrunn aufgewachsen und einundzwanzigjährig gestorben. »Anläßlich der hundertsten Wiederkehr der Überführung Napoleons von St. Helena nach Paris«, berichtete die Presse, habe sich der »Führer« entschlossen, die sterblichen Überreste des Herzogs den Franzosen »zum Geschenk zu machen«.
Am 12. Dezember 1940 verhaftete die Gestapo den Pater Provinzial des Kapuzinerklosters, während Angehörige der SS, der SA und acht Männer der Bestattung in die Kaisergruft eindrangen, den Sarg abbauten und mühsam – er wog achthundert Kilogramm – hinausschafften. Die Presse schrieb darüber weiter: »Die wenigen Menschen, die sich um diese Zeit in nächster Nähe der Kapuzinergruft befanden, eilten herbei und bildeten ein kurzes Spalier, die Hände stumm zum letzten Gruß erhoben.« Der Eindruck, den Hitlers organisierte Nekrophilie bei den Österreichern hinterließ, wäre es wert, näher untersucht zu werden. Übrigens vergaßen die Nazis in der Eile oder aus Unkenntnis, die Eingeweideurne und den Herzbecher mitzunehmen.
»Allein blieb ich, allein, allein, allein. Ich ging in die Kapuzinergruft«, ließ Joseph Roth den Franz Ferdinand von Trotta nach dem Zusammenbruch der Monarchie denken. In der Krypta der Michaelerkirche, gegenüber der Hofburg, wollten vor allem Adelige und ehemalige Bedienstete am kaiserlichen Hof bestattet werden, um dem Kaiserhaus auch im Tod nahe zu sein. Ab 1783 waren Bestattungen in Krypten aber aus hygienischen Gründen verboten. Im neunzehnten Jahrhundert, bei einer »Inventur der Grüfte«, wurden vierhundert Särge gezählt. Insgesamt liegen über viertausend Tote unter der Michaelerkirche. Die Grüfte waren nämlich nach Bedarf geräumt worden, damit man weitere Tote bestatten konnte. Mit den Holzsärgen wurde nicht viel Aufhebens gemacht. Man nahm die Bretter auseinander und verbrannte sie. Der Inhalt wurde mit einer dicken Schicht Erde und Sand bedeckt. Dieser Vorgang wiederholte sich oftmals, wodurch in der Michaelerkirche eine 1,50 Meter hohe Aufschüttung entstand; auf ihr steht der Besucher.
Wie Kähne in einem gemauerten Bootshaus, aus dem das Wasser versickert ist, liegen die Särge unter den Gewölben. Als man im zwanzigsten Jahrhundert zum ersten Mal die Gruft betrat, fand man nur noch 250 vor. Die übrigen 150 waren »verschwunden«. Die Holzsärge sind grün, gelb, rot oder braun, mit Blumen bemalt und zum Teil geöffnet. Innen wurden sie mit Hobelscharten ausgefüllt. An den Toten findet man Schuhe, den kurzen barocken Gehrock, auf dem Kopf des einen oder anderen das Netz einer Perücke. In einem Sarg ist das Tuch aufgeschnitten, die Tote liegt wie in einem Hochzeitskleid da, um den Kopf ein kleines Gewölk von Holzscharten wie ein vertrockneter Blumenkranz.
Luftzug und klimatische Verhältnisse haben die Leichen mumifiziert. Die Gesichter der Toten ähneln Masken. Mit weit aufgerissenen Mündern liegen sie da. »Das sind ein Strauß Rosen«, sagte der Gruftführer auf die Brust einer Toten deutend, »und die Reste eines Wachskreuzes. Hier eine ältere Dame, bei der das Kleid erhalten geblieben ist. Sie hat noch Nägel an den Fingern, aber es fehlt ein Schuh. Wo er hingekommen ist, weiß niemand.« Die bekannteste Tote in der Gruft ist eine Frau, die während der Schwangerschaft gestorben ist. Ihr Gewand ist rückstandslos zerfallen, aber das Kind blieb unter der Bauchdecke als Abdruck sichtbar.
Mehr als 15000 Menschen, Namenlose, liegen unter dem Stephansdom und einem Teil der Innenstadt begraben. Einen halben Quadratkilometer weit und zwanzig Meter tief erstreckt sich das Totenreich unter der Erde. Es ist eine Insel ohne Fluß. Die meisten Beerdigungen fanden zwischen 1711 und 1783 statt. 1713, bei der großen Pestepidemie in Wien, überhäufte man die Toten mit Kalk, damit sie schneller austrockneten, wickelte sie in Leintücher und warf sie in einen Schacht, der vom Stephansplatz zu den Katakomben führte. Durch eine Öffnung in der Wand blickt man in eine Grabkammer: Man stapelte in ihr fünfhundert Särge bis zum Plafond und wartete so lange, bis die Deckel einbrachen. Noch heute erkennt man unter den Knochen Stoffreste und Bretter. Um Platz zu schaffen, ließ man Strafgefangene und Bußmönche die Grabkammern aufbrechen, die Knochen säubern und wie Holzscheite aufeinanderschichten, »viele Klafter lang und hoch«, wie Adalbert Stifter schrieb, »lauter Knochen von Armen und Füßen … und nun liegen sie hier, starr, übereinander geschichtet, eine wertlose, schaudererregende Masse«.
Wien ist eine große Nekropole.
Bauarbeiter, Bauern und Archäologen stießen nicht nur auf Menschengräber, sondern auch auf versteinerte Tierreste: Zweihundert Millionen Jahre alte Ammoniten, Muscheln, Seeigel. In den Weingärten von Nußdorf wurden große Foraminiferen und Pilgermuscheln gefunden und in den feinen Meeressanden auf dem Friedhof von Pötzleinsdorf Muscheln und Schnecken. Die Ziegeleien im Stadtgebiet waren um die Jahrhundertwende Fundgruben für Wirbel und Rippen von Walen, Delphinen und Seehunden, die zehn Millionen Jahre alt sind. Aus der Zeit nach dem »Verschwinden« des Meeres verwahrt die Geologische Abteilung des Naturhistorischen Museums Zähne von Mammuts, den Schädel eines Wollhaarnashorns und eines Urpferdes. Beim U-Bahnbau zuletzt fand man Reste aus der Römerzeit.
»Die ganze Geschichte Wiens steckt im Boden«, sagte der Archäologe. »Die Stadt steht auf einem neun Meter hohen ›Kulturschutt‹ unserer Vorfahren. Am Stock-im-Eisen-Platz haben wir zehn Römergräber ausgegraben und unter dem Hohen Markt römische Ruinen, für die man ein kleines archäologisches Museum einrichtete. Über 90000 Münzen, Vasen, Figuren und Kochgeschirr wurden gefunden.«
Arbeiter legten 1973 beim U-Bahnbau auf dem Stephansplatz die bis dahin unbekannte Virgilkapelle aus dem zwölften oder dreizehnten Jahrhundert frei. Man schaut in der zweigeschossigen U-Bahnstation durch eine Glasscheibe auf sie hinunter, wie in ein tiefergelegenes Aquarium. Die Glasscheibe, in der sich eine Reihe gelber Telephonzellen spiegelt, trennt aber nicht die Elemente Luft und Wasser, sondern läßt in ihrer Durchsichtigkeit und ihren Spiegelungen Schichten von Zeit sichtbar werden.
Durch einen 208 Meter langen, mit Ziegeln ausgelegten geraden Stollen erreicht man in der Hinterbrühl den »größten unterirdischen See Europas«. Wie die Seitenschiffe eines Domes verzweigen sich die Nischen des Gewölbes über dem Wasser. Das aufgelassene Gipsbergwerk ist die Kulisse eines unterirdischen Naturtheaters. Durch Scheinwerfer wird die Felsendecke so auf die Wasseroberfläche des Sees gespiegelt, daß man sie für den Grund hält und sich über die wahre Tiefe täuschen läßt. Würden nicht täglich 50000 bis 60000 Liter Wasser abgepumpt, wäre die gesamte Grotte überflutet.
Die Voraussetzungen für das Naturtheater wurden vor mehr als siebzig Jahren geschaffen. 1912 ereignete sich bei einer Sprengung in sechzig Metern Tiefe ein Wassereinbruch. Zwanzig Millionen Liter überschwemmten die untersten Stollengänge, und der Betrieb mußte stillgelegt werden. 1944 wurde das Bergwerk von den Nazis beschlagnahmt. 1800 KZ-Häftlinge mußten Rümpfe für eine von Hitlers »Wunderwaffen«, den Heinkel-Düsenjäger He 162, in den ständig leergepumpten Hallen und Gewölben zusammenbauen.
Durch die spiegelnde Wasseroberfläche sieht man bei richtigem Blickwinkel noch die Schienenstränge auf dem eineinhalb Meter tieferen Grund. In einem Stollen sind hinter einem Drahtzaun Flugzeugtrümmer ausgestellt: Teile aus einem Cockpit, ein Rad, zerstörte Armaturen, eine Einspritzpumpe, die nach der Sprengung der Werkshallen durch die Nazis übriggeblieben sind.
Fünfzig KZ-Häftlinge wurden vor dem Heranrücken der Roten Armee an Ort und Stelle getötet, nur wenige überlebten den Todesmarsch in das KZ Mauthausen. Heute fahren die Touristen lautlos mit dem Elektroboot über den 6200 Quadratmeter großen See, der die Zeit unter sich »verschwinden« ließ.
Styx – »Grausen« – ist jener mythologische Fluß, der sich durch eine wilde Schlucht in die Unterwelt ergießt. Dort windet er sich neunmal um das Reich des Hades und der Toten. Einer seiner Nebenflüsse heißt Lethe – »Vergessen«. Der Fluß des Vergessens ist in Wien der Wein, und die Krypten des Weins sind die tiefen Weinkeller und ihre (vorläufigen) Särge die Weinfässer. Die Kapuzinergruft für den Wein war ein riesiger, 731 und einen halben Hektoliter fassender Keramikbehälter im Statuendepot der Hofburg. Ruft man in das Zapfloch des jetzt leeren »Fasses«, kann man zwölf Sekunden lang das Echo hören.
Wien ist und war voller Katakomben des Weins, wie dem Esterhazykeller, der an einen Luftschutzbunker erinnert, dem Zwölf-Apostelkeller, dem Urbanikeller, dem Melker Stiftskeller oder dem Piaristenkeller. Vom größten, dem Rathauskeller, sagt man, daß in ihm »hunderttausend Flaschen mit Wein lagern«. Man findet dort noch ein 70 000-Literfaß, das »aus Platzersparnis verkürzt wurde«. Die neugotischen Säle sind in einer Mischung aus Makart- und Jugendstil bemalt. In den Hinterräumen gab es Séparées für Offiziere und den Adel – heute sind es »Künstlergarderoben für Operettendarsteller«.
Die inneren Flüsse des menschlichen Körpers »verschwinden«, nachdem sie angeschwollen sind, wieder in der Erde. Ganz tief unten, in der Friedrichstraße zwischen der Secession und dem »Café Museum« arbeiten in einem Schotterfang der Kanalisation zehn Männer. Wie Galeerensträflinge unter Deck beugen und strecken die Arbeiter ihre Oberkörper und schaufeln im Fäulnisgestank und der Düsternis des Raumes Schotter in einen Kübel, der, sobald er gefüllt ist, nach oben gezogen wird. Zigarettenkippen, Zitronenschalen und Küchenabfall treiben auf der Kloake. Der Betonsteg am Rand glänzt unter den Deckenlampen bronzefarben und sieht aus wie ein mystischer Pfeil.
Die Galeere ist 14 Meter lang und sechs Meter breit. Mitunter knipst einer der Männer die Taschenlampe an und sucht im Schotter – ein Archäologe der Scheiße. »Die Grenze zwischen den normal und krankhaft benannten Seelenzuständen ist zum Teil … eine so fließende, daß wahrscheinlich jeder von uns sie im Laufe eines Tages mehrmals überschreitet«, hielt Sigmund Freud fest. Daran denke ich, als ich auf einer Brücke die Kloake überquere und in die Halle mit dem Regenüberfallkanal trete – ein Heiligtum des Films »Der dritte Mann«. Der Regenüberfallkanal ist eine Staumauer, über die das Hochwasser abfließt. Orson Welles floh über sie in unvergeßlicher Manier vor der Polizei.
Überall ist derselbe, fast bedrohliche Fäulnisgestank zu riechen, und man hat beim Gehen das Gefühl, immer tiefer in eine Pyramide einzudringen. 1800 Kilometer lang ist das Kanalnetz von Wien, die Hunderte kleiner Nebenkanäle nicht mitgezählt. Die Pyramide ist eine Kultstätte des Stoffwechsels. 450 Kanalarbeiter mit Gummikapuzen reinigen wie Hohepriester der Verdauung und des Verschwindenlassens Tag für Tag die nur siebzig Zentimeter bis zu einem Meter hohen Kanalrohre, in gebückter Haltung, mit einem »Schimmelbrett«, das einem Schneeschieber ähnelt. Niemand außer einer Million Ratten macht ihnen die Katakomben der Fäkalien streitig.
»Bei Gewitter«, sagt der Truppführer, »fängt die Galerie, auf der wir stehen und in das dunkle Brodeln schauen, zu vibrieren an. Das Wasser kann so hoch steigen, daß der gesamte Raum überschwemmt ist.«
Tag und Nacht fließt der Kloakenfluß unter der Erde, unter der sich die zweite Stadt verbirgt. Doch Tag und Nacht sind in Wien nur scheinbar voneinander getrennt. Über ein letztlich nicht durchschaubares System ist es möglich, daß sie hier stetig ineinander übergehen und einander zum Verschwinden bringen, wie die »normalen und krankhaften benannten Seelenzustände«, von denen Freud spricht.
Das Haus der schlafenden Vernunft
Als erstes erblickt man in der Anstalt Gugging gegenüber der Portiersloge ein buntes Wandgemälde. Labyrinthisch ineinanderverschlungen sind Mensch und Natur in friedlicher Fremdheit vereint. In großen Buchstaben liest man das Wort Paradies. August Walla, 52 Jahre alt, insgesamt 15 Jahre Patient in Gugging, hat es gemalt. Nicht weit davon findet man im Park eine Gedenktafel, die an die rund tausend Ermordeten der Gugginger Anstalt erinnert, welche dem Unternehmen »Lebensunwertes Leben« der Nationalsozialisten zum Opfer gefallen sind. Sodann fährt man zum »Haus der Künstler« wie auf einen kleinen Zauberberg hinauf. Es liegt auf einer Anhöhe, am Rand des Laubwalds, fast nicht mehr innerhalb des Anstaltsbereichs – weder ganz zur Hölle draußen noch ganz zur Hölle drinnen gehörig. Es wird zum Großteil von »aufgegebenen Fällen«, von »chronisch kranken Langzeitpatienten« – so der medizinische Standpunkt –, bewohnt, die dort mit gewissen Erleichterungen gegenüber Insassen mit einem ähnlichen Schicksal leben: Die Tür des Hauses ist nicht versperrt, die Atmosphäre ist privater; aber es ist trotzdem ein vorgeschriebenes Dasein mit eingeschränkter Verantwortung, das die Bewohner hier führen.
Das Haus ist mit dem »Teufelgott«, Zeichen und Inschriften von August Walla, und mit zwei langgestreckten Gestalten des neunundsechzigjährigen Oswald Tschirtner bemalt, der seit mehr als vierzig Jahren in der Anstalt lebt. Außerdem schmücken es eine lachende Sonne und ein rotes Herz des mittlerweile berühmten Johann Hauser, eines zweiundsechzigjährigen Patienten, der seit 39 Jahren hospitalisiert ist. Hinter dem Gebäude bemalte Steine und buntgetupfte Holzplastiken mit Windrädern, die an Totempfähle erinnern. Johann Garber, bis vor kurzem der jüngste Bewohner, ein einundvierzigjähriger Mann mit Zipfelhaube, hat sie gemacht. Er hat auch den großen alten Heizungsofen im Keller mit bunten Farbtupfen bemalt.
Den Psychiater Leo Navratil und seine Patienten kenne ich von Besuchen in Gugging, am längsten Ernst Herbeck, den ich 1976, als er noch im Hauptgebäude untergebracht war, zum ersten Mal traf, um über ihn zu schreiben. Navratil ließ kurz darauf Herbecks Gedichte unter dem Pseudonym Alexander als Taschenbuch veröffentlichen. 1978 wurde Herbeck in die »Grazer Autorenversammlung« gewählt, gab mit Oswald Tschirtner einen weiteren Gedichtband (jetzt unter eigenem Namen) heraus und verließ 1980 die Anstalt, um in das Landespensionistenheim Klosterneuburg zu ziehen. In der Folge wurde seine Entmündigung aufgehoben, aber 1981 kehrte Herbeck auf eigenen Wunsch in das im selben Jahr eröffnete »Haus der Künstler« nach Gugging zurück. Er ist 68 Jahre alt und seit 1946 hospitalisiert. Die Diagnose lautet, wie übrigens bei den meisten anderen: Schizophrenie.
Im Flur, der unübersehbar von August Walla bemalt ist und im trüben Vormittagslicht wie ausgedacht wirkt, kommt mir Ernst Herbeck, das Gesicht aus Scheu abgewandt, entgegen. Ich kann nur mit Mühe verstehen, was er spricht; er leidet unter einer Fehlbildung des Gaumens und wurde – wie ich erfahre – erst vor kurzem wieder operiert. Er ist ein Mensch, den man nicht vergißt. Seit vielen Jahren hat er sich in das stumme Selbstgespräch und die Einsamkeit der Gedanken zurückgezogen, in denen er als schweigender Philosoph im Herzen der Trauer lebt. Herbeck geht mit gesenktem Kopf voraus in den Speisesaal, dessen Wände bis zur Decke mit den farbigen Bildern der Patienten bedeckt sind. In einer Ecke steht ein phantasievoll bemalter Kleiderschrank.
Leo Navratil – groß, dichtes, graues Haar, hochstehende Backenknochen wie ein asiatischer Gelehrter – sitzt mit vierzehn Patienten und seinem Nachfolger Dr. Feilacher, einem vollbärtigen jungen Psychiater und Maler, um den gedeckten Tisch. Navratil betrachtet den Gugelhupf und die Patienten distanziert und stolz wie der liebe Gott das Licht am ersten Schöpfungstag. Neben ihm August Walla, von enormer Leibesfülle. Sein Kopf ist wegen einer Schuppenflechte kahl rasiert. Übrigens sind mehrere Patienten auffällig dick: Der verschlossene Franz Kernbeis zum Beispiel. Er ist 59 Jahre alt und seit 35 Jahren in der Anstalt. Er zeichnet ein wundervolles Reich der Schatten: eine Schattenhand, ein Schattenfahrrad, eine Schattenpetroleumlampe, Schattengefäße, Schattenbrillen, eine Schattenkugel – ein Niemandsland der verlorenen Schatten.