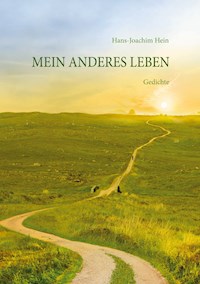Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Warum schreibe ich meine Biografie und warum in Auszügen? Ich wollte mich kennenlernen! Das habe ich nun getan und es war durchaus nicht das reine Vergnügen. Einige Kapitel habe ich aus meinem Leben herausgesucht. Bevor ich begann, hatte ich den Eindruck ich sei etwas Besonderes und es sei wert anderen mitzuteilen und siehe da, ich war bestenfalls „durchschnittlich“. Es sind viele Dinge in meinem Leben passiert mit denen ich mich auseinandersetzen musste. Diese Auseinandersetzung hält zum Teil noch an. Ich werde einige Ereignisse herausnehmen und detaillierter darstellen. Das Erinnern und wiederholte Verarbeiten war anstrengend, aber es tat meinem Ego gut! Zum anderen sind zeitgeschichtliche Ereignisse beschrieben, so wie ich sie erlebt und durchlebt habe. Vielleicht erging es dem einen oder anderen Leser ähnlich! Das würde ihm einen Vergleich erleichtern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 144
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lieber Leser, bevor du deinen Lebensweg beginnst, weißt du nie, wo er dich hinführt, nie, wie lange du brauchst, was die Reise in dir zurücklässt und welches der letzte Stopp sein wird.
Ein Leben wird letztlich bestimmt durch das, was du daraus machst und wie andere damit umgehen.
Es gibt nichts Traurigeres, als wenn du am Ende nach dem Sinn deines Lebens fragst!
Inhalt
Die Wurzeln
Kapitel
Geburt und Vorschulzeit, erlebt am Ende des zweiten Weltkrieges
Geburt
Vorschulzeit und Flucht nach Schleswig-Holstein
Die Flucht
Ende des Krieges
Rückkehr und Schulzeit
Zur Erntezeit aufs Land
Im katholischen Kinderheim
Begegnungen am Zaun
Weihnachten 1953
Vorbereitungen zum Weihnachtsfest
Schulzeit
Zeitvertreib und Spiele zu Hause
Mit Peter und den Nylonstrümpfen zur Wasserflohjagd
Konfirmation
Schulexperimente in der Wohnung
Umzug nach Stendal
Kapitel
Ausbildung und Beruf
Arbeitsaufenthalt am Institut für Biophysik der Akademie der Wissenschaften der UdSSR
Ein Tag für ein halbes Leben
Weitere Arbeit und Reiseaktivitäten
Neuorientierung nach der Wiedervereinigung und Evaluierung
Ehrenamtliche Tätigkeiten
Im ehrenamtlichen Besuchsdienst der Krankenhausseelsorge
Aktivitäten im Ruhestand – ein Widerspruch?
Einige Charaktereigenschaften
Sport und andere Aktivitäten
Kreuz und quer durch Lettland
Kontakt mit dem Baltisch-Deutschen Hochschulkontor
Ausflug zum Rigaer Badeort Jurmala
Nach Klausenburg in Rumänien
Ausflüge
Die kurze Geschichte meiner chronischen Erkrankung
Meine Söhne Dr. med. Markus Hein und Zahnarzt Stephan Hein
Mein Sohn Zahnarzt Stephan Hein
Das Sommerhaus
Anekdoten der Kinder
Nachruf für meine Mutter
Meine Grabstelle
Am Ende das Grab
Quellenverzeichnis
Die Wurzeln
Mein Stammbaum lässt sich mit Sicherheit bis zum Jahr 1817 zurückverfolgen. Hier möchte ich aber mit meinen Großeltern väterlicherseits beginnen.
Bild 1: Richard Hein, der Großvater des Autors, zu Beginn des 20. Jahrhunderts nach erfolgreicher Jagd.
Bild 2: Die Großmutter des Autors, Martha Hein, geb. Giese, mit ihren Kindern. In der Mitte (in weiß) der Vater des Autors im Sommer 1909.
1. Kapitel
Geburt und Vorschulzeit, erlebt am Ende des zweiten Weltkrieges
Wenn ich die Geschichte meines Lebens auszugsweise erzähle, dann spreche ich über eine Reihe von Ereignissen, die im Gedächtnis und im Gefühl haften geblieben sind. Allerdings schon reflektiert und folglich nicht immer detailgetreu wiedergegeben. Erinnerungen, die sehr unterschiedlich geprägt sind durch das, was sie verursacht, und durch die Reflexionen, die sie mehrfach erfahren haben. Die Ereignisse haben aber tatsächlich in der beschriebenen oder ähnlichen Weise stattgefunden. Das möge der geneigte Leser dieser Lebensgeschichte berücksichtigen.
Geburt
Der siebente Juni 1939 war in Frankfurt/Oder ein typischer Sommertag. Es war warm, sonnig und fast ein wenig schwül. Am Nachmittag gab es vereinzelt Gewitter. Mitten in diese Zeit hinein wurde ich geboren.
Jede Geburt ist etwas Einzigartiges, Unverwechselbares, auch wenn der Ablauf viele tausend Mal gleich zu sein scheint. Man nannte mich Hans-Joachim. Da mein Nachname kurz ist, wollten die Eltern wahrscheinlich mit dem langen Vornamen einen Ausgleich schaffen.
Mit mir kam der Krieg. Im Grunde genommen hat er mein ganzes Leben begleitet und größtenteils bestimmt, auch noch, als er längst vorbei war. Zum weiteren Verlauf des Lebens nach 1945 gab es anfangs kaum Alternativen. Anscheinend ahnend, was mich erwartete, legte ich mich quer. Die Geburt war schwierig und es bedurfte der Zange, mich dahin zu befördern, wo ich hin sollte, rein ins volle Menschenleben. So hatte ich noch oft den Eindruck, dass immer dann, wenn es kritisch wurde, irgendwie eine Zange nötig war und jemand, der sie zu bedienen wusste. Der Stress des Lebens nahm seinen Lauf.
Bild 3: Winter 1939/40, der Autor mit Vater und Mutter.
Total mit Blut verschmiert, das aus einigen Wunden kam, die mir offensichtlich die Zange zugefügt hatte, erblickte ich das Licht der Welt. Oder besser, die Welt erblickte mich als einen blutüberströmten, zappelnden, hässlichen Klumpen Fleisch. Meine Tante E. wünschte, dass ich doch sterben möge. Ich muss sehr hässlich ausgesehen haben, und sie war nun mal ein Ästhet. Das erzählte sie mir alles viel später, nach mehr als 55 Jahren. Immerhin, der Anblick muss schrecklich gewesen sein. Ich war wohl quasi so etwas wie eine Miniaturausgabe von Quasimodo, zumindest war das für später zu befürchten.
Bild 4: Letztes Bild der vollzähligen Familie 1943, rechts der Autor, links Schwester Marlies mit Vater und Mutter.
Aber wie das manchmal so ist, das Leben gewann und man konnte mich richten. Nach einigen Monaten wurde die linke Schulter aufgeschnitten, um den durch eine Entzündung entstandenen Eiter zu entfernen. Die Narbe ist noch heute, nach Jahrzehnten, deutlich zu erkennen.
Ich wuchs heran, spielte wie andere Kinder auch. Aber Krankheiten haben mich noch bis zu meinem zwölften Lebensjahr begleitet. Zwischendurch besserte es sich, vor allem in den knapp zwei Jahren, die ich mit meiner Mutter und der drei Jahre jüngeren Schwester auf dem Land in Schleswig-Holstein verbrachte.
Vorschulzeit und Flucht nach Schleswig-Holstein
Ich ging sehr gerne in den Kindergarten. Aber leider nicht regelmäßig, da ich oft krank war und später die Betreuung kriegsbedingt häufig ausfiel.
Die Erwachsenen gaben sich große Mühe, uns Kinder zu beschäftigen. Unter großem Sicherheitsaufwand fuhren wir zum Beispiel im Winter mit dem Schlitten den Oder-Damm hinunter auf den weitgehend zugefrorenen Fluss. In ausreichendem Abstand von der eisfreien Flussmitte standen die Erwachsenen und fingen uns ab.
Ich wundere mich noch heute darüber, dass es geduldet wurde. Es war ein sehr gefährliches Unterfangen, wie man sich denken kann. Also war es nicht das reine Vergnügen, sondern wohl mehr eine Mutprobe. Aber von einem Unfall habe ich nichts gehört!
Kinder im Vorschulalter sind besonders neugierig und wollen alles im wahrsten Sinne des Wortes begreifen. Darin muss ich wohl sehr aktiv gewesen sein, zum Leidwesen meiner Eltern. Das Spielzeug wurde bis auf die elementaren Bestandteile zerlegt, wenn es nur eben möglich war. Wenn nicht, konnte es mich nur für kurze Zeit fesseln.
Meine Mutter nähte. Sie nähte gut und gerne. Damit hat sie uns Kinder später häufig durch die ärgsten Nöte gerettet.
Zum Beispiel interessierte mich sehr, was die auf- und absausende kleine Nadel der Nähmaschine machte. Also fragte ich und zeigte gleichzeitig mit dem Finger auf die Nadel, und rums, sauste sie durch die Fingerkuppe und zerbrach. Ein kurzer heftiger Schmerz und ein Fluch meiner Mutter folgten. Ein paar Tage war die Maschine außer Betrieb, denn es war nicht so ganz einfach, Ersatz zu beschaffen, während ich mit einem Pflaster an der Fingerkuppe des Zeigefingers zwei Tage lang behindert herumlief. Übrigens habe ich damals nie erfahren, wie das Nähen mit der Maschine funktioniert.
Als meine Mutter wieder einmal an der faszinierenden Maschine arbeitete, spielte ich im Zimmer, aber immer mit einem Seitenblick auf die Maschine beziehungsweise auf das, was die Mutter tat, als es am Fenster klopfte (wir wohnten zu ebener Erde). Draußen stand mein älterer Freund, der schon zur Schule ging und immer gern zeigen wollte, was er schon alles konnte. Sein Imponiergehabe war erfolgreich. Er fragte mich, ob ich rechnen könne. Meine Mutter nickte mit dem Kopf und ich sagte: »ja!«. Da sie etwas versteckt in der Ecke hinter der Gardine saß, konnte mein »Freund« sie nicht sehen. Sie war gerade mit einem Kleidungsstück beschäftigt, das es ihr erlaubte, an unserem Gespräch passiv teilzuhaben.
Der Junge stellte mir einfache Rechenaufgaben, wie »eins plus fünf«, »drei plus zwei«, »vier plus fünf« usw. Meine Mutter sagte mir immer das Ergebnis und ich wiederholte es laut. Ich glänzte und stieg schnell in der Achtung meines Examinators. Irgendwann hatte meine Mutter keine Lust mehr und sagte nicht mehr vor. Da ich nun nicht gerade auf den Mund gefallen war, rief ich bei der nächsten Aufgabe dem Jungen zu:
»Das kann meine Mutti noch nicht!«
Der Fensterbesucher fühlte sich zu Recht verscheißert und zog fluchend davon.
Es war Krieg! Mein Vater war Soldat und brachte eines Tages, während eines der sehr seltenen Kurzurlaube, ein Gewehr mit nach Hause. Um es vor mir zu verstecken, wurde es hinter den großen Kachelofen im Wohnzimmer gestellt.
Bild 5: Autor im Alter von etwa fünf Jahren, Winter 1944/1945.
Aber das war wirklich keine gute Idee, denn ich entdeckte es schnell, zog das schwere Ding in die Stube und wollte es gerade in der beim Spielzeug bewährten Weise untersuchen, als die Tür aufflog. Meine Mutter stürzte sich auf das Gewehr, entriss es mir und schimpfte schrecklich. Sie hatte wohl das Geräusch gehört, denn Mütter haben immer mindestens die Hälfte ihrer Sinne auf die Kinder gerichtet und das ist gut so.
Ich wusste natürlich nicht, ob mein Vater jemals auf einen Menschen damit geschossen hatte. Hätte man mir vielleicht eine halbe Stunde Zeit gegeben, wäre es mit diesem sehr wahrscheinlich nicht mehr möglich gewesen.
Die Flucht
Das ferne Grollen, das schon tagelang anhielt, kündigte das Nahen der Front an. Was tun? Bleiben kam nicht infrage und so beschlossen die Frauen, es blieb ihnen ja auch nichts anderes übrig, mit einem der letzten Eisenbahnzüge Frankfurt zu verlassen. Wir wollten nach Schleswig-Holstein fahren, wo meine Tante Verwandte oder zumindest gute Bekannte hatte. Sie hatte schon eine Einladung besorgt. Das war sehr wichtig.
Es gab die Anweisung, die gesamte Stadt, bis zum 27. Februar 1945 zu evakuieren. Die Verwandten wollten uns aufnehmen. Das hatten wir schriftlich. Ein Licht, eine Hoffnung in dieser schlimmen Zeit.
Allerdings war es keinesfalls sicher, ob wir dieses Ziel jemals erreichen würden. Es gab aber keine Alternative.
Einen oder zwei Tage vor der Abfahrt versammelten sich alle Teilnehmer unserer Gruppe bei der Tante, die auf der Westseite der Oder wohnte. Es waren zwei oder drei Familien. An die Einzelheiten kann ich mich nicht mehr erinnern; nur noch daran, dass wir Kinder uns in einem großen Raum aufhielten, in dem eine Modelleisenbahn aufgestellt war. Es war eine »richtige« Eisenbahn, und das hieß, sie fuhr mit Dampf und wurde mit Spiritus beheizt. Es war faszinierend zu sehen, wie der Zug unter dem Schrank und anderen »hochbeinigen« Möbeln verschwand, um gleich wieder schnaufend und dampfend am anderen Ende zu erscheinen. Kurzum, es hat mich wahnsinnig beeindruckt. Sonst würde ich mich wahrscheinlich nicht so lebendig daran erinnern.
An einem späten Nachmittag ging es zum Bahnhof. Es war Zeit, Abschied zu nehmen. Alles, was mitgenommen wurde, musste in einen Koffer und in den Kinderwagen passen – in dem auch zeitweise meine fast zweieinhalb Jahre jüngere Schwester Platz finden musste.
Am Hauptbahnhof war die Hölle los. Unglaublich viele Menschen mit Sack und Pack liefen herum und durcheinander. Es waren fast nur Frauen mit ihren Kindern. Kisten, Koffer und allerlei Behältnisse, die zum Transport taugten, stapelten sich. Es war unglaublich, was noch alles untergebracht werden musste. Das »Verladen« hielt schon den ganzen Nachmittag an. Es war ein ohrenbetäubender Lärm, in den sich das ungeduldige Fauchen der Dampflokomotive mischte.
In der einbrechenden Dunkelheit fanden wir schließlich unseren Wagen und richteten uns, so gut es eben ging, in dem zugigen Güterwagen ein. Meine Schwester musste mit ihren zwei Jahren ab und zu laufen. Sonst saß sie ganz oben auf dem Kinderwagen. Das war eine wackelige Fuhre. Gelegentlich hielt ich mich wie meine Schwester an der Stange des Kinderwagens fest, um nicht im Gedränge verloren zu gehen und dem Kinderwagen etwas Stabilität zu verleihen. Nachdem unser Güterwagen besetzt war, wurde die riesige Tür zugeschoben, so dass die Luft nur durch zwei verstellbare Luken pfiff, die unter dem Dach des Waggons angebracht waren. Nur durch einen Spalt, den die Tür frei ließ, konnte man nach draußen sehen. Auf dem Bahnhof kehrte allmählich Ruhe ein, nur unterbrochen durch das Schluchzen und die Schreie des Abschieds, die sich in den Hallen mehrfach brachen. Meistens ein Abschied für immer!
Das dumpfe, grollende, an- und abschwellende Donnern der herannahenden Front bildete den furchterregenden Hintergrund.
Schließlich setzte sich der Zug ruckelnd und zuckelnd langsam Richtung Westen in Bewegung. Die dürftigen, lautlos im Dunst schaukelnden Lampen des Bahnsteiges malten ein gespenstisches Bild, bis sie verschwanden.
Beim Einmarsch der Roten Armee waren von den etwa sechzigtausend Frankfurtern nur noch etwa 500 Einwohner übrig geblieben. Es waren meistens Angestellte der kirchlichen Einrichtungen, der Krankenhäuser und einige Beamte der Stadtverwaltung. Diese Informationen erhielt ich aus dem Stadtarchiv in Frankfurt/Oder.
Die abenteuerliche Fahrt begann. Die Hoffnung, das Ziel zu erreichen, fuhr mit. Dort in Schleswig-Holstein wollten wir bleiben, wenn auch nur vorübergehend.
Im Waggon befanden sich etwa fünfzehn bis zwanzig Personen und das Gepäck, etwas Brennholz und ein kleiner Ofen.
Es ging quer durch das schon stark zerstörte Berlin. Die letzte schwere Bombardierung hatte erst vor zwei oder drei Tagen stattgefunden. Die Ruinen schienen mit den Händen greifbar zu sein. Durch den Spalt der Tür konnte ich ein wenig von der Außenwelt sehen. Ich wurde sehr neugierig, ohne zu begreifen, was ich dort sah. Ich sah Dinge, die ich lieber nicht gesehen hätte. Es gab Fragen über Fragen, aber es gab keine Antworten. Niemand wollte oder konnte zum Beispiel erklären, was die großen schwarzen Puppen zu bedeuten hatten, die ich gelegentlich in den ausgebrannten, zum Greifen nahen Ruinen sah. Fehlende Mauern erlaubten einen Blick in die Stuben wie in ein Puppenhaus. Es war, als führe man mitten hindurch in einer Gespensterbahn.
Am Abend des darauffolgenden Tages erreichten wir nach einigen Zwischenstopps Hamburg.
Wieder Himmel und Menschen! Aber es schien hier für die damaligen Verhältnisse alles gut organisiert.
Aufgrund der von uns angegebenen und schriftlich bestätigten Adresse wurden wir in ein Internierungs- beziehungsweise Flüchtlingslager bei Elmshorn gebracht. Es war wieder Abend geworden und stockdunkel, nur die im Wind schaukelnden Lampen warfen auch hier ihr trübes Licht auf die gespenstig wirkende Szenerie, als wir eingewiesen wurden. Wir erhielten Plätze in einem großen Mannschaftszelt. Als Schlafstatt fanden wir mit Strohsäcken gefüllte Holzrahmen. Es sollte ja auch nur für eine Nacht sein, und verglichen mit den Verhältnissen im Zug war es geradezu komfortabel. Es roch sehr angenehm nach Stroh.
Doch wo war meine Schwester? Sie war ja gerade einmal zwei Jahre alt. Große Panik, alle suchten und riefen. Auch der Lagerlautsprecher beteiligte sich. Sie wurde ausgerufen! Für mich war es jetzt wichtig, mir den Platz zu merken, um zurückzufinden. Doch so weit sollte es gar nicht kommen. Die Suche da draußen schien ohnehin aussichtslos!
Meine Schwester bekam von alledem nichts mit. Sie schlief ganz seelenruhig zwischen dem Brett des Holzrahmens und der Wand des Zeltes, als ich sie fand. Ein kluges Kind, es war das Beste, was sie in dieser Situation tun konnte.
Am anderen Morgen wurden wir aufgerufen und einem Fahrzeug zugeteilt, das uns reichlich zehn Kilometer weiter zum Ziel nach Barmstedt brachte.
Unsere Gastgeber hatten alles vorbereitet, so dass die Aufteilung auf die Räume schnell vonstatten ging. Mir wurde ein »Gitterbett« zugeteilt, was ich nicht angemessen fand. Ich war ja schon fünfeinhalb Jahre alt. Aber das Bett war groß genug. Das Zimmer war klein und hatte ein kleines, schmales Fenster, das allerdings zur Mauer des Nachbarhauses zeigte. Meine Schwester hatte ihr Bett an der anderen Wand. Unsere Sachen waren schnell untergebracht. Es war ja nicht viel und wir hatten genügend Platz.
Nun begann für mich eine aufregende, interessante und, der Leser wird es nicht glauben, relativ schöne, wenn auch kurze Zeit. Doch Angst und Ungewissheit waren unsere ständigen Begleiter. Eine Vielzahl völlig neuer Eindrücke stürmte auf mich ein. Es gab fast jeden Tag etwas Neues zu entdecken.
Das Haus, in dem wir wohnten, war ein niederdeutsches Bauernhaus, das durch eine riesige Toreinfahrt in zwei Hälften geteilt war. Die Kinder wohnten auf der rechten, etwas schmaleren Seite, auf der sich zwei oder drei Räume befanden. Auf der linken, etwas komfortableren Seite wohnte die Familie meiner Tante. Allerdings schliefen die Kinder in den Räumen auf der rechten Seite. Durch die große Toreinfahrt entstand in der Mitte so etwas wie eine schmale Straße, die auf den Hof führte, der von Stallungen und anderen Wirtschaftsgebäuden flankiert war. Am Ende des ansehnlichen, großen Hofes gab es ein breites Tor, das zu den Marschen führte. Der Hof war gepflastert und hatte in der Mitte, wie üblich, einen großen Dunghaufen, auf dessen Spitze ein Hahn jeden Morgen sein Volk zum täglichen Tun rief.
Das Wohnhaus hatte ein gewaltiges, ziegelgedecktes Dach, das einen sehr geräumigen Boden einschloss. Wahrscheinlich war er teilweise ausgebaut, aber das weiß ich heute nicht mehr sicher.
Zum Essen und für die Notdurft mussten wir über die Toreinfahrt auf die linke Seite gehen.
Obwohl ein Nachttopf vorhanden war, war man gut beraten, die Zeiten für die Notdurft zu trainieren. Es war wahrhaftig kein Vergnügen, zu nächtlicher Stunde bei manchmal klirrender Kälte die Seite zu wechseln, und war es auch nur für eine kurze Zeit.
Es gab viel Aufregung, Spannung, Angst und viel, viel Neues, das ich nicht alles verarbeiten konnte, obwohl ich schon kurz vor der Einschulung stand. Meine Mutter war auf dieser Flucht gerade dreißig Jahre alt geworden.
Gleich nach unserer Ankunft fiel mir natürlich auf, dass man etwas anders sprach und zum Teil auch andere Vokabeln benutzte, was ich sehr lustig fand (z. B. Feudel für Wisch- oder Staublappen). Aber schon nach einigen Tagen hatte ich mich daran gewöhnt und verstand wohl auch bald ausreichend plattdeutsch.
Ich erinnere mich noch sehr lebhaft an die Begegnung mit dem größten Tier, das ich bis dahin getroffen hatte.