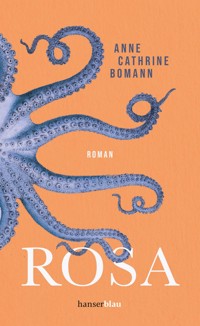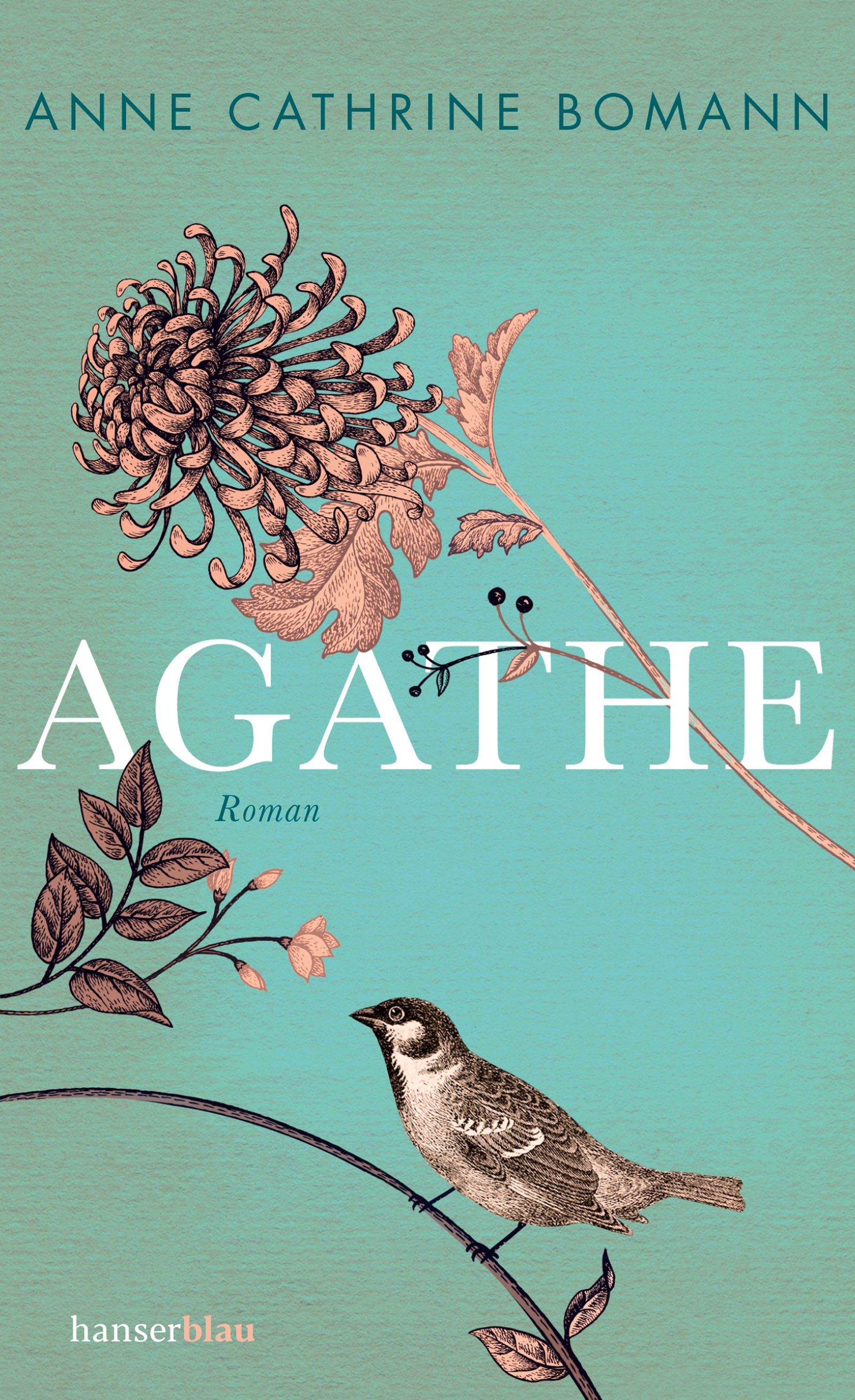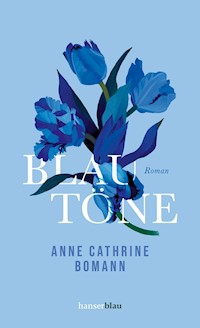
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was wird aus dem Schmerz über einen großen Verlust, wenn wir ein Heilmittel dafür erfinden?
Als Elizabeth ihren Sohn verliert, wendet sie all ihre Energie auf, um ein Medikament gegen die Trauer zu entwickeln. Doch kurz vor der Zulassung stellt sich heraus, dass dieses Medikament unheimliche Nebenwirkungen hat: Es lindert nicht nur Trauer, sondern lässt auch alle anderen Gefühle verkümmern.
Wie bereits in „Agathe“ erzählt Anne Cathrine Bomann von der Wichtigkeit, die tiefe Gefühle und menschliche Nähe für unsere Seele haben. Und dass unser Glück nur dann in allen Facetten schillern kann, wenn wir auch der Trauer ihren Raum geben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
Was wird aus dem Schmerz über einen großen Verlust, wenn wir ein Heilmittel dafür erfinden?Als Elizabeth ihren Sohn verliert, wendet sie all ihre Energie auf, um ein Medikament gegen die Trauer zu entwickeln. Doch kurz vor der Zulassung stellt sich heraus, dass dieses Medikament unheimliche Nebenwirkungen hat: Es lindert nicht nur Trauer, sondern lässt auch alle anderen Gefühle verkümmern.Wie bereits in »Agathe« erzählt Anne Cathrine Bomann von der Wichtigkeit, die tiefe Gefühle und menschliche Nähe für unsere Seele haben. Und dass unser Glück nur dann in allen Facetten schillern kann, wenn wir auch der Trauer ihren Raum geben.
Anne Cathrine Bomann
Blautöne
Roman
Aus dem Dänischen von Franziska Hüther
hanserblau
Für Rita, die uns daran erinnert hat, dass die Liebe wirklich die größte unter ihnen ist.
April 2011
Elisabeth
Elisabeth sah in die Augen der Krankenschwester und versuchte zu begreifen, was diese soeben gesagt hatte. Graue Augen waren es, mit Tupfern von etwas Dunklerem, und wenn sie lange genug hineinstarrte, schien es, als würden sie zu etwas, das jemand verschüttet hatte, zwei trübe Kleckse, die jeden Moment übers Gesicht laufen konnten.
»Obduktion?«, wiederholte sie.
»Ich verstehe, dass das eine schwere Entscheidung ist, aber wenn wir mehr darüber herausfinden wollen, was hier schiefgelaufen ist, dann kann Vinter helfen, ein anderes Kind vor einem ähnlichen Schicksal zu bewahren.« Die Krankenschwester legte Elisabeth die Hand auf den Arm. »Für manche Eltern kann das tragischen Umständen wie diesen ein klein wenig von ihrer Sinnlosigkeit nehmen.«
Endlich blinzelte Elisabeth. Sie wich einen Schritt zurück und schüttelte die übergriffige Hand ab.
»Fassen Sie mich nicht an«, sagte sie. »Und reden Sie gefälligst nicht weiter darüber, meinen Sohn aufzuschneiden. Er liegt direkt da drüben, und noch ist er nicht tot.«
Die Krankenschwester kniff die Lippen zusammen, was ihre Raucherfalten hervortreten ließ, und plötzlich wurde Elisabeth bewusst, wie hässlich sie war, in ihrem unförmigen Kittel, mit den strähnigen Haaren und dem herausgewachsenen Ansatz.
»Danke«, sagte sie und wandte der Schwester den Rücken zu. »Ich möchte jetzt gern allein mit ihm sein.«
Sie trat ans Bett. Vinter war nicht mehr da, so viel stand fest. Zurückgeblieben war nur sein Körper unter der viel zu großen Decke, leicht zusammengekauert in all dem Weiß, umgeben von den Maschinen und deren gleichsam mechanischem Wellenschwappen. Sie merkte, dass sie mal wieder angefangen hatte, im selben Takt zu atmen.
»Mein kleines Herz«, flüsterte sie. »Ich will nicht ohne dich sein.«
Beim Gedanken daran, Vinter hier zurückzulassen, ins Auto zu steigen und wegzufahren, während er dablieb, stach es ihr derart heftig in der Brust, dass sie für einen Augenblick glaubte, den Halt zu verlieren.
So stand sie da und versuchte, an nichts Besonderes zu denken. Die Sekunden einfach wie Wasser an sich herabrinnen zu lassen. Sie streichelte Vinters flaumige Wangen und musste lächeln beim Anblick der kleinen Milchzähne, die sich auf die Unterlippe drückten, fast wie in den Momenten, da er zu Hause vollkommen versunken auf dem Boden saß und malte. Seine Hand lag in ihrer, ohne auf ihren Griff zu reagieren, dennoch hielt sie sie fest.
Mama. Kaum schloss sie die Augen, traf seine Stimme sie mit voller Wucht, Guck mal, ich hab eine Rakete gemalt! Ihr kleiner Junge, den sie über Jahre der Spritzen und Hormonbehandlungen hinweg herbeibeschworen hatte, makellos an der Oberfläche, während unter seiner Brust die Krankheit schlummerte. Ob es leichter gewesen wäre, hätte sie ihn jäh verloren? Durch einen Verkehrsunfall oder einen tragischen Sturz auf dem Spielplatz? Sie vermochte es nicht zu sagen, wusste nur, dass dies das Schlimmste war, was ihr je widerfahren war, das Unmöglichste.
»Ich gehe jetzt, mein Schatz.«
Sie flüsterte ihm ins Ohr, versicherte ihm, dass er keine Angst zu haben brauche. Küsste ihn und strich ihm ein letztes Mal übers Haar. Dann richtete sie sich auf, benommen von monatelanger Angst und Schlafmangel.
Auf dem Gang stieß sie wieder auf die Krankenschwester.
»Sie können die Maschinen jetzt abschalten«, sagte sie. »Aber ihr schneidet ihn nicht auf.«
Die Schwester öffnete den Mund, doch Elisabeth ging an ihr vorbei, Richtung Ausgang. Das Knallen ihrer Absätze wurde gegen die Wände und wie Schläge zurück in ihr Gesicht geworfen.
»Aber wollen Sie denn nicht dabei sein?«, rief die Krankenschwester ihr nach. »Elisabeth, Sie müssen doch dabei sein und sich verabschieden!«
1
September 2024
Shadi
Es war Emil, der Shadi vorgeschlagen hatte, sie solle zum Schreiben doch mal woanders hingehen, statt immer nur zu Hause zu sitzen.
»Glaubst du nicht, es wäre gut, wenn du mal ein bisschen rauskommst?«, meinte er, und sie dachte, dass es ihr schwerfallen würde, sich zu konzentrieren. Wie sich jedoch herausstellt, spornen die Blicke der anderen und ihre arbeitsam gebeugten Rücken sie an. Das panoptische Prinzip. Außerdem haben alle Rituale, die daheim in der Wohnung wie Pfade durch vertrautes Terrain führen, keinen Platz hier, wo alles neu ist.
Sie öffnet das Dokument ihrer Masterarbeit. Ihre erste Aufgabe besteht darin, die Unterschiede zwischen normaler Trauer und der Art Trauer herauszuarbeiten, die vor einigen Jahren eine eigene Diagnose erhalten hat. Die anhaltende Trauerstörung. Laut ICD-Klassifikation müssen für eine solche Diagnose verschiedene Kriterien erfüllt sein. Zunächst einmal muss seit dem Ereignis, das der Trauer zugrunde liegt, mindestens ein halbes Jahr vergangen sein, außerdem muss es sich um einen Todesfall handeln. Anders als sie zunächst gedacht hatte, reichen eine Scheidung oder der Verlust des Jobs also nicht aus, so schlimm es sich auch anfühlen kann.
Im Lesesaal riecht es nach warmen, sonnengebräunten Körpern und Taschen mit Lunchpaketen, die die Leute mit nach draußen in die Aufenthaltsbereiche der Bibliothek oder hinüber in den Park nehmen. Manche schreiben mit Musik in den Ohren, andere legen den Kopf auf den Tisch und dösen, bis sie hochschrecken und sich schuldbewusst umsehen. Ein Typ mit Beanie schnarcht selig zu ihrer Rechten, jemand hat ein Fenster geöffnet, sodass der Wind die groben Vorhänge umspielt. Shadi schaut auf die Uhr und beschließt, ihrem knurrenden Magen zum Trotz erst noch den Abschnitt, an dem sie gerade sitzt, zu beenden. Eine Dreiviertelstunde später nimmt sie die Tupperdose mit den Resten von gestern und begibt sich hinaus ins grelle Licht, ihre Strickjacke hält ihr den Platz frei.
Als sie nach der Pause zurückkommt, geht sie als Erstes in die Teeküche, wo ein anderer aus dem Lesesaal gerade Wasser in zwei ineinandergesteckte Plastikbecher füllt. Er dreht sich zu ihr um und lächelt, wodurch sie sich gezwungen fühlt, stehen zu bleiben.
»Magst du auch?«, fragt er.
»Gern.«
Sie schaut ihm zu, wie er den Wasserkocher viel zu voll macht und wieder einschaltet.
»Schreibst du auch gerade Masterarbeit?«
Sie nickt.
»Psychologie. Du?«
»Politikwissenschaft«, er verdreht die Augen, »ohne Kaffee nach dem Mittagessen geht da gar nichts.«
Er öffnet den Kühlschrank, holt die Plastikflasche heraus, die Shadi am Morgen dort hineingestellt hat, und schenkt sich Milch in den Kaffee. He, will sie sagen. He, was soll das. Aber sie bleibt stumm, steht bloß da und spürt, wie es hinter ihren Lidern kribbelt, als er die Flasche auf den Kopf dreht und die letzten Tropfen herausschüttet.
»So, dann mal zurück in den Glaskäfig.« Er zwinkert ihr zu, aber ihre Miene ist steif. Auf dem Weg aus der Küche tritt er aufs Pedal des Mülleimers und wirft die Flasche, die sie extra im Netto ausgesucht und gestern Abend gespült hat, weg.
»Frohes Schaffen!«
Danach geht es mit dem Schreiben nur stockend voran. Immer wieder spielt sie die Szene aus der Küche im Kopf ab und stellt sich vor, was sie alles hätte sagen sollen. Hey, das ist meine Milch! Jeder andere hätte das schließlich getan, oder nicht? Oder ihm angeboten, sich davon zu nehmen, aber doch bitte etwas übrig zu lassen, dann wäre alles gut gewesen. Warum fallen ihr solche Dinge so schwer?
Allmählich aber findet sie zurück in den Rhythmus, zieht den Stoß Artikel über die Trauerdiagnose aus der Tasche, beugt sich darüber, um die feinen Spuren der Buchstaben auf dem Papier zu entziffern, und macht sich sorgfältig Notizen. Die Stunden verstreichen, der Lesesaal um sie herum leert sich, und als sie irgendwann beschließt, nach Hause zu gehen, sind sie nur noch zu zweit. Shadi und ein schlankes, rothaariges Mädchen in der Ecke, das anscheinend von den Jumborosinen lebt, die es in einem Glas vor sich stehen hat.
Shadi klappt den Laptop zu und streckt ihren verspannten Rücken. Der Ohrwurm, der ihr schon seit Tagen durch den Kopf geht, kehrt zurück, kaum dass sie ihren Gedanken freien Lauf lässt. Wie ging das Lied noch mal? Sie singen es immer bei Familienfesten, wenn sie in seltenen Fällen einmal alle versammelt sind, auch wenn ihre Mutter zu Shadis großem Bedauern weder ihr noch ihrer kleinen Schwester Persisch beigebracht hat, lebt der Rhythmus irgendwo in ihr.
Begleitet von der Melodie wandert sie durch die Stadt nach Hause. Die Sonne hängt prall und schwer über dem Horizont, heute ist ausnahmsweise mal sie diejenige, die als Letzte nach Hause kommt. Emil sitzt mit seinem Laptop auf dem Schoß auf dem Sofa. Sie geht zu ihm, ohne erst die Jacke auszuziehen. Es liegt eine gewisse Macht darin, denkt sie, als sie ihn küsst. Die erwartete Person zu sein. Diejenige, die von draußen hereinkommt und die Luft in Bewegung setzt.
Thorsten
Wenn Thorsten hin und wieder von seinen Notizen aufschaut, spürt er die Septembersonne wie eine behaglich warme Hand an seiner Wange. Im Unipark, der sich vor dem Fenster erstreckt, sitzen die Studierenden in Grüppchen auf dem Gras, und gelegentlich dringen ihre Rufe bis in sein Büro. Es wäre eine nette Abwechslung, sich zum Plaudern zu ihnen nach draußen zu setzen, aber für derlei Dinge findet er nur noch selten Zeit, außerdem erwartet er Besuch.
Wenn er die Stichpunkte liest, die er sich nach dem ersten Treffen mit Birgit gemacht hat, kann er sich mühelos vor Augen führen, wie sie damals aussah. Nicht ihre Kleidung oder ihre Frisur, für derlei Dinge hat er wenig Sinn, aber die gebeugte Körperhaltung, die sie um Jahre älter wirken ließ, als sie eigentlich war, und die Art, wie sie immerzu ihr Papiertaschentuch faltete. Es scheint sich nicht viel geändert zu haben, denkt er, als er den Kopf durch die Tür steckt und sie auf der Bank sitzen sieht. Ihre Hände zittern leicht, all ihre Bewegungen sind zögerlich, wie in der Zeit gedehnt. Als sie endlich ihre Sachen zusammengesucht hat, führt er sie zum Sofa.
»Da wären wir wieder«, sagt er mit einem Lächeln, doch Birgits einzige Antwort ist ein undefinierbares Zucken im Gesicht. »Kann ich Ihnen etwas anbieten? Hiervon vielleicht?«
Er reicht ihr die Keksdose.
»Heute ist unser letzter Termin. Ausnahmsweise gibt es also mal keine Fragebögen auszufüllen, nur ein kurzes Gespräch, um das Ganze abzurunden.«
Sie nickt. Der Vanillekringel ist ein Fremdkörper in ihrer Hand, sie sitzt zusammengesunken auf dem Sofa, und Thorsten kann nicht anders, als sie mit seiner Mutter zu vergleichen, die etwa im selben Alter ist, aber eine völlig andere Vitalität ausstrahlt.
»Ich möchte noch mal betonen, wie froh wir sind, dass Sie an unserem Projekt teilgenommen haben«, sagt er. »Es wird für etliche Menschen von großer Bedeutung sein. Wir arbeiten auf Hochtouren daran, Ihre Aufgaben und die der übrigen Teilnehmer zu analysieren, und werden in Kürze erste Ergebnisse haben.«
»Und dann sehen Sie, ob die Tabletten wirken?«
Birgits Unterlider sind rotgerändert, als würden sich ihre Bindehäute nach außen kehren. Thorsten findet, sie sieht krank aus, allerdings war das in der gesamten Zeit, die er sie kennt, nie anders.
»Ja«, antwortet er, »und vor allem, wie sie wirken. Besonders interessiert uns ja, was bei Einnahme der Tabletten im Gehirn passiert und wie sie die Art, wie man trauert, beeinflussen.«
Jetzt registriert Birgit offenbar den Keks in ihrer Hand. Sie beißt hinein, die Kiefer bewegen sich wie durch einen unsichtbaren Motor betrieben, der jederzeit stehen bleiben kann, sie sieht furchtbar müde aus. Thorsten würde gern etwas für sie tun, weiß aber nicht was, und so schenkt er ihr in Ermangelung etwas Besseren ein Glas Wasser ein.
»Sobald alles fertig bearbeitet ist, schreiben wir Ihnen, dann können Sie selbst lesen, zu welchen Ergebnissen wir gekommen sind. Weder Sie noch ich wissen ja, ob Sie ein Placebo oder das Medikament erhalten haben, aber …«
Birgit fährt ihm dazwischen, mit einem Mal ist ihr Blick hellwach, bohrt sich in seinen: »Wenn ich die echte Tablette gekriegt habe, kann ich Ihnen versichern, das Zeug wirkt nicht!«
Thorsten nickt.
»Kjelds Tod belastet Sie nach wie vor stark?«
Sie wischt sich einen Krümel von der zitternden Unterlippe.
»Es ist völlig unverändert.«
Thorsten beugt sich auf dem Stuhl nach vorn. Sie unterscheiden sich so stark, die Abschlussgespräche. Letzte Woche hat er mit einem jungen Mann gesprochen, der Schokolade mitgebracht hatte und ein ums andere Mal wiederholte, wie dankbar er sei, am Projekt teilgenommen zu haben. Aber es liegt in der Natur der Sache, dass es auch enttäuschte Teilnehmer gibt, für die nun eine weitere Hoffnung geplatzt ist.
»Das tut mir leid«, sagt er. »Darüber sollten Sie mit Miguel sprechen. Von ihm werden Sie erfahren, ob Sie Callocain erhalten haben oder nicht.« Er hebt die Hand, um Birgit zu signalisieren, dass er verstanden hat, wie sie über die Sache denkt. »Er kann Sie dann auch beraten, welche Möglichkeiten es im Weiteren für Sie gibt. Birgit, Sie werden die Hilfe bekommen, die Sie brauchen. Versprochen.«
Als sie gegangen ist, öffnet Thorsten das Fenster. Er hat noch ein paar Minuten bis zum Gespräch mit Mikkel, dem letzten Teilnehmer auf der Liste, bevor sein Part der Trauerstudie endgültig abgeschlossen ist. Alle Tests wurden durchgeführt, er selbst hat mit knapp zweihundert der beinahe vierhundert Teilnehmer gesprochen, und auch wenn es im Verlauf oft kleinere Probleme gab, wie immer bei der Durchführung von klinischen Studien, sind sämtliche Erwartungen übertroffen worden.
Nicht genug damit, dass es sich um die erste Studie ihrer Art auf dem Feld der Trauerforschung handelt, sie zeichnet sich zudem durch die Eigenschaft aus, der er in seinem Arbeitsleben den größten Wert beimisst: Sie bedeutet etwas. Ja, diese Aussage wagt er bereits jetzt zu treffen, denn ungeachtet der Befunde werden die dank der Studie gewonnenen Erkenntnisse bedeutsam dafür sein, wie Menschen mit anhaltender Trauerstörung zukünftig gesehen und verstanden werden. Diese Studie wird dazu beitragen, die Therapiestandards von Trauer zu verändern, und wenn das nichts ist, wofür es sich lohnt zu arbeiten, dann weiß er auch nicht.
Er wirft einen Blick auf den Gang, aber der ist noch immer leer, und nachdem er einige weitere Minuten gewartet hat, sucht er Mikkels Nummer aus der Teilnehmerliste heraus. Er wird direkt mit der Mailbox verbunden. »Hallo, Mikkel, Thorsten Gjeldsted von der Universität Aarhus hier. Ich rufe an, weil wir einen Termin um halb zwei hatten. Ich bin die nächsten Stunden im Büro, falls Sie die Nachricht rechtzeitig abhören, können Sie gern noch vorbeischauen. Ansonsten versuche ich es in den nächsten Tagen noch mal. Bis dann!«
Mikkels Geschichte gehört zu denen, die Thorsten am stärksten beeindruckt haben. Er und seine kleine Familie waren in einen Unfall im Silkeborgvej verwickelt, und wenige Tage darauf erlag zuerst Thorstens Freundin ihren Verletzungen, dann die neugeborene Tochter des Paares. In einem der Vorgespräche hatte Mikkels Schwester Louise ihren Bruder als allseits beliebten und sozial engagierten jungen Mann mit etwas zu viel Energie beschrieben. Genau wie Louise hatte Mikkel ihre schwierige Kindheit erstaunlich gut überwunden. Nach dem Unfall aber ging es stetig bergab. Schließlich verlor er aufgrund der vielen Krankmeldungen seinen Job als Erzieher, und zu Beginn der Trauerstudie kam er im wahrsten Sinne des Wortes kaum aus dem Bett.
Ein Windstoß wirbelt die Unterlagen auf dem Schreibtisch auf, und Thorsten schließt das Fenster. Seiner Auffassung nach hat sich Mikkels Befinden während der letzten Monate deutlich gebessert, dennoch würde er das Ganze gern in einem abschließenden Gespräch zu Ende führen. Zudem besteht bei Trauernden ein erhöhtes Suizidrisiko, und auch wenn es im Rahmen der Trauerstudie bisher zum Glück keinen Todesfall gegeben hat, ist dies stets sein erster Gedanke, wenn jemand einem Termin fernbleibt. Bevor er an diesem Nachmittag sein Büro verlässt, versucht er es daher ein weiteres Mal bei Mikkel. Aber es geht noch immer niemand ran.
Anna
Irgendetwas kitzelt Anna am Hals. Ohne die Augen zu öffnen, wühlt sie sich tiefer in ihr warmes Nest aus Decken, doch da ist es schon wieder, diesmal an ihrer nackten Schulter. Unwirsch schlägt sie mit der Hand danach.
»Guten Morgen!«
Sie blinzelt sich den Schlaf aus den Augen. Die Art Unwohlsein, die auf zu viele Drinks und viel zu wenig Schlaf folgt, überkommt sie wie ein spontaner Anfall von Seekrankheit.
»Du siehst aus, als hättest du einen üblen Kater.«
Er lächelt und sieht eigentlich ganz schnuckelig aus mit den dunklen Korkenzieherlocken. Sie hat keinen Schimmer, wie er heißt.
»Wie kannst du so fit sein?«, gähnt sie und überlegt, ob sie in der Lage ist, erneut mit ihm Sex zu haben, bevor er geht. Er stützt sich auf den Ellbogen und gibt ihr einen Kuss.
»Du hast heute Nacht im Schlaf geredet«, sagt er. »Irgendwas von deiner Mutter. Weißt du noch, was du geträumt hast?«
Anna schüttelt den Kopf. Die Nacht ist auf schwarzen Schlaf reduziert, so wie es ihr am liebsten ist. Aber es passt ihr nicht, dass ein Fremder sie im Schlaf hat reden hören, sie dabei vielleicht sogar angestarrt hat. Das Gesicht verrät einen, wenn man schläft, so viel weiß sie.
Auf dem Weg ins Bad ärgert sie sich darüber, dass sie immer nackt schläft. Sie muss sich angewöhnen, einen Slip bereitliegen zu haben, falls sie wieder jemanden mit nach Hause nimmt.
»Wollen wir zusammen frühstücken?«, ruft er ihr nach.
»Sorry, geht leider nicht. Ich muss in einer halben Stunde in der Uni sein, also …« Sie schließt die Tür und lässt sich aufs Klo plumpsen.
»Wie wär’s dann mit ner gemeinsamen Dusche?«, hört sie ihn von draußen rufen. »Oder wenigstens ein paar Kindern? Reihenhaus in der Vorstadt?«
Nachdem sie sich kaltes Wasser ins Gesicht gespritzt hat, wickelt sie sich in ein Handtuch und geht zu ihm in den Flur, wo er sich gerade die Schuhe anzieht.
»Wo wohnst du?«, fragt sie, und er wirft die Locken zurück.
»Beim Tousparken.«
Er greift nach seiner Jacke, meidet ihren Blick. Da tut er ihr doch ein bisschen leid.
»Magst du einen Apfel oder so?« Sie schlurft in die Küche und schaut in die leere Obstschale.
»Nein danke, passt schon.«
»Alles klar.« Sie geht wieder zu ihm in den Flur. »Es liegt nicht an dir, ich bin einfach ein bisschen komisch, ich hab’s nicht so mit Nachspiel.«
Einen Moment lang stehen sie da und schauen sich an, dann legt er die Hand auf die Türklinke.
»War jedenfalls schön heute Nacht. Mach’s gut.«
Sie lächelt ihn an, schließlich kann er nichts dafür, dass sie im Schlaf redet.
»Und grüß deine Mutter!«
Die Worte hängen im Treppenhaus, bis die Tür hinter ihm zufällt und das Echo zerschlägt.
Eine halbe Stunde später macht sie sich auf den Weg, es ist das erste Mal seit Wochen, dass sie an einem Vormittag in etwas anderem als ihrer Everlast-Trainingshose aus dem Haus geht. Das Fahrrad knarzt unter ihr, der erste Gang hat den Geist aufgegeben, aber sie kämpft sich halb in die Pedale gestellt bergan, bis sie beim Gamle-By-Freilichtmuseum in die Vestre Ringgade biegt. Die ersten Schweißtropfen rinnen ihr zwischen den Brüsten hinab, als sie ihr Rad vor dem Institut für Psychologie abstellt.
»Klopf, klopf.«
Thorsten sitzt an seinem überfrachteten Schreibtisch, offenbar versunken in die vor ihm ausgebreiteten Papiere.
»Anna!«, ruft er, als er sie bemerkt. »Das ist ja eine Überraschung!«
»Ich bin gerade vorbeigekommen, und da dachte ich, wir könnten über meine Masterarbeit reden, falls du kurz Zeit hast.«
Thorsten nimmt die Brille ab und legt sie auf einen freien Fleck auf der Fensterbank.
»Na, du hast heut Nacht wohl einen draufgemacht«, stellt er fest. »Soll ich uns erst mal einen Kaffee holen?«
Sie setzt sich in den abgewetzten Sessel und schaut sich um. Falls überhaupt möglich, ist es hier noch chaotischer als bei ihrem letzten Besuch irgendwann vor den Sommersemesterferien. Auf sämtlichen Flächen stapeln sich Fachbücher und Nachschlagewerke, und der muffige Geruch nach Druckerschwärze erinnert sie an die Schulbibliothek damals.
»Ich dachte, ich könnte doch über die Trauerdiagnose schreiben«, sagt sie, als er zurückkommt. »Kritisch, natürlich.«
Er stellt zwei Becher auf den niedrigen Couchtisch, schiebt ein paar Ordner zur Seite und sinkt in den Sessel ihr gegenüber. Der Kaffeeduft lässt ihren leeren Magen grummeln.
»Trauer?« Er kneift die Augen zusammen. »Ist das eine gute Idee?«
»Warum nicht?«, erwidert sie, fährt jedoch fort, ohne seine Antwort abzuwarten: »Und, bist du dabei?«
Zu ihrer Verblüffung schüttelt er den Kopf.
»Das wird leider nichts, Anna, du bist zu spät dran. All meine Betreuungsstunden sind schon belegt, das geht bei dem ganzen Top-Down-Management ziemlich schnell. Ich darf keine weiteren Abschlussarbeiten betreuen, so gern ich auch möchte.«
»Dein Ernst?«
Diese Möglichkeit war Anna gar nicht in den Sinn gekommen. Thorsten zu fragen, hatte sie im Grunde als reine Formalität erachtet.
»Ich könnte ja mal Svend fragen, ob er es machen würde«, schlägt sie vor, ohne es wirklich ernst zu meinen.
»Du kannst es probieren«, sagt Thorsten, »ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es bei ihm ähnlich aussieht. Wegen der Trauerstudie haben wir dieses Semester alle nur wenig Zeit. Du bist zu spät dran.«
»Danke, das sagtest du schon.«
Sie beugt sich vor und stützt ihren brummenden Kopf einen Moment lang in die Hände, dann richtet sie sich wieder auf.
»Kacke.« Anscheinend hat sie im Moment aber auch gar kein Glück. »Mein Antrag beim Studienausschuss wurde auch gerade abgelehnt. Ich muss Neuro wiederholen.« Sie hält den Blick gesenkt, damit Thorsten nicht sieht, wie ihr die Tränen in die Augen schießen. Sie schnieft laut. »So eine Scheiße.«
Die Federn des Sessels geben nach, und im nächsten Moment steht er neben ihr und reicht ihr eine rote Serviette mit irgendeinem beknackten Weihnachtsmotiv. Sie schnäuzt mitten in die Engelsflügel hinein.
»Das wird schon«, sagt er und tätschelt ihr den Arm.
Sie schneidet eine Grimasse. Im Augenblick fühlt es sich jedenfalls nicht so an. Sie war fest davon ausgegangen, dass man sie bestehen lassen würde, schließlich hat sie alle Leistungen erbracht, das einzige Problem waren die vielen Fehlzeiten.
»Lass uns mal überlegen«, meint Thorsten. »Vielleicht könntest du dich mit jemandem zusammentun, wie heißt sie noch gleich …« Er kramt in den Papierstapeln auf dem Schreibtisch und zieht einen Block heraus, den er gegen das Licht hält, um besser sehen zu können. »Shadi. Sie schreibt auch über Trauer. Wer weiß, vielleicht könnt ihr ja sogar voneinander profitieren. Das wären nur ein, zwei Betreuungsstunden mehr für mich, die kriege ich bestimmt irgendwie in die Excel-Datei geschmuggelt.«
Anna verdreht die Augen. Sie kennt Shadi, sie hatten ein paar Seminare zusammen. Am besten erinnert sie sich an sie aus Statistik, wo Shadi auf fast schon unheimliche und zugleich so heruntergespielte Weise geglänzt hat. Sie ist der Typ, der es gernhat, wenn die Dinge aufgehen, dafür hat Anna sie noch nicht einmal eine eigene Meinung in dem Fach formulieren hören, das sie seit bald fünf Jahren studiert.
»Ich glaube, da schlage ich mich lieber mit Svend rum.«
»Du könntest auch überlegen, ein anderes Thema zu nehmen«, sagt Thorsten. »Ich will mich ja nicht einmischen, aber …«
»Dann lass es«, schneidet sie ihm das Wort ab. »Mir fällt schon was ein.«
Sie zielt mit der zusammengeknüllten Serviette auf Thorstens Mülleimer und landet einen festen Treffer genau gegen die obere Innenkante. Mit einem großen Schluck leert sie ihren Becher, dieses Gespräch läuft so was von gar nicht nach Plan.
»Ich meine, sie sitzt drüben in der Bibliothek und schreibt, falls du sie noch erwischen willst.«
»Au, fuck!« Entnervt stellt Anna den Becher ab, der Kaffee rinnt brennend ihre Kehle hinab. »Was hast du gesagt? Wer sitzt in der Bib?«
April 2011
Elisabeth
Während der ersten Tage war Elisabeth stumm. Ihr Kopf war leer, sie hatte keine Tränen, und als ihre Sinne sich wieder regten und sie sich in Vinters Bett liegend fand, das Gesicht in seine Decke gedrückt, in seinem Duft, schmerzte es so sehr, dass sie wünschte, sie wäre nie erwacht.
Seit dem Tag seiner Geburt hatte sie in der Angst gelebt, ihn zu verlieren. Viel zu früh, still und blau war er auf die Welt gekommen, und diese Blautöne tauchten ihr Leben in besonderes Licht. Die erste Operation erfolgte unmittelbar nach der Geburt, es dauerte lang, bis sie ihn mit nach Hause nehmen konnte. Irgendwann jedoch durfte sie seinen kleinen Körper mit den durchsichtigen Fingernägeln und dem flackernden Puls an ihre Brust legen. Sie pustete Wärme in ihn hinein, betete dafür, dass sein Herz stark genug würde, um aus eigener Kraft zu schlagen, doch erst als sie eines Tages all den bekannten Gesichtern auf der Station zum Abschied winkte und mit ihrem Sohn im Arm hinaus zu ihrem Auto wankte, erst da wagte sie ernstlich daran zu glauben, dass es ihn gab.
Sie taufte ihn Vinter, obwohl er im Frühling gekommen war, wegen seiner bleichen Haut und weil sie seine Zehen und die winzigen Fingerchen massieren musste, um das Blut zum Zirkulieren zu bringen.
Nala lag apathisch am Fußende. Es war nicht zu sagen, ob die Hündin etwas spürte oder ob Elisabeths Zustand auf sie abfärbte. In jener Zeit ließ sie das Tier nur in den Garten, sie war kaum imstande, die einfachsten Bewegungen auszuführen, um Nala zu füttern oder das trübe Wasser in der Schüssel zu wechseln. Alles schmerzte. Sie fühlte sich, als hätte sie Grippe. Trauer ist wie Gicht, dachte sie, Trauer ist eine Krankheit, die einen zerfrisst. Das Telefon klingelte, aber sie ging nicht ran. Lag bloß im Bett, strich Nala zuweilen über den Kopf, erwiderte den braunen Blick der Hündin und schloss wieder die Augen.
So vergingen Wochen. Sie überstand die Beerdigung, ohne so recht zu wissen, wie, spürte die Bewegung ihrer Beine, den harten Stuhl und die an sie gedrückten Körper. Im Büro hatten sie ihr einen Monat freigegeben, einfach so, und sie war dankbar dafür. Kurz dachte sie an ihre laufenden Projekte und den Bericht, dessen Deadline am Tag nach Vinters Tod gewesen wäre. Dann schob sie den Gedanken beiseite.
Irgendwann begann sie, durchs Haus zu wandern. Zwang sich, bei der Spielzeugkiste stehen zu bleiben, bei Vinters Stuhl am Esstisch und der Plastikunterlage auf dem Wohnzimmerboden, auf der er so gern zum Malen gesessen hatte. Abends ging sie früh mit eingeschaltetem iPad ins Bett. Vinters Decke, in der sie lebte und atmete, roch schließlich nicht länger nach ihm. Sie hatte seinen Duft aufgebraucht.
Eines Sonntagabends war der erste Monat vergangen. Die Erde auf dem Grab war gesackt, der Stein, der nicht länger der jüngste auf dem Friedhof war, hatte in Regen und Wind gestanden.
»Komm«, sagte sie zu Nala, die zunächst nicht von Vinters Bett springen wollte. »Na komm, wir gehen jetzt.«
Behutsam zog sie das Bett ab, faltete die Decke ihres Sohnes zusammen, drehte die Heizung auf eins herunter und schloss die Tür hinter sich.
An diesem Abend lief ein Reh durch den Garten. Elisabeth stand bei der Mülltonne, hatte gerade den Sack mit der Bettwäsche weggeworfen, als sie es hörte. Ein trommelnder, fremder Laut, der vom Gras gedämpft wurde. Das Tier blieb vielleicht zehn Meter entfernt von ihr stehen. Mit halb abgewandtem Kopf verharrte es dort in der Dunkelheit, sie meinte, es atmen zu hören. Keiner von ihnen rührte sich. Mein kleiner Junge ist tot, dachte sie. Und ich habe mich selbst zum Weiterleben verdammt. Vielleicht hatte sie eine unbewusste Regung gemacht, denn mit einem Mal setzte sich das Tier in Bewegung und verschwand in wildem Lauf Richtung Wald.
2
September 2024
Shadi
»Shadi?«
Die Stimme ist rau und viel zu laut für die konzentrierte Stille im Lesesaal. Shadi steckt mitten in einer Gedankenkette über die Trauer als notwendige Kehrseite der Liebe, und die Unterbrechung trifft sie wie ein Schlag gegen den Hinterkopf.
»Du bist doch Shadi, oder?«
Hastig dreht sie sich um und bedeutet dem Mädchen, leise zu sein. Anna heißt sie, Shadi kennt sie aus ihrer Stammgruppe. Mit dem bauchfreien Top und Resten von Pink in den kurzen Haaren sieht sie aus, als käme sie direkt von einem Festival. Shadi hat zwar noch nie mit ihr gesprochen, trotzdem hat sie eine ziemlich genaue Vorstellung davon, wie sie ist. Sie gehört zu denen, die immer noch an den Lerngruppen festhalten, in die sie zu Anfang des Studiums von den Dozenten gesteckt wurden, weil sie leidenschaftlich bis spät in die Nacht über Simone de Beauvoir diskutiert, dabei selbstgedrehte Zigaretten raucht und die Machtstrukturen des Patriarchats verbal auseinandernimmt. So eine, die in den Seminaren eine viel zu große Klappe hat, aber vergisst, für die Klausuren zu lernen.
Gerade sieht sie ziemlich fertig aus. Ihre Augen sind blutunterlaufen, und selbst aus der Entfernung meint Shadi eine Fahne zu riechen.
»Komm mit raus«, flüstert sie.
Auf dem Weg folgen ihnen böse Blicke der anderen Studierenden. Shadi hasst es selbst, wenn jemand die Ruheregel bricht.
»Was ist?«, fragt sie, als die Tür hinter ihnen zugefallen ist.
»Wollen wir uns nicht irgendwohin setzen?«, fragt Anna, und Shadi führt sie in die Küche. Die Stühle schrappen über den Betonboden, als sie sich setzen.
»Du weißt, wer ich bin, oder?«, fährt Anna fort. Shadi nickt. »Gut. Ich hab eben mit Thorsten wegen meiner Masterarbeit gesprochen, und wie es aussieht, bin ich ein bisschen spät dran. Das heißt, er kann mich nicht betreuen. Jedenfalls nicht allein. Wenn ich aber mit jemandem zusammen schreibe, den er schon angenommen hat …«
Der Satz ist ein Haken mit einem glitschigen Wurm, den Shadi nicht schlucken mag. Statt Annas Blick zu erwidern, konzentriert sie sich auf den Ring von Emil, dreht ihn in einem fort am Finger.
Anna seufzt. »Also pass auf. Du schreibst über Trauer, ich schreibe über Trauer, wenn wir uns zusammentun, können wir uns Thorsten teilen. Ich habe meine Bachelorarbeit bei ihm geschrieben, und das war die beste Betreuung, die ich je hatte.«
»Tut mir leid«, presst Shadi hervor. Zum Glück klingt sie entschiedener, als sie sich fühlt. »Ich schreibe am besten allein. Außerdem hab ich schon angefangen.«
Sie schielt zu Anna, schaut hastig wieder weg. Dieser Blick.
»Wie lautet deine Fragestellung?«
»Die ist noch nicht ganz ausformuliert.« Shadis Beine rutschen unter dem Tisch herum, obwohl sie sich bemüht, still zu sitzen. »Ich dachte, ich schaue mir die Gründe an, warum die Trauerdiagnose eingeführt wurde, obwohl es so viel Widerstand gab. Und dann diskutiere ich die Vor- und Nachteile, sowohl ethisch als auch aus fachlich-psychologisch und eher pragmatischer Sicht.«
»Pragmatisch?« Anna speit das Wort geradezu aus. »Was meinst du denn bitte damit?«
Shadi schluckt, versucht, die richtigen Worte zu finden.
»Viele, die jetzt eine Trauerstörung diagnostiziert bekommen, hatten ja vorher auch schon eine Diagnose, nur hieß es da eben Belastungsreaktion oder Depression. Vielleicht ist es sinnvoller, die Dinge beim Namen zu nennen. Dann ist es für die Leute einfacher, die richtige Behandlung zu bekommen.«
»Perfekt!« Anna klatscht in die Hände. »Führen wir doch am besten auch eine Diagnose für Obdachlosigkeit ein, dann können wir den Leuten helfen, eine Wohnung zu finden!«
Shadi traut sich nicht, ihr zu sagen, dass diese Diagnose bereits im Z-Register aufgeführt ist.
»Manche zerbrechen völlig daran«, murmelt sie.
»Aber das heißt doch nicht, dass sie krank sind!« Annas Stimme hat einen metallenen Klang angenommen, in ihren graublauen Augen blitzt etwas Wildes. »Sie sind bestimmt einsam, vielleicht haben sie vorher schon mal jemanden verloren, oder sie haben mit anderen Dingen zu kämpfen, und jetzt hat es ihnen den Boden unter den Füßen weggerissen. Aber ob jemand vulnerabel ist oder psychisch krank, das ist ein himmelweiter Unterschied!«
»Da siehst du’s«, murmelt Shadi und steht auf, um ein bisschen Abstand zu bekommen. »Wir wollen nicht mal dieselbe Arbeit schreiben.«
Anna steht ebenfalls auf. Sie ist größer als Shadi, und jetzt, da sie einander gegenüberstehen, wird Shadi bewusst, dass sie wohl auch ein paar Jahre älter ist.
»Schön!« Anna sieht nicht aus, als ob sie es auch nur im Entferntesten schön fände. »Na dann viel Spaß mit deinem pragmatischen Projekt. Herzlichen Dank für nichts!«
Nachdem Anna gegangen ist, bleibt Shadi einen Moment in der Küche allein. In ihren Füßen prickelt es, als wäre sie mit knapper Not einem auf sie zurasenden Auto ausgewichen.
Doch auf dem Weg zurück in den Lesesaal sieht sie Anna wieder. Sie steht ein Stück den Gang hinunter an die Wand gelehnt und telefoniert. Als sie die Stimme hebt, kann Shadi hören, was sie sagt: »Deshalb hab ich doch ein Attest bekommen! Ich kapiere nicht, wie ihr mich in dem Fach durchfallen lassen könnt. Ihr zerstört Leben!«
Zurück im Lesesaal sinkt Shadi auf ihren Platz und versucht, sich daran zu erinnern, wo sie stehen geblieben war, aber sie ist viel zu aufgewühlt. Da sieht sie, dass eine Mail von Thorsten gekommen ist. Rasch überfliegt sie die Nachricht, schließt die Augen und legt den Kopf in den Nacken. Er war es also, der Anna geraten hat, sich an sie zu wenden. Wie Thorsten schreibt, wäre es eine große Hilfe, wenn Shadi eine Zusammenarbeit in Erwägung ziehen würde. Die Mail schließt mit den Worten, Es ist natürlich dein gutes Recht, Nein zu sagen, aber das stimmt ja nicht.
Ihr Hals schnürt sich zusammen. Nicht genug damit, dass Anna sie hasst, Shadi hat sich auch, ohne es zu wissen, dem Wunsch ihres Betreuers direkt widersetzt. Mechanisch beginnt sie, ihre Sachen zusammenzupacken, heute bringt sie sowieso nichts mehr zustande. Wenn es angeblich so gesund ist, Grenzen zu setzen, denkt sie und schaltet die Leselampe aus, warum fühlt es sich dann dermaßen mies an?
Thorsten
»Oh, hallo.« Thorsten betritt den Besprechungsraum, in dem Elisabeth, die Forschungsleiterin von Danish Pharma, bereits Platz genommen hat. »Sie sind heute also auch noch mal dabei?«
Elisabeth hat sie bei der Trauerstudie beraten und an einigen der Besprechungen teilgenommen. So eine Zusammenarbeit zwischen Universität und Industrie ist höchst ungewöhnlich, war jedoch eine der Bedingungen dafür, dass die Universität Aarhus bereits in einer solch frühen Phase das neue Trauermedikament untersuchen durfte. Und obwohl Thorsten anfangs dagegen war, muss er einräumen, dass bis jetzt alles reibungslos verlaufen ist.
Elisabeth schaut von ihrem Smartphone auf und grüßt ihn.
»Soweit ich informiert bin, steht ihr kurz vor dem Abschluss«, sagt sie. »Für meinen Teil dürfte es also das letzte Mal sein.«
Thorsten wählt einen Platz an der Längsseite aus. Elisabeth hat sich ans Kopfende gesetzt, und Kamilla, seine Chefin, möchte mit Sicherheit an das andere Ende.
»Wer war eigentlich die junge Frau, mit der Sie da vorhin gesprochen haben?«, fragt Elisabeth. »Groß, kurze Haare, sehr passioniert?« Sie weist mit dem Kinn zum Gang, und auf einmal durchbricht ihr Lächeln die Aura fast schon übertriebener Professionalität, die sie für gewöhnlich ausstrahlt. »Ich habe mehrere Stunden im Büro neben Ihrem gesessen, das Gespräch war kaum zu überhören.«
»Ah, das muss Anna gewesen sein«, sagt Thorsten, »eine meiner Studierenden. Sie hat manchmal eine ziemlich große Klappe. Immer kontra, Sie wissen schon.«