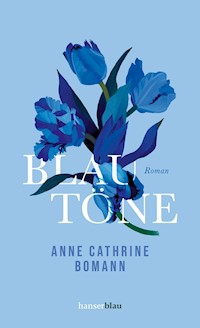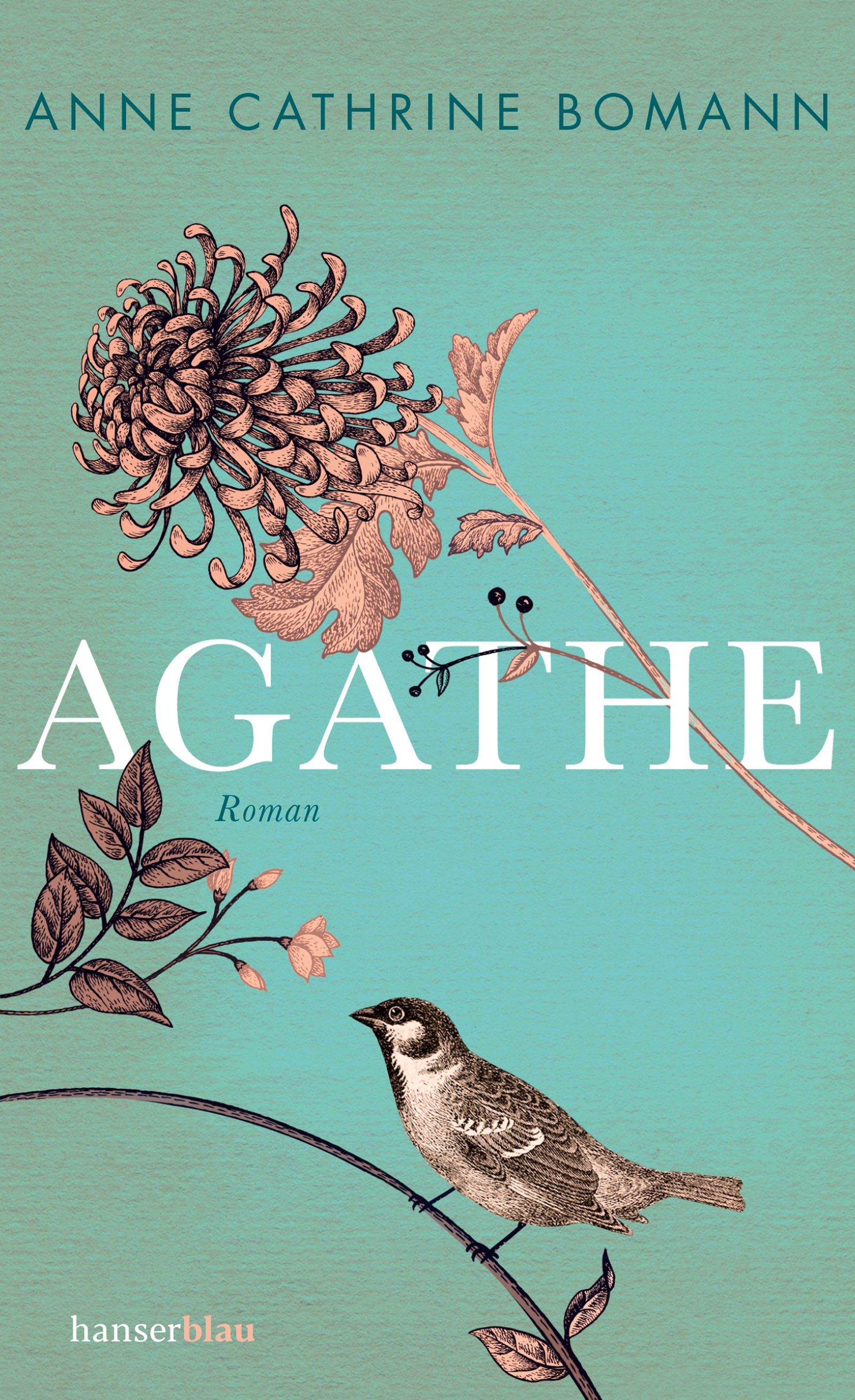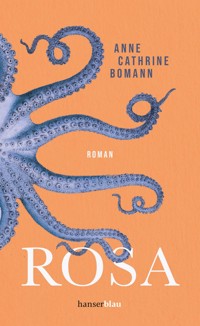
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Rosa“ widmet sich den großen Fragen des Lebens – tiefgründig, lebensklug und wunderbar leicht
Vigga, Ende zwanzig, lebt in ihrem eigenen kleinen Kosmos. Einzig ihre lebenslustige, aufgeschlossene Freundin Maiken schafft es immer wieder, sie aus ihrer Komfortzone zu locken. Als diese schwanger wird, fürchtet Vigga, dass nun alles anders wird, und zieht sich zurück. Zur selben Zeit begegnet sie in einem Aquarium in Kopenhagen dem Oktopus Rosa. Fasziniert von dem intelligenten, einzelgängerischen Wesen hinter Glas, beginnt sie, Rosa täglich zu besuchen, und ein zartes Band zwischen Mensch und Tier entsteht. Durch Rosa erkennt Vigga: Ohne Strömung und Bewegung ist es unmöglich zu leben. Und so beschließt sie, ihr Leben neu anzugehen.
Ein mitreißend erzählter, tiefgründiger Roman, in dem sich Anne Cathrine Bomann wie in ihrem Bestseller Agathe den großen Fragen des Lebens widmet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 194
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
»Rosa« widmet sich den großen Fragen des Lebens — tiefgründig, lebensklug und wunderbar leichtVigga, Ende zwanzig, lebt in ihrem eigenen kleinen Kosmos. Einzig ihre lebenslustige, aufgeschlossene Freundin Maiken schafft es immer wieder, sie aus ihrer Komfortzone zu locken. Als diese schwanger wird, fürchtet Vigga, dass nun alles anders wird, und zieht sich zurück. Zur selben Zeit begegnet sie in einem Aquarium in Kopenhagen dem Oktopus Rosa. Fasziniert von dem intelligenten, einzelgängerischen Wesen hinter Glas, beginnt sie, Rosa täglich zu besuchen, und ein zartes Band zwischen Mensch und Tier entsteht. Durch Rosa erkennt Vigga: Ohne Strömung und Bewegung ist es unmöglich zu leben. Und so beschließt sie, ihr Leben neu anzugehen.Ein mitreißend erzählter, tiefgründiger Roman, in dem sich Anne Cathrine Bomann wie in ihrem Bestseller Agathe den großen Fragen des Lebens widmet.
Anne Cathrine Bomann
Rosa
Roman
Aus dem Dänischen von Franziska Hüther
hanserblau
Es saust in den Ohren von Tiefe oder Höhe. Das ist der Druck von der andern Seite der Wand.
Tomas Tranströmer
Oktopus, schreibe ich, ich schreibe: Achtfuß. Von altgriechisch okto, acht, und pous, Fuß, aber normalerweise spricht man bei Tintenfischen von Armen, nicht von Füßen. Die Arme eines Oktopus können sich frei in alle Richtungen bewegen, mit tänzerischer Anmut. Die äußersten Saugnäpfe sind winzig klein, werden zur Mitte hin größer.
Inzwischen ist es Abend, vor mir türmen sich die Bücher. Mir läuft die Zeit davon. Deshalb blättere ich zu einer leeren Seite in meinem Notizbuch. Ich beginne zu schreiben, auf etwas zu, das ich noch nicht bereit bin zu begreifen. Ich schreibe: Mit ihren acht Armen gehören Oktopusse innerhalb der Tintenfische zu den Kraken (anders als Sepien und Kalmare, die über zehn Arme verfügen.) In Experimenten wurde festgestellt, dass ein Oktopus seine Arme mittels der Augen dirigieren kann. Es scheint jedoch ebenso natürlich für ihn, die Arme eigenständig umhertasten und Entscheidungen treffen zu lassen, zum Beispiel wenn er den Weg durch ein Labyrinth finden muss, und am schnellsten geht es, wenn beides gleichzeitig geschieht. In diesem Fall erfolgen offenbar zwei Arten von Kognitionen simultan: eine eher übergeordnete Kontrollfunktion, welche die Bewegungsrichtung mithilfe der Augen steuert, und ein lokaler Feinprozess in den Armen selbst.
Denn obwohl Kraken wie Menschen ein zentrales Gehirn besitzen, befindet sich der Großteil ihrer Neuronen in den Armen — tausende in jedem kleinen Saugnapf, mit denen sie physikalische und chemische Signale aus der Umgebung analysieren können. Ein Oktopus kann mit den Armen schmecken und riechen. Er kann sich an Objekte erinnern, die er nie gesehen, nur berührt hat. Acht Arme, jeder davon zu einem gewissen Grad autonom, die einen Teil des Denkens (das Sammeln und Verarbeiten von Informationen, die Entscheidung für bestimmte Bewegungen und deren Ausführung) größtenteils unabhängig vom Gehirn vornehmen. Mit den Armen denken.
Wie die Welt einem solchen Wesen wohl erscheint? Wie fügt ein Oktopus die von den Armen gesammelten Eindrücke zusammen? Wann darf ein Arm sich selbstständig strecken, festhalten, zurückziehen? Die Kunst, einen Arm in den Raum zu werfen und zu schauen, was er sich einfallen lässt.
Während ich schreibe, bewegt sich meine Hand wie von selbst über das Papier. Schon viel zu oft hat mein Körper Dinge getan, die ich hinterher bereut habe, etwa wenn meine Zunge Ketten von Wörtern formte, die ich nie hätte sagen sollen. Verfügen meine Glieder nicht auch über einen gewissen Grad an Autonomie? Wer entscheidet, dass ich mir ein kitzelndes Haar aus der Stirn streiche, dass ich lächeln muss, wann immer ich dich sehe?
Und trotzdem ist da das konstante Gefühl, ich zu sein. Kann es etwas Vergleichbares in einem Gehirn geben, das sich auf acht Arme verteilt, jeder davon mit seinem eigenen Gespür für die Welt?
Ich notiere:
Das Gefühl eines einheitlichen Selbst mit gewissen Anteilen, die hin und wieder tun, was sie wollen?
Ein in neun verschiedene Teile gespaltenes Selbst?
Oder überhaupt kein Selbst?
Ich schreibe: Die Arme sind stark, von Millionen Neuronen durchzogen und können nachwachsen. Selbst ein abgetrennter Arm kann noch für kurze Zeit greifen, schmerzhafte Reize meiden, die Farbe wechseln. Ich sehe deine zierlichen Kringel vor mir, wie du die Spitzen luftschlangenartig einrollst, sie wieder langbläst. Kurz muss ich die Augen zukneifen.
Die dünne Spitze eines Oktopusarms, dein Arm, auf meiner Haut.
1
Montagmorgen stehe ich vor dem Oceaneum. Das Gebäude hat die Form eines Strudels, der die Besucher in die Tiefen des Ozeans hinabziehen soll, aber ich finde, es sieht eher aus wie ein gestrandeter Wal. Soweit ich weiß, standen bei den Planungen ästhetische Überlegungen im Vordergrund, erst hinterher hat man sich Gedanken darüber gemacht, wie die Tiere hineinpassen sollen. Das sagt eigentlich alles.
Vor mir ist der Eingang, ich muss bloß einen Fuß vor den anderen setzen, aber ich rühre mich nicht. Sie Sonne fällt auf meine rechte Gesichtshälfte, die wärmer ist als die linke. Mein Handy vibriert.
»Bist du drin?«, fragt Maiken, ihre Stimme klingt schlaftrunken. Sie hatte gestern Spätschicht und liegt bestimmt noch im Bett.
»Noch nicht. Vielleicht gehe ich lieber wieder nach Hause.« Ich drehe mich mit dem Rücken zum Wind, der vom Øresund heranrollt. Sollen sie mich halt sanktionieren, mir doch egal. Würde es einen Job geben, der mir Spaß macht, hätte ich ihn wohl schon gefunden.
»Red keinen Quatsch.« Sie spricht in diesem Ton, der keinen Widerspruch duldet. »Du gehst jetzt durch die Tür, und dann rufst du mich an, wenn du heute Nachmittag wieder rauskommst. Okay?«
»Okay.«
Ich schaue auf die Uhr, Punkt neun. Es ist Zeit.
»Herzlich willkommen.«
Der Mann am Empfang trägt eine gelbe Hose, das fällt mir als Erstes auf. Er stellt sich als Johannes vor, und als er mir die Hand reicht, spüre ich, dass es eine Einladung ist. Dass diese Hand über etwas hinübergreift, um mich in ein Universum zu heben, das ich absolut nicht betreten möchte.
»Ich bin dein Mentor hier«, sagt er. »Und werde aufpassen, dass du nicht untergehst vor lauter neuen Aufgaben.«
Er hat so ein Gesicht, das in keiner Weise zu erkennen gibt, ob er scherzt. Ich lächle vorsichtshalber, aber nicht zu sehr; kein Grund, ihn glauben zu lassen, ich wäre jemand, der ich nicht bin.
»Und du warst echt noch nie hier?«, erkundigt er sich, während er mich in eine große Halle und durch eine kaum sichtbare Tür in der blauen Wand führt, woraufhin wir uns plötzlich auf der Rückseite des Aquariums befinden. »Du wohnst hier in der Stadt und warst noch nie im Oceaneum?«
»Ich interessier mich nicht so für Fische«, antworte ich. Um uns herum surrt und brummt das riesige Wasserpumpensystem, wodurch ich das Gefühl habe, tief im Bauch der Maschine zu stehen, die alles am Laufen hält. »Ich esse nicht mal Fisch.«
Da stehen wir also in diesem unterirdischen, feuchten Reich, wo ich Gefahr laufe, die nächsten sechs Monate meines Lebens zu versauern. Hier auf der Rückseite gibt es keine Fenster und somit kein natürliches Licht, und irgendwie fühle ich mich durch die Art, wie der Bereich vor den unwissenden Blicken der Leute auf der anderen Seite verborgen ist, merkwürdig entrückt.
»Der Großteil der Arbeit findet hier hinten statt«, informiert mich Johannes.
Während er mich herumführt, erklärt er mir die in jedem Bereich anfallenden Aufgaben. Er zeigt mir die Garderobe, die Toiletten und einen lang gestreckten Raum mit Glastanks zu beiden Seiten, aber ich verliere mehrfach den Überblick. Ich kenne Typen wie ihn, ich bin ihnen im Jobcenter begegnet, habe sie zum Chef gehabt. Diese Leute, die nicht nur einer anderen Generation angehören, sondern in einer vollkommen anderen Welt leben und ihrer Arbeit derart sisyphusartig nachgehen, dass sie den Blick für alles andere verlieren. Daran muss ich unwillkürlich denken, während Johannes mir alles zeigt, als wäre das Oceaneum seine Idee gewesen und das, was er hier tut, tatsächlich von Bedeutung.
»Dein Arbeitstag beginnt hier, jedenfalls in den ersten Wochen.«
Er führt mich in einen Raum mit Metalltischen und einer Wand voller Kühlschränke, die Luft ist klamm und kalt. Hier nehmen sie anscheinend die ganzen toten Fische aus, die den glücklichen Auserwählten, die am Leben bleiben dürfen, als Futter dienen.
»Ich zeig dir morgen, wie man das macht«, sagt Johannes. »Jetzt geht’s erst mal darum, dass du einen Überblick kriegst.«
Mir ist es sehr recht, wenn wir das mit dem Fischezerlegen verschieben, ehrlich gesagt bezweifle ich nämlich, dass ich das überhaupt fertigbringe. Seit ich Maiken vor fast zehn Jahren kennengelernt habe, bin ich Vegetarierin, und schon vorher konnte ich nicht hinsehen, wenn meine Mutter ein Huhn der Länge nach aufschnitt oder einen Fisch öffnete wie ein Buch.
Wir bewegen uns weiter durch das Labyrinth hinter der Kulisse, die die Besucher erleben. Hin und wieder treffen wir auf andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Johannes mir vorstellt und deren Namen ich gleich wieder vergesse. Tierpflegerinnen und Tierpfleger, Pädagoginnen und Pädagogen, eine Köchin. Mich stellt er als »Vigga, unsere neue Azubi« vor, eine Bezeichnung, die mich meiner Meinung nach jünger und motivierter klingen lässt, als ich es bin.
Zum Schluss zeigt er mir einen Putzraum und redet von den Unterschieden zwischen kalten und warmen Aquarien mit und ohne Salz, und ich höre ihm gerade genug zu, um nicht versehentlich irgendetwas kaputt zu machen. Dass ich hier arbeiten soll, war nicht meine Idee, das hat sich der Typ mit der hohen Stirn — ich nenne ihn Eierstirn — vom Jobcenter ausgedacht. Ich bin nicht hier, um einen guten Eindruck zu machen. Außerdem stimmt, was ich vorhin gesagt habe. Fische sind nicht so meins.
Als ich am Nachmittag nach Hause komme, esse ich gebratenes Gemüse von gestern und falle aufs Bett, Arme und Beine von mir gestreckt wie einer der schlappen Seesterne vorhin im Streichelbecken. Querschnitte von durch Glas begrenztes Wasser flimmern hinter meinen Lidern. Ich bin so kaputt, dass ich es nicht mal schaffe, Maiken anzurufen.
Am nächsten Morgen fahre ich eine Stunde früher mit der Metro und bin schon um acht da, wieder wartet Johannes am Eingang auf mich. In derselben gelben Hose.
»Nimm dir eine nach dem anderen vor.« Er zeigt auf die Boxen mit gefrorenen Meerestieren. Wir stehen wieder in der Futterküche. »Sie müssen gewogen und verteilt werden, hier siehst du alles.«
An einer Pinnwand hängt ein Plan, auf dem steht, wer welches Futter bekommt. Montag acht gefrorene Würfel mit Leuchtgarnelen für die Stichlinge zum Beispiel, fünf kleine Tintenfische für die Piranhas. Alles muss sorgfältig gesäubert, ausgenommen und mit der großen Waage gewogen werden. Johannes zeigt mir wie. »Wenn die Bewohner des Oceaneums etwas Falsches zu fressen bekommen«, erklärt er, »können sie krank werden oder im schlimmsten Fall sterben.« Mein Eindruck ist, er nimmt den Plan ein bisschen übertrieben genau.
Das Ganze ist zwar widerlich, scheint aber relativ einfach. So ist es meistens, wenn ich an einen neuen Arbeitsplatz komme; es sind selten die konkreten Aufgaben, die mir Schwierigkeiten bereiten, es ist etwas Größeres, die Frage, warum wir sie überhaupt ausführen sollen.
»Und zum Schluss da in den Eimer.« Johannes deutet darauf.
Auch wenn einem bei den ganzen toten Tieren eigentlich nur schlecht werden kann, folge ich seiner Anweisung. Wenigstens muss ich sie nicht selbst töten — hoffe ich jedenfalls. Ich würde mich weigern.
Johannes arbeitet schnell. Der Rhythmus ist ihm in Fleisch und Blut übergegangen, keine Bewegung ist zu viel. Was man von mir weniger behaupten kann. Ich schneide erfolgreich die Schwanzflosse einer Makrele ab, aber als ich den Fisch aufs Brett drücke, um genug Halt zu haben, steche ich ihm versehentlich den Zeigefinger ins Auge. Rasch ziehe ich die Hand weg, doch Johannes wirft nur einen knappen Blick auf meinen abgespreizten, blutverschmierten Finger, an dem jetzt der Rest des Auges klebt.
»Daran gewöhnst du dich«, meint er und trennt mit einem präzisen Schnitt den Kopf seines Herings ab. »Dann gehst du anders mit ihnen um.«
Ich schaue auf das tote Tier vor mir, auf die lädierte Augenhöhle, durch die der Fisch noch blinder aussieht als vorher schon. Das hier dürfte so ziemlich das Letzte sein, woran ich mich gewöhnen möchte.
»Na, wie ist das Leben im Fischgefängnis?«
Maiken und ich liegen auf meinem Sofa, die Beine ineinander verschlungen, die Köpfe jeweils auf einer der Armlehnen. Es ist Donnerstag, die erste Arbeitswoche ist fast um.
»Im Aquarium«, verbessere ich sie, denn so habe ich das Oceaneum für mich umgetauft. Mehr Glaswände, weniger Meer. »Im Moment zerlege ich hauptsächlich tote Tiere.«
Maiken verzieht das Gesicht und stupst meine Knie an, sodass unsere Beine hin- und herschaukeln.
»Klingt ja eklig. Aber immer noch besser als die Wäscherei, oder?«
»Auf jeden Fall besser, als vom Jobcenter ›ermuntert‹ zu werden.« Ich male Gänsefüßchen in die Luft. »Ich gebe dem Ganzen ein paar Wochen, dann kann niemand sagen, ich hätte es nicht versucht.«
Ich könnte ihr erzählen, dass Johannes immer noch der Einzige ist, mit dem ich bisher richtig gesprochen habe, oder wie fehl am Platz ich mir in den Pausen vorkomme, aber mir ist nicht danach. Es gibt so vieles, was man sich nicht erzählt, nicht mal den Menschen, die einem am nächsten stehen. Außerdem: Das Gefühl, nicht dazuzugehören, ist für mich wie Atmen: trivial, konstant, nicht der Rede wert.
Ein paar Monate, nachdem Maiken und ich uns an der Fachoberschule kennengelernt hatten, fragte sie mich, was ich eigentlich gegen die anderen in unserer Klasse hätte. Die Frage überraschte mich, so sah ich das gar nicht. Ich antwortete ihr, das Problem sei eher, dass ich nicht wisse, was ich mit ihnen reden soll. Dass ich mich in Gesellschaft von anderen meistens total unwohl fühle. Wir saßen auf einer Bank hinter der Schule, Maiken wollte rauchen und ich hatte sie begleitet.
»Aber warum?«, fragte sie, ehrlich verwirrt. Und obwohl ich versuchte, es ihr zu erklären, merkte ich schnell, dass sie es nicht verstand, nicht wirklich. Sie ist auf eine Art normal und mit sich im Reinen, die sie das Beste in den Leuten sehen lässt und umgekehrt dazu führt, dass sie von fast allen gemocht wird. Das erzeugt eine perfekte selbsterfüllende Prophezeiung. Und wie soll man jemandem eine Distanz beschreiben, die er nie erfahren hat?
Jetzt, hier in meinem Wohnzimmer in Kopenhagen Nørrebro, holt Maiken dieselben Zigaretten aus der Tasche wie damals, Dark Blue, und setzt sich auf ihren Platz auf der Fensterbank. Die Beine angewinkelt, das Fenster einen Spaltbreit geöffnet. Die Glut leuchtet im Halbdunkel, sie schaut mich mit zusammengekniffenen Augen an.
»Aber stell dir mal vor, du würdest etwas finden, was dir Spaß macht.«
Sie hat bestimmt recht. Das sollte ich anstreben. Die Sache ist nur, dass ich — außer Zeit mit Maiken zu verbringen — nie etwas gefunden habe, woran mir wirklich etwas liegt.
»So wichtig ist das auch nicht«, wehre ich ab und schenke mir den letzten Schluck Wein ein. »Ist ja nur ein Job.«
Ich kann gar nicht genau sagen, wie es dazu kam, dass ich so einen Rattenschwanz an fehlgeschlagenen Arbeitsverhältnissen hinter mir herziehe. Es hat sich einfach so ergeben. Am längsten hatte ich den Job als Aushilfe in einer betreuten Wohngruppe, der hat mir teilweise sogar Spaß gemacht. Aber nach den letzten Umstrukturierungsmaßnahmen verbrachten die Festangestellten mehr Zeit damit, hinter verschlossenen Türen Papierkram zu erledigen, als sich um die Bewohner zu kümmern. Und als ich das zum dritten Mal ansprach, bestellte mich die Heimleiterin zum Gespräch.
»Ich glaube, die Arbeit hier ist nichts für dich«, sagte sie. »Es wäre besser, wenn du dir etwas anderes suchst.«
In der Industriewäscherei, wo ich davor gearbeitet hatte, bestand ein Teil der Erniedrigung darin, zehnmal pro Stunde von Wagen voller getrockneter Wäsche angerempelt zu werden. Meine Tage mit den knittrigen Krankenhauskitteln und der Bettwäsche zusammenzufalten, zu stapeln und wieder wegzuschieben. Bitte schön, hier ist dein Leben. Wir wussten alle, dass dies nur eine Zwischenstation sein durfte. Manche bekamen einfach schneller die Kurve als andere. Ich hielt einen Monat durch.
Gegen Mitternacht schaltet Maiken einen der alten Schwarzweißfilme ein, die ihr das Gefühl geben, tiefgründig zu sein, und sie unverständliche Dinge auf Französisch sagen lassen. Sie hat die Sprache nie gelernt, ist aber überzeugt, in einem früheren Leben in Paris gewohnt zu haben. Ich mache den Fehler, Decken aufs Sofa zu holen, und als um fünf vor sieben der Wecker klingelt, liege ich noch immer in den Klamotten von gestern dort und wache mit einem pelzigen Belag auf den Zähnen auf. Maiken liegt zusammengerollt auf der Chaiselongue. Sie ist auch aufgewacht, muss aber erst später zur Arbeit in der Wohngruppe, weshalb sie nur aufsteht, um an mir vorbei ins Bett zu wanken und weiterzuschlafen.
»Ich glaube, mein Tinnitus ist schlimmer geworden«, murmelt sie, während ich mir ein Oberteil über den Kopf ziehe. »Hier klingelt es wie irre.«
»Denkst du dran, abzuschließen, wenn du gehst?«, sage ich.
Beim letzten Mal hat sie es vergessen, und auch wenn es bei mir nichts zu stehlen gibt, ist mir unwohl beim Gedanken, meine Wohnung über einen ganzen Tag hinweg so zurückgelassen zu wissen, offen und verwundbar.
Maiken hebt die Hand und winkt mir mit kleinen, verquollenen Augen.
Ich bringe den letzten Tag der ersten Woche im Aquarium hinter mich. Die Müdigkeit klebt an mir, und das Einzige, woran ich denke, während ich Böden wische und Schwimmflossen aufhänge, ist der Feierabend. Johannes gibt sich alle Mühe, mich zu motivieren.
»Du weißt ja, die können um die Ecke gucken«, sagt er und knufft mich, als wären wir Zeugen eines Wunders. Wir stehen bei den Barschen, Johannes’ gelbe Hose leuchtet, seine Haare wippen wie Seetang vor lauter Begeisterung. Er hat eine besondere Art, die Dinge zu sagen, als würde er mir etwas ins Gedächtnis rufen, was uns beiden bekannt ist. Ein althergebrachtes Wissen, das er hervorholt und mit einem Pusten vom Staub befreit.
Dieses Mal erzählt er irgendwas vom weitwinkligen Sehbereich von Fischen und der Brechung des Lichts im Wasser. Ich schaue auf die gestreiften Fische und weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Mich beschäftigt mehr Johannes’ knallige Hose, sie erinnert mich an irgendwas. An Matschhosen auf dem Spielplatz im Kindergarten vielleicht, an Bagger und das Gefühl, in einem Sandkasten zu sitzen und davon überzeugt zu sein, der Haufen vor mir wäre mein Schloss.
Aber als es endlich vier wird und ich Feierabend habe, ist das Wochenende nichts als geballte leere Zeit. Ich habe keinerlei Pläne. Maiken, mit der ich normalerweise mindestens einen der beiden Tage verbringe, fährt mit ihrem Freund Daniel zu seiner Familie nach Odense und gibt sich alle Mühe, so zu klingen, als sei sie gezwungen mitzukommen.
Jetzt hör auf, schreibe ich zurück. Ich weiß doch, wie gern du dort bist.
Also versuche ich mein Wochenende mit Tätigkeiten zu füllen, mit denen man sein Leben eben so zubringen kann: Ich wasche Wäsche. Schaue eine Serie über Tschernobyl, die ich schon zweimal gesehen habe, bei der ich aber noch immer an denselben Stellen heulen muss. Hänge die Wäsche auf. Stelle mich lange unter die heiße Dusche und entdecke den Fisch, den Maiken mir anscheinend gestern, bevor sie gegangen ist, auf den Spiegel gemalt hat.
Irgendwann klappe ich meinen Laptop auf, denn auch wenn ich nicht vorhabe, länger als unbedingt nötig im Aquarium zu bleiben, wüsste ich über ein paar Dinge gern besser Bescheid. Speerfischen zum Beispiel, ein Begriff, der in der Mittagspause immer wieder fällt.
Das erste Suchergebnis zeigt einen Mann im Taucheranzug mit beklommener Miene. Es gibt zwei Arten von Speerfischern, steht oben in der linken Ecke des Bildes. Die, die in den Anzug pinkeln … Mein Blick sucht automatisch nach der Punchline in der rechten unteren Ecke: … und die, die sagen, sie tun es nicht.
Ich versuche mir Johannes und diesen breitschultrigen Typen, der sich um die Haie kümmert, im Taucheranzug vorzustellen, in fünf Metern Tiefe, die Harpune im Anschlag, als sich ein dringendes Bedürfnis meldet. Der Fisch, den sie die letzte halbe Stunde gejagt haben, wird jeden Moment im Algenwald verschwinden und wäre für immer verloren, wenn sie jetzt auftauchen. Ich rümpfe die Nase und scrolle weiter, mein Blick streift das Bild eines Mannes, der stolz auf sechs großen Fischen liegt. Speerfischen. Sehr merkwürdiges Hobby.
Am Sonntag pflücke ich meine steife, frisch gewaschene Wäsche von der Leine und lege sie in den Schrank mit der schiefen Tür, die nicht schließt, seit Oskar mich damals so hart dagegen gestoßen hat, dass es mir die Luft nahm. Keine Ahnung, warum ich diesen Schrank immer noch habe.
Anfangs schließe ich mich meinen neuen Kollegen jeden Tag um halb zwölf zum Mittagessen im Pausenraum an. Wie immer überrage ich die meisten, wie immer habe ich das Gefühl, zu einer anderen Spezies zu gehören, wenn sie sich über ihre Kinder und Kredite und ihre Wochenendaktivitäten unterhalten. Um mich an solchen Gesprächen zu beteiligen, müsste ich mich derart verstellen, dass ich es erst gar nicht versuche.
Eines Mittwochvormittags steche ich mich fast an einem Petermännchen, das sich in einem der Aquarien, die ich säubern muss, im Sand versteckt hat, und obwohl ich Handschuhe trage und nichts passiert, bin ich besonders mies gelaunt, als ich mich zu den anderen an den langen Tisch setze.
Auf dem Teller mir gegenüber liegt ein paniertes Fischfilet auf einer Scheibe Roggenbrot, und ein Mann mit Vollbart — ich glaube der, der für die Seeotter zuständig ist — beschmiert es gerade mit Remoulade. Auf einmal kommt mir das Ganze komplett aberwitzig vor; da sitzt er hier in einem Gebäude voller Fische, für deren Wohlergehen er tagtäglich sorgt, vor diesem trockenen, toten Stück Fleisch, das er sorgfältig auf seinem Brot drapiert hat.
»Hast du den mitgebracht?«, frage ich.
Er hebt den Blick. Die anderen am Tisch verstummen, wahrscheinlich weil sie mich zum ersten Mal unaufgefordert sprechen hören.
»Wieso? Glaubst du, ich habe ihn mir aus dem Becken geangelt?«
Einige der anderen lachen, und es wäre sicher gut, würde ich mitlachen, mich ein bisschen lockermachen, dem Mann eine Chance geben. Stattdessen zucke ich mit den Achseln, um ihm zu bedeuten, dass ich ja wohl schlecht wissen kann, wo er seine Fische herhat.
»Scholle?«, frage ich, und seine belustigte Miene weicht einem Ausdruck von Ekel.
»Köhler«, erwidert er. Dann säbelt er ein großes Stück ab und führt die Gabel zum Mund.
Das restliche Essen über richtet niemand mehr das Wort an mich, was mir eigentlich nur recht ist. Trotzdem habe ich wie so oft das Gefühl, dass ich irgendetwas nicht verstanden habe. Nicht nur hier am Tisch, sondern ganz allgemein, und könnte ich nur die richtige Frage formulieren, was genau es ist, oder käme jemand auf die Idee, es mir zu erklären, wäre alles anders.
Nur — hofft man nicht immer, dass man durch irgendeine Kleinigkeit auf magische Weise alles verändern kann? Indem man ein bestimmtes Wort etwas anders betont, einmal tief durchatmet? Und ist es nicht so, jedenfalls bei mir, dass diese Dinge nie funktionieren?
Sobald ich den letzten Bissen runtergeschluckt habe, stehe ich auf. Ich werde nicht noch mal in diesem Raum essen, so viel steht fest.
»Massierst du mich?«
Maiken legt ihre rosa Muschelfüße in meinen Schoß. Sie seufzt vor Wohlbehagen, während ich kreisend die Daumen bewege. Jedes Mal wenn ich sie wegnehme, bleibt eine kleine Delle in ihrer Haut zurück, die nur langsam wieder verschwindet.
»Ich glaube, nächstes Weihnachten fahre ich weg«, sage ich. »Magst du mit?«
»Weg? Wohin denn?« Maiken hat die Augen geschlossen, ihre Stimme klingt fern.
»Keine Ahnung, einfach irgendwohin. Ich hab keine Lust mehr auf Weihnachten, irgendwann reicht’s auch.«