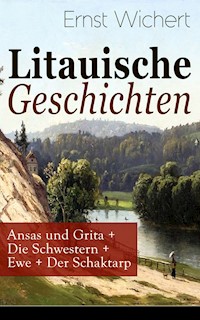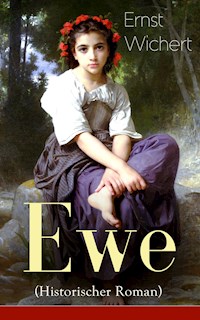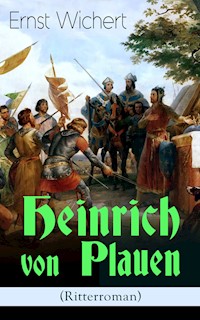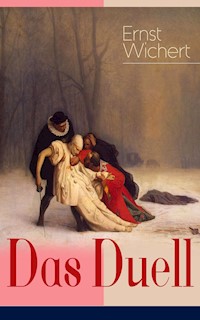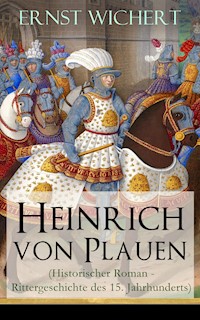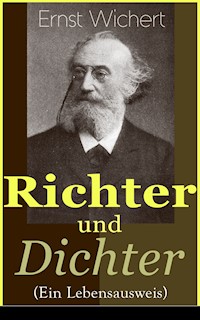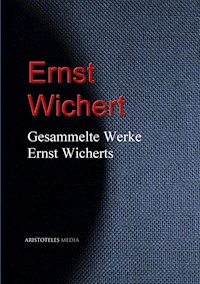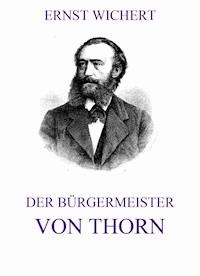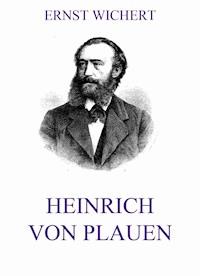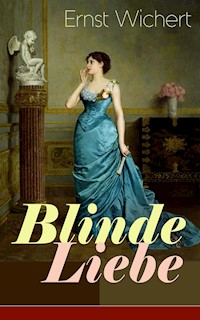
0,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Blinde Liebe" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Aus dem Buch: "Fünf Jahre waren vergangen. In dem Städtchen hatte sich wenig verändert. Zwei neue Häuser waren gebaut oder noch im Bau, einige andere abgeputzt. Dem längst schadhaft gewordenen rostbraunen Spitzdach der alten Kirche waren frischrothe Ziegelreihen eingeflickt, worüber die ästhetisch Gebildeten sich entrüsteten, die Uhr am Rathhause hatte noch immer die Gewohnheit, falsch zu gehen, einige Kaufmannsschilder glänzten in neuer Aufschrift, einige Schaufenster zeigten sich den Anforderungen der Zeit gemäß vergrößert, der Apotheker ließ die ganze Nacht durch über seiner Thür eine rothe Laterne brennen, und im Gymnasium waren während der letzten Sommerferien sämmtliche Schulzimmer geweißt; die üblichen Todesfälle, Hochzeiten und Kindtaufen in den Honoratiorenfamilien hatten vorübergehend von sich reden gemacht. Sonst hatte das Intelligenzblättchen nicht viel zu melden gehabt." Ernst Wichert (1831-1902) war ein deutscher Schriftsteller und Jurist. In seinen Bühnenstücken und Prosaarbeiten entsprach er dem Bedürfnis des wilhelminischen Bürgertums nach Bestätigung seiner Werte und des Glaubens an die Zukunft des Bismarck-Reiches. Sie bilden ein kulturhistorisch authentisches Bild des 19. Jahrhunderts.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Blinde Liebe
Inhaltsverzeichnis
I.
Doctor Erhart Waldstätter bewohnte ungefähr seit so lange, als man sich überhaupt mit ihm beschäftigte, den oberen Stock des vor dem Westthor des Gymnasialstädtchens gelegenen, dem Fabrikanten Steiger gehörigen Hauses. Als er einzog, war er kürzlich als jüngster Lehrer mit sehr mäßigem Gehalt angestellt worden und hatte eiligst eine alte Liebe heimgeführt. Damals lebte noch der Großvater des jetzigen Besitzers, ein schon recht bejahrter Mann, der das Haus einst seinen Bedürfnissen entsprechend gebaut hatte, jetzt aber nur die untere Etage benutzte, nachdem seine Töchter sich verheirathet und seine Söhne auswärts Stellung gesucht hatten. Das Haus da draußen war ihm zu einsam geworden, als seine Frau starb, und er suchte für die oberen Räumlichkeiten einen Miether, mit dem sich angenehm verkehren und bequem leben ließe. Auf die Höhe des Zinses kam es dem sehr reichen Manne gar nicht an, und das anspruchslose und doch zur besten Gesellschaft gehörende junge Paar wäre ihm auch als Freiwohner recht gewesen. Dr. Waldstätter wieder war froh, nicht in der engen Stadt eins von den Giebelhäusern mit niedrigen Zimmern und dunkler Treppe beziehen zu müssen, und sein Weibchen fand die großen Räume, namentlich im Sommer, ganz nach Wunsch, auch wenn sie vorläufig nur recht spärlich oder gar nicht möbliert werden konnten. Da blieb der Zukunft so viel zu thun offen, und es war vergnüglich, so recht darauf gestoßen zu sein, für sie allerhand Möglichkeiten auszuklügeln. Es hatte ihnen auch wenig Bedeutung, daß sie in der schlechten Jahreszeit mitunter gesellschaftlich von der Stadt abgesperrt waren. Sie machten sich aus den Lustbarkeiten, wie sie die Mittelstadt bieten konnte, nicht viel. Waldstätter, der den deutschen Unterricht auf den oberen Klassen ertheilte, besaß eine große und auserlesene Bibliothek, die keine Langeweile aufkommen ließ, und zur Noth bedurfte es ja auch nur eines Wortes beim Hausherrn, um bereitwilligst dessen Equipage zur Verfügung zu erhalten. Im Sommer entschädigte reichlich der schöne Garten, in den der Miether freien Eintritt hatte.
Der Doctor war dann mit der Zeit zum Oberlehrer aufgerückt und sogar nach Veröffentlichung einer sehr schätzenswerthen wissenschaftlichen Facharbeit durch den Professortitel beglückt worden. Seine Frau hatte ihm mehrere Kinder geschenkt, von denen jedoch nur zwei Mädchen am Leben geblieben waren. Dann hatte sie selbst vor einigen Jahren das Zeitliche gesegnet. An eine zweite Heirath dachte der schon graue Herr nicht. Er lebte mit seinen beiden Töchtern in ganz angenehmen, wenn auch bescheidenen Verhältnissen, auf sein Gehalt angewiesen, das immer gerade ausreichte, da er seine Bedürfnisse danach bemaß. Sein Tag war reichlich mit Arbeit besetzt, und selten gönnte er sich so viel Muße, darüber nachzudenken, was aus den Kindern einmal nach seinem Tode werden sollte. Fühlte er sich doch noch rüstig und war es keineswegs ausgeschlossen, daß sie eine annehmbare Partie machen könnten. Nicht, daß er sich darum irgendwie bemühte; aber das war ja auch nach seiner Meinung, wenn er darüber wirklich eine hatte, gar nicht erforderlich. Stand er persönlich im größten Ansehen, so waren die Mädel auch wohlgebildet und gut erzogen: mehr hatte er für sie nicht thun können, und das schien auch genug gewesen zu sein, denn über ihre Beliebtheit in der ganzen Stadt und Umgegend konnte kein Zweifel laut werden.
Auch »unten« hatten die Dinge sich vielfach verändert. Nach dem Tode des alten Fabrikanten stand die Wohnung eine Zeit lang ganz leer. Die Erben ließen die ansehnliche Dachpappen- und Cementfabrik durch einen Inspector verwalten, der in dem tausend Schritte entfernten Geschäftsgebäude wohnte. Dann übernahm ein Enkel, der wohlhabend genug geheirathet hatte, die andern Interessenten abfinden zu können, das Grundstück mit allen Anlagen und bezog die großväterliche Wohnung, nachdem sie durchweg modern eingerichtet war. Das Miethsverhältniß mit dem Professor blieb selbstverständlich unberührt. Herr Theodor Steiger hatte, als er eben erst vierzig Jahre alt geworden war, das Unglück gehabt, seine Frau im dritten Wochenbett zu verlieren. Darüber waren nun wieder drei Jahre vergangen. Er lebte seitdem fast ausschließlich seinem Geschäft, dem er durch die Benutzung verbesserter Maschinen und Materialien einen neuen Aufschwung gegeben hatte. Die Kinder wurden von einem ältlichen Fräulein beaufsichtigt, welches zugleich die Wirthschaft führte. Daß er der reichste Mann im Orte sei, wußte jedes Kind, aber seinem Auftreten war es nicht anzumerken. Der Gesellschaft galt er für schwer zugänglich, wenn auch nicht gerade für menschenscheu. Mit dem fast zwanzig Jahre älteren Professor stand er in bestem Einvernehmen, wennschon sie einander nicht häufig besuchten. Eigentlich hatten sie recht wenig Anknüpfungspunkte; aber der Fabrikant, welcher selbst nur durch eine Realschule gegangen war und später wenig Zeit gehabt hatte, sich eine freiere Bildung anzueignen, sah den Gelehrten als eine Art höheres Wesen an, und der Professor, dessen Sinn in eigenen Angelegenheiten allem Praktischen abgewandt war, schätzte den lebensklugen und vielerfahrenen Geschäftsmann vielleicht gerade wegen der Eigenschaften, die ihm selbst abgingen. So konnte auch in der Unterhaltung Jeder auf seinem Gebiet bleiben, ohne dem Andern langweilig zu werden; nur durfte man einander nicht zu oft in Anspruch nehmen.
Die beiden Töchter des Professors waren im Lebensalter sehr verschieden. Die ältere Agnes hatte schon ihren sechsundzwanzigsten Geburtstag gefeiert. Frida war erst neunzehn Jahre alt und überhaupt das jüngste Kind gewesen. Für hübsch galten sie beide, ähnlich aber waren sie einander so wenig, daß ein Fremder sie an Gesicht und Figur schwerlich als Geschwister erkannt hätte. Agnes über mittelgroß, schmächtig, von zarter Gesichtsfarbe, dabei schwarzhaarig, Frida eher klein, voll, blond und von gesündestem Aussehen. Sie hatte die muntersten braunen Augen, während die dunkelgrauen der Schwester meist ernst blickten oder in verhaltenem Feuer glänzten. Auch in ihrem Wesen zeigten sie wenig Gemeinsames. Agnes sei ganz des Vaters Tochter, hieß es, Frida erinnere mehr an die verstorbene Mutter. Das war doch nur mit Einschränkungen und Zusätzen richtig. Freilich hatte die Frau Professor ein heiteres Temperament und viel geistige Beweglichkeit gehabt, aber den wirthschaftlichen Sinn erbte die ältere Tochter von ihr; und wenn diese des Vaters ernste Lebensanschauung und seine Liebhaberei für Bücher theilte, so trat bei ihr doch an die Stelle der Pedanterie des Gelehrten ein ihm ganz fremder Zug von schwärmerischer Vertiefung in allerhand idealistische Vorstellungen, die ihr zu sittlichen Problemen wurden, und das schwermüthige Behagen am Alleinfürsichsein. Der Professor, wenn er sich in seinen Arbeiten gegen Abend oder an Sonn- und Festtagen eine Erholungspause gönnte, vergnügte sich ganz gern in der Gesellschaft von Kollegen und sonstigen gebildeten Leuten aus Stadt und Umgegend beim Glase Bier und der Cigarre und konnte über die älteste, schon zehnmal aufgewärmte Anekdote herzlich lachen.
Agnes besorgte die kleine Wirthschaft geräuschlos mit der Genauigkeit und Sauberkeit eines geborenen Hausmütterchens, an das doch in ihrer eher hohen Erscheinung und nach außen hin sehr sicheren Lebenshaltung nichts erinnerte. Sie hatte ja die Mutter schon in den letzten Jahren ihrer Krankheit vertreten und dann ganz an ihre Stelle rücken müssen. Nach ihren Neigungen war nicht gefragt worden, und sie hatte selbst nicht danach gefragt. Es schien ja selbstverständlich, daß die älteste Tochter sich des Hauswesens annahm. Sie that aber nicht nur das Nothwendige, sondern sah es nun ganz ihrer Art gemäß als eine heilige Pflicht an, diese häuslichen Dienste, auch wenn sie ihr nicht gefielen, mit aller Hingebung zu leisten, ihr Wirthschaftsbuch peinlichst in Ordnung zu halten, mit der Magd auf den Wochenmarkt zu gehen und die Schwester zu »bemuttern«. Das mußte so sein, und darum geschah es im Gefühl der Freiwilligkeit; sie hätte sonst keine Freude an dem guten Erfolg ihrer Thätigkeit gehabt. Aber sie ging keineswegs in derselben auf. Es war, als ob sie sich nur freimachen wollte, um dann mit gutem Gewissen des Papas Bibliothek durchstöbern und sich deren Schätze aneignen zu können. Auch hier wählte sie nicht die leichteste und ansprechendste Lektüre, sondern stellte sich die Aufgabe, bestimmte Gebiete der Literatur planmäßig durchzuarbeiten, und schreckte diesem Zweck zuliebe auch vor dem Langweiligsten nicht zurück. Es ließ ihr innerlich keine Ruhe, bis sie sich gestehen durfte, mit irgend einem Theil des Wissens so weit fertig zu sein, als ihr Verständniß und die Mittel reichten. Es war nicht das philologische Interesse des Professors an diesen Dingen, wie ihr denn auch das Notieren von bemerkenswerthen Einzelheiten und das Ausziehen von wichtigen Stellen gar nicht in den Sinn kam; sie wollte nur möglichst viel von dem wissen, was die Jahrhunderte an allgemeinem Bildungsstoff aufgehäuft hatten, und sie führte ein Tagebuch, in das sie sehr gewissenhaft an jedem Abend eintrug, welche Eindrücke sie empfangen und wie sie sich mit ihnen abgefunden hatte. Sie las auch französisch und englisch, nachdem sie sich nicht ohne schwere Mühe mit Beistand des Specialkollegen ihres Vaters die erforderlichen Sprachkenntnisse angeeignet hatte. Am liebsten saß sie, mit einem Buch in der Hand, zur Winterszeit im Lehnstuhl, in eine warme Decke eingehüllt, die Lampe auf dem kleinen Tisch seitwärts hinter sich im Sommer in der schattigen Laube oder auf dem Bänkchen unter der Linde. Dabei hütete sie sich wohl, mit ihren literarischen Errungenschaften irgend einem lästig zu fallen. Sie wußte, daß die Frauen und Mädchen ihres Umgangskreises daran nur sehr oberflächlichen Antheil nahmen und wollte sich bei den Männern nicht in den Verdacht der Blaustrümpfigkeit bringen. Es war unter ihnen auch Niemand, dem sie sich mitzutheilen ein besonderes Verlangen hätte haben können. Man hätte sie nicht verstanden, das fühlte sie. Ueberhaupt fehlte ihr die Neigung, sich auszugeben. Natürlich besuchte sie Gesellschaften und selbst Bälle; das war sie ja der Schwester schuldig, aber auch da schien’s immer, als ob sie mehr mit sich, als mit andern wäre. Sie betheiligte sich bei den Spielen der Jugend und auch beim Tanz, man wurde ihrer jedoch nicht froh, und die jungen Herren forderten sie auch nur noch pflichtschuldigst auf. Es schien ihr aber gar keinen Schmerz zu bereiten, bei den Engagements die letzte zu bleiben oder ganz vergessen zu werden.
Darin war vielleicht auch der Grund zu suchen, weshalb sie sechsundzwanzig Jahre alt geworden war, ohne ein Liebesverhältniß gehabt zu haben, geschweige denn ein Verlöbniß eingegangen zu sein. Ein armes Mädchen freilich, das nicht einmal auf eine nennenswerthe Ausstattung zu rechnen hatte, konnte schwerlich als eine lockende Partie gelten. Aber es fehlte doch nicht an jüngeren Lehrern mit bescheidenen Ansprüchen, und zwei von den Richtern, ein paar Rechtsanwälte und Aerzte, der Oberpostsekretär und der Stadtkämmerer, die es allenfalls auf ihr Einkommen wagen konnten, waren auch noch unbeweibt. Eine hübsche und kluge, dabei wirthschaftliche Frau zu bekommen, deren Vater ein hochangesehener Professor war, konnte doch nicht unerwogen geblieben sein. Aber niemand hatte bisher einen Antrag gewagt oder sich auch nur um eine ernstliche Annäherung bemüht. Für die Herren Primaner, die in der Gymnasialstadt eine Rolle spielten, für die Referendare und Lieutnants der Garnison war Agnes nun erst recht schon längst kein Gegenstand der Schwärmerei mehr. Sie hatte es nie verstanden, ihnen freundlich entgegenzukommen und sie zu ungefährlichen Huldigungen aufzumuntern. Nicht der abgünstigsten alten Jungfer hätte es einfallen können, ihr Koketterie vorzuwerfen. Man schalt sie zwar nicht einen Eiszapfen, aber man sagte: Fräulein Agnes Waldstätter hat ihren eigenen Geschmack! und zuckte dabei die Achseln.
Dieses Achselzucken bedeutete allemal: Was soll man sich Mühe geben? Er hat keinen Zweck.
Da geschah nun das ganz Unerwartete. Eines Tages ließ sich zu sehr ungewöhnlicher Stunde Herr Steiger bei dem Professor melden und hielt feierlich um ihre Hand an. Der alte Herr war freudig erschreckt. Galt doch der Fabrikant als weitaus der reichste Mann im ganzen Kreise! Dazu als ein hochangesehener, zu allen Ehrenämtern gesuchter Mann! Hing es doch sogar nur von ihm ab, ob er zum Reichstage gewählt werden wollte! »Ich habe aber so gar nichts gemerkt,« sagte der Professor ganz verwirrt, indem er die Feder statt in das Tintenfaß über sein Manuskript ausspritzte.
»Es ist da auch wohl nichts zu merken gewesen,« antwortete Herr Steiger lächelnd. »Ich hab’s bei mir ganz still gehalten, bis es reif geworden ist. Sie können sich’s selbst vorstellen, daß man in meiner Lage, wenn man kein Thor ist, sehr sorgfältig prüft, was man bieten kann und empfangen will. Ich bin glücklich verheirathet gewesen und möchte das nicht vergessen dürfen. Ich habe drei Kinder, die ich liebe und gut zu erziehen wünsche. Zu jung, um schon mit dem Leben nach einer traurigen Erfahrung abschließen zu wollen, bin ich doch wieder zu alt geworden, um seine Freuden noch mit frischer Empfänglichkeit genießen zu können. Es ist kein Grund, an meiner körperlichen und geistigen Rüstigkeit zu zweifeln, aber mit dreiundvierzig Jahren bewegt man sich doch kaum noch in aufsteigender Linie. Mein Aeußeres und meine gesellschaftlichen Gaben lassen mich auch bei nicht übergroßer Bescheidenheit auf keine Eroberungen rechnen; ich bin auf die Hoffnung angewiesen, daß man einiger guter Eigenschaften wegen, die tiefer liegen, die augenfälligen Mängel gütig übersieht. Alles, was ich mir noch wünsche, ist ein ruhiges Glück, eine häusliche Behaglichkeit, eine angenehme Geselligkeit. Ich möchte mir bleiben können, was ich mir bin, um meiner Frau etwas zu bedeuten, was sie zu achten vermag. Darum suche ich nicht in der Ferne, sondern greife nach dem Guten, das so nah liegt. Ich hoffe, verehrter Herr Professor, daß Sie meine Wahl billigen.«
»Das versteht sich ja von selbst,« rief Waldstätter ganz aufgeregt. »Nur weiß ich nicht … Ich kann freilich kaum glauben, daß Sie über meine Verhältnisse im Irrthum sind. Ich besitze nicht das mindeste Vermögen, habe meiner Tochter nichts mitzugeben oder zu hinterlassen. Mein Gehalt —«
»Beunruhigen Sie sich darüber keinen Augenblick,« fiel Steiger ein. »Ich bin völlig eingerichtet und besitze selbst so viel, daß ich meinen Kindern durch eine zweite Heirath nichts entziehe, was sie einmal billigerweise erwarten dürfen. Ich gestehe Ihnen, daß ich sogar Werth darauf lege, in dieser Hinsicht ganz der gebende Theil zu sein. Es würde mich beschweren, mit Ansprüchen rechnen zu müssen, die mir einen gewissen Zwang der Berücksichtigung auflegen, und denke mir’s gerade als eine sehr wohlthuende Befriedigung, doch irgend etwas zu haben, womit ich hochherzige Liebesverdienste vergelten kann.«
Der Professor schüttelte ihm gerührt die Hände. »Braver Mann,« rief er, »braver Mann: Ja, es giebt noch Uneigennützigkeit in der Welt! Welche Ueberraschung, welche Ueberraschung! Nein, das wäre mir auch im Traume nicht eingefallen. Meine Agnes … Ein Ausbund von Schönheit ist sie doch nicht. Da könnte man eher Frida —«
»Fräulein Agnes hat ein so liebes Gesicht, so seelenvolle Augen —!«
»Ja, ja! Das hat sie. Aber … Und es ist Ihnen auch bekannt, daß sie die Mitte der Zwanziger schon überschritten hat …«
»Für mich ist sie noch immer sehr jung, ich möchte sagen: zu jung, wenn nicht ihr gesetztes Wesen den Ausgleich verbürgte. Darf ich mich also Ihrer Zustimmung für versichert halten?«
»Herr Gott, mit tausend Freuden! Wie könnte ich gegen Sie etwas haben, mein bester Herr Steiger? Und für Agnes ist’s ja ein Glücksfall … Hm, hm! es läßt sich so ansehen. Ich wundere mich nur, daß sie mir so gar nichts verrathen hat. Nicht mit einem andeutenden Wörtchen, nicht mit einem Blicke, einer Miene —«
»Ja, wie sollte sie?« fiel der Fabrikant anscheinend verwundert ein.
»Wie sollte sie —« wiederholte der Professor etwas unsicher, »sie ist freilich auch sonst nicht plauderhaft. Aber man denkt doch … Wenn einem Mädchen so etwas passiert —«
»Fräulein Agnes ist gar nichts passiert,« unterbrach Herr Steiger. »Was sollte —?«
»Aber sie weiß doch —«
»Nichts weiß sie. Ich habe mich bisher keinem, als Ihnen, eröffnet.«
»Ah! Sie sprachen mit Agnes noch nicht?«
»Nein. Es war mein Wunsch durch Sie Gewißheit zu erhalten.«
»Durch mich? Ja, aber —«
»Und ich muß wünschen, daß das Geheimnis gewahrt bleibt, wenn Fräulein Agnes, was ich nicht fürchten will …« Er senkte verlegen die Blicke.
»Aber wie wissen Sie denn, daß Agnes Ihnen gut ist?« platzte der Professor heraus.
»Das weiß ich eben noch nicht,« antwortete Steiger. »Ich hatte auch nicht den Muth, sie danach zu fragen.«
»Aber dazu gehörte doch wenig Muth, wenn Sie sich sonst überzeugt halten durften —«
»Daran fehlt’s aber auch.«
»Wie? Sie haben meiner Tochter nicht zu verstehen gegeben, daß Sie mit solchen Absichten umgehen?«
»Nein. Ich habe absichtlich jede Annäherung vermieden, die sie befangen machen könnte. Ich habe Fräulein Agnes zu beobachten Gelegenheit gehabt, wenn ich die Ehre hatte, Ihr Gast zu sein. Ich habe sie öfters von meinem Fenster oder Balkon aus mit dem Buch in der Laube sitzen sehen und mir so ihre Züge tief eingeprägt. Sie hat immer wieder den günstigsten Eindruck auf mich gemacht. Ich zweifele nicht, daß sie meiner Wirthschaft würdig vorstehen, mir eine sehr liebe Frau, meinen Kindern eine gute und gerechte Mutter sein wird, kurz — daß ich keine bessere Wahl treffen kann. Der Wunsch, sie zu besitzen, hat dadurch so an Stärke gewonnen, daß ich mich zu diesem nicht leichten Gange entschlossen habe. Da wissen Sie nun alles.«
»Da weiß ich nun Alles —« sprach wieder der Professor nach, aber so zaghaft, als ob er eigentlich sagen wollte: da weiß ich nun gar nichts. Und das stand auch auf seinem Gesicht geschrieben. »Ja —« stotterte er nach einer kleinen Weile, »mein lieber, guter … Das ist ja alles ganz vortrefflich, aber ein junges Mädchen, sehen Sie — und wenn’s auch nicht mehr ganz jung ist … Das heißt, ich denke mir’s so … Und in meiner Jugend, und wie ich selbst es einmal gemacht habe … Na, das mag jetzt auch anders geworden sein.«
»Was? wenn ich fragen darf, Herr Professor,« bemerkte der Freiersmann, der offenbar aus seinem Benehmen nicht recht klug wurde.
»Verzeihen Sie«, bat der alte Herr, seine Schulter streichelnd, »ich bin wirklich in solcher Situation noch nicht gewesen. Als Vater … Nein, ich gesteh’s, es hat noch keiner bei mir um die Hand einer Tochter angehalten. Es handelt sich um eine erste Erfahrung. Nun weiß ich zwar aus den Dichtern hinlänglich —«
»Aber hier entscheidet das praktische Leben,« bemerkte der Fabrikant abweisend.
»Nun eben,« bestätigte der Professor. »Ich denke mir, Sie können darüber doch nun ganz beruhigt sein, daß ich Sie mit offenen Armen empfange, wenn … Ja, und da ist ja gar kein Zweifel. Agnes wäre ja die größte Thörin … Aber sagen müssen Sie ihr’s am Ende doch. Und ich denke mir, es wäre das Gescheiteste, wenn Sie sogleich zu ihr gingen —«