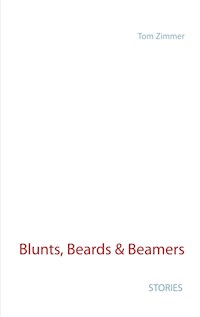
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der Student Toni Zaunmüller fühlt sich nach seinem Studium fehl am Platz und beschließt, noch ein Studium zu beginnen, um seiner alltäglichen Beschäftigung rund um das Faulenzen, dem Alkohol, dem Gras und dem Feiern nicht entkommen zu müssen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 296
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Rosen sind rot, Veilchen sind blau. Das ist die Geschichte von Toni Zaunmüller.
Inhaltsverzeichnis
Der Matrose
Frühshoppen
Der Dicke und sein Japaner
Il bavarese
Onkel Franz
Jingle Hells
Der Werbespot
Die Praxis
Three Sheets to the Wind
Stag-Party
Heists & Blow
Waldmeister
Das Hochzeitsauto
Bis der Tod sie scheidet
Weinstube
Tanzverbot
Dein Wille geschehe
Der Mähdrescher
Alpenglühen
Sonnhalde
Der Matrose
Es war scheißkalt. Zur Abwechslung mal wieder. Die letzten fünf Monate war es das schon. Die Sonne verabschiedete sich bereits am späten Nachmittag wieder und ließ mich in der Dunkelheit alleine. Auf dem Weg raus zum Balkon riss ich eines der Kuverts auf. Ich wusste natürlich, was drin war. Bei gemütlichen minus zwei Grad draußen setzte ich mich hin, schüttelte mir eine Zigarette aus der Schachtel und las den Inhalt des Kuverts einmal durch. Das Balkonlicht über der Tür spendete mir getrübte Helle.
Die Hochschule in Rosenheim entließ mich mit meinem bestandenen Ingenieurszeugnis und nach der Abschlussfeier mit Sekt-O-Saft und dem Schmeißen des blöden Hutes und Händeschütteln und allem Drum und Dran hinaus in die Welt der Erwachsenen. Für einen infantilen Quacksalber wie mich genau das Richtige. Ich war nicht bereit für die Arbeitswelt. Wenn ich die zahlreichen Broschüren von Firmen schon sah, wo alle Quereinsteiger und Azubis fröhlich lachten und sich gestellt irgendwelche Tipps von ihren älteren Kollegen abholten oder sich Methoden erklären ließen, wurde mir schlecht.
Ich wusste natürlich, dass ich das Zeugnis irgendwann in der Post vorfinden würde und mein Studentenstatus dann vorbei sein würde. Und doch hatte ich keinen Dunst, wie es danach weitergehen würde. Fragen gingen mir durch den Kopf.
Was macht man, wenn man sein Studium abgeschlossen hat, aber noch immer zu kindlich ist, um zu arbeiten? Man studiert weiter. Was macht man, wenn man nach abgeschlossenem Ingenieursstudium als Planungsgrundlage noch immer Klebeband und WD40 sieht? Man studiert weiter. Und was macht man, wenn der abschließende Notenschnitt beinahe höher ist, als die durchschnittliche Auswärtssiegquote bei den Sechzigern? Man studiert natürlich weiter.
Ich wusste auch nicht. Die Kälte ließ meine Ohrläppchen gefrieren und ich schaute hinunter auf die Straße und die passierenden Leute. Wie sie aus den Büros strömten und zu ihren Autos zurückkehrten. Das sollte mir nun auch bald blühen, kam es mir in den Kopf. Andere dagegen kamen erst in die Stadt. Und selbst die hetzten. Von Termin zu Termin, von Anwalt zu Anwalt, von der Parkuhr zur Fußgängerzone. Der raue Februar wehte ihnen über die Mäntel. Ich dagegen saß da und dachte weiter nach. Ich versuchte, vor der Endstation Ernsthaftigkeit noch ein paar Raststationen mit Spaß zu erwischen. Und die gab’s im Erwachsenenleben nun mal nicht immer. Wo man seinen Polo gegen einen Firmenwagen oder eine Familienkutsche tauscht. Wo man Jeans und T-Shirt gegen die dreiteilige Arschlochuniform tauscht. Wo man Ikea gegen den Schreiner tauscht. Und wo aus Toni Anton wird. Das konnte nicht das Ende sein. Grundgütiger. Vierundzwanzig Jahre und zu festgefahren im Leben der Juvenilen.
Der Trott zog mich mit der Zeit runter wie Treibsand. Mir fehlte der Pepp. Überall und allerseits. Vielleicht war es an der Zeit, die Komfortzone zu verlassen und irgendetwas zu verändern. Vielleicht ginge ich wieder ins Fitnessstudio, dachte ich. Ein neuer Haarschnitt – beziehungsweise überhaupt mal ein ordentlicher –, ein neuer Hut, das Rauchen aufhören oder mehrlagiges Klopapier. Kleinste Veränderungen könnten schon etwas bewirken. Zudem hatte ich nurmehr ein paar Wochen, bis Krankenkasse und Haftpflichtversicherung geladen und entsichert vor meiner Haustür standen. Ich wusste weder wohin, noch warum und wann.
Als ich die Zigarette aufgeraucht hatte und sich meine Gedanken langsam beruhigten, öffnete ich das zweite Kuvert. Auch bei diesem wusste ich, was darin war. Dieses Kuvert lag bereits seit zwei Wochen in meinem Briefkasten und trug nur die Aufschrift „Toni“. Ich kannte die darin befindliche Einladung mit all ihren organisatorischen und örtlichen Einzelheiten bereits, da sie mir mündlich noch einmal zugetragen wurden. Nun machte ich die Einladung zur Abschiedsfeier von Sven auf.
Sven war aus Norddeutschland und verbrachte seine Studienzeit bei uns im Süden. Nun war er, wie ich, mit dem Studium fertig und entschloss sich, mit einer Mottoparty zum Abschluss ein letztes Mal die Korken knallen zu lassen. An genau diesem Abend. Ich hatte noch gut drei Stunden, bis das Knallen der Korken feierlich starten sollte. Ich hatte bislang noch nicht zugesagt.
Zum einen kannte ich keinen. Alle unsere Kommilitonen, die ich leiden konnte, waren ein paar Semester vor mir und Sven fertig, wir beiden waren ein paar der letzten Übriggebliebenen. Zweitens hasste ich Mottopartys. Als würde man Mottos dafür brauchen. Diesmal war es „Nordisch by nature“. Jeder sollte irgendetwas Typisches für Norddeutschland anziehen. Mein Gott.
Drittens wollte ich die Diplomatie wahren und nicht mit billigen Ausreden kommen. Meine Großmutter war dieses Jahr schon dreimal gestorben. Zählte man alle Geburtstage meiner Schwester zusammen, die ich für eine Absage benutzt hatte, würde sie heuer um die zweihundertvierunddreißig werden. Und Karten für die Bayern hatte ich angeblich auch beinahe jeden zweiten Samstag. Aber mit irgendetwas Abgedroschenem wie dem Geburtstag des Hundes meines Fahrlehrers wollte ich auch nicht daherkommen. Also musste ich wohl die Arschbacken zusammenkneifen und hingehen. Doch dieses Hin und Her ließ mich auf meine Entscheidung warten. Und Sven auch.
Ich starrte einfach weiterhin die Einladung an, in der Hoffnung, sie würde einfach weggehen. Wie eine Blase auf der Zunge, wo man meint, sie heilt schneller, wenn man dauernd darauf herumkaut. Ich rauchte eine zweite Zigarette und ließ den eiskalten Wind über mich herziehen. Ich schloss die Augen und dachte nach. Als ich sie wieder öffnete, war die Zigarette von alleine runtergebrannt und die Asche bereits auf den Boden gefallen. Mein Handy läutete. Ich nahm einen der letzten möglichen Züge vor dem Filter und lupfte mein Smartphone aus der Hosentasche. Sven war dran. Ich seufzte einmal kurz auf und hob ab. Als ich ranging, fragte er nochmal nach, ob ich denn nun käme oder nicht. Ernüchtert vor Ungewissheit und ebenso ernüchtert vor Lustlosigkeit sagte ich ihm zu. Manchmal brauche ich eben jemanden, der mir die Entscheidung abnimmt, dachte ich.
Außerdem: was hatte ich denn sonst vor? Ein weiterer Abend mit Weißweinschorle und Luftgitarre spielen? Das ist nur einmal pro Woche witzig.
Nun brauchte ich wohl ein Kostüm. Ein norddeutsches Kostüm, was immer das auch sein sollte. Motto-Party, sagte ich erneut zu mir selbst. So ein Blödsinn. Damit man ja nicht auf die Idee kommt, sich selbst ein Kostüm auszusuchen. Ich klopfte die abgebrannte Zigarette im Aschenbecher nochmal aus und ging hinein, zog mir eine Hose an, schwang mich auf meinen Drahtesel und fuhr an den Stadtrand, wo ein Großhandel für Faschingsklamotten und so Jux war. Die konnten mir sicherlich bei der Kostümproblematik weiterhelfen.
Unterm Fahren dachte ich weiter über meine melancholische Stimmungslage nach. Es war, dachte ich, nicht nur die Unsicherheit über die Zukunft, die mich feststecken ließ. Es war darüber hinaus auch die Örtlichkeit, was mir beim Passieren dieser auf dem Fahrrad einmal mehr klar wurde. Ich kam an dem Bolzplatz vorbei, wo ich mir die Technik und die Übersicht eines Brotzeitfußballers antrainierte. Dort stand jetzt ein Discounter. Aus der Bar, in der ich zum ersten Mal ein fesches Dirndl bezirzen konnte, mir ihre Zunge in den Hals zu stecken, verkaufte man nun trendige Smoothies und kalorienarme, glutenfreie Cookies.
Zu den schicken Burger-Läden gesellten sich mittlerweile hippe Nobelitaliener, die in ihrer Einrichtung eher einer Diskothek ähnelten, und trendige Second-Hand-Geschäfte, die nun auf Vintage spezialisiert waren. Rosenheim war schon immer Münchens kleiner Bruder. Und der wurde jetzt erwachsen und wollte dem Großen die Stirn bieten, wenn er auch noch so unterlegen war.
Vielleicht war es ja wirklich das. Ich musste weg. Das war wahrscheinlich die Veränderung, die ich brauchte. Der Ort war mir mit der Zeit einfach zu fremd geworden. Oberbayerisch wurde noch in den Vororten gesprochen. Die Autos wurden dicker, die Nachbarn sensibler. Da war dann die Musik zu laut, die Leute zu lange da. Staubsaugen durfte man nur mehr untertags. Obwohl ich mich in diesem Alter noch kindlich fühlte, musste ich nicht von Fremden bemuttert werden. Auf dem oberbayerischen Land südlich von der Luxusmetropole München war man zweifellos gefangen zwischen neoliberalen Hipstern, die sich mit Hüten und knöchelfreien Jeans von allem und jedem beleidigt fühlten, und alteingesessenen Vorgestrigen, jenen vom selbstpropagierten alten Schlag, die alles, was vor vierzig Jahren noch nicht existierte, kritisierten und ablehnten, sogar wenn sie selber jene vierzig Jahre noch nicht erreicht hatten oder die Neuheiten Sinn machten.
Als ich nach zirka fünfzehn Minuten draußen am Großhandel war, musterte ich sämtliche Maskierungen. Superhelden, Cowboys, Astronauten, Scheichs. Gab es nichts norddeutsches? Anders als in normalen Bekleidungsgeschäften, stürmten hier die Verkäufer nicht gerade auf einen zu. Also versuchte ich, einen zu finden. Nach ein paar Minuten des Suchens zwischen den Hochregallagern mit Clownsmasken und Indianerfedern fand ich einen Verkäufer.
„Servus“, sagte ich und riss ihn aus seiner Langeweile, die er mit dem Rumspielen an seinem Handy zu überbrücken versuchte, „I bräucht was Norddeutsches.“
„Was?“, fragte der Typ in strengem Ton, nachdem er vom Smartphone mit verzogenem Gesicht aufsah.
„Ja, hören Sie. I bin zu na Abschiedsparty eingeladen, wo man irgendwas typisch Norddeutsches anziehen soll.“
Wir durchkämmten den Laden. Ninjas, Zorros, Ritter, Piraten. Rüstungen, Augenklappen, Hüte, Schwerter, Masken. Schminke, Perücken, falsche Nasen, große Ohren. Mit Sicherheit ließe sich aus den ganzen Sachen etwas geeignetes herausbasteln. Doch ich war nicht zufrieden. Gar nicht zufrieden. Bis zu dem Punkt, an dem zwischen Bienenflügeln und Froschaugen etwas hervorblickte. Mein Kostüm für den Abend. Es war perfekt.
Ich bezahlte, packte mein Kostüm ein und radelte wieder zurück in die Stadt. Ich kam an einem Plattenladen vorbei. An einem ehemaligen Plattenladen, um genau zu sein. Zugegeben, zu meiner Zeit belief sich das hauptsächliche Geschäft dort auch schon auf CDs. Aber nun konnte man dort Gummibärchen kaufen. In allen Formen und Farben, in allen Geschmäckern und Gerüchen. Schlangen, Würstchen, Bärchen. Sauer, süß, klebrig. Plompenzieher und Apfelringe.
Keine zehn Meter weiter trat eine Frau auf den Radweg, ohne sich einen Dreck zu kümmern, wer hier gerade bei einer Scheißkälte und glatter Bahn daherkommt. Ich bremste zusammen, die Frau starrte nur aus ihrem operierten Gesicht heraus und ließ die Situation unkommentiert. Gruzifix. Selbst plastische Chirurgen fanden mittlerweile Arbeit im ländlichen Rosenheim. Ich musste hier weg.
An dem Platz, an dem ich eine Weile weiter vorbeikam, hatte ich das Radfahren gelernt. Da war jetzt zur Abwechslung ein Café. Eines derjenigen, die auf den modernen Industrielook setzten. Offene Lüftungsleitungen, zerkratzte Edelstahlstühle und Bedienungen, deren Laune auch oft kalt wie Stahl war. Ich musste weg.
Zurück in meiner Wohnung, zog ich mein Matrosenoutfit an und betrachtete mich im Spiegel. Ein Schuss Motivation zog mir durch den Körper. Ich hatte sie, die erste kleine Veränderung. Die Bereitschaft, gegen den eigenen Willen etwas für jemand anderes zu tun. Und an die musste ich anknüpfen. Kostümtechnisch fehlte etwas, was ich merkte, als ich mich weiter im Spiegel selbst beäugte.
Ich nahm meinen elektrischen Rasierer aus dem Regal neben dem Waschbecken, schob den Schalter nach vorne und schor mein Gesicht. Was übrig blieb, war ein altmodischer, gut aussehender und unwiderstehlicher Schnurrbart. Eine Popelbremse feinster Güte. Holztennisschläger, Polohemd, Eierzwickerhosen und Socken bis zu den Knien und ich wäre wieder ein wunschlos glücklicher junger Mann gewesen. Aber ich hatte eben nur diesen Matrosenanzug. Und nun eben den Schnauzer. Aber ich war stolz drauf. In der Hipster- und Motorradcopszene war der Schnurrbart schon lange wieder ein Hit, wieso dann nicht auch bei mir? Machte mich der Schnauzer zu einem besseren Menschen? Keine Ahnung. Machte er mich reich? Nicht die Bohne. Sah ich aus wie ein degenerierter Dorftrottel? Teilweise. Und war es mir scheißegal? Jawohl, Sir. Wenn Kleider Leute machten, machte ein Schnauzbart Legenden.
Zum ersten Mal in meinem Leben trug ich einen Respektbalken. Und es fühlte sich gut an. Wie eine Wiedergeburt. Wie ein weiterführendes Gadget für meinen Körper. Ich richtete mich her, zog die Tür hinter mir zu und ging noch zu einem Supermarkt beim Busbahnhof. Irgendetwas musste ich ja mitbringen.
Ich schlenderte durch den kleinen Laden bis ganz hinter zum Weinregal. Mal sehen, was wir da finden, dachte ich. Die klassische Flasche Wein löste in meinem Alter nun den Discounter-Wodka und die No-Name-Paprika-Chips als Mitbringsel zu Feiern aller Art ab. Also ging ich hinter und nahm Flasche für Flasche in die Hand und tat so, als würde mir das Etikett irgendetwas mitteilen.
„Schickes Outfit!“, klang es neben mir auf einmal hervor. Eine Gruppe junger Kids in den gewöhnlich bescheuerten Klamotten der Zeit lungerten neben mir herum und schauten sich ihrerseits nach einem bevorzugten Drink für den Abend um.
„Danke.“, war meine knappe Antwort, nachdem ich meinen Blick zurück auf das Weinsortiment des kleinen Eckladens gerichtet hatte. Südafrikaner, Frankenwein, Spätburgunder, Chardonnay, Neuseeländer, Pfälzer. Beim Teutates. Wie soll man da was finden?
„Ist das dein Hochzeitskostüm?“, fuhr einer aus der vier bis fünf Mann starken Gruppe fort, „Was sagt dein Bräutigam dazu?“
Alles klar, dachte ich. Der ist der Boss in der Gruppe. Das Sprachrohr. Die anderen um ihn rum lachten laut in ihren weiten Klamotten und unter ihren in die Gesichter gezogenen Caps. Gott, hoffte ich schon wieder, nochmal ein Kind zu sein. Dann hätte ich dem Knirps eine auf die Fresse hauen können, ohne jegliche schwerwiegende Strafverfolgung. Das konnte ich nun nicht mehr. Wie sähe das denn aus, wenn ein erwachsener Mann mit Schnauzbart in einem Matrosenkostüm in einem kleinen Supermarkt Kinder vermöbelt? Ja, genau. Ich dachte das gleiche, wie Sie jetzt.
Ich ignorierte den Haufen Kleingewachsener, suchte eine Flasche aus und machte mich auf den Weg zur Kasse. Außerdem war der Spruch des Kleinen gar nicht so schlecht. Etwas Ansehen hatte er schon gewonnen damit. Dennoch bestätigte mich das Ganze noch in meiner Sache. Ich musste hier weg. An der Kasse schloss ich erneut die Augen und dachte nach. Ich ließ die Gerüche durch meine Nase ziehen, das alte Obst und das übriggebliebene Gemüse. Und ich versuchte zu entspannen.
Ich war an der Reihe. Die Dame hinter mir legte noch einen Trenner zwischen ihren Wocheneinkauf und meine hin und her rollende Flasche Weißwein, um ja kein Missverständnis zu erzeugen. Die Kassiererin lächelte mich an und zog die Flasche über den Scanner.
„Schönes Kostüm.“, sagte sie. Das zweite Kompliment innerhalb weniger Minuten.
„Danke.“
„Sind Sie ein Bäcker?“, fragte die Kassiererin und lächelte wieder, nachdem sie mir den Preis mitgeteilt hatte.
„Ja, ganz genau. Hundert Prozent.“, sagte ich etwas monoton und lakonisch und gab ihr die Münzen rüber.
„Dachte ich mir. Sehr nett.“ Die Dame gehörte, glaube ich meiner hobbypsychologischen Analyse, zu denen, die immer positiv waren. Optimisten von Geburt an. Ich bedankte mich nochmal und ging hinaus.
Es war noch kälter geworden und der Wind war noch ungemütlicher. Und das Matrosenkostüm alleine hielt dieser Kälte einfach nicht stand. Aber ich zog mit Sicherheit keine Jacke darüber und zerstörte somit mein Kostüm. Das einzige, was ich noch lächerlicher finde, wie Leute, die einen Selfie-Stick benutzten, waren Leute, die über ihr Faschingskostüm noch eine Jacke zogen. Ich war nun selbst kein begnadeter Faschingsfreund, aber wenn man sich für ein Kostüm entscheidet, dann hat man verdammt nochmal auch dazu zu stehen.
Ich schlenderte mehr als ich ging und ich flanierte mehr in Richtung Svens Hausparty, als ich denn eilte. Meine Gedanken leiteten mich wieder, ich wurde sie einfach nicht los. Nicht für ein paar Stunden mal konnte ich abschalten und mir einreden, dass sich schon alles regeln lassen würde. Dauernd dachte ich daran, wie es nun in Zukunft weitergehen würde.
Als ich bei Svens Adresse ankam, stand plötzlich Pippo vor dem Haus und rauchte eine Zigarette. Ja, Herrschaftszeiten. Pippo war einer meiner besten Freunde im Studium und wir freuten uns beide gleichermaßen, dass der jeweilig andere auf einmal da stand. Er kam als Schifffahrtskapitän. Auch gut.
„Pippo, scho fertig mit dem Leute bescheißen heute?“, fragte ich in lautem Ton, als ich ihm die Hand reichte.
„Ha! Netter Pornobalken, Magnum! Studierst immer no auf Kosten vom Staat?“, war seine provokative Antwort. Pippo meinte, er wurde auch noch eingeladen, obwohl er anderthalb Jahre vor uns bereits fertig war. Wir ratschten kurz weiter und gingen rein.
Drinnen waren ein paar andere Matrosen, ein Käpt’n Iglo, ein Käpt’n Blaubär und unzählige Unverkleidete. Na toll. Geradewegs ging es für uns zur Bar. Wir bestellten zwei Gin Tonic und besprachen die letzten Monate, in denen wir uns kaum sahen. Pippo war erfolgreich als Ingenieur in einem Bauträgerbüro eingestiegen. Bei der Frage nach mir fehlten mir mehr und mehr die Worte. Was ich machen würde? Weiß ich doch nicht. Ich meinte nur, dass ich Rosenheim wohl verlassen würde. Pippo verstand nicht, versuchte mir das auszureden. Was gäbe es denn schöneres, als daheim zu sein? Das war seine Devise.
„Bist dir sicher? Wos is mit deine Freund‘?“
„Mann“, sagte ich streng, „I muss einfach raus hier. Wos wartet denn hier auf mi no? Heiraten, Kinder, Alimente zahlen und sterben?“
„Toni“, mahnte er in ruhigem Ton, „Du warst scho im Studium a kompletter Zyniker. Außerdem wartet des woanders a auf di.“
Ich erklärte ihm, was mich alles nervte. Die Leute mittlerweile. Die Stadt. Es war seit beinahe einem Vierteljahrhundert das gleiche. Jeden Tag. Wir plauderten noch zwei Stunden so weiter. Rauchten zwischendrin, gingen wieder zur Bar. Trafen kurzzeitig jemanden flüchtig bekanntes. Auf einmal kniff er mir in die Schulter und schaute über mich hinweg zum Eingang.
„Toni, is des ned die Sandra?“ Ich drehte mich um.
„Ach ja. Die im fünften rausgeflogen is.“, erinnerte ich mich, nachdem ich mich umgedreht hatte.
„Hast du ned was mit der gehabt?“
„Ned dass i wüsste. Da Sven aber. Glaub i.“
Wir glotzten wie zwei Bescheuerte weiter zu Sandra hinüber, immer wieder mal für die nächste Stunde. Mit der Zeit erhöhte sich auch der Pegel. Das Bild wurde schwummriger, die Witze schlechter. Die Zeit verging schneller und die Toilettenbesuche wurden häufiger. Kurz nachdem wir wieder durch die Bagage schauten und ein paar Momente bei Sandra stehenblieben, tippte mir jemand auf die Schulter.
„Hast du mein Mädel angeglotzt?“, fragte der Begleiter von Sandra, der mir am Anfang schon auffiel, und bäumte sich auf. Der war auch unverkleidet. Amateur. So ein Typ in Loafer und mit akkurat frisiertem Haar. Bitte ned, dachte ich mir nur. Der Halunke war so unauthentisch wie House-Musik im Jahr 2011. Ich rollte genervt mit den Augen, was er so verstanden haben muss, dass ich ihn näher an mir haben wollte. Er kam weiter auf mich zu.
„Sag mal, hast du n‘ Problem?“ Er stupste mit seinem Finger gegen meine Brust. Ich ließ es mir gefallen. Ich schloss die Augen und dachte an Worte wie „Ruhe“ und „Wald“.
„Hörst du schlecht?“ Er führte einen Monolog, ich reagierte nicht. Wieder stupste er gegen meine Brust. Ich scheute mich nicht vor der Konfrontation, aber ich wusste, wenn ich was tat, würde am nächsten Tag sein Daddy mit dessen Anwalt vor meiner Zimmertür stehen, was mir nicht zwingend lieber als die Haftpflicht oder die Krankenkasse gewesen wäre. Er holte wieder mit dem Finger aus und stupste im Gleichtakt mit den Silben gegen meine Brust.
„Hörst. Du. Schlecht. Du….“ Ich nahm seinen Finger und bog ihn nach hinten. Er ging in die Knie und schrie, die Leute drehten sich zu uns um. Ich ließ ihn wieder los, er fiel nach hinten auf den Boden. Erschrocken schaute er auf zu mir. Pippo zog mich weg und wir gingen durch den Kreis der Schaulustigen hinaus auf die Terrasse.
Pippo meinte nur: „Langsam versteh i, warum du weg willst.“ Wir standen da und ich war immer noch energisch. Mit der Zeit beruhigte ich mich und bedankte mich bei Pippo, dass er dazwischen gegangen ist. Ich wollte nichts mehr hören und sehen. Kleingeister blieben Kleingeister, dachte ich. Heimgehen wollte ich aber auch nicht. Rauchen, trinken, feiern. Alles auf Svens Kosten. Bis auf das Rauchen natürlich. Aber wenn mich etwas ablenken konnte, dann das.
Der Typ, dem ich den Finger umgebogen hatte, tapste vorsichtig auf den Balkon heraus und wollte sich für das Missverständnis, das ihm von Sandra nun anscheinend zugetragen wurde, entschuldigen. Pippo lauerte schon auf einen falschen Ton. Wohl um die Wogen etwas zu glätten, fragte er nach einer Zigarette.
„I hab aufgehört…“, sagte ich und zündete mir noch eine an.
„Aber du hast doch gerade…“
„… mit dem Herschenken. Und jetzt schwing di.“ Ich wurde nicht oft pampig, aber wenn, dann richtig. Er drehte um und ging zurück auf den provisorischen Dancefloor zwischen Couchecke und Fernseher. Wir sahen ihm nach, rauchten fertig, gingen rein und bestellten noch ein paar Gin Tonic. Wir redeten weiter, aber über weniger deprimierende Themen. Die Bundesliga, E-Bikes, Michael Jordan und Ed von Schleck.
Die Feier ging noch ein paar Minuten, als plötzlich, um etwa kurz vor elf, die Musik ausging. Wir schauten zunächst alle überrascht durch den Raum und wussten nicht recht, was vor sich ging. An der Tür standen drei Nachbarn und beschwerten sich – laut ihrer Aussage zum fünften Mal – über die Lautstärke. Das sei hier keine Diskothek und alle hätten sie Kinder und so weiter. Pippo und ich sahen uns an und ich dachte an unsere Gespräche über den Abend.
„Schau her, Mann. I muss einfach weg.“, sagte ich und trank aus.
Frühshoppen
Es gehört zur altbayerischen Lebenskultur, wie die Tracht, das Bier, der Anstand und der unbändige Glaube an JC, seinen Schöpfer und den Heiligen Geist: das Frühshoppen. Damit ist allerdings nicht der sonntägliche Flohmarktbesuch, das verkaufsoffene Wochenende, Night Shopping oder das Durchzechen vor den digitalen Online-Königreichen der Bekleidungsindustrie gemeint, sondern das altbewährte, legere Weißwurstfrühstück, das es jedem bedingungslos erlaubt, am Vormittag Weißbier in allen Maßen und Formen zu konsumieren, ohne sich umgehend zu einem gesellschaftlich Geächteten zu entwickeln. Weißbier und Weißwürst: das Frühstück der Champions. #healthyfood #startyourdayright.
Mein Freund Michi hatte gerade eine neue Terrasse vor seinem Wohnhaus errichtet und lud mich zu einem jener Weißwurstfrühstücke ein. Freier Blick auf die Chiemgauer Alpen, eine neuerdings öfter lachende Sonne und mein baldiger Abschied aus dem Voralpenland waren Grund genug, uns zu treffen.
Wie zumeist, lag es an mir, Michi in die Welt der wachen Menschen zu befördern. Eine handelsübliche Hausklingel eignet sich bei unregelmäßiger und schneller Betätigung von außen hervorragend dafür. Er machte mir nach wenigen Augenblicken auf und legte sich seine Haare zurecht, als er mich ins Haus hereinführte.
Er meinte, er richte sich noch kurz her und ich solle schon mal die Würstl in die Küche legen. Und wenn ich Zeit hätte, noch den Tisch auf der Terrasse decken. Freilich.
Ich durchkämmte jeden Küchenschrank nach ordentlichem Besteck und wurde auch irgendwann fündig. Ich nahm Teller, Besteck, Senf und Weißbiergläser mit nach draußen und setzte mich. Michi kam nach ein paar Minuten heraus und setzte sich dazu. Die Sonne lockte uns förmlich nach draußen.
„Hast du as Wasser schon aufgesetzt?“, fragte Michi, noch immer in recht verschlafenem Ton.
„Na.“, sagte ich.
„Okay, mach i dann.“
Wie in jeder ehrlichen Konversation des 21. Jahrhunderts saßen wir am Handy, während wir uns nebensächlich unterhielten. Dennoch bestand zwischen uns ein grundsätzlicher Unterschied in der Herangehensweise am Smartphone. Michi entnahm seiner bevorzugten Social-Media-Plattform den Inhalt seines Feeds. Wenn man den Feed wirklich mit „füttern“ übersetzt, dann bekommt die ganze Geschichte einen viel intensiveren Schlag, dachte ich.
Ich dagegen las zunächst, warum man der Regierung nicht glauben sollte und dass die Erde in Wirklichkeit flach wäre. Sie ist keine Kugel, sondern flach, mit einem Eiskranz rundherum, damit man nicht runterfällt, wenn man an den Rand segelt. Ich las mir sorgfältig die Argumente durch, doch verstand nicht ganz, wer denn davon profitieren würde, wenn alle Menschen glaubten, die Erde wäre eine Kugel. Doch auch dafür bekam ich recht schnell – zumindest teilweise – eine Antwort. Die Reptiloiden profitierten davon. Echsenmenschen, die sich als Abgeordnete und Prominente tarnen und uns unterwandern. Wo genau jetzt der Profit lag, verstand ich immer noch nicht. Ich war in Gedanken voll und ganz verschwunden, bis Michi aufblickte und mir Neuigkeiten zutrug.
„Die Lisa hat heut Geburtstag.“, sagte er.
„Welche Lisa?“, gab ich mich unbewusst blöd.
„Wie viele kennst denn?“
„Okay.“, gab ich nach, „Und woher weißt du des?“
„Hat sie gepostet.“ Er drehte das Handy zu mir und zeigte mir den Post. Ja, liebe Leser des prä-sozial-medialen Zeitalters, das gibt es. Leute, die ihren eigenen Geburtstag posten. #happybirthdaytome. Das erinnert mich immer an den jungen Klaus in unserer Realschulklasse, der auch Geburtstag hatte und der, als ihm aus Unwissenheit niemand gratulierte, seinen Geburtstag in kleinen und leise betonten Nebensätzen in Konversationen einzubauen versuchte. „Schon wieder ein Jahr älter.“, sagte er dann. Oder: „Die Zeit vergeht so schnell.“ Mit einem starken, seufzenden Ausatmen hinterher, damit irgendjemand irgendwann ja merken musste, dass er irgendetwas mitteilen wollte.
Michi legte sein Handy weg und meinte: „I mach mal die Weißwürst warm. Wie viel magst du?“
„Drei. Und pass auf, dass sie ned platzen.“, sagte ich und hörte nur ein abwesendes „Ja, ja“, als Michi zur Tür hinein verschwand. Ich saß beruhigt da und blickte geradewegs von Michis Terrasse rein in die Chiemgauer Alpen und sah, wie die Sonne hinter der Siedlung weiterstieg. Und irgendwo zwischen hier und da, sagte ich mir, sind sie auch, die Reptiloiden.
Michi kam wieder heraus und die Konversation wurde nahtlos fortgeführt.
„I glaub’s ja ned, dass der Seppi der an Antrag gemacht hat.“, sagte Michi, wieder in sein Smartphone glotzend. Ja, immerhin bin ich nicht der einzige, der weit weg ist vom Heiraten, dachte ich.
„Und woher weißt du des scho wieder?“, kam es mir plötzlich.
„Er hat a Foto dazu gepostet.“ Was sonst? Michi drehte das Display erneut zu mir und ich sah das Foto von Seppi, Lisa und dem Ring, irgendwo auf einer Berghütte, umringt von Schnee.
„Der hat a Sonnenbrille im Winter auf. Jetzt dreht er total ab.“, sagte ich zynisch. Ich war der jüngste alte Mann der Welt.
„Ja, und?“, fragte Michi.
„Des is wie die Leute, die beim Joggen Sonnenbrillen tragen.
Dafür gibt’s verdammt nochmal an Ort und a Zeit.“
„Wie du meinst. Aber des war ned im Winter, die waren nur auf na Hütte. Jetzt is Anfang März. Da hats halt no Schnee. Und vielleicht verträgt er des Licht ned da oben. Außerdem: was is so schlimm dran?“, ging Michi auf mich ein.
„Der hat nix mit de Augen, i kenn den seit der Schule.“
„Vielleicht is er kurzfristig erblindet.“, meinte Michi scherzhaft.
„Des würd erklären, warum er die Lisa heiratet.“ Beide lachten wir. Ja, manchmal war ich für einen gut.
„Wie lange brauchen die Würst eigentlich no?“, fragte ich zwischendurch.
„I schau nach.“ Michi ging ins Haus, ließ mich mit meinen Gedanken alleine und meinte, als er wieder rauskam, die Würst wären immer noch kalt.
„Weißt, was i vorhin gelesen hab?“, fragte Michi, als er zur Abwechslung mal wieder in sein Handy schaute. Er tappte ein paar Mal darauf rum und las mir vor. „Landkreis Landshut. Bla bla bla. …Musste das Tier eingeschläfert werden, nachdem der Mann mit der Befriedigung fertig war.“
„Hm?“, fragte ich recht wortkarg. Ich hatte keine Ahnung, was er wollte und war mir nicht sicher, ob das nicht sogar gut war.
„Da hat einer an Hund gevögelt.“, belehrte mich Michi, fast schon wiederholend. Netter tierischer Ausdruck. Einen Hund gevögelt. Ich schaute nur unbekümmert drein. Er drehte mir das Display wieder hin, um mir die Sache ernsthafter anzupreisen.
„Is doch nimmer so schlimm heutzutage.“, kommentierte ich lakonisch, zuckte mit den Schultern und nahm einen Schluck von meinem Weißbier.
„Wos meinst du?“, fragte Michi, erschrocken von meiner monotonen Unvernunft.
„Naja. Selbst wenn des furchtbar is. Der Typ googelt einfach, wer sonst noch so Hunde vögelt da draußen, wird Teil von na Community, trifft sich auf Hundeficker-Meetings. Die haben dann Aktionen, machen Spielenachmittage untereinander. Des is halb so schlimm in Zeiten vom Internet. Und außerdem drehen sowieso alle durch.“
„Du bist echt a Miesmacher manchmal, Toni.“
„Wieso? Nur weil i Sachen aussprech, die jeder denkt?“
„I denk ned, dass Hunde bumsen normal is.“, gab sich Michi anständig.
„Mann. I sag ja ned, dass es normal is. Aber für manche Menschen is es nichts unnormales mehr.“
„So, wie wenn man a Sonnenbrille im Winter trägt?“, provozierte Michi.
„Leck mich.“, kappte ich ihn ab, „Es is wie mit Religion.“
„Wos is damit jetzt wieder?“
„Früher war des undenkbar, dass jemand ned an Gott glaubt. Heut is de Kirche am Sonntag so leer wie a Studentengeldbeutel.“
„Wie kommst du jetzt vom Hunde bumsen auf Religion?“
„I wollt so schnell wies geht des Thema wechseln.“
„Okay.“, nickte mir Michi rechtgebend entgegen und legte sein Smartphone endgültig beiseite, „Bist du religiös?“
„Hm?“, fragte ich erneut. Mit einem angesetzten Weißbier bringt man nicht mehr allzu viel heraus.
„Glaubst du an Gott?“
„I glaub eher an Aliens.“, sagte ich und kratzte mit dem Finger auf dem Holztisch herum.
„An Aliens?“
„Ja.“
„I hab no nie welche gesehen.“, meinte Michi und lehnte sich zurück.
„I hab a no keinen Gott gesehen. Aber Alien a keinen, da hast du recht. Werd i a nie. Wer will uns denn scho besuchen?“
„Es gibt doch schöne Orte bei uns. Und mit Sicherheit Technologien und sowas, des die ned kennen.“
„Um zu uns zu kommen, brauchen die scho mal a Technologie, die viel weiterentwickelt is, als alles bei uns kaufbare.“, erklärte ich meine neueste Theorie, „Und außerdem: sagen wir mal, du kommst zur Erde und siehst, wie junge Leute in affigem Gewand sich a Smartphone vor die Linse heben und zu irgend na Kack-Musik tanzen und des filmen, würdest du dann ned umgehend wieder in dei Raumschiff steigen, dir fünfhundert Gramm Koks reiziehen und ohne Abschiedsbrief einfach abdanken?“
„Jetzt geht des wieder los. Du und deine Theorien immer. Du hörst di an, wie a Rentner. So is halt mal die Zeit, die Jugend.
Des ändert si halt. Sollens alle im Wald rumlaufen wie da Tom Sawyer, oder wos?“
„Wos heißt da: i und meine Theorien? Deine Theorie is ja mal völlig wahnsinnig!“, verteidigte ich mich.
„Welche? Dass jemand, der mit juckendem Arsch ins Bett geht, mit stinkendem Finger aufwacht?“
„Ja genau.“, antwortete ich, verschränkte die Arme vor der Brust und lehnte mich zurück.
„Des is ja so.“
„I glaub es is gescheiter, wenn du mal nach de Würstl schaust.“, warf ich in die Debatte, um eine mögliche Eskalation zu vermeiden. Eigentlich wollte ich vor dem Essen keine rauchen, aber die Diskussion trieb mich wieder zum Griff in die Schachtel. Michi kam relativ schnell zurück auf die Terrasse.
„Also, die sind immer no kalt. Du warst doch mal beim Heizungsbauer, kannst du dir des mal anschauen?“
„Erstens war i da gerade mal zwei Sommer lang. Und zweitens: wos hat des überhaupt mit dem zu tun?“
Ich ging rein, um mir das Problem anzuschauen. Ich weiß nicht, ob ich ihn mit Verschwörungstheorien und Gesprächen über Sodomie abgelenkt hatte, doch ich hatte Michis Problem recht schnell entdeckt.
„Michi, du hast die falsche Herdplatte angeschaltet.“
„Oh.“, sagte Michi verdutzt, „Naja, wenigstens sind sie ned geplatzt.“
Der Dicke und sein Japaner
Ich brüllte zum gefühlt vierundsiebzigsten Mal auf meiner Autofahrt den Vordermann an. Dann zog ich links vorbei, schaute rüber und sah einen alten Tattergreis mit einer dieser braun getönten Brillen, wie er mit akkuratem Kurzhaarschnitt und Zehn-vor-Zwei-Lenkung die Spur hielt und sein Tempo achtzig gemütlich durchzog. A-Klasse, Wackeldackel und Gamsbart auf der hinteren Ablage ließen mich schon vermuten, wen ich da vor mir hatte. Und nach einer Viertelstunde hatte ich es nun auch geschafft, ihn zu überholen.
Ich war auf der A96 unterwegs, in Richtung Baden-Württemberg. Genauer gesagt: in den Schwarzwald. Das sollte ich noch lernen, dass diese Spezifikation unvermeidlich ist, um mit einigen Personen auf der Westseite der Republik ein gutes Verhältnis zu pflegen. Mei o Mei, wo war ich da wieder gelandet? Ja, das dachte ich zu diesem Zeitpunkt. Bis mir einfiel, dass bei uns drüben auf bajuwarischer Seite der gleiche Blödsinn abgeht. Da kann es einem schon zum Verhängnis werden, wenn man im falschen Ortsteil wohnt. Du wohnst bei den zweiunddreißig Typen hundert Meter hinter dem Sportplatz? Schau ja nicht meine Tochter an.
Nach meinem Bachelorstudium in Rosenheim hatte ich keinen Plan, wie es denn weitergehen sollte, und ich fand eine Hochschule im Schwarzwald, die sich bereiterklärte, mich unter ihre Fittiche in ihrem Angebot von Masterstudiengängen zu nehmen. Betrachtet man den linearen zeitlichen Fortschritt in der Sache, so stimmt der Satz, dass, wenn sich eine Tür schließt, eine andere aufgeht.
Die Hochschule lag in einem beschaulichen Siebentausend Seelen-Ort und ich fand in der Nähe eine kleine, nette Wohnung auf dem Land. Bei meiner kurzweiligen Recherche zu meinem künftigen Lebensabschnitt, mit der ich mir die Werbepause in einer dieser Amateur-Sänger-Shows beschäftigt hatte, fand ich bei der Betrachtung einiger Online-Foren und anderweitigen Internetquellen heraus, dass meine neue Heimat anscheinend der Ort in Deutschland mit der höchsten Selbstmordrate unter Studenten sei. Das konnte ja lustig werden. Eine Randnotiz vorweg: ich fand nie heraus, ob dieser Mythos der Wahrheit angehörte oder nicht.
Und nun saß ich halt da, im geliehenen Auto meiner Eltern und bog ab in eine Zukunft voller Ungewissheit, wo ich niemanden kannte, wo niemand meinen Dialekt sprach und wo höchstwahrscheinlich keiner Bock auf meine Geschichten über Komparserie, Dorfrangeleien und gestörte Nachbarn hören wollte. Klasse.
Es ging weiter auf der Autobahn monoton voran. Auto für Auto, Lastwagen für Lastwagen, Traktor für… Moment. Traktor? Ja, da war einer. Ein Traktor auf der Autobahn. Wo war ich denn da gelandet? Alle Autos schossen in dieselbe Richtung und ich fragte mich, wo die alle hinwollten. Ich war umringt von Pendlern, Vertretern und Touristen. Und umringt von Zweifeln, ob das denn alles Sinn ergab, was ich da lostrat. Mit zunehmender Entfernung von der Heimat wurde die Landschaft flacher. Die Berge zogen sich weit in den Horizont zurück. Und weiter und weiter. Bis sie irgendwann nur noch schattenartige Silhouetten waren, die nur unter klarem Himmel zu sehen waren.
Bis nach Memmingen konnte ich die grenzenlosen Vorteile der German Autobahn und seinen zum Teil frei wählbaren Geschwindigkeiten auskosten, danach ging es runter auf die Landstraße.
Es war ein recht heißer Tag für das Frühjahr. Zumindest was die blau-weiße Heimat und den größten Teil der Autobahn anging. Je weiter ich dann in den Schwarzwald vordrang, desto mehr wurden meine bereits aufgezogenen Sommerreifen zu einem Untersuchungsfall für die Versicherung.
In einer Ortschaft namens Ochsenhausen fuhr ich dann kurz in den Boxenstopp. Tankdeckel auf und ab geht’s. Man kennt das ja. Ich schaute auf die riesige Anzeige an der Straße mit den 1,29 Euro für den Liter Benzin und dachte zurück an meine Lehrerin in der Grundschule, die meinte, sobald der Benzinliterpreis die Eine-Mark-Hürde überklettert, breche breites Chaos in der Welt aus. Ja, so war das zu meiner Zeit in der Grundschule. Da wurde man noch mit der Angst in den Beinen nach Hause geschickt. Oh Gott, ich hör mich schon wieder an, als würde ich vierzig Jahre älter sein, als ich denn bin. Jetzt brauchte ich nur noch Camp-David-Klamotten, Pulled-Pork-Burger und Tourenski und ich war im wohl unterbewusst ersehnten Mittfünfzigerdasein angekommen.
Als ich dastand und auf das Schnackeln des Schlauches wartete, trödelte sich ein japanischer Kleinwagen mit Biberacher Kennzeichen hinter mich in die Spur der Tankstelle. An den Wagen konnte ich mich noch erinnern, den überholte ich außerorts vor einer Ortschaft namens Erlenmoos. Der nervte mich schon ab der Autobahnausfahrt. So ein Experte, der sich an jede rote Ampel hin rollen ließ, in der Hoffnung, sie schalte wieder auf Grün und er müsse nicht schalten. Dann noch der „Leider Geil“-Aufkleber auf der Heckstoßstange, den ich die ganze Zeit sehen musste. Dann wurde er halt überholt, der Golf meiner Eltern schaffte das ja. Mein 98er Polo hätte da mehr Schwierigkeiten gehabt. Zwar wurde es ein wenig eng, aber ich konnte die nächsten zwei Kilometer beruhigt weiterfahren. Bis jetzt.





























