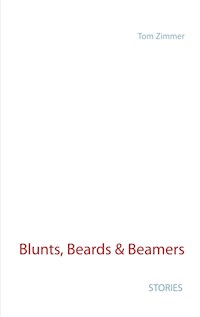Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Abiturient Toni Zaunmüller beginnt in diesem Prequel zu "Blunts, Beards & Beamers" ohne große Hoffnungen ein Studium der Ingenieurswissenschaften in seiner Heimatstadt Rosenheim. Schnell muss er allerdings feststellen, dass ihm nicht das Bewältigen von Klausuren oder Hochschulprojekten das Leben schwer machen, sondern vielmehr die nächtlichen Streifzüge durch das Studentenleben, die Nebenjobs in der Filmkomparserie und die ganz normalen Absurditäten des Alltags.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Während der Produktion des Buches kamen keine Tiere zu Schaden.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Je m’appelle Toni Zaunmüller
Stefan-Boltzmann
Herr Maierhofer
Es war mir ein Volksfest
Steeze und Schönheit
Die Olympiade
Spitz
Infinity Pools
Gottverdammt und Gruzifix
Die Angesagten
Das Ende
Welle
Schneelancholie
Das Match
Maxi
Der Defaitist
2003
Heid bin i Kini
Prolog
Was macht man, wenn man außer dem Drang, auf die Toilette zu gehen, morgens ansonsten keinerlei Antrieb hat? Man studiert.
Was macht man, wenn man handwerklich so talentiert ist, dass man bei einer ausgebrannten Glühbirne die Rohrzange holt? Man studiert.
Und was macht man, wenn man außer einem durchschnittlichen Abitur und einer zweistelligen Niederlagenserie am hauseigenen Schachcomputer wenig vorzuweisen hat? Man studiert natürlich.
Zu studieren war natürlich auch irgendwo unabdinglich. Schließlich schaffte es sogar der Nachbarsjunge, der in der fünften Klasse seinen Namen noch nicht schreiben konnte und der dachte, Antipasti wäre die griechische Version von Monopoly, über den fünfundvierzigsten Bildungsweg am Ende auch, einen Bachelor-Abschluss zu erlangen. Das spornte meinen Plan – und vor allem den meiner Großmutter – zu studieren, natürlich an. Die Frage war nur noch, was. Als ob das jemals richtig gewesen wäre.
Die letzten Sommer half ich meinem Cousin in seinem Baubetrieb und legte mir die gesammelte technische Erfahrung als Ausrede parat, ich würde gerne Bauingenieurwesen studieren. Da konnte niemand was sagen. Das war angesehen und man fand später sicherlich einen Job. Redete ich mir ein. Am wichtigsten war jedoch, ich konnte mein Leben mittelfristig dahinfließen lassen, auch wenn – oder gerade weshalb – ich wusste, dass ich mich nie zu einhundert Prozent mit dem Studium identifizieren oder mich gar dafür interessieren würde. Aber wer tut das schon?
Meine Stärken lagen eher in kreativen Dingen, dessen war ich mir immer bewusst. Ich war schon als Kind gut im Malen und Zeichnen. So gut, dass mich die Grundschullehrer zeitweise für einen Autisten hielten.
Filme interessierten mich, Bücher, Malerei. Aber primär fand ich Spaß am Zeichnen. Auch der örtliche Kinderarzt, Dr. Hohenegger-Müller, der jedes Kind standardgemäß bat, sich bis auf die Buchse auszuziehen, ganz egal, weshalb es überhaupt bei ihm war, meinte zu mir eines Tages, als ich wieder in der Unterhose vor ihm stand, ich solle später einmal was mit dieser Gabe anfangen, schließlich hingen einiger meiner frühen Kunstwerke damals an seiner Wand in der Praxis. Und ich gab dem Mann recht, schließlich war er Arzt. Und hatte einen Doppelnamen.
Ich hatte mich unlängst schon für die risikofreiere Variante des Bauingenieurwesens an der Rosenheimer Hochschule eingeschrieben. Vielleicht war das Leben eines bettelarmen Künstlers in einer eiskalten Wohnung nichts für mich. Und was sollten die Leute denken? Ich kam aus einer örtlichen Siedlung am Rosenheimer Stadtrand. Wenn man da als Kerl Kunst studierte, hielt einen die Dorfgemeinschaft sofort für eine einzige Last des Steuerzahlers oder zweifelte an der Sexualität des Studierenden. All diese Gedanken ließen mich den konservativen Weg gehen.
Dennoch wollte ich mein Gewissen erleichtern und entschied mich in meinen letzten Schulsommerferien, mir den Tag der offenen Tür an einer Münchener Kunsthochschule zu geben.
Ich stieg also eines heißen Sommertages in den Zug in die Landeshauptstadt und marschierte vom Bahnhof weg zu besagter Kunsthochschule. Schnellen Stiftes trug ich mich in dem Besucherbogen ein und startete meinen Erkundungslauf durch das Gebäude.
Bereits am Eingang waren mir sämtliche klischeehafte Mitglieder der Kunstszene aufgefallen. Baskenmützen, wild gefärbte Haare, die den Widerstand gegen eine aktuelle politische Debatte oder die Unterdrückung irgendeiner Gruppe, zu der man selbst selten gehörte, zum Ausdruck bringen sollte. Schwenkende Arme in Gesprächen, gepflegte Bärte, Hornbrillen. Science-Fiction-Flapper-Girls. Ich passierte immer wieder diese Menschen und wünschte mir einen Wald zum Reinschreien oder einen Mülleimer, wo ich reinkotzen konnte. Ich regte mich schon wieder zu sehr auf.
Die Schule hatte eine Galerie für die Interessenten geöffnet. Es war ein großes, kahles und trauriges Hallenabteil mit vereinzelten Neonröhren, die den Fokus der Besucher auf die jeweils darunterliegenden Kunstwerke richten sollte. Die I-Träger und der glatte, unbehandelte Beton an den Wänden ließen alles gefühllos und neutral erscheinen.
Vorsichtig schaute ich durch die Halle und betrachtete ein paar der Werke. Mit solchen Sachen konnte man also wirklich Geld verdienen? Wieso studierte ich dann Bauingenieurwesen? Farbkleckse, in denen man die Umrisse üblicher Haushaltsgegenstände erkennen sollte, welche einem die mentale Steuerung der Persönlichkeit verraten konnten. Halbnackte junge Statistinnen, die sich zwei Stunden lang rekelten und in Ganzkörperschminke auf einer Empore zur Schau stellten und ausschließlich in getakteten, beinahe motorisch gesteuert wirkenden Bewegungen existierten. Alles für die Kunst.
Ich blieb an einem der Bilder hängen, das aussah, als würde eine Galapagos-Schildkröte im Twister gegen einen nordischen Elch verlieren. Minutenlang betrachtete ich es. Ich verstand es nicht, aber ich achtete auf die Spuren, welche die unterschiedlichen Pinsel hinterlassen hatten. Ich achtete auf die Farbkompensationen, die Dichte, die Aura. Und ich musste noch ein paar Minuten totschlagen, bis der Zug kam.
Ich hatte genug. Ich sah ein, dass ein Leben für die Kunst doch nichts für mich war. Anfangs enttäuschend, sah ich es nach kurzer Zeit als Befreiung.
Ein junges Mädchen wurde auf mich aufmerksam, als ich noch immer an dem Bild haftete. Ich fragte mich, ob ihre Aufmerksamkeit auf meinem Interesse an dem Möchtegern-Pollock beruhte oder auf der Annahme, dass sie mich ähnlich unwiderstehlich hielt, wie ich selbst, so wie ich da mit meiner wildgewordenen Mähne und meiner Lederjacke rumlungerte.
„Hey, du.“, sagte sie freundlich, „Gefällt’s dir?“
Sie war wohl eine der hier immatrikulierten Studentinnen, die den Besuchern bei Fragen zur Seite standen. Sie sah auch ganz nett aus, anders als ihre futuristischen Kommilitoninnen mit den bunten Haaren und den Cyberpunk-Klamotten.
„Ja, echt faszinierend.“, antwortete ich abfälliger, als ich überhaupt wollte, „Der Cousin von meiner Nachbarin is vier, der kann mit seinem Malkasten was ähnliches anstellen. Da wird er aber scho so zwei oder drei Minuten brauchen.“
„Alles klar.“, sagte sie mit abnehmender Stimme und gleichzeitig abnehmendem Lächeln, „Meld‘ dich, wenn du was brauchst.“
Verdammte Scheiße. Ich machte das doch noch nicht mal absichtlich. Der Mist kam immer automatisch aus mir raus. Vor allem in dieser Situation, als ich kurz zuvor einzusehen hatte, dass die Kunst für mich als Lebensentwurf gestorben war und ich den konventionellen Weg zu gehen hatte.
Ich ging auf die Toilette und warf mir am Waschbecken eine Ladung Wasser ins Gesicht. Auf der Uhr sah ich, dass ich noch gut zwanzig Minuten hatte, bis der Zug kam. Jetzt oder nie.
Ich ging nochmal in die Halle und suchte nach dem Mädchen, um ihr eine Entschuldigung zu liefern. An dem Bild von vorhin war sie nicht mehr. Ich schaute umher, die Zeit lief. Ich fragte Leute nach ihr, die mir allesamt außer Achselzucken und wortlose Kopfschüttler wenig entgegenbringen konnten. Letztendlich fand ich sie bei einer der halbnackten Statistinnen, der sie beim Zusammenpacken half. Ich ging zu ihr rüber und erklärte ihr, dass ich seit nunmehr neunzehn Jahren ein unzufriedener, unmotivierter und phlegmatischer Zeitgenosse sei und der Traum über die Kunst für mich ein paar Momente zuvor gestorben war. Wir quatschten noch gut zehn Minuten weiter und sie schien mich zu verstehen, sie lächelte wieder.
Ich sputete mich zum Bahnhof, klassisch erreichte ich den Zug gerade da, als sich die Türen schon zu schließen begannen.
Ich ließ mich in einen Vierer fallen und lehnte den Kopf schnaufend nach hinten. Mit gesteigerter Fitness vom Spurt, pochender Lunge und einer neuen Handynummer nahm ich die Entscheidung an, nie wieder an die Kunsthochschule zu kommen. Zum ersten Mal war ich mir bewusst, künftig Bauingenieurwesen zu studieren.
Je m’appelle Toni Zaunmüller
Ich war in die City gezogen. Also, in die Rosenheimer Innenstadt, City kann man jetzt nicht sagen. Die erste Nacht in meiner neuen Bude war gleichzeitig jene vor dem ersten Vorlesungstag. Bis dahin hatte ich der Nostalgie halber noch in meinem Kinderzimmer im Elternhaus geschlafen.
Ich stand auf und schritt mit langen Beinen über die Umzugskartons und die am Boden liegende Kleidung vom Vortag, die ich umgehend aufhob und an meinen Körper brachte.
Der erste Vorlesungstag an der Rosenheimer Hochschule und auch insgesamt für mich stand vor der Tür. Ich bewegte mein Gefährt und mich früh morgens in Richtung Hochschulgelände. Unterwegs wurde mir erst bewusst, wie klug es war, in Rosenheim zu bleiben. So hatte ich nie den Pendelstress nach München oder Salzburg oder Kufstein. Die fünf Minuten Autofahren zur Hochschule gingen mir ja schon auf den Sack.
An der Hochschule angekommen, bemerkte ich die erste Problematik, die mich die kommenden elf Semester – bestehend aus sieben Semestern Regelstudienzeit und vier selbstverschriebenen Sabbath-Semestern (Spoileralarm) – begleiten sollte: die Parkplatzsituation.
Man kann sich vorstellen, wie einer vierzehn Maß Bier im Zelt in seinen Magen pumpt, man kann sich vorstellen, wie zweiundzwanzig Clowns aus einem Auto steigen. Aber glaub mir, Bruder: man kann sich niemals vorstellen, wie fünftausend Studenten auf zwei Parkplätzen ihre Wagen unterbringen.
Besonders gewiefte Denker kamen gleich mit dem Zug oder dem Fahrrad. Erfahrung macht die Weisheit. Nach gefühlt endloser Rumkurverei und zahlreichen enttäuschenden Momenten, in denen man eine Parklücke findet, nur um im letzten Augenblick feststellen zu müssen, dass doch noch ein Smart drinsteht, fand ich doch noch eine der begehrten Lücken auf dem Parkplatz hinter dem Q-Gebäude. Ich hatte zwar den Kompromiss einzugehen, dass meine Nebenleute Probleme beim Einsteigen haben würden und ich das Auto über das Dachfenster zu verlassen hatte, aber ich war zufrieden.
Es schien nicht zu regnen, also zog ich die Nummer über das Dachfenster durch. Eine kleine, an der hinteren Tür der Hochschule stehende Gruppe von Leuten beobachtete mich und machte höchstwahrscheinlich intern blöde Bemerkungen über einen der Erstis.
Ich warf mir den Rucksack über die Schulter und marschierte in Richtung Foyer im Hauptgebäude. Dort angekommen, musste ich feststellen, dass ich wohl der Einzige mit Rucksack war. Umhängetaschen und kofferähnliche Verstauvarianten waren eher angesagt im Studentenleben. Sehr ungewohnt.
Ungewohnt war zudem, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben einen Tag in einer schulischen Einrichtung verbrachte, ohne dass ich eine von Mamas Brotzeitdosen dabeihatte.
Das Foyer wurde mir als Startpunkt des ersten Tages in meiner Willkommenspost der Hochschule mitgeteilt. Hier gab es nun eine groß angelegte Eröffnungsfeier für alle Neuankömmlinge. Ich stellte mich unter die immer noch frischen Abiturienten und horchte den Worten der Redner zu.
Die Bürgermeisterin pries die jahrelange Zusammenarbeit der Hochschule mit umliegenden Betrieben positiv an, ein Mitarbeiter der Hochschule verkündete die sportlichen Erfolge der Vergangenheit und eine Studienbotschafterin versuchte mit angeboten Freizeitaktivitäten, die lauschenden Gesichter einzustimmen.
Nachdem ich erfuhr, dass die Rosenheimer bei der oberbayerischen Hochschul-Basketballmeisterschaft 1982 den dritten Platz holte und dass man anscheinend schauen sollte, nicht vor dem Fernseher zu versauern, teilte sich die Menge in kleinere Gruppen. Jeder Student begab sich zu einem Tutor, welcher ein Schild mit dem jeweiligen Studiengang in die Höhe hielt. Ich für meinen Teil begab mich zu dem Pollunder und Brille tragenden, hochgewachsenen Jüngling ohne Haarschnitt, der das Schild „Bauingenieurwesen“ in die Höhe reckte. Er wirkte genervt und stand wortlos nur da, bis der Zulauf zu unserer Gruppe zu versickern schien.
Er teilte uns die Fächer in kleiner Runde mit, die wir in der ersten Woche zu bewältigen hatten, und stellte sich den übermotivierten und teils selbsterklärenden Fragen der enthusiastischeren Erstsemestler.
Danach führte er uns zum ersten Hörsaal, den die meisten von uns jemals betraten und überließ uns dem Dozenten.
Wir alle nahmen irgendwo Platz. Ich suchte mir logischerweise einen Platz in den hinteren Vierteln des Auditoriums. Auch wenn ich die Hochschule nur als Durchgangsstation sah und ich mehr auf das Nachtleben als Student gespannt war, so war ich durchaus begeistert von dieser ganz neuen Lernkultur, die sich in hohem Maß von der aus der Schulzeit unterscheid. Hörsäle, Dozenten, Siezen, große Zahlen an Zuhörern.
Wie die meisten anderen hier im Auditorium, kannte ich keinen. Ich war alleine und auch irgendwo froh drüber. Der Hörsaal füllte sich mit der Zeit immer mehr und die Plätze rechts und links von mir wurden schnell besetzt. Es lief dann so, wie es sich immer in solchen Situationen ergibt: man wirft sich in belanglosen Small-Talk. Und in dem war ich ja Weltklasse.
Der rechts neben mir kam aus dem Sauerland und las ein Buch über Biologie, das er beim Hinsetzen auf den klappbaren Tisch vor sich gelegt hatte.
„Wos liest denn da?“, fragte ich, nachdem er mir die ganze Plörre von seinem Umzug und seinem ersten Mal in Bayern und die Lüge über die freundlichen Leute in Rosenheim präsentiert hatte.
„Ach, das ist n‘ Buch über die Tierwelt, wo Vergleiche mit den Menschen gezogen werden.“, antwortete er mir, „Ist zurzeit recht interessant, gerade mit der ganzen Sache hier mit dem Wolf.“
„Wolf?“, fragte ich.
„Na, der Wolf.“, wiederholte er sich und gab mir das Gefühl, als wäre etwas Sensationelles an mir vorbeigegangen, „In den Chiemgauer Alpen soll sich ein Wolf rumtreiben. Der ganze Landkreis und alle Medien streiten sich darum, ob man ihn erschießen sollte oder nicht. Hast du das nicht mitbekommen?“
Nicht mitbekommen? Ich wusste nicht mal, wer gerade Bundespräsident war.
„I dacht, es geht um Vergleiche mit dem Menschen?“, lenkte ich von meinem Unwissen ab.
„Ja, größtenteils. Wusstest du zum Beispiel, dass Elefanten doppelt so schlau sind wie Menschen?“
„Is des so? Wieso können die dann ned Autofahren?“
Mit großen Augen starrte er mich perplex an und drehte sich zu seinem rechten Nebenmann um, um mit dem zu schwätzen. Ich denke, das war für alle Beteiligten auch das Beste.
Der links neben mir hing ähnlich in den Seilen wie ich.
„Hey. Toni.“, stellte ich mich vor und reichte ihm die Hand.
„Philipp. Aber alle nennen mi Pippo.“, sagte er mit monotoner Stimme und noch monotonerem Blick und schüttelte meine Hand.
„Rosenheimer?“, fragte ich, nachdem ich seinen bayerischen Dialekt erkannt hatte.
„An wos hast des erkannt? An meine Augenringe?“
Ich hatte ihn noch nie gesehen in Rosenheim.
„Eher an den Einstichstellen am Arm und am leeren Geldbeutel.“
Schlagfertig, Toni. Schlagfertig.
Wir saßen weiterhin da, vertrieben uns die Zeit mit kleineren Plaudereien über Zigaretten und Snus, über autofahrende Elefanten und den heiligen Jesus und warteten, bis der wahre Studiengang endlich losging.
Dann war es so weit: der Dozent stieß die Tür auf und die erste Vorlesung meines Lebens sollte beginnen. Ich hatte ursprünglich immer die Vorstellung, dass das Studieren im realen Leben dem aus dem Fernsehen gleichkommen würde. Häuser besetzen, demonstrieren, sich im Hörsaal wegen dem Schah von Persien fetzen. Die Realität sah jedoch um kleine Nuancen anders aus.
Der Prof schrieb seinen Namen an die Tafel und Mathe I stand an. Er begrüßte uns kurz, wünschte uns viel Glück und legte direkt los. Keine Häuser besetzen, keine Demonstrationen, nicht einmal ein Wortgefecht im Hörsaal. Dafür gab es das Ableiten von e-Funktionen, partielles Integrieren, Taylor-Reihen und Laplace. Herrschaftszeiten.
Ich kam mir ähnlich blöd vor, wie mein gleichaltriger Vetter Valentin, der mir mit sechzehn auf so einer Garagengeburtstagsfeier nach siebzehn Halben Bier weismachen wollte, dass jemand mit Satzbauschwächen an Kommunismus leide.
Da ich ja nun kein Künstler werden sollte, wollte ich eigentlich nur später einmal acht Stunden am Tag Zahlen in einen Computer hacken, heimkommen, ein Bier trinken, den Abfluss reparieren, am Wochenende in den Tierpark fahren, Fotos von meinem Essen posten und vor dem Fernseher einschlafen und musste einsehen, dass man für so etwas wohl mithilfe eines Zirkels und einer Buntstiftbox die Umlaufbahn des Saturn berechnen können musste.
Mir wurde in Windeseile klar, dass mein Fachoberschulwissen bereits am Ende angelangt war. Diese Pseudo-Raumfahrttechnik hier war eine andere Liga als Deckungsbeitrag I, 6000 Aufwendungen für Rohstoffe und Je m’appelle Toni Zaunmüller.
Wir rechneten bis zum Abend weiter. Der kalte Oktobertag ließ es früh dunkel werden. Ich schaute immer wieder durch das Fenster und sah die Sonne untergehen und mich selbst irgendwo mit ihr. Mit zunehmender Dunkelheit erkannte ich immer mehr meiner Verzweiflung in der Spiegelung des Fensters.
Irgendwann, so gegen sieben Uhr, war dann die Vorlesung beendet. Einige der Studenten klopften auf die Klapptische vor ihnen, andere klatschten. Ich klatschte zunächst und wechselte nach ein paar Handbewegungen zum Klopfen über. Es war halt erst mein erster Tag.
Ich war einfach fertig. Unvorbereitet betrat ich die Schlacht und bekam frühzeitig den Todesstoß durch Sinus, Kosinus und Arkustangens. Auch das noch. Da begriff ich mit Müh und Not, was ein Tangens war, dann kam auch noch so etwas wie ein Arkustangens daher. Das kam mir in etwa so vor, als würde man versuchen, angeschwitzte Kalbsleber mit Apfel-Chutney und Kartoffel-Espuma mit Mousse au Chocolat im Nachgang zuzubereiten, bekommt aber keine zwei Spiegeleier hin.
Ernüchtert packte ich meine Sachen zusammen und betrat schlauchend den Parkplatz. Am nächsten Morgen sollte es gleich um acht Uhr weitergehen. Grandios. Das bedeutete, ich würde um sieben sowas aufstehen dürfen. Eigentlich war doch immer die Intention, zu studieren, nicht früh aufstehen zu müssen. Ein weiteres Unterfangen, das nach hinten losging.
Auf dem Parkplatz angekommen, bemerkte ich, dass mein Auto mittlerweile das einzige war, das man weit und breit auf dem kiesigen Platz sehen konnte. Ich konnte entspannt durch die Fahrertür einsteigen und musste nicht wieder über das Dach klettern. Ich warf die Maschine an und drehte den Knopf des Radios so weit im Uhrzeigersinn, bis er anstand.
Von einem ungewohnten Druck auf den Schläfen und an der Stelle, wo sich Augenbrauen und Nasenbein treffen, geplagt, chauffierte ich mich und meine beiden Ranzen durch Rosenheim. #einerfürdieBlasmusik.
Die Musik war so laut, dass sogar die B-Säule hinter meinem Ohr vibrierte. Love me, love me. Say that you love me.
Wütend stellte ich mir immer wieder die Frage, wie lange ich es wohl aushalten würde. Drei Wochen? Vier? Zwei Monate? Ein ganzes Semester? Oder doch bloß bis zum nächsten Morgen?
Ich betrat die Wohnung, stieg wieder über die Umzugskartons, ließ meine Jacke von den Schultern auf den Boden fallen und sank in den Sessel. Eine Feder stand auf.
Ich dachte nach. Das konnte es doch nicht sein. Wie konnte ich so etwas freiwillig machen? Ich verspürte nun noch weniger Antrieb als am Morgen. Doch das änderte sich auf einmal schlagartig.
Irgendetwas schoss mir durch den Körper. Ich wurde gepusht. Gepusht von der Idee, doch was aus meinem Leben zu machen. Gepusht von der Idee, der Kunst noch eine Chance zu geben. Scheiß auf Laplace. Scheiß auf Gauß-Jordan. Ich wollte es allen zeigen, dass man auch ohne diese Raketenphysik erfolgreich werden konnte.
Hin und wieder zeichnete ich noch, vorwiegend oberflächliche und einfach gestrickte Comicfiguren. Ein paar Wochen zuvor hatte ich einen Comic über einen humanoiden Bananenmann begonnen, der die Superkraft hatte, aus seinem Kopf Bananensaft zu schießen. Ein etwas verstörendes Bild, wie mir gerade auffällt.
Jedenfalls spürte ich das Adrenalin. Ich war wie eine Kaffeebohne auf Speed. Hastig suchte ich nach dem Comic auf meinem Schreibtisch. Rechnungen, Lohnsteuergedöns, Einladungen, die Flyer sämtlicher freien Kirchen. Ich räumte die ganze Tischplatte ab. Wo war der Bananenmann?
Schließlich fand ich ihn und nahm ihn mir zur Brust. Mit dem Bleistift zwischen Zeige- und Mittelfinger wippend überlegte ich in die Luft starrend, welches Abenteuer er als nächstes erleben sollte. Und einen Kumpan brauchte er noch einen Sidekick. Vielleicht eine Ananas? Eine Apfelsine?
Energisch notierte ich alles, jede Idee. Ich zeichnete kleine Konzepte und Storyboards mit Strichmännchen. Das war es, was ich wollte. Keine Nullstellen berechnen, keine Limes-Annäherungen.
Nach etwa fünf Minuten legte ich den Stift zur Seite und schaltete die Glotze ein. Schließlich musste ich am nächsten Tag wieder um sieben aufstehen.
Stefan-Boltzmann
Ich fuhr meinen Polo geradewegs durch die Rosenheimer Nacht. Nichts war wirklich zu erkennen oder gar überhaupt zu sehen, die Scheinwerfer der anderen Autos und die bunten Lichter der Geschäfte tanzten in den Pfützen auf den Straßen und wurden mir direkt ins Gesicht geworfen.
Es war Donnerstag. Oder wie sich selbstlobende Witzbolde unserer gespaltenen Gesellschaft gerne zu sagen pflegten: Vize-Freitag.
Reflektierend dachte ich darüber nach, wie ich innerhalb von etwa acht Stunden in die Situation gekommen war, in der ich nun war. Eine Situation, die ich mir am Tag davor so noch nicht vorstellen hätte können.
Die Physik-Vorlesung am Vormittag hatte mich beinahe zum mentalen Kollaps gebracht. Impulse und Kräfte und 9,81 Meter pro Sekunde im Quadrat. Hätte der Typ damals seinen Scheiß-Apfel einfach gegessen.
Gähnend und erschöpft brach ich die Stunde ab, verließ den Hörsaal und bewegte ich mich zur Schul-Cafeteria. Ich stellte mich in der Reihe vor dem Kaffeestand hinten an. Nachdem die neoliberalen Weltretter*innen mit ihren Ballonhosen und diesen ganz nah am Haaransatz abgeschnittenen Ponys vor mir ihre Chai-Latten, glutenfreien Muffins oder weiß der Teufel was bestellt hatten, war ich nun an der Reihe: Kaffee – viel Milch, viel Zucker. Wie einst Mr. Wolfe im Jahre 1994.
Und wieder merkte ich, dass ich meinen Studentenausweis nicht mit Geld aufgeladen hatte. Nicht mal in der Cafete der Rosenheimer Hochschule brachte man sein Schwarzgeld los. Nicht mal für einen deutschen Brühkaffee.
Jetzt studierte ich seit zwei Monaten in dem Laden und hatte das bargeldlose Bezahlen noch immer nicht begriffen. Heutzutage sieht das anders aus, ich weiß. Leute bezahlen mit der Karte oder mit dem Smartphone. Letztens habe ich so einen Hexenmeister gesehen, der hat sein Tragerl Bier mit seiner Uhr bezahlt.
Ich ging also schnell zum Automaten neben der Cafete, um meinen Ausweis mit Geld zu füttern, um dann wieder zur Kasse zurückzumarschieren, um die Sache mit meinem Kaffee zu begleichen. Dieses ganze Prozedere kostete mich dermaßen viel Zeit, dass sich nun auch die meisten anderen Kommilitonen, die die Physik-Vorlesung noch bis zum Ende genossen hatten, in der Mensa eingefunden hatten. Meistens aß ich alleine, um mir in der Mittagspause nicht noch Stefan-Boltzmann-Konstanten und Lambdas um die Ohren schlagen zu müssen.
Mit meinem Kaffee in der Hand ging ich zur Essensausgabe, nahm mir ein Tablett und ein Zwei-Euro-Thai-Curry und stellte mich an der Kasse fürs Essen an. Plötzlich, als ich da in der Reihe stand, schlangen sich zwei Arme um meinen Körper und zwei zierliche Hände verdeckten meine Augen.
Dachte ich zunächst, mein halb-thailändischer Kollege Ahn, der mir des Öfteren subtile Streiche zu spielen versuchte, wäre schuld an meiner vorübergehenden Blindheit, versuchte ich ihn zu verscheuchen. Ich war zu müde für Scherze.
„Schwing di, Mao Tse Tung!“, sprach ich drohend und ohne Augenlicht, mit einem Teller voll gelbem Reis auf dem Tablett und einem Rucksack voller uninteressanter geliehener Bücher auf dem Rücken.
Als sich die Arme gelöst hatten und ich mich noch nicht ganz umgedreht hatte, sprang mir bereits eine Umarmung entgegen. Einen Teil von dem Reis schüttete ich mir übers Hemd und als ich begriff, was los war, stellte ich das Tablett ganz zur Seite und verließ die Schlange vor der Kasse.
Julia, eine Wirtschaftsstudentin muy fuega, die während meiner Jugend mit ihren Eltern ein paar Häuser weiter gewohnt hatte, hatte mich erkannt und sprang mich nieder, so wie ich es mir von ihr während der Schulzeit gewünscht hatte. Damals in der Schule war ich ziemlich vernarrt in sie, hatte mich aber nie getraut, sie anzusprechen. Weswegen es mich umso mehr überraschte, dass sie mich erkannte.
Wir quatschten eine Weile. Über ihr Auslandsjahr und meine Motivation für das Studium. Die Faszination für Lambdas und Stefan-Boltzmann. Ich schämte mich, bereits nach drei Minuten das erste Mal gelogen zu haben. Wir redeten über unsere Studiengänge, die alte Abi-Zeit, das Rosenheimer Nachtleben und die aktuell voll florierende Weihnachtszeit.
Nach ein paar Minuten Smalltalk merkten wir, dass wir etwas ungünstig im Ausgangsbereich der Kasse standen, da sich immer mehr Studenten mit ihren Essen um uns herumdrücken mussten.
Sie hatte noch eine Vorlesung, ich machte Feierabend, doch als sie ging, meinte sie, ich solle doch am Abend zu einer kleinen Party in ihrer WG kommen.
Eine neue Chance, dachte ich. Eine neue offene Tür, ihr den Hof machen zu können. Ja, Sie haben richtig gelesen: ihr den Hof machen. Wie ein Typ aus den Fünfzigern. Scheitel nach Strich, Rockabilly mit nach außen wippenden Knien und Kriegstrauma inklusive.
Sie schrieb ihre Adresse und Telefonnummer auf eine abgerissene Ecke ihres karierten Blockes und umarmte mich einmal mehr. Ich nahm den Zettel, schob ihn in die hintere Hosentasche und holte mir ein neues Thai-Curry.
Ich bezahlte, plauschte kurz mit der Kassiererin und suchte mir einen Sitzplatz. Um die mittig in der Mensa befindliche Empore herum ging ich mitten rein in den Dschungel. Die Mensa war mittlerweile so voll wie ein Media Markt am Black Friday und die Streitereien an jedem der Tische zwischen den Studenten um die letzten freien Plätze erinnerten an die antiken Schlachten bei Asculum.
Ich stand nur da, ließ die Zeit und die Studenten um mich herum passieren und dachte nicht viel. Das Licht fiel über das Glasdach herein und ich sah, wie dicker Regen auf dem Glas zerplatzte. Erneut verdeckten mir zwei Hände von hinten die Augen.
„Wenn du mi weiter belästigst, hol i die Bullen.“, sagte ich mit einem gewissen Schmäh. Mit einem vorfreudigen Grinsen drehte ich mich um und sah keine Julia. Ja, nicht einmal annähernd. Einen Kopf unter mir stand Ahn und schaute mich wortlos an.
„Sorry.“, sagte ich mit enttäuschend fallender Stimme, „I hab di verwechselt.“
Er deutete auf einen Tisch ein paar Reihen von uns entfernt und machte mir klar, dass er einen freien Platz für mich hätte. Ich schlich ihm nach und seufzte, als ich die Belegschaft des Tisches sah. Ahn hing gerne mit eben diesen Typen ab, die selbst nach der Vorlesung noch nicht genug davon hatten, sich gegenseitig die Energieerhaltungssätze und thermodynamischen Grundsätze voller Lust zu präsentieren.
Ich nickte einmal freundlich grüßend in die Menge und wurde gleich eingebunden, als ich gefragt wurde, wie ich das E-Modul aus dem ersten Praxisversuch berechnete.
„Keine Ahnung.“, sagte ich mit vollem Mund und fragte mich, über welchen Praxisversuch die redeten.
Mich beschäftigte gerade eher die Tatsache, dass ich mit einem Thailänder ein Thai-Curry in der Mensa aß. Welch eine Ironie.